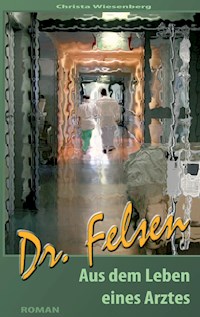
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Arzt Dr. Felsen ist ein Mensch, der in seinem Beruf die ganze Erfüllung seines Lebens sucht und findet. Die Schicksale seiner Patienten sind es immer wieder, die ihn selbst dann noch beschäftigen, wenn er nach seinem Dienst die Klinik verlässt. Ihm ist alles verhasst, was unaufrichtig, unterwürfig oder gar heuchlerisch ist. Eine nicht sehr glücklich gewählte Partnerbeziehung wird für ihn unerwartet zu einem nahezu schicksalhaften und scheinbar unlösbaren Problem. Er weiß sich als das Opfer einer Intrige und fühlt sich gerade dadurch machtlos. Er macht es sich durch seine Überzeugungen nicht nur selbst schwer, sondern wird auch für manchen seiner Zeitgenossen unbequem und von ihnen in die Enge getrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Dienst in einer Nacht
Ein Tag wie jeder andere
Ein abgeschlossenes Kapitel
Die Unterredung
Ferien vom Alltag
Gefährliches Spiel
Brief an einen Freund
Vorbemerkung
Der Arzt Dr. Felsen ist ein Mensch, der in seinem Beruf die ganze Erfüllung seines Lebens sucht und findet. Die Schicksale seiner Patienten sind es immer wieder, die ihn selbst dann noch beschäftigen, wenn er nach seinem Dienst die Klinik verlässt. Ihm ist alles verhasst, was unaufrichtig, unterwürfig oder gar heuchlerisch ist. Von dieser Wesenseigenschaft geprägt, macht er es nicht nur sich selbst schwer, sondern wird auch für manchen seiner Zeitgenossen unbequem und von ihnen in die Enge getrieben. Eine nicht sehr glücklich gewählte Partnerbeziehung zu einer Frau, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war und später wieder gelöst wurde, taucht für ihn unerwartet zu einem nahezu schicksalhaften und scheinbar unlösbaren Problem auf. Er weiß sich als das Opfer einer Intrige und ist gerade dadurch machtlos geworden. Sich längst in Nöten ahnend, nützt er nicht die Gelegenheit eines Gespräches mit seinem Freund, der ihn gut kennt. Es sind seine Kollegen und Mitarbeiter, besonders aber seine Patienten, denen er Partner und Weggefährte sein will, wodurch er sich glücklich und ausgesöhnt fühlt mit sich und der Welt. Gesunde und Kranke, Gute und Böse, sie alle sind, wie Felsen glaubt und sich selbst auf seine Weise dazugehörend fühlt, nur Gast auf Erden.
Die Personen und Begebenheiten sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Christa Wiesenberg, November 2014
Dienst in einer Nacht
Dr. Felsen stand im Mittelraum der Intensivstation. Er blickte auf seine Uhr, auf deren Ziffernblatt die Zeiger nichts weiter taten, als die Zeit anzuzeigen, die augenblicklich war, die sich jedoch niemals aufhalten ließ, mit der er unzählige Male im Wettlauf stand, der oft unerbittlich schien. Manche Stunde danach kostete es, um über das, was in solch einer Zeit geschah, selbst an den Grundfesten seiner Weltanschauung zu suchen, bemüht darum, ein Mosaiksteinchen wenigstens nur zu finden, an dem Hoffnung und Glaube noch hängen konnten, vergleichbar dem Festhalten eines Ertrinkenden an einem Strohhalm. Er neigte nicht so schnell dazu, Kompromisse zu schließen. Am wenigsten mit sich selbst. Und das machte es ihm mit sich selbst oft nicht leicht. Verhasst war ihm jede Form von Unaufrichtigkeit, Feigheit und Bequemlichkeit. Längst hatte er den Begriff „Gerechtigkeit“ aus seiner Überzeugung gestrichen, kannte ihn lediglich als einen Teil des Vokabulars, zwischen dem sich viele unbedeutende Wörter befanden. Auch das machte es ihm nicht immer leicht, ... mit den anderen, unter denen er bisher nicht unbedingt viele Freunde fand. Er mochte somit selbst ein Teil dazu beigetragen haben, dass er nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stand.
Vor einer knappen halben Stunde fühlte er noch die Müdigkeit, die ihm zustehen musste, nach 29 Stunden Dienst, die hinter ihm lagen. Jetzt war er wach. Unruhig. Unruhig, weil eben diese Zeit für ihn unausgenützt verging und jede Sekunde von der Möglichkeit eines Handelns fraß.
Endlich. In dem Dunkel der Nacht sah man bereits den bekannten blauen Schein eines Lichtes, hörte bald darauf das vertraute Signal, das jedes Mal ein erlösendes Gefühl deutlich werden ließ, denn nun wurde sie real überschaubar, die Zeit, in der zu handeln war.
„Schwester Elsa, ist hier soweit alles in Ordnung?“, fragte er mit ruhiger Stimme in einen Nebenraum hinein, in dem nur schwaches Licht die sechs Intensivbetten erkennen ließ, in denen Patienten lagen, entweder im Schlaf oder im Koma... Man kannte das ja. „Der Neuzugang wird gleich hier sein.“
„Ja, Herr Doktor. Aber irgendetwas stimmt wieder einmal nicht mit dem Infusomaten. Das Nitro läuft nicht!“ und Schwester Elsa schnippte dabei mit dem Finger Male um Male an den dünnen Infusionsschlauch, der zum Einlegen in die Apparatur bestimmt war. Ein kleiner Knick, hinter dem sich dann ein winziges Luftbläschen bildete, der reichte bereits aus, die Elektronik des Apparates zu stören.
„Kann ich helfen?“, fragte Dr. Felsen.
„Nein nein, dankeschön, Herr Doktor, jetzt geht's glaube ich schon wieder.“
Und sie bastelte gekonnt den dünnen Schlauch in den dafür vorgesehenen Teil des Gerätes, bediente ein paar Digitaltasten, bis das kleine rote Lämpchen wieder aufleuchtete und ein summender Alarm ausblieb. Die Tropfen aus der Infusionsflasche bildeten sich bald wieder bis zu jener Schwere aus, mit der sie herabfallen konnten. Das System funktionierte wieder ordnungsgemäß.
„Stellen Sie doch bitte das Nitro auf ein Milligramm pro Stunde zurück, Schwester. Das ist vollkommen ausreichend... Der Patient klagte doch über keine Beschwerden?“
„Nein, Herr Doktor, schon seit gestern nicht mehr.“
„Das ist erfreulich... Ich habe die Änderung der Dosierung schon in der Kurve vermerkt. Wenn der Blutdruck weiterhin stabil bleibt, dann lassen wir es dabei. Vielleicht können wir den Patienten dann morgen bereits auf Station verlegen. Dem Stress bei uns hier müsste er dann nicht länger ausgesetzt sein. Aber das sage ich Ihnen dann morgen noch genau.“
Dr. Felsen verweilte eine Zeitlang mit prüfendem Blick auf dem Monitor über dem Krankenbett, auf dem unermüdlich ein gleichmäßiges Bild registrierter Herzstromkurven vorbeizog, das dem Arzt über ein regelrechtes Funktionieren des Herzens stille Auskunft gab. Ruhig und tief schlief der Patient, schien nichts von alledem bemerkt zu haben.
Ein bekanntes Geräusch, das vom Aufzug kam, war ein Signal dafür, dass nun ein erster Kontakt bevorstehen würde, ein erstes Gegenüberstehen mit einem Jemand, den man nie zuvor gesehen hatte, für den einzig und allein die erste entscheidende Verantwortung zu tragen war, von der jedes weitere Geschehen abhing. Es war ein Signal, das die Sinne in einen Zustand höchster Konzentration und Wachheit versetzte.
Zwei Sanitäter schoben auf einer Transportliege einen Patienten rasch und gewandt durch die bereits offenstehende Tür in den Mittelraum. Über die Rettungsleitstelle wurde er als: „Bewusstlose männliche Person, Name unbekannt, etwa 55 Jahre alt“ gemeldet. Jetzt musste alles wie gewohnt sehr schnell gehen.
Dr. Felsen registrierte auf die ihm eigene Weise und scheinbar beiläufig, dass der Mann ein gepflegtes Aussehen verriet, nichts erbrochen hatte, dass der linke Ärmel seines karierten Jacketts und die linke Seite seiner schwarzen Hose mit lehmiger Erde verschmutzt waren, dass er eingenässt hatte, dass seine Atmung eher flach aber spontan war, dass Gesicht, Ohren, Nacken und Hände eine bedrohlich bekannte bläuliche Verfärbung zeigten. Es musste nun wirklich alles sehr schnell geschehen!
„Der Mann muss plötzlich auf der Straße zusammengebrochen sein. Eine Straßenpassantin, die das bemerkte, hat, wie sie uns sagte, gemeint, dass er noch irgendetwas sagen wollte, aber davon hätte sie nichts verstehen können. Aus einem Gasthaus in der Nähe hat sie schnell Hilfe geholt. Von dort aus wurde dann gleich angerufen... Papiere hat er leider keine dabei, aber einer aus dem Wirtshaus meinte, dass er ihn kenne. Wir haben ihn neben einem Gebüsch liegend aufgefunden, so, wie er zusammengebrochen ist. Ansprechbar war er nicht und geatmet hat er die ganze Zeit lang unverändert so, wie jetzt auch... Wir haben ihn dann halt schnell hergebracht. Der Puls war nur schwach zu tasten, auch nicht immer so ganz regelmäßig... Mit dem Blutdruck war er anfangs um die 180 herum, also schon recht hoch, ... aber dann ist er damit ziemlich schnell abgefallen, so um 100 herum...“
Während der eine der Sanitäter diese Auskünfte erteilte, wurde der Mann entkleidet und in das bereitstehende Bett gehoben, seine Brust an wenigen Stellen rasiert, von denen mittels aufgeklebter Elektroden die Herzstromkurven abgeleitet wurden, die sich sogleich auf dem Monitor zeigten.
Dr. Felsen hatte, nachdem er mit einer kleinen Lampe rasch die Reaktionen der Pupillen geprüft hatte, in großer Schnelligkeit je einen größerlumigen Venenkatheter rechts und links an den Unterarmen gelegt, nach Prüfung ihrer richtigen Lage daraus Blut in mehrere Röhrchen für die Notlaboruntersuchungen entnommen, dann beidseits daran Infusionen angeschlossen, die von einer Schwester nach bekanntem Schema und auf seine Anordnung schnell hergerichtet waren. Eine „Elektrische Schwester“, wie im Team ein elektronisch gesteuertes Blutdruckmessgerät genannt wird, war als Manschette um seinen linken Oberarm gelegt und zeigte in Abständen von wenigen Minuten die aktuellen Blutdruckwerte an. In der rechten Leiste tastete Dr. Felsen den Pulsschlag der Arterie, entnahm aus ihr mit einer sehr dünnen, feinen Kanüle ein wenig Blut, beorderte den Pfleger damit, sogleich daraus die Werte der Blutgase ermitteln zu lassen, die ihm näheren Aufschluss über den akuten Zustand des Patienten geben konnten. Als der Pfleger ihm kurze Zeit darauf das Messergebnis auf einem Zettel ausgedruckt vorzeigte, ordnete er an, eine weitere Infusion herzurichten und zusätzlich anzuhängen. Das dauerte nicht lang, und Schwester Alice stellte die Frage:
„Soll die Infusion schon laufen?“
„Das Natriumbikarbonat? Bitte sofort! Die ersten fünfzig Milliliter davon ganz rasch, ... im Schuss, Schwester!“
Schwester Alice drehte das Dosierungsrädchen an dem Infusionsschlauch ganz auf, markierte mit einem dicken blauen Filzstift die „50“, die in das Glas der Flasche geprägt stand, damit man aus der Ferne die Kontrolle darüber behielt. Denn vieles andere war gleichzeitig noch zu tun.
Dr. Felsen verfolgte die Herzstromkurven auf dem Monitor mit einem sehr angespannten Ausdruck im Gesicht. Dann las er das Kurvenbild auf dem langen EKG-Streifen, der ausgeschrieben bereit lag. In allen Ableitungen, als sei er für kurze Zeit nur allein darauf konzentriert. Und wieder tastete er nach dem Puls des Mannes. Unter der Sauerstoffmaske atmete dieser noch immer recht flach, doch schien die Gesichtsfarbe rosiger zu werden. Alle Infusionen liefen ordnungsgemäß. Die „Elektrische Schwester“ zeigte schwankende systolische arterielle Blutdruckwerte zwischen 120 und 90 mmHg an. Die Harnausscheidung, die über den gelegten Blasenkatheter kontrolliert werden konnte, schien ihn nicht bedenklich zu stimmen, sie schien ausreichend zu sein.
Erneut entnahm er aus der Leiste des Mannes arterielles Blut, um über die Messergebnisse daraus eine Verlaufskontrolle zu erstellen, die als ein wichtiger Untersuchungsbefund immer wieder Hinweis über den unmittelbaren Zustand des Mannes geben konnte. Das Ergebnis dieser wiederholten Untersuchung löste zwar noch nicht die Spannung in seinem Gesichtsausdruck, schien ihn aber auch nicht allzu sehr mehr zu beunruhigen. Und dann hefteten sich seine Augen wieder auf den Monitor des EKGs, abwechselnd auf die Werte, die über die Blutdrucksituation informierten.
Die ersten Laborergebnisse wurden von einer Schwester gebracht. Dr. Felsen fand unter ihnen nichts, was auffallend abweichend von Normalwerten gewesen wäre und einer zusätzlichen weiteren Behandlung dringend bedurft hätte. Erneut leuchtete er mit einer kleinen Lampe in die Augen des Mannes, prüfte somit abermals die Reaktionen der Pupillen, registrierte, dass die Haut an Stirn, Brust, Armen und Beinen jetzt warm und trocken war, prüfte, da ihm etwas ausreichender die Zeit dafür belassen schien, umfangreicher die Funktionen des Nervensystems über das Reflexverhalten an dem noch immer bewusstlosen Patienten, um Weiteres über dessen Zustand erfahren zu können. Zumindest stand es um den Mann jetzt nicht schlechter als zu Anfang. Um vieles besser aber auch nicht.
„War aus dem Röntgen schon jemand da?“, fragte Dr. Felsen Schwester Elsa, die soeben an ihm vorbeihuschte, um einen weiteren Eintrag in der Kurve vorzunehmen.
„Ich hab schon zweimal nach unten angerufen. Aber dort kann im Augenblick niemand weg. Die haben einen Notfall bekommen.“
„Wir haben auch einen Notfall bekommen, liebe Schwester!“, und zum ersten Mal wurde Dr. Felsen im Tonfall laut. „Das gilt nicht gegen Sie, Schwester! Aber es ist doch bald nicht mehr zum Aushalten, wenn man dringende Untersuchungsbefunde braucht, weil man auch einen Notfall hereinbekommen hat und einen ‚Herrn Unbekannt‘ an einem Leben erhalten möchte, an dem er wahrscheinlich ebenso hängt wie Sie und ich und – ... wohl jeder...“, lenkte er wieder ein, in dem ihm so eigenen ruhigen Tonfall.
Dr. Felsen ergänzte nun das bereits angelegte Krankenblatt, auf dem alles verzeichnet stand, was den Zustand des Patienten, die vorliegenden Messergebnisse (Blutdruck, Puls, Temperatur, Ausscheidung, Laborwerte) und die bisher erfolgten behandelnden Maßnahmen betraf. Unter „Name“ ... „Geburtsdatum“ ... „Wohnort“ standen jeweils mit Bleistift geschriebene Fragezeichen. In die Spalte „Diagnosen“ schrieb er: ‚Kammertachykardie bei V.a. akuten Myokardinfarkt; DD: V.a. akute Lungenembolie‘. Auf der Rückseite des Krankenblattes wurden die Befunde in deutlich lesbarer Handschrift dokumentiert, die sich aus der klinischen Untersuchung des Patienten bisher ergaben.
„Mir gefällt das Ganze nicht so recht.“, sagte Dr. Felsen eher leise zu sich selbst, als er sich erneut zu einer Kontrolle der Blutgasanalyse anschickte. Auch schien er mit dem Messergebnis daraus weniger zufrieden.
„Nach den jetzigen Werten ist die Übersäuerung ausgeglichen. Das Natriumbikarbonat brauchen wir vorerst nicht. Aber lassen Sie die Flasche noch hängen, Schwester. – Der pO2-Wert gefällt mir nicht, die Sauerstoffanreicherung im Blut ist einfach zu gering. – Wieviel Liter Sauerstoff bekommt er gerade über die Maske?“, fragte Dr. Felsen in den Raum, während er die ausgedruckten Messwerte auf dem Zettelchen in seiner Hand etwas nachdenklich prüfte.
„Jetzt haben wir eine Sauerstoffzufuhr von 12 Litern in der Minute.“, kam eine Antwort zurück.
„Nein... Das gefällt mir nicht... Ich möchte ihn doch lieber intu...“
In diesem Moment forderte ein lautes, anhaltendes Signal erneut alle Konzentration und Schnelligkeit. Auf dem Monitor des EGK-Überwachungsgerätes zeigte sich das Bild breiter, verzerrter Kammerkomplexe, die sich kontinuierlich fortsetzten, zackige Linien, eine Serie hochfrequenter Wellen, bizarr und multiform. Ein Bild, das jeder kennt und zu interpretieren weiß, der hier seinen Dienst tut. Kammerflimmern! Eine tödliche Bedrohung!
Ohne, dass Anweisungen gegeben oder Worte hätten gesprochen werden müssen, wusste jeder, was zu tun war. Schnell. Diszipliniert. Jeder auf seinem Platz. Das beim Aufladen des Defibrillators immer viel zu ungeduldig ersehnte Surren, das schließlich in einem feinen Pfeifen endet und damit den zum „Schuss!“ endlich geladenen Kondensator avisiert, ließ mit wohlweislichem Respekt jeden die Hände von Patienten und deren Betten nehmen, ehe die rettende Energie über großflächige Elektroden an den Patienten abgegeben wurde. Denn wenn mit 400 Wattsekunden eine externe Defibrillation vorgenommen wird, bei der man den Herzschlag mittels elektrischen Stromstoßes wieder zu normalisieren versucht, ist es wenig ratsam, sich selbst in den Stromkreis einzuschalten.
Gebanntes Starren für einen Moment auf den Monitor... Nichts. Nichts tut sich. Nichts verändert sich. Und sofort das Gleiche nochmal: das kurze Surren bis zu dem feinen Pfeifen, der „Schuss!“, das kurze Zucken durch einen menschlichen Körper, dem man das Leben zu erhalten trachtet. Der Wettlauf mit der Zeit, die man festhalten möchte, die sich aber nicht festhalten lässt, hat wiederum begonnen. Und auch weiterhin zeigt sich nichts anderes auf dem Monitor, als diese Serie hochfrequenter, bizarrer Wellen, die einem oftmals verhasst werden...
„Intubationsbesteck!“, forderte Felsen, als läge nun etwas Eisenhartes in seiner Stimme.
Während er damit beschäftigt war, schnell und gewandt den Tubus in der Luftröhre zu platzieren, damit über diese künstliche Röhre gezielte Atemspende geleistet werden konnte, ihm eine der Schwestern dabei wortlos und sicher assistierte, hatte der Pfleger längst seine Aufgabe wahrgenommen und führte eine äußere Herzdruckmassage durch, indem er den Brustkorb des Patienten sachkundig in rhythmischen Abständen nach unten drückte. Als Felsen selbst ihn dann von dieser Tätigkeit ablöste, entnahm der Pfleger erneut Blut aus der Leiste, denn erst recht kam es nun darauf an, zu wissen, welche Funktionen in einem Organismus ablaufen, dem man sein Leben erhalten will. Dabei war der Pfleger darauf bedacht, niemandem im Wege zu stehen, der seinerseits wusste, was zu geschehen hatte. Zur unbewusst gewordenen Gewohnheit wurde es in solch einer Situation, den Monitor unaufhörlich im Blick zu behalten, dabei ununterbrochen hoffend, dass das vorbeiziehende Kurvenbild wieder über eine Normalisierung und Eigenständigkeit des Herzschlages verkünden würde.
„Läuft das Bikarbonat?“
Felsens Stimme war klar zu hören, schneidend in alle Emsigkeit hinein, doch trotzdem Ruhe ausstrahlend, denn er wusste, dass jede Art von Hektik jetzt nur schaden konnte.
„Bikarbonat läuft.“, drang es an sein Ohr.
„Weitere fünfzig Milliliter im Schuss!“, forderte er...
Keine Veränderung des Bildes auf dem Monitor. Die Zeit schien wieder einmal zur unerbittlichen Gegnerin geworden zu sein.
„Den Defi nochmal scharfmachen!“
Sogleich war das Surren bis zum feinen Pfeifen zu hören.
„Achtung! Schuss!“
Und wieder dieses hilflose Zucken durch den Körper des Mannes. Blicke von verschiedenen Seiten, die sich auf einem einzigen Punkt des Monitors zu vereinen schienen. Hoffend, ja, bangend. Und die Zeit zeigte sich weiterhin grausam in ihrer Eigenart, wenn sie mit ihren Bruchteilen von Sekunden alle Ungeduld herausforderte, alle Hoffnung von einem mehr und mehr wegzuzerren suchte.
„Schuss nochmal mit 400!“
Nichts geschieht daraufhin, keine ersehnte Veränderung.
„Adrenalin i.v. ... ein Milligramm, schnell!“, befiehlt Felsens Stimme, während er erneut mit einer externen Herzdruckmassage fortfährt.
Doch so gar nichts verändert sich an dem Zustandsbild des unbekannten Mannes, eines Menschen, dessen Lebensjahre noch nicht so viele waren. „Vermutlich 55“ – so stand es inzwischen auf dem Krankenblatt...
Während Felsen den Brustkorb des Patienten in regelmäßig rhythmischem Verlauf tief und gezielt nach unten gegen die Unterlage presste, gegen ein unter dem Rücken liegendes Brett, ließ er den Monitorbildschirm nicht aus den Augen. Ein hohes, steiles, anei nandergereihtes Kurvenbild zeichnete sich ab, mit jedem kräftigen Druck auf den Brustkorb. Kurzes Verharren, das erneute Erwarten des Momentes, wo Eigenaktionen des Herzens alle Anspannung der Sinne hätten nehmen können – ... Nulllinie auf dem Monitor. Und weiter, weiter, weiter... Aber es geschah nichts, gar nichts. Lediglich wurde auf künstliche Art und Weise eine Funktion erhalten, von der man sich Selbständigkeit gewünscht hätte.
„Adrenalin i.v. nochmal!“
Nulllinie auf dem Monitor. Und: weiter, weiter, weiter...!
„Femoralis zu tasten?“, fragte Felsen trocken und erhielt von dem Pfleger, der den Puls in der Leiste zu tasten suchte, die Antwort:
„Kaum, Herr Doktor. Es kommt nichts durch. Nur wenn Sie drücken.“
Felsen wusste, was das hieß. Aber er konnte und wollte noch nicht aufgeben. Eine gute Stunde war währenddessen vergangen. Die Atemspende, die von einer Schwester mittels eines Gummiballons über den liegenden Tubus gegeben wurde, verursachte ein eintöniges Geräusch: monoton, gleichmäßig. Die wiederholt gemessenen Blutgasanalysen zeigten inzwischen Werte, wie sie jeder gesunde Mensch zu bieten hat. Auf künstliche Art und Weise hielt man somit einen menschlichen Körper lebendig, in den kein Leben zurückkehren wollte. An Medikamenten gab es nichts mehr, das zusätzlich gegeben in dieser Situation zu einer positiven Wende geführt hätte. Warum. Warum. Immer wieder die gleiche Frage, die sich mittlerweile ohne Fragezeichen, aber immer und immer wieder stellt...
„Soll ich Sie ablösen, Herr Doktor?“, fragte leise der Pfleger. „Sie sind schon ganz durchgeschwitzt.“
Felsen antwortete nicht gleich. Dann aber entgegnete er:
„Machen Sie weiter. Aber wir können wohl auf keinen Erfolg mehr hoffen… Wir sind nun mal nicht allmächtig –“.
Er stieg entmutigt von dem Trittbänkchen, das ihm vor das Patientenbett gestellt worden war. Noch einmal prüfte er die vitalen Funktionen – leuchtete in die Augen, die jetzt unbewegliche, maximal weite Pupillen unter einer zu trüben beginnenden Hornhaut zeigten.
Felsen stand noch einen langen Moment sehr ruhig an dem Bett des ‚Unbekannten‘, an dessen sterblicher Hülle nur noch ein allerletzter Versuch ablief, und er sehnte jenem Stückchen Hoffnung nach, das keinem belassen werden sollte. Ihm nicht, seinem Team nicht, dem ‚Unbekannten‘ selbst nicht, denen, die zu ihm gehören mochten, auch nicht.
„Reanimation kann eingestellt werden.“
Diese Worte waren bekannt... Allen hier... Aber jedes Mal war es die gleiche Leere, in die hinein sie stumm verhallten.
„Es hat sich noch niemand gemeldet? Jemand von den Angehörigen? Jemand der ihn kannte?“
Kannte. Ja, ... kannte. Denn dieses Menschenleben war von nun an gewesen. So fremd und ‚unbekannt‘ für einen, und doch auf eine so undefinierbare Weise mit einem bekannt geworden.
Dr. Felsen entfernte selbst noch die venösen Zugänge an den Unterarmen, durch die die notwendigen Infusionen liefen. Er komprimierte mit einem Tupfer und unter festem Druck die Einstichstellen solange, bis die Blutung daraus endete und brachte einen Pflasterstreifen jeweils darüber an. Er schloss die zu einem Spalt geöffneten Lider der Augen ganz, zeichnete dem ‚Unbekannten‘ still ein kleines Kreuz auf Stirn, Mund und Brust, und es störte ihn dabei nicht, wenn jemand in der Nähe stand. Man kannte dies von ihm, schien aber nie danach fragen zu wollen oder zu können, warum er so tat.
„Schwester, bitte, ordnen Sie sein Bett und legen Sie ihn würdig zurecht. Sie wissen, wie ich dies meine. Doch gehört es ebenso zu unseren Pflichten, der Toten Würde gerecht zu werden... Und, bitte, piepsen Sie mich an, falls sich Angehörige melden sollten. Ich möchte selbst mit ihnen sprechen... Den Zeitpunkt seines Todes vermerke ich selbst im Krankenblatt.“
„Wird alles so gemacht, wie Sie gesagt haben, Herr Doktor.“, antwortete die Schwester, wobei etwas in ihrer Stimme klang, was an eine Art ängstlichehrfurchtsvolle Zaghaftigkeit erinnerte.
Felsen visitierte noch einmal seine Patienten in den beiden Nebenräumen der Intensiv. Er sah zu den Monitoren, hörte auf das Atmen der Kranken in ihrem Schlaf, warf einen letzten, kurzen Blick auf die jeweiligen Kurven, die auf dem Tisch in der Mitte auflagen und von einem schwachen Licht beleuchtet wurden. Hier nahm alles seinen geordneten Verlauf... Viel losgewesen war heute eigentlich nicht. Viel nicht. Wenn man an andere, zurückliegende Tage dachte... Und doch schien unendlich viel geschehen zu sein... –
Dr. Felsen schritt über den Flur in das kleine Dienstzimmerchen, in dem er heute seinen Platz hatte. Nur für die, die Dienst hatten, stand ein Bett in dieser Kammer bereit. Jedes Mal mit frischer Bettwäsche bezogen, die unbenützt blieb, wenn es genügend Arbeit gegeben hatte, Zeit zu kurzer Ruhe nicht gegeben war. Er schlug die Bettdecke zurück, rückte das Telefon auf dem Schreibtisch dichter an das Bett heran, legte den Piepser in greifbare Nähe daneben, ordnete seine Sachen, von denen er sich entledigte, auf einen Stuhl, zog sein Pyjama über, legte sich zur Ruhe, nachdem er das Licht gelöscht hatte. Er ruhte noch eine ganze Weile mit geöffneten Augen, die ins Dunkle starrten. Er bemerkte den Zeitpunkt nicht, als ihn ein tiefer, kurzer Schlaf ereilte...
* * *
Ein schriller Ton riss Felsen aus einem traumlosen Schlaf, in dem er weniger als eine Stunde lang geruht hatte. Wie mechanisch suchte seine Hand nach dem Rufgerät, das neben dem Telefon auf dem Schreibtisch lag, und gleichfalls wie mechanisch suchte die andere Hand, den Schalter der kleinen Stehlampe am Kopfende des Bettes zu bedienen.
„Bitte sprechen“, klangen seine Worte noch etwas verschlafen in das kleine orangefarbene Gerät, von dem man sich während des Dienstes nicht trennen durfte.
„Die Angehörigen von dem Mann sind gerade gekommen. Sie wollten doch darüber benachrichtigt werden?“, erklang eine Stimme aus dem Piepser.
„Ja danke, ich komme sofort.“
Dr. Felsen schlüpfte aus dem Pyjama in seine Dienstkleidung, wobei er ein langgezogenes tiefes Gähnen nicht unterdrücken konnte. Er platzierte das kleine Rufgerät wieder an seiner gewohnten Stelle in die linke Brusttasche seines Kittels. Zuvor noch hatte er sein Gesicht mit kaltem Wasser erfrischt, ein paar kräftige Schlucke davon genommen und sein Haar geordnet. Er wusste nur zu gut, was ihn für eine Aufgabe jetzt erwartete. Obgleich ihm solches schon mehrere Male auferlegt war, verspürte er ein Gefühl, das irgendwie bange machte. Ein immer wieder schweres Los, das einen trifft, vor dem es sich nicht weglaufen lässt, das nie zu einer Art Routine werden darf.
Vor der Intensivstation stand Schwester Alice mit zwei Frauen beisammen, einer noch sehr jungen und einer älteren, und deutete jetzt in die Richtung, aus der Dr. Felsen kam.
„Guten Abend. Mein Name ist Felsen. Ich bin der diensthabende Arzt...“.
Noch ehe er ausgesprochen hatte, fiel die ältere der beiden Frauen ein:
„Günther ist mein Name, Erika Günther, und das hier ist meine Tochter. Herr Doktor, entschuldigen Sie bitte, ich hab mir nur schnell den Mantel übergezogen, als ich hörte, mit meinem Mann sei etwas geschehen und bin so schnell ich konnte hergekommen. Bitte, wie geht es meinem Mann. Sieht‘s recht schlimm mit ihm aus? Meine Tochter und ich..., wissen Sie, das war ein solch entsetzlicher Schreck, als wir hörten, er musste mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden...“
Das rötlichblonde Haar der Frau schien vom Wind ganz zerzaust, und dieses unterstrich nur noch alles Aufgeregte in den Fragen, welche gemischt mit Entschuldigungen und zaghaft dahinter verborgenem Bitten die Erregung und Sorge der Frau zum Ausdruck kommen ließen. Die Tochter, die kaum älter als siebzehn zu sein schien, stellte sich etwas abseits, als habe sie Furcht davor, eine schlimme Nachricht zu erfahren.
„Kommen Sie, Frau Günther, es ist vielleicht besser, wenn wir uns dort an den kleinen Tisch setzten. Ich habe da einige Fragen an Sie“, sprach Felsen ruhig zu der Frau, ging ihr um eine halbe Schrittlänge voraus bis zu dem Tischchen und bot erst ihr, dann der Tochter, einen Stuhl an.
Die Tochter wollte sich nicht setzen. Sie blieb hinter dem Stuhl stehen, der ihr angeboten wurde, fragte zaghaft:
„Wie es dem Papa jetzt geht, da können Sie uns wohl noch nichts sagen? ... Können wir dann wenigstens kurz mal nach ihm schaun?“
Dr. Felsen blieb weiterhin sehr ruhig in seiner Stimme, deutete durch ein bejahendes Nicken eine erste Antwort darauf an, die als ein „Ja“ wohl verstanden werden musste, die aber ebenso eine Antwort auf etwas bedeutete, was noch nicht ausgesprochen war.
„Sagen Sie, Frau Günther, hatte sich Ihr Mann in letzter Zeit krank gefühlt? Hat er Ihnen irgendwann einmal darüber etwas gesagt, dass es ihm manchmal nicht so gut ginge, … hat er über Schmerzen geklagt, … vielleicht über ein Druckgefühl, das er in der Brust verspürt, … oder über Atemnot, die er beim Treppensteigen vielleicht gehabt hat?“
Dr. Felsen stellte diese Fragen, beließ genügend Zeit dazwischen, während der er der Frau ins Gesicht sah, um jede Regung von Ausdruck darin wahrzunehmen.
„Nein. Davon ist mir gar nichts bekannt.“
Und zur Tochter gewandt setzte sie fort:
„Bettina, der Papa hat doch nie von sowas mal gesprochen?“
Und wieder zu Dr. Felsen:
„Also, ganz bestimmt, Herr Doktor, mein Mann hätte etwas gesagt, wenn es ihm nicht gut gegangen wäre oder wenn er, wie Sie sagten, so etwas verspürt hätte. Ganz im Gegenteil! Er ist jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, gerade, weil er immer darauf geachtet hat, genügend körperliche Bewegung zu haben. Wissen Sie, so als Ausgleich zu seinem Beruf.“
„Was macht Ihr Mann beruflich?“
„Er ist schon seit Jahren in der Buchhaltung bei einer Firma, und er ist dort sehr beliebt, weil er alles immer ganz exakt macht. Da hat er sich auch nie geschont, wenn mal mehr Arbeit angefallen war. Nicht so, wie es bei den jüngeren Leuten heutzutage ist, dass sie schon bald den Stift aus der Hand fallen lassen, bloß, weil Feierabend ist. Mein Mann hat es mit seiner Arbeit sehr genau genommen. Das weiß auch jeder in der Firma...“
„Ich glaube Ihnen das gern, Frau Günther... Was ich aber noch wissen wollte: hat Ihr Mann in letzter Zeit irgendwelche Medikamente regelmäßig einnehmen müssen? Hat er vielleicht gelegentlich Medikamente gebraucht?“
„Mein Mann? Medikamente? Nein, wirklich nicht Herr Doktor. Mein Mann hat von Medikamenten noch nie etwas gehalten. Es gab ja auch keinen Grund, dass er hätte welche nehmen müssen. Erst vor einer Woche hat ihm der Hausarzt gesagt: Herr Günther, hat er gesagt, wenn jeder so gut beieinander ist, wie Sie, dann wäre ich bald arbeitslos...“
„Ihr Mann war vor einer Woche bei seinem Hausarzt?“
„Ja. Aber nur, weil er sich mal wieder durchuntersuchen lassen wollte. Damit hat er es recht genau genommen. So jedes halbe Jahr ist er zu seinem Hausarzt gegangen...“
„Welchen Hausarzt haben Sie denn, Frau Günther?“
„Das ist der Doktor Kempinsky. Bei dem war ich selber schon als Kind! Er hatte auch meine Mutter immer behandelt, wenn mal was war. Der kennt unsre ganze Familie schon seit langem, stimmt‘s Bettina? Dich behandelt er ja auch, wenn mal was ist...“
Frau Günther sprudelte alle Antworten heraus, als suche sie dadurch ihre Erregung etwas zu unterdrücken. Ihrem Tonfall war abzulauschen, dass fast wie zur Entschuldigung alle diese Erklärungen gegeben wurden. Die anfangs bestandene Hilflosigkeit auf den ganzen Schrecken hin stand nicht mehr so deutlich im Vordergrund. Doch die unruhig fragenden Blicke, die eine versteckte Angst bekundeten, die bohrten im Innern an einer Stelle, an der sich Felsen jedes Mal erneut in solchen Situationen getroffen fühlte. Das Wissen darum, was mit einem Menschen bereits unabwendbar geschehen war, um den sich die Seinen in quälender Angst so plötzlich sorgten, weil ja so überraschend etwas Unerwartetes geschehen war, etwas, auf das man nie vorbereitet schien. Und man muss –ob man will oder nicht – von ihm, von ihm allein es nun zu hören und zu wissen fordern, wie schlimm es wirklich um den Mann, den Papa, die Tochter, den Sohn, die Mutter, den Vater, den Freund steht. Und jedes Mal schwingt dabei in den Fragen eine Hoffnung deutlich mit: ‚Nicht wahr, Herr Doktor, das wird doch nicht so schlimm sein... Jetzt sind ja Sie da... Nun wird doch alles bald wieder gut sein?‘
Dr. Felsen hat die vielen Male nicht gezählt, wenn er darüber Auskunft geben musste, dass ein Menschenleben nicht mehr ist. Und er hat dabei jedes Mal erneut erfahren müssen, mit welcher Abruptheit seine Nachricht allen Schmerz in einer menschlichen Seele auslöste. Wie geheimnisvoll verborgen sind doch gerade die Wege in die Seelen der Menschen, die einem unbekannt begegnen, aus denen alles Hoffen fleht. Nie wird sich daran etwas ändern, und immer wieder erfährt und fühlt man daran erneut. Das sind die Momente, in denen es an den Grundfesten nagt, an jenen kleinen Mosaiksteinchen, aus denen sich das ganze Gefüge zusammensetzt...
„Frau Günther... ich habe keine gute Nachricht..., die ich Ihnen über Ihren Mann geben kann...“
Und wie in eine plötzlich eingetretene Totenstille hinein dröhnten jetzt scheinbar die ruhig gesprochenen Worte Dr. Felsens:
„Ihr Mann wurde uns in einem sehr kritischen Zustand gebracht... in einem lebensbedrohlichen Zustand... in einem sehr unerwartet und plötzlich eingetretenen solchen Zustand... und... bitte, versuchen Sie es mir zu glauben... es wurde alles versucht, sein Leben zu retten...“
„Ja, ich danke Ihnen Herr Doktor, ich danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen, aber steht es denn jetzt im Moment immer noch so schlimm um ihn...? Bitte, Herr Doktor, sagen Sie mir die Wahrheit. Steht es immer noch so schlimm um ihn!“
Die Frau musste in ihrer Erwartung wie darin festgewurzelt die Kunde von einer unabänderlichen, bösen Nachricht nicht wahrgenommen haben. Bettina, die Tochter, schien die Aussage Dr. Felsens eher er fasst zu haben. Aus ihr brach zunächst ein stilles, dann den Mädchenkörper regelrecht erschütterndes, lautes Weinen heraus. Dr. Felsen ging zu ihr hin, hielt sie beidseits an den Armen:
„Bettina... Ich darf Sie doch so nennen? ...“
Bettina nickte schluchzend.
„Es gibt Dinge, Bettina, gegen die niemand von uns mächtig ist... Es sind schlimme Dinge... sehr, sehr bittere Dinge... Ich weiß, wie unerwartet hart Sie das Ganze treffen muss... Es kann Ihnen nur wenig Trost bedeuten, wenn ich Ihnen sage, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein... Aber trotz alledem sage ich zu Ihnen, Bettina, dass Sie jetzt tapfer bleiben müssen... Ihre Mutter wird Sie gerade jetzt sehr brauchen...“
Bettina nickte immer wieder zu den Worten, die Felsen zu ihr sagte, von denen er selbst doch wusste, wie wenig unmittelbaren Trost sie geben konnten. Doch sagte er die Wahrheit, über die man wissen wollte, über die jeder Mensch das Recht hat, zu erfahren. Und er musste sie aussprechen, diese bitter harte Wahrheit. Erspart bleiben konnte dies niemandem...
Auf dem Gesicht von Frau Günther zeichnete sich aller Unglaube ab. Es schien wie in eine Starre verwandelt. Ungläubig sah sie zu ihrer Tochter Bettina. Was spielt sich da, um Gottes Willen, bloß ab! Bettina weint? Ja, Bettina weint auf eine Art, wie sie es von ihr noch nie gesehen hatt Und was hatte der Herr Dok tor gerade zu ihr gesagt? Etwas von schlimmen Dingen, etwas von bösen Dingen, etwas über unmächtig sein... oder so ähnlich.
„Herr Doktor, bitte, es steht doch noch nicht so schlimm um meinen Mann... so schlimm, wie Sie... meinen?“, dabei zog die Frau Dr. Felsen auf eher zaghafte Weise am Ärmel seines Kittels.
„Frau Günther... Sie baten darum, die ganze Wahrheit zu erfahren... Es ist leider die ganze Wahrheit. Ihren Mann haben wir nicht retten können, so sehr wir dieses auch versucht haben... Ihr Mann ist tot...“
„Aber warum... Warum ist mein Mann tot...“





























