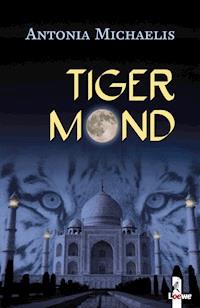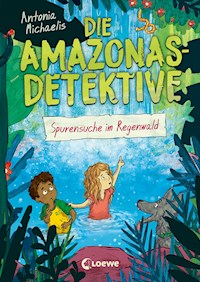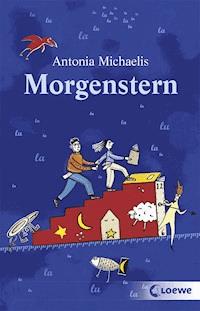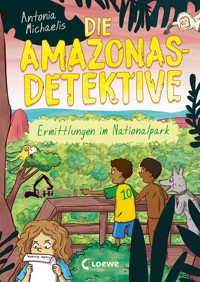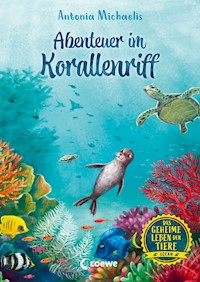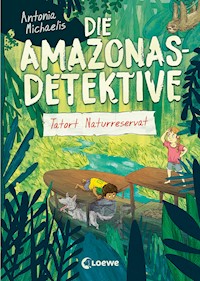
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Amazonas-Detektive
- Sprache: Deutsch
Mutige Kinder können die Welt verändern! Springende Flussdelfine, himmelhohe Baumriesen, Hausboote auf dem Amazonas: Rund um die Stadt Manaus wartet der Dschungel. Doch im Geheimen geschehen erschreckende Verbrechen … Die Amazonas-Detektive horchen auf: Ein ausgestopftes Riesenfaultier ist aus dem Naturkundemuseum gestohlen worden, der Direktor ist verschwunden und am Tatort entdecken sie Blutflecken. Die Spur führt Ximena, Pablo, Davi und den Hund in ein malerisches Naturreservat. Was hat es auf sich mit den Geschichten vom Mapinguari, dem menschenfressenden Monster, das angeblich eine Art Riesenfaultier war? Und ist unter den Forschern und Touristen wirklich jeder der, der er zu sein scheint? Band 2 der spannenden Detektivreihe! Tief im dichten brasilianischen Dschungel wartet der zweite Kriminalfall auf die Amazonas-Detektive. Eine spannende und unterhaltsame Detektiv-Reihe mit starker Umweltthematik für Jungs und Mädchen ab 9 Jahren rund um Klimaschutz, Umweltzerstörung, Kulturen, Brasilien, Regenwald und die Natur. Großartig erzählt von der unvergleichlichen Antonia Michaelis und mit coolen Schwarz-Weiß-Illustrationen von Sonja Kurzbach. Für Fans von Kirsten Boie und Annelies Schwarz. Der Titel ist auf Antolin gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle mutigen Kinder, die nie aufhören,die verschwundenen Dinge und Leute zu suchen.
INHALT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Letztes Kapitel
ERSTES KAPITEL,
in dem ein Faultier verschwunden ist und offenbar einen Museumsdirektor mitgenommen hat, denn der fehlt ebenfalls
»Pablo!«
Pablo blinzelte.
Die Sonne ging eben erst auf. Er setzte sich auf und sah über die Stadt, die unter ihm im Morgen lag, seine Stadt: Manaus. Irgendwo dahinter begann in der Ferne der Urwald.
Er hatte auf dem Dach des Turms geschlafen wie immer. Der Turm gehörte zu einer maroden Villa. Es war schön hier oben, man fühlte sich fast wie ein König, auch wenn man nichts besaß außer einer bunten Tasche, einer alten Bibel, einem Messer und einer Kerze.
»Pablo!«
Pablo rieb sich den Schlaf aus den Augen und rutschte nach vorn, dorthin, wo die Kletterpflanze über den Rand kroch. Die Pflanze sah eindeutig wacher aus als er.
»Wach auf, Schlafmütze!«
Unten auf der Straße stand Ximena, in einem eleganten veilchenblauen Kleid mit weißer Spitze, jedoch mit ungekämmten Locken, und sah zu ihm hinauf. Offenbar hatte sie sich selbst angezogen, das Kindermädchen war um diese Zeit noch nicht da, um ihr Haar zu bändigen.
Ximena wohnte in einer heilen Villa im Viertel der Reichen und ihr Großvater war vermutlich nicht darüber im Bilde, dass sie bei Sonnenaufgang heimlich aus dem Fenster kletterte, um in der Stadt herumzurennen.
»Komm runter!«, rief Ximena. »Vor dem Naturkundemuseum stehen Polizisten und alles ist abgesperrt! Ich glaube, die Furchtlosen Drei haben einen neuen Fall!«
»Polizei? So früh am Morgen?«, murmelte Pablo.
Dann streifte er sich die bunte Tasche über und begann, an den Ranken hinunterzuklettern. Die Vögel waren schon vollauf mit ihrem Morgenkonzert beschäftigt, die ganze Villa war umgeben von Ästen und Blättern und Nestern. Der Urwald von einst spross hier wieder empor und das war der Grund, aus dem Pablo die Villa mochte: Sie war wie ein Stück von dem großen grünen Meer da draußen, dem Meer aus Bäumen, in dem er mit Ximena so viel erlebt hatte.
Jetzt stand sie da, die Hände in die Seiten gestemmt, und wartete auf Pablo. Sie sah so abenteuerlustig aus, dass er lachen musste.
»Los, komm«, sagte sie, als er bei ihr war, und zog ihn am Arm mit sich. »Das musst du sehen. Die haben das Museum abgeriegelt. Da muss etwas Großes passiert sein. Ein Mord oder so. Ich war … zufällig in der Gegend unterwegs und hab die Polizisten gesehen.«
»Zufällig?«
Ximena seufzte.
Sie gingen jetzt am Fluss entlang, das Morgenlicht ließ das träge Wasser glänzen wie einen Spiegel. Um diese Zeit saßen noch keine Verkäufer und Bettler und Liebespärchen auf der Mauer.
»Ich wandere seit einer Weile frühmorgens durch die Stadt, um nachzudenken«, murmelte sie. »Ich kann die Delfine nicht vergessen. Wie sie mich gerufen haben, draußen im Urwald …«
»Du langweilst dich zu Tode, in der Villa mit deinem Großvater«, meinte Pablo mit einem Grinsen, »zwischen den Büchern und den regelmäßigen Mahlzeiten.«
»Und dem Kindermädchen und dem Privatlehrer«, sagte Ximena. »Ja.«
Sie streckte die Hand aus, als wollte sie den Rio Negro streicheln wie ein großes Tier.
»Der Fluss kommt aus dem Urwald und fließt in den Urwald«, flüsterte sie. »Irgendwo in ihm schwimmen die Delfine, irgendwo an seinem Ufer wartet Davi. Meinst du, er denkt an uns?«
»Keine Ahnung.« Pablo zuckte mit den Schultern. »Ich hab andere Sorgen. Jeden Tag was zu beißen zu finden, zum Beispiel.«
»Ach, gib’s zu«, sagte Ximena. »Du würdest auch gerne wieder was erleben.«
Sie kletterte auf die Mauer und rannte los, der Rock ihres veilchenblauen Kleides wehte im Wind. Pablo kletterte hinterher. Es war schön, auf einer Mauer in den Morgen zu rennen, auch wenn er es nie zugegeben hätte.
Schließlich sprangen sie hinunter und Ximena führte ihn durchs Gewirr der Gassen bis in eine Seitenstraße mit einem alten Tor. Es hing schief in den Angeln und schloss nicht mehr richtig.
»Da!«, flüsterte Ximena. »Siehst du?«
In dem kleinen Hof hinter dem Tor war im Schatten eines Baumes ein Polizeiauto geparkt und daneben standen drei Polizisten und rauchten. Sie sahen müde aus. Ein Grüppchen anderer Leute hatte sich in der Nähe versammelt, sie diskutierten und zeigten immer wieder auf das Gebäude, zu dem der Hof gehörte und dessen doppelflügelige alte Holztür offen stand: das alte Naturkundemuseum. So stand es in abblätternder Schrift über dem Eingang.
»Ach so, das Museum«, murmelte Pablo.
Es gab noch ein anderes, moderneres Naturkundemuseum, etwas außerhalb der Stadt, das einem Japaner gehörte und eine Menge großer und prunkvoller Ausstellungsstücke besaß, ausgestopfte Jaguare und sogar einen lebendigen Apanima, einen dieser Riesenfische.
Wenn da die Polizei herumgestanden hätte, wäre vermutlich sofort das Fernsehen gekommen.
Aber hier? Dieses Museum war uralt. Der Direktor war ebenfalls uralt, Pablo kannte ihn flüchtig vom Sehen. Er kam manchmal zum Platz vor dem Theater, saß dort auf einer Bank und lauschte den arbeitslosen Opernsängern und Musikern – verloren in seine eigenen Träume.
Das Museum war mit Schlingpflanzen zugewuchert wie die alte Villa, vermutlich hatte in den letzten zwanzig Jahren kein Tourist oder Wissenschaftler es überhaupt gefunden.
»Vielleicht hat jemand einen mottenzerfressenen, ausgestopften Affen geklaut?«, fragte Pablo.
»Und deshalb kommt so früh am Morgen die Polizei?«, flüsterte Ximena.
Sie drückte sich an der Wand entlang und glitt wie ein Schatten in den Hof und das war vermutlich gut so: Jemand wie Pablo, mit zerrissenen Kleidern und Dreck auf der Nase, konnte einfach so morgens auf der Straße herumhängen. Aber jemand wie Ximena mit ihrem feinen, sauberen Kleid fiel auf und die Polizisten hätten vermutlich gefragt, warum sie alleine unterwegs war, und sie in ihre hochherrschaftliche Villa zurückgebracht.
Deshalb blieben Pablo und Ximena unsichtbar, huschten an der Mauer entlang durch den Hof, schlüpften in eine Lücke zwischen Museumswand und Mauer und Ximena zeigte auf ein Fenster.
»Da rein!«
Pablo nickte. Er machte Ximena eine Räuberleiter und sie reckte sich hoch und zog die alten Fensterläden auf. Die meisten alten Häuser hatten ein Hochparterre, was bedeutete, dass die Fenster im ersten Stock unpraktisch hoch lagen, weil die Leute früher alles hoch gebaut hatten, falls der Rio Negro wieder einmal über die Ufer trat.
Hinter den Fensterläden befand sich ein Glasfenster. Ximena steckte eine Karte zwischen die Fensterflügel und hebelte den Riegel innen auf. Augenblicke später zog sie Pablo zu sich hoch und dann waren sie drin.
»Mann«, wisperte Pablo. »Du hast doch nicht die Bankkarte vom Silberbaron geklaut, um Fenster zu öffnen?«
Sie lachte und hielt die Karte hoch: eine Spielkarte.
»Die wird er nicht vermissen«, sagte sie. »Er spielt sowieso nie. Das Spiel lag in der Bibliothek, in der er sich vergräbt, um allein zu sein.« Die Karte sah abgegriffen aus, es musste eine Zeit gegeben haben, in der Ximenas Großvater mit jemandem Karten gespielt hatte. Ehe er so alt und knurrig geworden war.
Manchmal dachte Pablo, dass auch den Silberbaron ein Geheimnis umgab: ihn und seine Villa. Und seine Enkeltochter, die so wenig über den Tod ihrer Eltern wusste. Die ins Wasser sprang wie in Trance und mit den Flussdelfinen schwamm, wenn sie sie riefen.
Er schüttelte den Kopf. Jetzt ging es um das Naturkundemuseum.
Der Raum, in dem sie gelandet waren, war voller Bilder hinter Glas. Die ersten Sonnenstrahlen brachten die Farben darauf zum Gleißen und Glänzen – und dann sah Pablo, dass es keine Bilder waren. Es waren Schmetterlinge. Auf weißes Papier hinter Glas gepresste Schmetterlinge aus dem Urwald: wunderschön. Riesengroß. Mausetot.
In einem Rahmen befand sich ein Pärchen: Ein Schmetterling war leuchtend blau mit schwarzen Linien, der andere weiß mit feinen Linien und orangegelben Flecken.
Ximena legte die Hand auf das Glas und schluckte.
»Wissenschaftler«, hörte er sie zischen. »Sie müssen alles erst totmachen, um es auszustellen.«
In der Mitte des Raumes standen mehrere Glasvitrinen mit riesigen, schillernden Käfern: alle auf Nadeln gespießt und sorgfältig mit kleinen, handgemalten und vergilbten Namensschildern versehen.
»… einfach die Tür aufgebrochen«, sagte jemand im nächsten Raum. »Er hat das Schloss mit roher Gewalt geknackt.«
»Und dann hat er das Ding in ein Auto transportiert und ist damit geflohen, richtig«, sagte jemand anderer. »Gut, so weit haben wir das. Und der Herr, der angerufen hat … was hat er noch gleich erzählt?«
»Er hätte Lärm gehört, vom Türaufbrechen wahrscheinlich, und dann, nach einer Weile, wäre jemand aus dem Museum gekommen und hätte etwas Großes getragen.«
»Und hat er das Kennzeichen notiert? Oder die Marke?«
»Nun, der Herr … unser Informant … nein. Er … schien nicht ganz …«
»Ist er noch da? Draußen? Um befragt zu werden?«
»Nein. Er ist verschwunden. Ganz ehrlich, er war betrunken. Sehr sogar. Weshalb wir ihn auch erst nicht ernst genommen haben. Aber es stimmt. Jemand ist in dieses verflixte alte Museum eingebrochen.«
»Um ein mottenzerfressenes, ausgestopftes Tier zu stehlen«, entgegnete die andere Stimme. Pablo sah Ximena an und grinste. Er hatte also recht gehabt.
»Mit Verlaub, Signor, es ist nicht mal ein ausgestopftes Tier gewesen«, sagte die erste Stimme. »Es war ein Modell. Nur ein Modell.«
»Nur, warum …«, begann die andere Stimme, dann entfernten sich beide. Pablo sah Ximena fragend an. Sie nickte.
Diesmal schlich er voran in den nächsten Raum, in dem im Dämmerlicht Tiere auf Tischen hockten und lauerten, sprungbereit: kleine Raubkatzen, Affen, ein Kaiman. Ximena hielt sich an Pablo fest und er spürte, wie sein Herz stehen blieb. Aber dann schlug es doch weiter, denn die Tiere, das sah er jetzt, waren nicht lebendig. Sie waren es einst gewesen, doch jemand hatte sie erlegt und ausgestopft. Ihre Glasaugen wirkten, als träumten sie von einer großen grünen Vergangenheit, von ihrer Freiheit im Dschungel, damals, vor langer, langer Zeit.
Pablo sah jetzt, wie fadenscheinig ihr Fell war. Er strich mit der Hand über den Rücken eines Äffchens und eine Staubwolke stieg daraus empor, sodass er ein Husten unterdrücken musste.
»Geschossen und präpariert 1961 von C.d.Silva«, entzifferte Ximena auf dem Schildchen unter dem Affen. Sie schüttelte sich. »Brrr! Ein ganzer Tierfriedhof! Komm weiter!«
Sie durchquerten zwei weitere Räume mit verblichenen Fotos von Menschen, die mit Tropenhelmen im Dschungel standen und Gewehre oder Lupen bei sich hatten. Und schließlich betraten sie einen größeren Raum, in den durch ein hohes Fenster ein wenig mehr Licht fiel. Jemand hatte einen der Fensterläden geöffnet. Und quer durch den Raum spannte sich, etwas schlaff und halbherzig angebracht, ein Stück rot-weißes Absperrband. Das Absperrband der Polizei.
Dahinter stand ein merkwürdiges Ding, ein Ständer mit einem Drahtgestell darauf. »Ist das eine Art gruselige Maschine?«, wisperte er.
Ximena schüttelte den Kopf. »Das ist ein … Tier«, flüsterte sie, strich sich die Locken aus dem Gesicht und blickte an dem Ding empor. Es reichte bis knapp unter die Decke. »Ein riesiges Tier. Ein Tier aus Draht … sieh mal, da, es hat einen Arm nach oben gestreckt, einen langen Arm. Ist das … ein Affe?«
Da sah Pablo die Bilder. Auch hier hingen Bilder an der Wand, es fiel kein Licht darauf, deshalb hatte er sie nicht gleich bemerkt. Er trat näher. Es waren keine Fotos, es waren Zeichnungen. Alte Federzeichnungen, bräunliche Tinte auf bräunlichem Papier, vergilbt, aber noch zu erkennen. Sie zeigten alle dasselbe riesige Tier zwischen den Bäumen des Urwaldes. Die Menschen auf den Bildern wirkten im Vergleich zu dem Tier winzig. Das Tier hatte lange Arme und Beine und einen Kopf mit glatt anliegendem Fell, ohne sichtbare Ohren, und keinen Schwanz.
Auf einem Bild saß es auf einem uralten, meterdicken Baum und unten standen Menschen und sahen zu ihm hinauf. Auf einem anderen Bild hatten sie das Tier offenbar gefangen, denn es lag auf dem Boden in einer Art Netz aus Seilen oder Lianen und sie hielten es fest. Sie trugen keine Kleidung, dafür aber Speere oder Pfeile.
»Das sind … Davis Leute, da im Dschungel«, flüsterte Pablo.
»Nein«, sagte Ximena, die hinter ihn getreten war. »Das sind nicht Davis Leute. Davis Leute haben vielleicht nicht immer etwas an und wohnen in einem Shabono und jagen mit Pfeilen, aber sie leben heute. Schau dir das Datum unter dem Bild an: 8.000 vor Christus. Das war vor … zehntausend Jahren.«
»Jemand hat dieses Bild vor zehntausend Jahren gemalt?«, fragte Pablo zweifelnd. »Wäre es nicht längst verrottet?«
»Das Bild doch nicht.« Ximena seufzte. »Jemand hat ein Bild gemalt von etwas, das vielleicht vor zehntausend Jahren so aussah. Sieh mal! Hier in der Vitrine ist ein Knochen! Ein … was steht da? Meine Güte, alles Latein … Vertebra … Das ist ein Wirbelknochen. Ein Stück Wirbelsäule. Bei uns wäre so ein Knochen nur so groß wie ein Ohr oder so. Dieser hier ist gigantisch. Fast wie bei einem Wal.«
Pablo nickte. Latein und menschliche Knochen. Ximena wusste so viel. Manchmal ärgerte es ihn fast. Privatunterricht war sicher langweilig und einsam, aber auch hilfreich.
»Das Tier sieht aus wie irgendwas, das wir kennen«, murmelte er. »Es sieht aus wie … Davis Faultier. Das er bei unserer letzten Reise gerettet hat, du weißt schon.«
Ximena nickte langsam. Dann zeigte sie auf das Schild, das vor dem seltsamen Drahtgestell auf dem Boden befestigt war. »Megatherium americanum«, flüsterte sie. »Das war ein Modell, Pablo. Ein Modell des ausgestorbenen Riesenfaultiers. Aus Fell oder so.«
»Jemand hat das Fell geklaut und nur das Gestell dagelassen, auf das es aufgezogen war«, flüsterte Pablo. »Das ist verrückt. Es war einfach irgendein Stück Fell, nichts Besonderes. Warum bricht dafür jemand ins Museum ein und klaut so was?«
»Vor allem …« Ximena fuhr mit dem Zeigefinger die Vitrine mit dem Knochen entlang. Der Finger hinterließ eine deutliche Spur in der dicken Staubschicht. »Vor allem, weil das Museum offenbar schon eine ganze Zeit lang geschlossen war.«
Pablo überlegte. »Ich habe den Direktor früher immer am Theaterplatz herumwandern sehen«, sagte er. »Aber … jetzt, wo ich darüber nachdenke … die letzten paar Wochen war er nicht da.«
Sie sahen sich an. »Wo ist er?«, flüsterte Ximena.
»Vielleicht macht er irgendwo Ferien«, sagte Pablo leise. »Oder er ist einfach krank.«
»Ja, nur frage ich mich«, wisperte Ximena mit großen Augen, kaum hörbar jetzt, »was das ist.« Sie deutete auf den Boden hinter dem Absperrband, unter dem hohen Fenster, dessen einer Laden offen stand. Dort war ein Fleck auf dem Boden. Ein kleiner dunkler Fleck. Und auf dem Fensterbrett gab es noch ein paar weitere dieser Flecken. Als wäre dort eine dunkle Flüssigkeit hingetropft. Jemand hatte eine Vase direkt danebengestellt, eine Vase mit vertrockneten Blumen, und ehe Pablo sie hindern konnte, war Ximena unter dem Absperrband durchgeschlüpft und hatte die Vase beiseitegeschoben. Darunter war noch ein Fleck. Ein großer. Bräunlichrot. Jemand hatte die Vase daraufgestellt, um wenigstens den größten Fleck zu verbergen.
»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Polizei das nicht gesehen hat«, flüsterte Ximena. »Sonst hätten die sich mehr Mühe mit dem Absperren gegeben und wären aufgeregter gewesen. Die glauben, hier ist nur ein Modell von einem komischen ausgestorbenen Tier geklaut worden.«
»Und du glaubst …?«, flüsterte Pablo.
Ximena zuckte mit den Schultern. »Ich weiß noch nicht, was ich glaube«, wisperte sie. »Aber zusammengenähte Modelle von ausgestorbenen Tieren verlieren kein Blut.«
ZWEITES KAPITEL,
in dem eine alte Frau über fliegende Riesentiere spricht, ein blinder Opernsänger von geheimen Gartentüren singt und niemand über das Mapinguari reden will
Als sie wieder aus dem Fenster kletterten, stand die Sonne schon hoch über Manaus. Der Verkehr begann, durch die Straßen zu lärmen und übertönte die Vögel in den Bäumen und der Rio Negro, der sich mitten durch die Stadt schob, war eingeschlafen. Die Tagwelt gehörte den Menschen, der Technik, dem Lauten und Eckigen. Nur nachts erinnerte sich die Stadt daran, dass sie einmal Teil des großen grünen, träumenden Urwalds dort draußen gewesen war.
Die Polizisten und die Schaulustigen waren fort, der Eingang des Museums war verschlossen, der Hof lag verlassen da.
»Alle weg«, sagte Pablo erstaunt. »Als wäre nie etwas geschehen.«
»Ist es aber«, meinte Ximena und zog ein weißes Spitzentaschentuch aus dem Ärmel ihres veilchenblauen Kleides. Das Taschentuch trug ihre Initialen, X.S., und daneben war ein großer verschmierter bräunlicher Fleck. »Der Beweis«, sagte sie. »Falls später jemand putzt, haben wir den Beweis dafür, dass da Blut war.«
»Wann hast du …?«, begann Pablo.
»Während du versucht hast, dich durch die Texte unter den alten Fotos zu buchstabieren«, sagte Ximena und Pablo knurrte, denn es war schließlich seine Sache, wie schnell oder langsam oder ob er überhaupt las. »Das Blut war doch schon eingetrocknet«, sagte er. »Wie hast du es auf das Taschentuch gekriegt?«
»Och, ich hab draufgespuckt und ein bisschen gerubbelt«, sagte Ximena. Dann steckte sie das Taschentuch wieder ein. Pablo lachte. »Wenn der Silberbaron wüsste, wie wenig damenhaft sich die Senhorita benimmt! Durch Fenster klettern und spucken wie ein Kerl.«
Ximena ging auf die Straße hinaus und sah an den Fenstern der Häuser hoch. Sie drückte auf alle Klingeln gleichzeitig, aber nichts geschah. Vielleicht waren sie alle kaputt oder die Menschen, die dort wohnten, waren bereits zur Arbeit gegangen. Aber eines der Fenster stand offen, im ersten Stock. »Hallo!«, rief Ximena. »Ist da oben jemand?«
Da steckte eine alte Frau den Kopf aus dem Fenster, so rasch, als hätte sie nur darauf gewartet, dass jemand nach ihr rief. Ihr graues Haar war zu zwei dünnen Zöpfen geflochten, ihr Gesicht faltig wie schon lange benutztes Leder und sie trug ein buntes, gewebtes Hemd. Jetzt war es ausgeblichen, doch einst musste es farbenfroh gewesen sein wie das Gefieder eines Papageis. »Was ist? Was wollt ihr?«
Ihre Stimme klang knarzig, knarrend, wie das Holz eines uralten Baumes im Wind.
»Entschuldigung … haben Sie etwas gesehen?«
»Oh, ich habe in meinem Leben viel gesehen«, antwortete die alte Frau und lachte. »Ich habe Herrscher kommen und gehen sehen, Monster durchs Unterholz schleichen und verschwinden, Bäume wachsen und fallen …«
»Ja«, sagte Ximena. »Aber haben Sie heute Nacht etwas gesehen? Von dem Einbruch im Museum?«
»Oh, das«, sagte die Alte. »Hab schon gehört, war einer da, der hat es mitgenommen, was? Weggetragen, haha. Einfach in sein Auto gesteckt. Hat es entführt.«
»Es«, murmelte Pablo. »Das Riesenfaultier.«
»Hab mir gedacht, dass das eines Tages passiert«, sagte die Alte. »Oh ja, hab ich mir gedacht. Dass es einer zurück in den Wald holt, wo es hingehört.«
»Dieses … Fell?«, rief Ximena. »Aber es war kein richtiges Fell. Es war nur ein Modell. Jemand hat es mitgenommen, das stimmt. Aber haben Sie gesehen, wer? Haben Sie das Auto gesehen? Und wissen Sie, wer dieser Betrunkene war, der bei der Polizei angerufen hat?«
»Du stellst eine Menge Fragen«, sagte die alte Frau und beugte sich weit aus dem Fenster, so weit, dass Pablo Angst bekam, sie würde vor ihnen auf die Straße plumpsen.
»Ich hab von diesem Auto gehört«, erklärte sie, nun leiser. »Und Lärm vom Museum. Jaja, die haben ja gesagt, jemand hätte die Tür geknackt … Und dann bin ich zum Fenster und habe den Schatten gesehen. Einen gebückten Schatten mit einem großen Paket, schwer getragen hat er an seiner Beute, und dann ist er wieder in sein Auto gestiegen, da unten im Dunklen, und ich hätte mir denken können, dass er das Fell von dem magischen Tier hat. Denn dann, meine Kinder, ist er mit dem Auto weggeflogen. Jaja.«
Pablo und Ximena sahen sich an.
»Wo ist es denn … hingeflogen?«, fragte Pablo nach oben.
»Da lang«, sagte die Alte und zeigte irgendwohin. »Ist aufgestiegen in den Nachthimmel und geflogen und sie haben alle geschlafen und es nicht gesehen. So war das schon damals im Wald, alle haben geschlafen und nichts gesehen, nur ich, ich hab es gesehen, aber ich war noch ein kleines Mädchen. Wir haben am Fluss gespielt, die Welt war ganz anders und ich …« In diesem Moment schrillte ein Wecker in der dunklen Wohnung hinter ihr und sie zuckte zusammen. »Oh«, sagte sie dann. »Gut, dass ich ihn gestellt habe. Acht Uhr. Um acht Uhr kommt meine Lieblingsserie. Ich muss los … die Leute im Fernsehen warten auf mich. Ich muss doch wissen, ob sie ihn heiratet oder mit seinem Freund flieht … und von wem die Cousine schwanger ist … Verzeiht, ich muss.« Und damit verschwand sie vom Fenster.
»Acht Uhr, verflixt«, murmelte Ximena. »In einer Viertelstunde sitzt mein Großvater am Frühstückstisch und köpft sein Ei. Und wenn am anderen Ende des tausend Meter langen Tisches keine Enkeltochter sitzt, wird er nicht erfreut sein.«
Sie holte tief Luft und sprintete los. »Vergiss nicht, dich zu kämmen!«, rief Pablo ihr nach. »Ehe du dich an den Tisch setzt!«
Als der Morgen voll und gelb über der Stadt hing und die Hitze in den Straßen zu flirren begann, trat Pablo in den Schatten der Bäume, die auf dem Theaterplatz standen. Hinter ihm ragte das Theater mit seiner goldenen Kuppel in den blauen Himmel, auf den Caféstühlen rings um den Platz saßen Touristen und Menschen mit Geld und schlürften Saft durch bunte Strohhalme.
Ximena hatte mal gesagt, dass man die Strohhalme, die an einem einzigen Tag weggeworfen wurden, mehrere Male um die Erde wickeln konnte, und Pablo fragte sich, ob eine dieser Strohhalmlinien dann auch durch Manaus und den Urwald führen würde und wie das dann wohl aussah.
Er ließ sich auf eine der Bänke fallen, neben einen sehr großen Mann mit breitem Strohhut und grauem Pferdeschwanz. Der Mann lauschte dem Geiger, der vor ihnen auf dem Platz spielte. Ein Orchester aus einem kleinen alten Lautsprecher begleitete ihn und er spielte mit geschlossenen Augen und so hingebungsvoll, als gäbe es nichts auf der Welt als ihn, diesen kleinen, hageren Mann im abgewetzten Jackett, und seine Geige.
»Er träumt wieder von damals, was?«, fragte Pablo und nickte zu dem Mann hinüber. »Senhor Vargas. Als er noch berühmt war und im Theater gespielt hat.«
»Klar, wir träumen alle von damals«, sagte der große Mann neben Pablo, nahm seinen Strohhalm und drehte ihn zwischen den Händen. »Von besseren Zeiten. Aber du bist nicht hergekommen, um mit Tom Weißfeder über Träume zu sprechen.« Er wandte Pablo sein Gesicht zu, als musterte er ihn eingehend. Aber Tom Weißfeder war blind. Die Geschichte, wie er sein Augenlicht verloren hatte, gehörte zu denen, die ein Geheimnis blieben. »Du hast was auf dem Herzen, mein Junge.«
»Hm«, sagte Pablo vage. »Du … hast nicht zufällig was zu essen?«
»Noch nichts gefrühstückt, wie?«, fragte Tom Weißfeder. »Tut mir leid, ich bin auch blank.«
»Ich dachte, du verkehrst jetzt in besseren Kreisen, mein Junge? Bei deiner kleinen Freundin?«, fragte jemand von der Seite. Pablo fuhr herum und sah gerade noch, wie der Sprecher seinen Rollstuhl bremste.
Der Reisende, wie sie ihn nannten, ging schon lange nicht mehr auf Reisen, sie nannten ihn nur so, weil er irgendwann einmal auf einer Reise nach Manaus gekommen und dann geblieben war. Er hatte blaue Augen und helle Haut wie die reichen Europäer und niemand wusste, wie es kam, dass er im Rollstuhl saß, der eigentlich ein Korbstuhl auf Rädern war, und auf den Straßen bettelte. »Gehst beim Silberbaron ein und aus, sagen sie«, fuhr der Reisende fort. »Gibt’s da nicht Kuchen und Pralinen in Massen?«
»Ich gehe da nicht ein und aus«, knurrte Pablo. »Ich bin nur zufällig mit seiner Enkeltochter befreundet. Das heißt nicht, dass sie mich durchfüttern muss wie einen Hund. Ich frag sie nicht dauernd nach Essen, ich hab meinen Stolz.«
»Aber bei uns kannste schnorren, ja?«, fragte Tom Weißfeder und lachte gutmütig. »Na, gib doch mal einer dem Jungen ein Frühstück aus! Vargas?«
Senhor Vargas hatte sein Geigenstück beendet, aus dem Lautsprecher ertönte Applaus und er verbeugte sich. Dann hob er seine schwarze Kappe auf und kam auf seine etwas steife Art zu ihnen herüber. »Zwei Centavos«, sagte er und schüttete das Geld in seine Hand. »Pff! Lächerlich. Die Leute verstehen nichts von Kunst.«
Pablo schluckte. Dann eben kein Frühstück.
»Okay«, sagte er. »Es gibt Wichtigeres als Essen. Eigentlich bin ich gekommen, um euch etwas zu fragen.« Er räusperte sich. »Wann habt ihr den Direktor vom alten Naturkundemuseum zuletzt gesehen? Wisst ihr, dieser kleine Dicke mit dem Hut?«
»Oh, der! Der hat immer was gespendet«, sagte Tom Weißfeder. »Ein angenehmer Mensch, hat selten geredet, aber die Musik geliebt. Manchmal habe ich nur für ihn gesungen. Puccini, er wollte immer Verdi hören. Aber er war schon eine ganze Weile nicht mehr da.«
Senhor Vargas griff in die Tasche des abgewetzten schwarzen Jacketts, zog ein ebenfalls schwarzes Notizbüchlein heraus und blätterte. Er war der vermutlich ordentlichste und traurigste Mensch, den Pablo kannte. »Sieben Wochen«, sagte er jetzt. »Vor sieben Wochen war er zuletzt da. Er hat mir damals einen großen Schein gegeben. Hat etwas von Hochzeitstag gemurmelt. Ich habe mir das Datum notiert. Ich dachte, es ist gut zu wissen, wann der Hochzeitstag eines Museumsdirektors ist. Man kann dann ein Ständchen spielen.«
Er klappte das Büchlein zu und steckte es hastig wieder ein. »Und das alte Museum ist seitdem zu«, sagte jemand hinter Pablo. Er fuhr herum. »Maria! Hast du mich erschreckt!«
Maria lachte zufrieden, sodass ihr ausladender Busen hinter der Schürze wackelte. Sie trug ein Baby auf dem Arm und hinter ihr stand der Saftwagen, mit dem sie frisch gepressten Fruchtsaft an Touristen verkaufte. Um die grünen, gelben und roten Kannen herum jagten sich drei oder vier kleine Kinder. Pablo vergaß immer, wie viele Kinder Maria hatte. »Ich hab vor dem Museum verkauft, als es noch offen war«, sagte Maria. »Aber seit es zu ist – keine Chance. Na, Touristen sind sowieso fast nie gekommen, aber ab und zu Studenten. Ich glaube, die alten toten Tiere waren ihnen egal, aber in dem kleinen Garten dahinter kann man sicher gut turteln … ein lauschiges Plätzchen, wo einen niemand stört. Und der Direktor hat meistens vergessen, den Eintritt zu kassieren.« Sie lachte wieder. »Der saß ja selbst an der Kasse … wenn er denn mal da saß. Ein komischer Mensch. Immer mit dem Kopf in den Wolken, wie ein kleiner Junge.«
Sie wuschelte Pablo durchs Haar und er duckte sich weg, weil er wuscheln nicht mochte.
»Dieser Direktor … er hat irgendwas mit blauen Schmetterlingen gesagt«, sagte Tom Weißfeder plötzlich. »Ehe er weg ist. Ein paar Mal. Das Meer der blauen Schmetterlinge – oder war es der Fluss? Ich glaube, es war ein Ort, an den er sich erinnert hat, aber genau weiß ich es nicht mehr. Da waren blaue Schmetterlinge, hat er gesagt, und irgendwas war mit einem Monster … Vielleicht war es ein Traum, den er hatte. Gott, ich habe nicht richtig zugehört.«
»Das Mapinguari«, sagte der Reisende im Rollstuhl.
Alle starrten ihn an. »Wie bitte?«