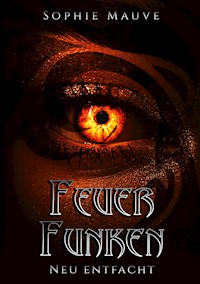Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Ich bin nicht als Missgeburt auf die Welt gekommen." Aber jetzt bin ich eine. Täglich verstecke ich mich vor den kalten Augen der Menschheit. Bin ich denn noch ein Teil von ihnen? Bin ich noch ein Mensch? Ich weiß es nicht. Und sie hört durch Wände ... Und er verfolgt mich ... Bin ich bald tot? Dies ist die Geschichte einer Superheldin wider Willen. Dies ist mein Untergang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für David.
Und unsere beiden Flauschnasen.
Inhaltsverzeichnis
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel X
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
PLAYLIST
In the Shadows – The Rasmus
Astronaut in The Ocean – Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui
Thriller / Heads Will Roll – Glee Cast
Humans Are Such Easy Prey – Perturbator
Hide and Seek – Lizz Robinett, Dysergy
Everybody Wants To Rule The Word – Lorde
Taste – Sabrina Carpenter
Let Me Go – Avril Lavigne, Chad Kroeger
What’s Up Danger – Blackway, Black Caviar
Insane – Black Gryphon, Baasik
After Dark – Mr.Kitty
Holding Out for a Hero – Adam Lambert
Let the World Burn – Chris Grey
Popular Monster – Falling In Reverse
Let It Go – Peyton Parrish
KAPITEL 1
Einsame Penthäuser bei Nacht sind das Beste an meinem Job. Ich stehe in einem solchen und sehe nach unten, auf die Straße zwischen den Hochhäusern. Dort, zwischen den Laternen und Briefkästen, stehen sie. Die Menschen, die ihn anhimmeln und seinen Freispruch wollen. Sie feiern ihren Helden, dem frisches Politikerblut an den Händen klebt – und sie sind viele.
Ich halte dabei eine Birmakatze im Arm und kämme ihr Fell, pflichtgemäß mit der Bürste aus Perlmutt. Violettblaue Augen strahlen mir dunkel umrandet entgegen. Die Katze verliert jedoch die Lust an ihrer Schönheitsbehandlung. Sie fährt ihre Krallen aus und kratzt mich. Ihr Hieb ist stark. Aber ich zucke nicht zurück, sondern wende bei ihr diesen Griff im Nacken an, den auch Muttertiere anwenden. Es funktioniert. Das Tier hält still.
Bis morgen noch ist das hier mein Terrain, dann kommt Frau Jones von ihrer Geschäftsreise zurück und ich muss gehen. Ich sehe mich vorsichtshalber noch einmal um. Die Wohnung ist ordentlich. Gut so. Den Fehler, meinen Müll oder meine Unterwäsche bei einem Kunden liegen zu lassen, werde ich nie wieder begehen.
Der Kühlschrank ist gefüllt, das ist ein kleiner Extraservice von mir. Die Katzentoilette ist frisch gereinigt und beim Zahnarzt war ich ebenfalls mit Eloise. So heißt die junge Birmakatze. Alles ist perfekt vorbereitet für die Rückkehr der Hausherrin, die Schlüsselübergabe und meine Heimkehr in ein schäbiges Ein-Zimmer-Apartment am Pine Park.
Alles läuft glatt und so, wie es sein soll.
Alles ist richtig.
Außer mein Hals, der sich im Fenster spiegelt, der ist es nicht.
Nur hier oben, weit über der Straße, wo mich niemand sehen kann, lasse ich ihn unter dem Stoff hervorblitzen. Im leicht spiegelnden Fenster erkenne ich das Glänzen der Schuppen. Wenn irgendjemand davon wüsste, würden sie Handtaschen aus mir machen. Im besten Fall.
Ich ziehe meinen Bademantel enger um den Hals. Es ist ohnehin viel zu kalt in dieser riesigen, offenen Wohnung. Aber die Temperatur bleibt so niedrig, wie Frau Jones es wünscht. Eloise hat derweil endgültig genug. Sie springt von meinem Arm und ich habe keine Motivation mehr, ihr zu widersprechen. Nicht, dass ihre Krallen mir etwas anhaben könnten. Ich habe trotzdem keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit der flauschigen Tochter des Hauses. Lieber stelle ich mich näher ans Fenster, blicke zehn Stockwerke in die Tiefe und beobachte, wie sie immer noch vor dem Hintereingang des Gerichts demonstrieren. Steine fliegen. Ich sehe Leuchtfeuer. Diese Idioten. Warum fahren sie nicht zur Psychiatrie, zu ihm? Dort ist ihr guter Freund, ihr Superheld, doch aufgehoben. Dort können sie ihn persönlich treffen und nach Autogrammen fragen. Ist das nicht ihr feuchter Traum? Durch das dicke Glas kann ich ihre Rufe nicht hören, aber ich kann ihre Rage sehen.
Ich lösche das Licht und lege mich aufs Sofa. Eloise wetzt sich die Krallen am Kratzbaum. Da ihre Bewegungen regelmäßig sind, hat das Geräusch etwas Beruhigendes. Ich versinke schläfrig in der Liegefläche.
Während der Arbeit schlafe ich oft auf Sofas wie diesem. Manchmal gibt es Gästezimmer, aber da selbst reichen Menschen in dieser Stadt nur begrenzt Platz zur Verfügung steht, sind zusätzliche Zimmer selten. Viele wollen mich auch nicht darin schlafen lassen, weil ich eben kein Gast bin. Ich bin nur diejenige, die zum Abschluss des Tages noch mal alle exotischen Pflanzen gießt, die Post holt und das Wasser für die Katze auffrischt. Das gluckernde Geräusch des Trinkbrunnens treibt mich erst in den Wahnsinn, bevor es mich schließlich in einen unruhigen Schlaf sinken lässt.
Ich träume von Wesen, die ähnlich sind wie ich. Sie haben dunkle, eindringliche Augen, in denen sich die Verzweiflung spiegelt. Einer von ihnen hat so eiskalte Hände, dass er damit ein kleines Gewässer einfrieren lässt. Das nasse Gras unter seinen Füßen schimmert in der Sommersonne, doch Stück für Stück zieht sich die knackende, klirrende Kälte über die Wasseroberfläche, breitet sich in alle Richtungen aus, fängt Gräser und Tiere in sich ein und töten sie augenblicklich. Eine Frau verfolgt mich in den Gassen einer Stadt. Ich sehe sie in spiegelnden Flächen hinter mir, aber jedes Mal, wenn ich mich zu ihr umdrehe, verschwindet sie. Nicht weil es ein Traum ist und dieser keiner Logik folgt, sondern, weil die Dame unsichtbar wird. Jemand in der Realität hat behauptet, dass er so eine Person fotografiert habe. Sie könne sich unsichtbar machen, doch man würde an den verzerrten Hintergründen erkennen, dass jemand dort stehe, der das Licht umlenkt oder durch sich durchfiltert. Ich komme im Traum auf diesen Gedanken, weil genau dieser Mann auftaucht und mich fotografiert. Mein Traum lässt ihn daraufhin doppelt erscheinen. Ich sehe ihn überall: Neben mir, hinter mir, unter mir im Boden, dann wache ich auf.
Es ist inzwischen mitten in der Nacht. Regen rinnt am Fenster herunter, er fällt still vom Himmel. Ich höre kein Rauschen, kein Platschen. Alles ist wie in Watte gehüllt, allein wegen des dichten, schneeweißen Teppichs in der Wohnung und der dicken Fenster. Eloise sitzt darauf und putzt sich, ein Bein in die Höhe gestreckt. Ich setze mich aufrechter hin und reibe mir die eiskalten Hände. Es bringt nichts, sie werden nicht wärmer. Das werden sie nie, nicht bei mir. Also tue ich, was nötig ist. Ich atme aus. Auf meine besondere Weise. Und siehe da, meine Hände werden augenblicklich warm.
KAPITEL 2
Die Schlüsselübergabe ist reibungslos verlaufen. Dass sich jetzt auch noch die Sonne an diesem Herbsttag hervortraut und die kalte Luft durchbricht, ist für mich ein Segen. Was für ein perfekter Tag. Ich lasse mir Zeit auf dem Rückweg, nehme jeden Sonnenstrahl auf. Ich hole mir einen wärmenden Karamell-Latte mit einem extra Schuss Espresso und strecke die Nase in die Wärme. Mein Hals wird hier draußen von einem Schal geschützt beziehungsweise verborgen. Die Ärmel schiebe ich dafür so hoch, wie es gefahrenlos geht. Meine Strumpfhose ist dunkel und zugleich etwas durchlässig, die perfekte Mischung, um so viel Wärme wie möglich zu sammeln. Ich weiß, dass ich sie brauche. Der Kaffee heizt meine Seele von innen auf.
Der Umweg am Wasser entlang lohnt sich heute besonders. Wie schön die Hochhäuser bei Sonne glitzern, schöner als die Augen der Bewohner. Mir fällt immer wieder auf, wie viele Menschen hier mit einem toten Ausdruck im Gesicht unterwegs sind.
Da Frau Jones so nett war und mir ein gutes Trinkgeld in die Hand gedrückt hat, gebe ich einen Teil davon an den heruntergekommenen Straßenmusiker mit der Geige weiter. Seine Klänge ersetzen heute die Kopfhörer auf meinen Ohren. Ich will die Welt spüren und sehen, hören und riechen und er untermalt sie. Dafür hat er einen Dank verdient.
Die letzten drei Stationen will ich mit der U-Bahn nach Hause fahren. Weil ich den Teil der Stadt so in- und auswendig kenne, dass es mich langweilen würde, diesen letzten Abschnitt zu laufen.
Ich mache mich gerade auf den Weg in den Untergrund, als mein Blick den eines Mannes trifft. Seine Augen wirken so dunkel, dass ich keine Pupille erkenne. Habe ich mir das eingebildet oder hat er an der Ecke gestanden, Zeitung lesend, und ist absichtlich genau in dem Moment losgelaufen, als ich mich ihm genähert habe? Er streift mich leicht am Arm. Bis ich es realisiere und darüber nachgedacht habe, ob es Absicht war oder nicht, ist er bereits aus meinem Sichtfeld verschwunden. Während ich mich auf den Stufen nach unten befinde, ist er nach oben davongeeilt. Sein langer, schwarzer Ledermantel weht in meinen Gedanken nach.
Als ich in der Bahn stehe, habe ich ihn bereits vergessen.
Stattdessen erweckt eine Benachrichtigung aus meinem Lieblings-Forum meine Aufmerksamkeit. Ich entsperre mein Handy und öffne es.
Wir sprechen in diesem Netzwerk über Verschwörungstheorien und andere mysteriöse Vorkommnisse weltweit. Natürlich rein zum Vergnügen! Heute geht es mal wieder um Chemikalien in der Luft und im Trinkwasser und darum, ob sie uns verblöden lassen oder uns besondere Kräfte geben. Zu Letzterem sage ich selbst lieber nichts, dafür lese ich umso interessierter die Theorien meiner Onlinefreunde:
@planet_morphine:
Was meinst du dazu, @dragongirl? Hast du gesehen, wie viele Flieger in letzter Zeit in der Luft sind? Und dann sagen sie immer, sie wollen das Klima schützen, sprühen aber so viele Abgase da raus. Dieser Planet und diese Zivilisation müssen sich mal entscheiden!
@dragongirl:
Ich denke, man sieht gerade einfach mehr, weil der Himmel im Winter klarer ist und die Leute ins Warme fliegen.
@planet_morphine:
Wetter-Erklärungen und Urlauber? Wirklich Skye? Sonst bist du doch immer die Misstrauischste hier. Nur bei bestimmten Themen nicht. Sus, meine Liebe, äußerst sus.
Oh, Gott, dieses Wort! Wir alle hier pflegen eine Hassliebe zum Begriff ‚sus‘, was für suspekt steht. Ich muss ein wenig schmunzeln.
@dragongirl:
Sorry, hab halt meine favorisierten Rabbit Holes und solche, die mich weniger interessieren. Melde dich wieder, wenn du ein paar ungelöste Zeitreisefälle hast. ;)
Die Dritte im Chat wirft etwas anderes ein:
@rinaxx:
Kommt ihr eigentlich zur Halloween-Party im Rodent?
Warum ich mich hier @dragongirl nenne, ohne Scheu und Sorge? Nun, weil niemand wirklich auf Usernamen im Internet achtet. Sie werden überlesen und vergessen oder als harmlos-peinliche Relikte aus Kindheitstagen angesehen. In all den Jahren hat niemand etwas anderes hineininterpretiert, als dass ich gerne Fantasy-Geschichten lese.
Ich schließe erst einmal unseren kleinen Gruppenchat. Ob ich zur Halloweenfeier gehen werde oder nicht, muss ich noch entscheiden. Einerseits bin ich fast nie auf Partys, ich bin dort nämlich nicht gut aufgehoben. Andererseits … Halloween ist einer der wenigen Tage, an denen ich ungeschützt ich selbst sein könnte. Also theoretisch. Bis sie erkennen, dass mein Make-up sich nicht entfernen lässt. Instinktiv bedecke ich mich stärker.
Die Bahn erreicht in diesem Augenblick die Station Pine Park. Hier muss ich aussteigen. Mein Kaffee ist leer, ich werfe den Becher in den Müll und trete wieder aus dem Untergrund ans Sonnenlicht. In Verbindung mit dem pfeifenden Wind zwischen den Mietshäusern ist das Licht hier weniger schön, und dennoch so verdammt lebensnotwendig für mich. Um es einzufangen, bleibe ich noch kurz stehen. Als mich jemand anquatscht und fragt, worauf ich denn warten würde, wird es mir unangenehm. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.
Ich komme an und schließe gerade die Haustür auf, als mir der Griff von innen aus der Hand gerissen wird. Die Tür öffnet sich, doch nicht durch mich. Meine Nachbarin Eden stürmt nach draußen. Um ein Haar rennt sie mich über den Haufen. Sie stammelt dreimal hintereinander: »Entschuldigung«, hat aber nicht mal die Zeit, dafür stehen zu bleiben. Einen Ordner unter den Arm geklemmt und mit strengem Pferdeschwanz frisiert, rennt sie davon, in Richtung Bus der Linie 168. Den nimmt sie in letzter Zeit jeden Tag. Schon ist sie weg und ich bin noch da, mit dem metallisch grünen Schlüssel in der Hand und dem schweren Rucksack auf dem Rücken. Erschöpft gehe ich nach oben.
Endlich umgeben mich wieder meine wohlvertrauten eigenen vier Wände. Wie so oft läuft mein eigener Briefkasten über, während die der Kunden immer pünktlich geleert sind. Bei mir stecken meist Rechnungen oder Werbung darin, oder es ist das Finanzamt, meine absurd hohe Haftpflichtversicherung oder ähnliches unerfreuliches Zeug. Hin und wieder ist ein Buch oder Comic dabei oder eine Zeitschrift. Das sind die guten Tage, so wie heute. In diesem Monat befasst sich meine liebste Wissenschaftszeitschrift mit Pulsaren und Neutronensternen. Eine schöne Herbstlektüre. Das Heft werde ich mit in die Badewanne nehmen.
Siedend heiß läuft das Wasser aus dem Hahn. Ich strecke meine Füße hinein. Das Brennen ist Perfektion, es gleicht aus, was in mir ist. Kaum liege ich in der Wanne, kommt wieder eine Nachricht an. Die Userin @planet_morphine (alias Kaiwen) will jetzt auch endlich wissen, ob ich an Halloween dabei bin oder nicht! Sie wird nicht lockerlassen und hat gesagt, sie fährt extra zwei Stunden mit dem Zug, um kommen zu können. Also sage ich zu. Eine Party im Monat ist in Ordnung. Ich hätte schon Lust, mal wieder zu Musik zu tanzen, statt sie nur regungslos über meine Kopfhörer zu hören.
Etwas mehr Sorgen macht mir die andere Art von Nachrichten auf dem Handy, die von der lokalen Presse. Seit zwei Wochen kämpfen sie für den Freispruch des Fennell-Mörders. Sie halten ihn für einen Helden unserer Zeit, weil er es den linken Politikern ‚mal so richtig gezeigt hat‘, O-Ton Ende. Er hat sie eiskalt mitten auf der Straße umgebracht. Jetzt sitzt er im Hochsicherheitstrakt.
Hoffentlich läuft die arme, kleine Eden nicht mitten in die Menge seiner Fans hinein. Ich weiß auch wirklich nicht, ob sie sich das richtige Studienfach ausgesucht hat. Meine Nachbarin ist so zart, zerbrechlich und unschuldig.
Ich lasse mich tiefer ins Badewasser sinken. Es beruhigt mich, tröstet, ist für mich da. Meine Schuppen lassen unter Wasser interessante Muster entstehen. Ich fahre mit den Fingern darüber, streiche vom Hals nach unten, bis kurz oberhalb des Ellenbogens, wo die Schuppen in optisch betrachtet gewöhnliche Menschenhaut übergehen.
Wie oft habe ich mir die Frage gestellt, wie viele andere Personen solche Eigenheiten wohl an sich verstecken. Dann gehe ich im Sommer nach draußen, sehe ihre Freizügigkeit und weiß, dass es nicht viele sein können.
Doch was ist mit anderen … Sachen? Besonderen Talenten? Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht. So wie mein Atem, der den Raum innerhalb von Sekunden in eine Sauna verwandeln könnte. Mein Atem, der danach mein Bedürfnis nach Wärme allerdings verstärkt.
Oder was ist mit meiner nur vermeintlich gewöhnlichen restlichen Haut, die so gut wie nie geblutet hat? Diese Eigenheit sieht man mir nicht an. Woher kann ich also wissen, ob da draußen nicht doch mehr von … uns sind?
Manchmal treibe ich mich in den Verschwörungsforen herum und lese bei bestimmten Themen nur mit, weil ich Hoffnungen hege. Eines Tages hat vielleicht jemand den Hinweis, der mich meiner wahren Familie näherbringt. Über Reptiloiden wird immerhin viel diskutiert. Denn ich könnte eine von ihnen sein. Allerdings wüsste ich nichts davon, dass ich von einem anderen Planeten stamme. Auch nicht aus Atlantis oder einem geheimen Bunker unter der Erde. Manchmal habe ich scherzhaft darüber nachgedacht, ob ich ein Schläfer-Agent bin, der sich an nichts erinnern kann und nur auf das Signal aus dem Mutterschiff wartet. Dann werden schon alle Bilder und Erinnerungen wieder zurückkehren. Womöglich braucht es nur die richtigen Codewörter.
Wieder einmal schiebe ich all diese Spinnereien beiseite, mit dem Argument, dass es nicht wichtig ist. Mit mir ist doch alles gut. Ich kann ein fast normales Leben führen, und abgesehen von ein, zwei Sonderbarkeiten ist alles an mir gewöhnlich. Etwas zu gewöhnlich sogar. Mein Gesicht zum Beispiel ist ganz hübsch, aber es ist rein gar nichts Auffälliges daran. Mein Haar ist glatt und hellbraun. Total langweilig. Ich bin 1,70 m groß und weder muskulös noch besonders dünn oder dick. Ich bin in so vielem die Definition des Durchschnitts. Nur ein paar Aspekte liegen außerhalb der Norm, und Menschen haben nun mal unterschiedliche Körper. Dann sind diese Schuppen eben meine Besonderheit. Eine davon zu haben, ist doch normal. Ich meine, manche Leute haben schon mit zwanzig Jahren graue Haare. Andere besitzen ein fotografisches Gedächtnis oder sie wurden mit sechs Zehen an jedem Fuß geboren. Und der eine blutet besonders viel und langanhaltend, der andere eben nicht, manche schwitzen schnell, andere frieren immer. Es gibt Pigmentstörungen, die für interessante Muster auf der Haut sorgen, Albinismus, oder verschiedenfarbige Augen. Alles ganz normal, keiner von uns ist ein Metamensch.
Nur mein Atem – der ist definitiv anders.
Ich erhitze das kühl gewordene Badewasser erneut, nicht aus eigener Kraft, sondern mit Nachschub aus dem Hahn. Dann schlage ich die Zeitschrift auf, um von den neuen Beobachtungen der Pulsare zu lesen. Wieder einmal erschlägt mich die Vorstellung ihrer wahnsinnigen Rotationsgeschwindigkeit. Die Energien, die dabei freigesetzt werden, sind in uns vertrauten Skalen kaum messbar. Die Welt ist voller Wunder und unvorstellbarer Kräfte. Pulsare sind natürlich, also kann ich es auch sein.
In den nächsten vier Tagen habe ich keine Aufträge. Das bedeutet, ich lebe vier Tage in winzigen Räumen mit einem kleinen, tristen Balkon. Von der anderen Seite der engen Straße leuchtet mir eine gigantische Eisteedose entgegen. Die Werbetafel strahlt so hell, dass ich kein Licht anmachen muss. Alles wirkt durch sie leicht bläulich.
In meinem eigenen Reich zu sein, bedeutet auch, ich kann das Chaos einfach Chaos sein lassen. Der Pizzakarton stört niemanden, die angefangenen und zerknüllten Zeichnungen ebenso wenig. Am Abend sitze ich unter meinem Heizstrahler auf dem schmucklosen, grauen Balkon und zeichne den Mann aus der U-Bahn-Station. Das Bild in einem Comic hat die Erinnerungen an ihn wieder hervorgeholt und auch sein Outfit ist in meinem Kopf hängen geblieben. Diese Hose, mit so vielen Taschen und Details und mit Schriftzeichen in dunklem Lila. Die Nieten an seinen Handschuhen haben in der Sonne geglänzt. Sein Mantel war im Vergleich zu seinen sonstigen Accessoires überraschend glatt und schlicht. Seine schweren Stiefel verursachten klackernde Geräusche auf dem Asphalt. Ich zeichne ihn mit verwaschenem Gesicht, als wäre er ein Geist oder eine Illusion. Der Grund dafür ist, dass ich mich an nicht viel mehr erinnern kann als an seine außergewöhnlichen schwarzen Augen. Diese stechen auch auf der Zeichnung hervor. Sie geben ihm den Anschein einer Horrorfigur. Ich glaube, ich kann mich außerdem an lange, grau-schwarze Haare erinnern. Mit dem Bleistift setze ich die Schattierungen. Die Enden der Haare dunkle ich gerade etwas ab, als über mir ein Fenster aufgeht. Dann höre ich eine leise und hohe weibliche Stimme. Es ist Eden. Den Geräuschen nach zu urteilen, lehnt sie sich aus dem Fenster, raucht eine Vape mit Kaugummigeschmack (das riecht man bis hier unten) und telefoniert.
Ich halte inne, drossele meine Atmung und höre auf, mit dem Bleistift über das Papier zu kratzen. Es gibt keinen speziellen Grund dafür, ich möchte einfach nur hören, was sie sagt.
»Nee, Dad, es ist alles in Ordnung. Da passiert nix. Ich höre bei den Sitzungen nur zu, aus einem Nebenraum. Da ist Panzerglas dazwischen. Ansonsten geben die mir nur Aufgaben, die auch eine Azubine im Hotel machen würde oder eine Sekretärin. Essen vorbereiten, ans Telefon gehen und so was, oder ich sitze am Empfang, oder plane so Gruppenaktivitäten für die harmloseren Fälle. Ich darf bisher nicht mal an den Schrank mit den Medikamenten! Stattdessen habe ich die Instrumente für die Musiktherapie desinfiziert. Also, du siehst, alles nichts Gefährliches!«
Ihr Vater erwidert etwas. Eden stockt. Man merkt an ihrer Stimme, dass sie sich selbst zu überzeugen versucht. Der Geist der wissenschaftlichen Neugier schlägt in ihr, aber ihr Arbeitsumfeld ist nun mal gefährlich.
»Ich weiß, ich weiß. Aber das ist doch erst alles nach meinem Abschluss. Dann weiß ich schon, wie man das macht. Wir haben so viele Gitterstäbe und Türen aus Stahl, Kameras und es gibt sogar Elektro…, nein, egal und außerdem weißt du, dass ich …« Sie stockt erneut, sucht nach Worten. Ihr Vater spricht nun wieder und er scheint nicht glücklich über das zu sein, was seine Tochter als Nächstes sagen wollte.
»Nein, keine Sorge, mache ich nicht.« Sie gibt bei irgendetwas klein bei. Eine kurze Pause entsteht.
»Warum das alles?«, fährt sie fort. »Aber das weißt du doch. Ich will helfen und ich will, dass sie sich wie normale Menschen fühlen. Soweit es eben geht. Das hat jeder verdient.«
Nach diesem Satz entsteht erneut eine Pause, in der vermutlich sowohl Eden als auch ihr Gesprächspartner ernsthaft über etwas nachdenken. Dann wechseln sie das Thema, es geht jetzt um Edens kleinen Bruder und um den Hund der Familie.
Meine Nachbarin von obendrüber schließt das Fenster, ich höre sie zwar noch laufen, verstehe jedoch kein Wort mehr. Der Geruch von Kaugummi schwebt noch in der Luft, löst sich aber langsam im Wind und den Abgasen auf. Die Eisteedose auf dem Bildschirm rauscht und surrt kurz, dann wechselt das Bild zu der Ankündigung, dass eine Band in die Stadt kommt. Vier Jungs, mit blasser Haut, blutjung, ihre Blicke finster, der Hintergrund auf dem Plakat ist neongrün.
Krach! Eine Benzinbombe fliegt gegen den Bildschirm. Ein Riss zieht sich daraufhin durch die Scheibe. Die Boyband flackert auf - surr, blitz - und verschwindet. Es wird schwarz gegenüber von mir. Ich muss nicht nach unten sehen, um zu wissen, was los ist.
»Tuntige, verweiblichte Weicheier! Ziehen unseren Töchtern das Geld aus der Tasche und machen unsere Söhne schwul! Was für Betas! So richtige Loser! Und diese Musik braucht keiner.« Ein weiterer Stein fliegt an die Hauswand.
So geht es weiter und weiter. Ich reagiere nicht, höre nur zu. Der Typ, der da vor sich hin schreit, wird von einem anderen angefeuert und beklatscht. »Wehrt euch jetzt! Lasst Männer wieder richtige Männer sein!«, schreien sie. Weiter geht es mit: »Ihr seid die Clowns! Nicht wir!«
Es sind bloß vier oder fünf Stimmen, die meisten männlich, eine weiblich. Sie laufen die Gasse unter mir entlang.
Über mir geht das Fenster erneut auf. Ich höre Schnappatmung, irgendwo zwischen Angst und Faszination. Eden läuft zurück auf ihren Balkon und bleibt am Geländer stehen. Sie lehnt sich eine lange Zeit nach vorn, ihre Haare hängen über die Brüstung hinab. Mich bemerkt sie nach wie vor nicht. Ich halte still, warte ab, was sie dort oben treibt. Wir atmen nun beide flach und ich überlege, in jedem Moment einfach »Hallo Eden, wie geht es dir« zu sagen, aber je länger ich damit warte, desto unheimlicher wäre es. Es wäre außerdem seltsam, wenn sie mich jetzt erst hört und dann realisiert, dass ich schon die ganze Zeit hier unten bin - ohne mich auch nur einmal zu regen. Dann würde ich echt creepy herüberkommen. Sollte ich besser so tun, als wäre ich auf dem Stuhl eingeschlafen? Ich schließe die Augen, halte meinen Atem noch flacher und sitze nur da, bis sie weg ist und bis die Demonstranten verschwunden sind. Danach weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen. Also sitze ich weiterhin hier draußen, schweigend und im Dunkeln, bis ich Durst bekomme und deswegen nach drinnen zum Kühlschrank muss.
KAPITEL 3
Drei weitere Tage halte ich es allein in meiner Wohnung aus, nur unterbrochen von gelegentlichen Erledigungen und Streifzügen durch das Internet. Wieder treffe ich dabei zufällig Eden an der Tür, dieses Mal verlassen wir das Haus zeitgleich. Doch wieder hat sie es eilig. Sie komme zu spät zu ihrem Praktikum, ruft sie mir entgegen. Ich musste bloß kurz zur Apotheke.
Wenn sie zurückkommt, sollte ich sie fragen, ob sie mal wieder Bücher tauschen möchte, überlege ich. Wir haben nicht viel gemeinsam, doch die Liebe zum Lesen, auch über Populärwissenschaftliches, vereint uns. Der alte Herr Bachmann aus der untersten Etage rümpft über uns die Nase, als sich unsere Wege kreuzen. Der Grund dafür ist, dass wir unverheiratete, alleinlebende Frauen sind. Das passt ihm nicht. Ich frage mich, ob er weiß, in welchem Jahrhundert wir leben und ich frage mich außerdem, warum er denn keine Frau hat und scheinbar auch nie hatte. Er projiziert heftig. Ob Eden bei ihrem Praktikum etwas über solche Verhaltensweisen lernt?
Am vierten Tag genügen mir die flüchtigen Grüße im Treppenhaus der Mietskaserne nicht mehr. Ich muss nach draußen und etwas erleben.
Der graue Rollkragenpullover mit den Glitzernähten schützt mich. Ansonsten trage ich wieder nur eine wollige Strumpfhose und einen Lederrock. Rote Armbänder bilden den Blickfang meines Looks. Ich trete vor die Tür, mit einer Thermosflasche voller Tee und einem Buch in der Tasche. Wohin nun? An eine der Uferpromenaden? Oder ins Partyviertel, in dem auch tagsüber genug los ist? Oder sollte ich wieder nach oben gehen und mein Zeichenzeug holen und die Passanten skizzieren? Manche freuen sich, wenn man ihnen anschließend das Bild schenkt oder zeigt. Ich erhalte dann ein nettes Lächeln. Oder ein »Wie cool«. Das genügt oft schon, um meinen Tag ein bisschen schöner zu machen.
Als ich noch über diese kleinen Begegnungen nachdenke, sehe ich das schlichte Plakat: Ein Science-Slam findet heute statt. Nur drei Blocks von hier entfernt und er beginnt in einer Stunde. Das hört sich doch gut an.
Ich setze die geliebten Kopfhörer auf, schalte meine Lieblingsplaylist für Draußentage ein und schlendere durch die Gassen. Zwei Katzen und ein Straßenhund kreuzen meinen Weg, genau wie ein paar Ratten. Unter einem blätterlosen, großen Baum auf einer steinernen Bank geht es bunt zu. Drei Drag Queens sitzen darunter und rauchen zusammen. Ob heute eine Show stattfindet? Nicht weit von ihnen hängen Jugendliche auf einer Mauer ab. Sie haben eindeutig etwas anderes in ihre Limonadenflaschen gefüllt als das, was darauf steht.
Ein Jogger will an mir vorbei. Zu spät höre ich ihn und wirble etwas erschrocken herum, als er haarscharf an mir vorbeizieht. Dabei sehe ich, wie sich jemand Bekanntes von mir abwendet und vermeintlich unauffällig eine Pizzeria betritt. Er ist heute etwas anders gekleidet, doch er trägt denselben Mantel und auch die schwarz-grauen Haare sind dieselben, nur zum hohen Pferdeschwanz gebunden. Es ist der Mann mit der Zeitung, der mich am Eingang zur U-Bahn leicht berührt hatte. Erst jetzt komme ich auf die Idee, nachzusehen, ob er mir vor ein paar Tagen etwas in die Tasche geschmuggelt hat. Rausgenommen kann er nichts haben, sie war leer. Ich fühle in die Tasche meiner tannengrünen Herbstjacke hinein. Nein, darin ist nichts. Als ich wieder hochsehe, merke ich, dass sich der Mann einen Platz am Fenster der Pizzeria ausgesucht hat. Natürlich, dort oder an der Theke sitzen meist die Menschen, die allein essen, so wie ich. Sie sitzen dort an den schmalen Tischen, damit sie weniger Platz einnehmen und damit sie eine Beschäftigung haben – ihre Umwelt beobachten. Und damit sie nicht in die Augen der anderen Gäste sehen müssen. Oder damit sie arbeiten oder lesen können an den erhöhten Tischflächen. Was man eben allein in einem Restaurant macht.
Ich überlege kurz, mir dort etwas To-Go zu holen, nur um einen längeren Blick auf den Mann werfen zu können. Aber der Slam beginnt bald und ich möchte das wirklich hören. Ich liebe wissenschaftliche Vorträge, wenn sie nicht nur mathematisch und trocken sind, und ich führe gerne kleine Fachgespräche danach. Ein bisschen Socializing ohne echte Nähe. Es geht nur um die Sache, nicht um uns. Also lasse ich den Unbekannten weiterhin unbekannt sein und sein Essen genießen. Ob sein Blick mir folgt, sehe ich nicht.
Das Nebengebäude der Uni, ein Altbau, wirkt einladend. Es sticht zwischen den Giganten aus Glas und Beton hervor, obwohl es so viel niedriger ist. Menschen wie aus einem Dark-Academia-Buch strömen von allen Seiten durch das gusseiserne Tor in einen kleinen, gut beheizten Saal. Dazwischen hat sich der ein oder andere moderne Nerd gedrängt. Ich als Schnittmenge zwischen beiden Gruppen verschwinde komplett in der Masse. Etwa hundert Menschen passen in den Saal, dann schließen die Pforten. Ich habe es noch geschafft, dränge mich auf einen Holzstuhl mit einem Kissen, neben eine Frau im mittleren Alter. Sie erwähnt etwas darüber, dass ihr Sohn hier auftreten würde als einer der Slam-Teilnehmer. Ich sähe übrigens aus wie eine alte Freundin von ihm. Das mache sie ganz rührselig und sowieso sei sie so aufgeregt.
Viele andere wären von dieser Frau genervt. Ich nehme ihre Herzlichkeit und Wärme gerne entgegen und erfahre sogar ein wenig über diese alte Freundin. Ich bin es eindeutig nicht, und doch habe ich den Eindruck, kurz in ein anderes Leben einzutauchen. Diese alte Schulkameradin ihres Sohnes hätte den klassischen Weg eingeschlagen: mit Mann, Hund, Kind und Haus in den Bergen.
Der Moderator des Abends heißt uns willkommen. Ich lege endlich meine Jacke ab. Man sieht trotzdem nichts Verdächtiges an mir. Die vielen, eng beisammensitzenden Menschen heizen den Raum auf. Selbst das Holz an den Wänden ist gemütlich. Es geht los. Der erste Vortrag beginnt, vorgetragen vom ältesten Teilnehmer, einem Doktor der Chemie. Er erzählt uns etwas über drogenartige Wirkungen in vermeintlichen Alltagssubstanzen. Böser Kaffee, furchtbarer Alkohol sowieso und dann immer dieser Hustensaft … Wir schmunzeln und lernen etwas. Die Dame neben mir gibt zu, dass sie ihren Tee nicht ohne haufenweise Zucker trinken kann. Wir lachen kurz darüber. Der nächste Vortrag beginnt, dieser wird von einer jungen Studentin gehalten. Sie hat sich das Thema der Sprachwissenschaften ausgesucht und macht all den Incels klar, dass Sprache sich schon immer verändert hat und dass auch sie Pronomen haben. Verhaltenes, wissendes Lachen ertönt im Raum. Ein paar Menschen raunen.
Meine neue Bekanntschaft gibt zu, dass sie das mit den neuen Pronomen zwar aber noch nicht verstehe, aber sie wolle sich nicht gegen Fortschritt wehren. Ich freue mich über ihre Ehrlichkeit und ihren entspannten Umgang mit dem Thema. Wir lauschen nun ihrem Sohn, der die Psychologie von Tieren näher beleuchtet und uns mit Witz und Comiczeichnungen erklärt, dass auch Haustiere an Depressionen leiden können. Ich klatsche besonders begeistert, meiner neuen Freundin zuliebe. Gegen Ende des Abends stellen wir uns gegenseitig mit Namen vor. Sie heißt Cecilia. Ich sage ihr, dass ich Skye heiße. Man schüttelt sich die Hand. Sie ist erschrocken darüber, wie kalt meine ist, trotz der Hitze im Raum. Ich winke es ab, sage schnell, dass das immer so bei mir wäre, was nicht gelogen ist. Sie sagt, vielleicht sähe man sich mal wieder hier. Ich nicke. Ausgeschlossen ist es nicht, es hat mir gefallen.
»Willst du noch Tim kennenlernen?«, erkundigt sie sich schließlich.
Mit einem Nicken stimme ich zu.
Ich komme kurz mit, grüße ihren Sohn und spreche mit ihm darüber, dass ich auf alle möglichen Tiere meiner Kunden aufpasse. Einige von denen hätten bestimmt mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen, stellen wir amüsiert fest. Tim zeigt mir Fotos von seinem Hund und berät mich ein wenig darin, mit welchem Futter und welchen Spielen man Hunde bei bester Laune hält. Ich danke ihm, sage, dass ich es an die nächsten interessierten Kunden weitergebe und entschuldige mich dann.
Tim sucht zu viel körperliche Nähe und generell wird es mir zu eng in dem Raum. Warum gehen die nicht alle nach Hause, warum stehen sie noch hier, so lange nach Ende des Programms?
»Tschüss, Skye! Es war schön, dich kennenzulernen«, rufen mir Cecilia und Tim hinterher, als ich endlich durch die Tür nach draußen trete.
In der Zwischenzeit ist es dunkel geworden, der Herbst ist heute gnadenlos mit seiner Sonnenlosigkeit. Bleibe ich draußen oder suche ich mir den nächsten Innenraum? Ich hole mir in einem grell beleuchteten Supermarkt schnell ein Sandwich und ein paar gegrillte Heuschrecken. Igitt, würden viele sagen, aber für mich sind sie Gold wert. Ich bringe es moralisch nur selten über mich, Fleisch zu essen und doch braucht etwas in meinem Körper ständig tierische Eiweiße. Also freue ich mich darüber, dass der Verkauf von Insekten als Nahrungsmittel erlaubt wurde. Heuschrecken haben keine besten Freunde, oder? Sie können auch keine Depression bekommen. Ich sollte zu Tim zurückgehen und ihn fragen.
Ich stehe mit meinem Essen brav am Straßenrand, beobachte die Menschen und sehe erste Freundesgruppen und Paare, die sich zum Feiern aufmachen. Hohe Schuhe, viel zu dünne Kleidung für die Jahreszeit, Haarspray und Glitzer-Make-up im gesamten Gesicht. Ich sehe Sneakers, deren Sohlen im Dunkeln leuchten und so viele Netzstrumpfhosen und Handschuhe, Pelzmäntel und Kunstleder, dass mir schwindelig wird. Eine Gruppe von College Girls amüsiert sich besonders gut. Sie sind laut, sie sehen strahlend aus und eine von ihnen schaut mich direkt an. Es bildet sich sofort eine Verbindung. Ihr Blick scheint zu sagen: »Ich verstehe dich. Ich tue dir nichts. Willst du herkommen?«
Ich hocke in meinem imaginären Terrarium und starre zurück, kann ihrem netten Blick nicht ausweichen. Sie sieht meinen Thermobecher in der Hand, holt ihren Wein im Pappkarton aus der Tasche und fragt, ob sie mir was eingießen soll. »Siehst aus, als könntest du das gebrauchen«, meint sie mit einem Ausdruck, als würde sie zwinkern. Was sie aber nicht macht, denn das hier ist kein Cartoon.
Ich lächle, zucke mit den Schultern und lasse mich mitziehen. Ich muss ihnen ja nicht zu nahe kommen, und mein Outfit unter der Jacke ist wirklich sicher. Das rede ich mir ein, während ich ständig hoffe, dass mir niemand an die Schultern greift. Sei es versehentlich oder absichtlich, um Körpernähe herzustellen. Mein Nacken zieht sich zusammen, aber auch ich reiße mich zusammen. Es heißt, man solle regelmäßig die eigene Komfortzone überschreiten. Die College Girls geben mir etwas von ihrem Glitzer ab und von ihrem Duftspray für die Haare. Schon gehöre ich dazu, ohne dass viele Worte gesprochen wurden. Sie nehmen mich in den Arm, tanzen um mich herum. Ich glaube, sie merken nicht, dass ich anders bin. Es ist, wie wenn man Mädels auf der Clubtoilette begegnet, nur in diesem Fall vor der Tür. Alle gehören sofort zusammen. Dieses Phänomen habe ich zu 90% durch Memes kennengelernt. Einmal ist es mir bisher im echten Leben passiert.
Ich streiche mir die Haare aus der Stirn und lasse mich treiben, von ihrer Freude anstecken. Diejenige, die mich dazugeholt hat, stellt sich als Asra vor. Sie streckt sich und jubelt mir ins Ohr, dass sie heute die Ergebnisse für eine Prüfung erhalten und alle bestanden hätten. Deswegen gäbe es was zu feiern. Noch während sie das sagt, schenkt sie mir mehr von dem sauren Weißwein nach, der auch Essig sein könnte.
Der Becher muss draußen bleiben, aber das ist mir egal. Ich kann ihn an der Garderobe abgeben. Drinnen umfängt mich warme, laute Dunkelheit. Die Mädels warten keine Sekunde, sie stürzen sofort den Beats entgegen. Ich laufe langsamer hinterher. Asra kann unfassbar gut tanzen. Sie bevorzugt eine Mischung aus Hip-Hop, klassischem Ballett und Freestyle. Ihre Schultern sind beim Tanzen frei. Ich starre auf ihre, wünsche mir, meine könnten genauso frei sein. Asra nicht, doch ihre beste Freundin zeigt viel Dekolleté. Auch das kann ich nicht. Es wird warm in meinem Pullover. Ich habe den Vorwand, dass Glitzerfäden eingewebt sind. So fragt niemand, warum ich ihn nicht ausziehe. Er passt in die Disco und mein Rock und die roten Armbänder sowieso. Ich bin für alles vorbereitet. Obwohl es hier so dunkel und voller Strobo ist, dass man ohnehin nicht viel erkennen würde. In der Dunkelheit bin ich freier als sonst.
Jemand tanzt mich von hinten an und ich zucke zusammen. Wie gerne würde ich mich sorglos fallen lassen. Doch es geht nicht. Er darf nichts Falsches wollen, er darf nichts Falsches wollen! Was, wenn er … besser gar nichts erst daran denken.
Schnell drehe ich mich um, um wenigstens einen kurzen Blick zu erhaschen. Beim nächsten Beat geht mein Blick zurück nach unten, vor mir auf den Boden. Der Mann hinter mir ist jung, viel jünger als ich. Er scheint vom gleichen College zu kommen wie die Mädels, denn sie haben ihn herzlich begrüßt und in unserer Runde willkommen geheißen. Andererseits muss das nicht viel heißen.
Außerdem ist er ganz in Schwarz-Weiß gekleidet, sogar seine Haare sind zweigeteilt in Schwarz und Weiß. Ich drehe mich wieder um, betrachte sein Haar kurz, lächle ihn an. Wie dumm von mir. Doch ich liebe seinen Style und muss es ihm irgendwie zeigen. Er kann fast genauso gut tanzen wie Asra. Das liebe ich noch mehr und hasse es zugleich, weil ich so was nicht denken sollte. Er scheint an älteren Frauen interessiert zu sein, uns trennen bestimmt zehn Jahre. Ich weiß allerdings nicht, was ich davon halten soll. Generell bin ich sehr ratlos in dieser Gesamtsituation, und ironischerweise komme ich mir viel jünger vor als er.
Keiner hier weiß, dass ich Jungfrau bin und sich das vermutlich nie ändern wird.
Ich sollte längst gehen, doch die Musik und diese verlockende, potenzielle Verbindung zu anderen Menschen halten mich fest. Weil ich den Jungen sympathisch finde – und anscheinend gerade Lust darauf habe, mich dumm zu verhalten - stelle ich ihm eine Frage. Natürlich muss ich ihn fast anschreien, weil wir mitten auf der Tanzfläche sind. Ich erfahre, dass er Matthew heißt und Musik macht. Meist elektronische, die er selbst komponiert. Manchmal spiele er außerdem Bass in einer Band.
Matthew erfährt von mir, in welchem Viertel ich lebe und seit wann, und dass ich gern zeichne. Von dem Science-Slam erzähle ich auch.
Mehr will ich nicht sagen, es war schon zu viel, und das brauchen wir auch nicht.
Matthew gibt mir unerwartet einen Kuss auf die Wange.
Ich erstarre. Nein. Skye, bist du lebensmüde? Er lehnt sich daraufhin dankbar an meine kalte Haut, weil die Luft im Club schweißtreibend ist. Die Berührung löst etwas aus: Endlich erinnert sich mein verblödetes Gehirn wieder an das, was falsch bei mir ist, und jegliche emotionale Reaktion auf ihn und seinen Körper löst sich in Luft auf.
Gut so. Die Panik hatte sich schon breit gemacht, hatte unter der Oberfläche gebrodelt.
Zum Glück wird Matthew müde und betrunken, weswegen er sich in eine ruhige Ecke setzen will. Von da aus sehen wir den anderen nur noch beim Tanzen zu. Das ist besser so, viel besser. Ich halte einen gesunden Abstand von ihm. Die Hypnose der Musik macht dabei auch mich schläfrig. In manchen Nächten ist es frustrierend, ich zu sein.
Nach einer Weile entschuldige ich mich, sage, ich müsse mal auf Toilette. Dort gehe ich auch hin, doch sofort danach verlasse ich den Club. Becher und Jacke werden noch kurz eingesammelt, dann bin ich weg.
Die Erinnerung an Matthew nehme ich ebenfalls mit nach Hause. Nur könnte ich den realen Matthew niemals mitnehmen. Das Feuer … es hat Momente, in denen ich es nicht mehr regulieren kann und deswegen war dieser ganze Ausflug bereits ein Fehler.
Zuhause, wenn die Balkontür geschlossen ist, kann ich im Tanktop herumlaufen. Am Morgen nach der spontanen Party fallen mir die losen, schmalen Träger seitlich von den Schultern. Mein Rundhalsausschnitt ist tief, der Stoff leicht, meine Haut kann atmen. Genau wie ich.
Die gestrige Nacht hat sich bereits in Schall und Rauch aufgelöst. Ich vermisse nichts mehr. Mein Körper hat diesen ganzen Mist so lange unterdrückt, dass er kaum noch da ist.
Ich schalte mein Tablet ein und scrolle durch unsere Foren, unter meiner Infrarotlampe sitzend.
Kaiwen hat irgendwas über angeblich noch lebende berühmte Persönlichkeiten herausgekramt. Unsere Dritte im Bunde, @rinaxx, freut sich sehr über diese neuen Infos. Vieles davon sind bloß Sichtungen auf viel zu verpixelten Bildern. Das könnte jeder sein, doch allein die Möglichkeit, dass es die bekannte Persönlichkeit ist, macht die Fotos spannend. Dazwischen streut @planet_morphine vermeintliche Beweise für Zeitreisende. Die Fotos, die sie teilt, sind genauso unscharf. Es sind vermutlich bloß Menschen, die mit ihrem Style ihrer Zeit so weit voraus waren, dass man sie für Rückkehrer aus der Zukunft hält. Manche der mysteriösen Personen tragen Gegenstände mit sich herum, die man als ein Smartphone deuten könnte, aber auf alten, sepiagetönten Fotografien. Auch Gemälde von der Antike bis zur Klassik weisen ungewöhnliche Gegenstände auf, manche zeigen zum Beispiel Ufos. Kaiwen, Riri und ich kennen diese Bilder fast alle. Die fliegenden Objekte wirken so deplatziert, dass es verdächtig ist.
Andererseits: Wenn man in der Zukunft unsere heutigen Kunstwerke sehen würde und alles darauf Abgebildete für real halten würde, … dann … dann wäre ich in ihren Augen ein normaler Teil unserer Epoche.
Wer weiß schon, was real ist oder irgendwann mal war und was nicht?
Minutenlang starre ich auf dieselben kleinen Bildausschnitte und frage mich, was das Gezeigte in Wirklichkeit sein könnte. Wenn das unbekannte Flugobjekt dort am oberen Bildrand erfunden ist, warum ist dann alles andere auf dem Bild realistisch? Ist es nun Retro-Fantastik oder nicht? Die Zeit vergeht, ohne dass ich zu Ergebnissen gelange.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich nur noch drei Stunden habe, bis ich zu meiner nächsten Auftraggeberin aufbrechen muss. Sie verbringt eine Woche bei ihrer Familie und hat ein ganzes Zimmer voller Reptilien, Amphibien und Fische, um die sich in der Zwischenzeit jemand kümmern muss. Haus(Tier)Sitterin Skye Alana Miller ist zu Diensten.
Der Auftragsort ist diesmal nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Ich werde also nicht dort schlafen müssen, sondern es genügt, ein oder zwei Mal am Tag Besuche zu machen.
Frau Leblanc, die Kundin, ist jung und eine Outdoor-Abenteurerin. Entsprechend kleide ich mich. Sympathien und Vertrauen beim Gegenüber zu wecken, ist essenziell bei diesem Job. Erst recht, wenn man nicht die kontaktfreudigste Person der Welt ist. Grüne Cargohose, ein Oberteil aus Merinowolle, das wertvollste in meinem Schrank, und Wanderstiefel, abgerundet mit dem braunen Parker sind meine Wahl. In diesem Outfit breche ich auf. Sollte sie fragen, warum ich so aufkreuze, nehme ich das Wetter als Vorwand. Dicke Schleier aus Regen schieben sich über den Himmel. Ich habe das Wetter immer im Blick.
Die kleinen Salamander und Schildkröten sind längst gefüttert. Am meisten angetan haben es mir die Smaragdeidechsen. Morgen will ich ihnen bessere Leckereien mitbringen. Ich freue mich mehr auf den nächsten Besuch im Haus von Frau Leblanc als bei anderen Aufträgen. Wie die Kleinen über meine Arme geklettert sind, hat etwas in mir ausgelöst. Ist es Vertraulichkeit? Ich weiß, dass man als Mensch manchmal Reptilien zu sich locken kann aufgrund der eigenen Körperwärme. Davon kann ich ihnen aber nicht allzu viel bieten. Und doch war meines wohl wärmer als ihr Blut, denn sie kletterten neugierig und mutig auf meine Hand. Ihre kleinen Füße hinterließen ein sanftes Kitzeln. Oder suchten sie aus einem anderen Grund meine Nähe?
Ich denke an ihre süßen, sich schnell bewegenden Zungen und das vorsichtige Riechen an meiner Hand, als ich meinen Einsatz für heute Nacht entdecke.
Er kauert in einer Ecke zwischen einer verlassenen Pommesbude und einer Bushaltestelle. Sein Zittern sehe ich bis hierhin, die dreckige Mütze fällt ihm fast vom Kopf. Der Regen hat nachgelassen, doch die Feuchtigkeit zieht uns allen in die Knochen. Ich bin noch in meine beste Wollkleidung gehüllt und er sitzt in löchrigem Polyester da, dem Tod näher als dem Leben.
Ich kann dem Bild nicht gerecht werden, das man in der Popkultur von Individuen wie mir hat. Meine Kräfte sind nicht für den Kampf ausgelegt. Nach zwei ‚Attacken‘ geht mir der Saft aus und ich muss lange regenerieren. Bis dahin hätte mich jeder Bösewicht gekillt. Aber ich kann mit diesen zwei Atemzügen viel benötigte Wärme geben. Und damit gebe ich gleichzeitig auch mir etwas Wärme, Sinn im Leben und Verbundenheit zu anderen allein umherstreunenden Seelen.
Auf Zehenspitzen schleiche ich mich an den schlafenden Mann heran. Wenn sie merken, auf welche Weise sie gewärmt werden, flippen sie aus. Deswegen ist Lautlosigkeit das oberste Gebot. Ich gehe neben ihm in die Hocke. Jede Bewegung ist kontrolliert. Der erste, leicht dosierte Feuerodem taut den Obdachlosen vorsichtig auf. Ich erkenne direkt, wie sich seine Gesichtszüge und die verkrampften Arme entspannen. Als Nächstes sammle ich brennbaren Müll, umgebe ihn mit herumliegenden Ziegelsteinen und Metallresten und bereite dem Mann damit ein Lagerfeuer. Ein zweiter, kräftigerer Atemstoß und es knistert und brennt. Der Schlafende wird wach. Er öffnet die Augen, sieht das Feuer. Im ersten Moment zuckt er zusammen, sein Blick ist dabei voller Angst. Dann lächelt er und schließt die Augen wieder, mit einem Ausdruck des Friedens. Mich hat er nicht bemerkt. Ich kauere hinter einer Tonne, die als Stehtisch umfunktioniert wurde.
Nachdem die Hitze aus mir verschwunden ist, macht sich die eisige Kälte breit. Meine Hände und Füße werden steif. Jetzt muss ich rennen, schnell nach Hause kommen, sonst bleibe ich reglos liegen. Es ist jedes Mal gefährlich – ein Spiel mit dem wortwörtlichen Feuer – doch das ist es mir wert. Ich raffe mich auf und humpele los, ein verliebtes Paar zieht an mir vorüber. Sie ist bei ihm untergehakt, springt durch die dreckige, feuchte Nacht, als wäre es ein Frühlingsmorgen. Während ich ihnen nachblicke, wie eine Statue, die nur gespenstisch leicht den Kopf dreht, bemerke ich einen Schatten. Er ist weit weg, auf der Fußgängerüberführung. Sie führt um die Hochhausschluchten herum und quer über den Marktplatz, auf dem ich mich befinde. Es ist nur ein Mensch, der des Nachts spazieren geht. Ich würde ihm keine Beachtung schenken, wenn die Größe, Statur, der lange, weit oben auf dem Kopf ansetzende Pferdeschwanz und der noch längere wehende Mantel nicht so unverkennbar wären.
»Du bist nicht so gut, wie du glaubst«, denke ich halblaut. Ich blicke geradewegs zu ihm hoch. Er läuft weiter, beachtet mich nicht. Sieht er mich? Registriert er meine Bewegung im Seitenwinkel seines Sichtfeldes? Seine Schritte werden schneller. Jetzt höre ich das Pochen seiner schweren Stiefel. Klick, klack, klock. Er hat den Mantel geschlossen, eng um sich gehüllt, um das Wehen im Wind zu vermeiden. Keine Chance, mein Lieber, ich habe dich erkannt.
Ich weiß, dass du mir folgst.
Ich renne los, sprinte zur nächsten Treppe, die nach oben führt auf die Brücke. Die Taubheit in meinen Füßen ignoriere ich gekonnt, gerate immer wieder ins Wanken, renne aber weiter. Zum Glück wissen meine Beine, wohin sie mich tragen müssen. Ich kenne diese Stadt wie meine Westentasche, so groß und gnadenlos sie auch ist. Ich bin eine streunende Katze im Körper eines menschlichen Drachen. Du wirst mir nicht entwichen. Nicht hier!