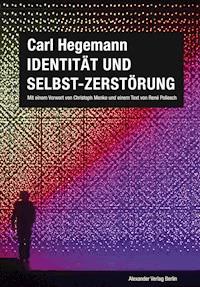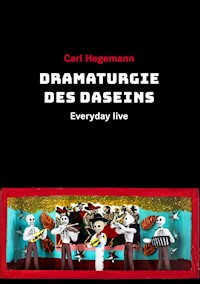
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch versammelt Texte, die der Philosoph und Dramaturg Carl Hegemann in den letzten fünfzehn Jahren geschrieben hat. Carl Hegemann über das Glück der Tragödie. Romantische, käufliche und revolutionäre Liebe. Fluchtbewegungen in Familie, Kunst und Staat. Allmacht, Nichtstun und ewige Ruhe. Leben im Selbstwiderspruch. Organisation und Desorganisation von Erfahrung. Adornos Geheimnis. Brechts Theaterrevolution. Schillers amoralische Anstalt. Fake-Strategien. Kunst in Gefahr. Das Männliche ist das Vergängliche. Das Elend der Unsterblichkeit. Der Übergriff als Kunst und Wirklichkeit u.v.a.m. Mit Referenztexten von Frank Castorf, Diedrich Diederichsen, Boris Groys, Christoph Menke, René Pollesch, Christoph Schlingensief und 25 Bildern und Zeichnungen von Ida Müller und Vegard Vinge. Herausgegeben und mit einer Einleitung von Raban Witt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Carl Hegemann, geb. 1949 in Paderborn, studierte 1969–1978 Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaften in Frankfurt am Main. Nach der Promotion unterrichtete er dort zehn Jahre Philosophie und Soziologie. 2004/2005 war er Gastprofessor an der HdK Karlsruhe und 2006–2014 Professor für Dramaturgie an der HMT »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig. Seit 1979 arbeitet Hegemann an zahlreichen Theatern und Opernhäusern, darunter das Tübinger Zimmertheater, das Burgtheater Wien, die Bayreuther Festspiele, die Schauspielhäuser in Freiburg, Bochum, Köln, Zürich und Hamburg, die Staatsopern in Berlin und Hamburg sowie das Opernhaus in Manaus, Brasilien. Nach dem Tod von Heiner Müller war er 1996–1998 Ko-Intendant am Berliner Ensemble. An der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin unter der Leitung von Frank Castorf war er zwischen 1992 und 2017 insgesamt 15 Jahre engagiert, zuletzt 2015–2017 als Chefdramaturg. Dort entstanden auch prägende Arbeitszusammenhänge mit Christoph Schlingensief, René Pollesch, Herbert Fritsch und Bert Neumann. Hegemann unterrichtet u. a. an den Kunstuniversitäten in Wien und Berlin. Zuletzt arbeitete er mit Frank Castorf, Jette Steckel und Christoph Marthaler. 2018 gründete er die dramaturgische Beratungsagentur »Everyday live« (www.everydaylive.de).
Raban Witt, geb. 1988 in Leipzig, studierte Politikwissenschaft in Wien, Philosophie in Oldenburg und Dramaturgie in Hamburg. Nach dem Studium Arbeiten als Teil des Regie-Duos Kaufmann/Witt, als »embedded author« bei Inszenierungen von Dor Aloni, als Produktionsdramaturg sowie als Lehrbeauftragter für Philosophie. 2017 gehörte er in der letzten Spielzeit der Intendanz Castorf zur Dramaturgie der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er Dramaturg am Theater Oberhausen. Mit Carl Hegemann hat er bereits an mehreren Büchern gearbeitet: Wie man ein Arschloch wird. Kapitalismus und Kolonisierung, Identität und Selbst-Zerstörung und (als Mitherausgeber) Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 1992–2017. Ein Fotoalbum, alle erschienen im Alexander Verlag Berlin.
Carl Hegemann
DRAMATURGIEDES DASEINS
Everyday live
Herausgegeben von Raban Witt
Für Bonn Park, Vanessa Unzalu Troya, Jette Steckel,Jürgen Kruse und Siegfried Bühr.
© by Alexander Verlag Berlin 2021
Alexander Wewerka, Postfach 19 18 24, 14008 Berlin
[email protected] | www.alexander-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung,
auch der auszugsweisen, nur mit Genehmigung des Verlags.
© für die Abbildungen bei den Urhebern.
© für die Texte von Frank Castorf, Diedrich Diederichsen, Christoph Menke und Christoph Schlingensief bei den Autoren.
Redaktion/Lektorat: Marilena Savino
Satz und Layout: Antje Wewerka
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Umschlagabbildung: »Retablo de día de los muertos« aus einem
Souvenirladen in Mexiko, Foto: Sandra Then
eISBN 978-3-89581-573-7 (eBook)
Inhalt
Einleitung
Von Raban Witt
B-Seite des Lebens
Vorwort für die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten
I. WIE DEN TAG ÜBERSTEHEN?
Glücklich im Unglück
Paradoxien des Genießens
Ich wünsche nur, was ich bereits besitze
Romantische Liebe überleben
Lie to me, I promise I’ll believe
Kann man echte Liebe kaufen?
Flucht in die Familie
Die Keimzelle des Staates gebiert Ungeheuer
Flucht in die Kunst
oder: Der ideale Staat
Anhang: Flucht in den Baumstamm
Zurück zur Allmacht
Die schönste Zeit im Leben
Nichts tun
Zur Metaphysik der Zeitverschwendung
Das Dunkel, das uns blendet
Sind wir Weltraumschrott?
Krieg der Viren
Zusammenfall von Mythos und Geschichte bei Heiner Müller (Kommentar zum Germania 3-Schaubild)
Living in a Ghost Town
Telefongespräch Berlin-New York mit Boris Groys, April
II. WAS GEHT HIER EIGENTLICH VOR?
Leben als Selbstwiderspruch
Hölderlin formuliert den Höhe- und Endpunkt der Philosophie und streicht ihn durch
Erving Goffmans Rahmen-Suppe
Organisation und Desorganisation von Erfahrung
Index zu Erving Goffmans Rahmen-Analyse
Von Michael Gmaj
Vergesst Marx
Einführung in den historischen Materialismus
Schock des Offenen
Das Geheimnis der Negativen Dialektik
Spaß haben, die Welt retten und dabei Geld verdienen
Brechts Theaterrevolution
Nicht Realismus, sondern Realität
Von Frank Castorf
HeART of the City
Bausteine für eine Dramaturgie der Gegenwart
Anhang: Dramaturgie ist der Tod der Autonomie. Von Christoph Schlingensief
Digitale Geschlechtsumwandlung ist toll, reicht aber nicht
Schaubühne als amoralische Anstalt
und Friedrich Schiller als Marketingstratege
So hast du stets dein Spiel mit uns getrieben
Alle Menschen werden Spieler I
Das Können des Nichtkönnens
Die Kunst des Bäckers und die Kunst des Künstlers
Doing Things with Words
Alle Menschen werden Spieler II
Darf man auf der Bühne lügen?
Die Deutsche Bank sucht Dramaturg*innen
Schreiende Laien
Die Süddeutsche Zeitung hat den Blues
Die Liebe zur Geheimagentin
Gespräch mit René Pollesch
Only Tragedies can make me happy
Der amerikanische Traum von der Tragödie
Von Afrika lernen
Parenté à plaisanterie – Wie man sich in Burkina Faso beschimpft
Die Volksbühne der Republik
Theater als Selbstwiderspruch
Kunst und Gefahr
Warum Christoph Schlingensiefs Aktionskunst heute wahrscheinlich keine Chance mehr hätte
III. ERLÖSUNG IST MÖGLICH …
Die Schrecken der Unsterblichkeit
Der fliegende Holländer in Manaus
Confidence Games
Die Johanna-Passion von Walter Braunfels
Ein Dichter unter den 36 Gerechten
Wie Botho Strauß sich beinah verplapperte
Schade, dass ich nicht der Teufel bin, sondern Henry Hübchen
Everyday live
Dasein des Dramaturgen
Von Vegard Vinge
Blick aus dem Jenseits – Mea Culpa
Christoph Schlingensiefs Readymade-Oper am Burgtheater Wien
Mea Culpa. Eine Readymade-Oper
Handlung
Ohne dich kann ich nicht sein
Tannhäuser zwischen Rausch und Traum
Mit dir bin ich auch allein
Der Tannhäuser-Konflikt (Kommentar zum Schaubild)
Anhang: Experiment und Institution. Von Christoph Menke
Ohne Dunkelheit sind wir blind
Die Zauberflöte und das schwarze Herz der Revolution
Das Männliche ist das Vergängliche
Übergang zur Eingeschlechtlichkeit
Fort-Schritt
Die ewige Raststätte
No Service
Gegen die Konsenskultur (Volksbühne 2015/16)
Theater der Apokalypse
Den Leuten nur sagen, was sie schon wissen
Wenn Gott tot ist, darf VW Abgaswerte manipulieren
Anhang: Den Westen ficken
Erobert euer Grab
IV. … ABER NICHT FÜR UNS
Es gibt kein Leben außerhalb meiner Produkte
Gespräch mit Corinne Orlowski über Einar Schleef
S.M.A.S.H. – In Hilfe ersticken
Christoph Schlingensiefs Operndorf-Apokalypse (abgesagt am 1. Juli 2010)
Tod eines Weltstars
Warum Schlingensiefs letzter Film nicht zustande kam und dennoch vorhanden ist
Der Mann, der nicht lügen konnte
Nachruf auf Christoph Schlingensief
Germania – Egomania
Kunst und Nicht-Kunst bei Christoph Schlingensief
Menschenfreund und Wundertäter
Antrag auf Heiligsprechung des katholischen Künstlers C. S.
Wehrlos durchs Leben
Nachruf auf Maria Kwiatkowsky
Nadryw
Nachruf auf Bert Neumann
Der Übergriff als Kunst und Wirklichkeit
Nachruf auf Volker Spengler
ANHANG:DIE NATÜRLICHE ÜBERLEGENHEIT VIERTEILIGER MODELLE
Vier Voraussetzungen jeden Daseyns
Von Friedrich Hölderlin
Vier Dinge braucht die Kunst
Vier Dinge braucht der Mensch
Die Ordnung der Getränke
Von Diedrich Diederichsen
Verzeichnis der Leitmotive
Namenregister
Texte
Bilder
Dank
Einleitung
Von Raban Witt
Um was handelt es sich hier? Um eine philosophische Abhandlung, ein Handbuch für die Theaterpraxis oder einen Ratgeber fürs alltägliche Leben? Dieses Buch ist nichts davon und doch all das zusammen. Carl Hegemanns Denken ist keine graue Theorie, sondern immer auf gelebte Wirklichkeit bezogen, er hält sich an Salomon Maimons Devise »Ich denke von meinen täglichen Verrichtungen her«. Seine Analyse ergibt, dass auch das Theater vom Leben nicht zu trennen ist, weil beide dieselbe Grundlage haben: die Spannung, den Konflikt, das Drama. Und so finden hier Theater und Leben und Theorie durch eine »heilige Kollision« (Wolfram Lotz) zusammen zu einer Dramaturgie des Daseins.
Das Buch versammelt im Wesentlichen Texte, die Carl Hegemann in den letzten fünfzehn Jahren geschrieben hat. Davon werden viele hier zum ersten Mal veröffentlicht (etwa die zentralen theoretischen Grundlagentexte über Hölderlin, Goffman, Marx und Brecht), andere sind vorher schon verstreut in Sammelbänden, Theatermagazinen oder Zeitungsfeuilletons erschienen. Obwohl die einzelnen Beiträge allesamt Gelegenheitsarbeiten sind, aus verschiedenen Anlässen entstanden und mit unterschiedlichen Intentionen verfasst, haben sie sich doch zu einem kohärenten Text zusammenfügen lassen, den man gut von vorn nach hinten lesen kann. Will man ihn sich trotzdem lieber sprunghaft erschließen, kann neben dem Inhaltsverzeichnis das Namensregister helfen, direkt zu den Materialien und Themen zu finden, die einen gerade am meisten interessieren. Als zusätzliche Orientierung haben wir im Verzeichnis der Leitmotive Zitate und Denkfiguren versammelt, die in vielen Texten vorkommen und dort von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden.
Diese Veröffentlichung hat zwei sehr unterschiedliche Vorläufer. Zum einen das Plädoyer für die unglückliche Liebe, ein chronologisch geordneter Sammelband mit Hegemann-Texten von 1980 bis 2005. Zum anderen die Dissertation Identität und Selbst-Zerstörung, die schon 1982 erschienen ist und 2017 wiederveröffentlicht wurde.1 Was er hier als junger Philosoph vor über vierzig Jahren entwickelt hat, ist in seiner Theaterreflexion und -praxis bis heute überall zu finden.
Eine zentrale Pointe lautet: Wir können uns nur selbst bestimmen, wenn wir von außen bestimmt sind. Determiniertheit ist die Voraussetzung von Freiheit wie umgekehrt Freiheit die Voraussetzung der spezifisch menschlichen Form von Determination ist. »Nur der spannungsvolle und spannende Prozess zwischen beiden Extremen, zwischen bestimmendem, tätigem Ich und determinierendem, das Ich jenseits seines bewussten Wollens prägendem Nicht-Ich ermöglicht lebendiges Leben.«2
Dieser Zusammenhang zwischen Ich und Welt wird in der kapitalistischen Gesellschaft zerrissen: Was das Subjekt wesentlich ausmacht, seine Tätigkeit, kann von ihm nicht mehr als etwas erfahren werden, das zu ihm gehört. Diesen Vorgang hat zwar schon Karl Marx beschrieben (er nannte ihn »Entfremdung«), aber ihn ausschließlich mit einer objektiven Analyse des Kapitalismus verbunden. Marx zeigt, wie die Art, in der in der bestehenden Gesellschaft Reichtum vermehrt wird, »zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.«3 Hegemann analysiert darüber hinaus in seiner Doktorarbeit, wie der Kapitalismus »neben der Untergrabung der objektiven Bedingungen jeder gesellschaftlichen Reproduktion auch die subjektiven Voraussetzungen für die gelingende Identitätsbildung der Menschen gefährden und zerstören« kann.
Die Reflexion über diese objektiv und subjektiv zerstörerischen Potenzen des Kapitalismus gehört auch zur Dramaturgie des Daseins. Weil das vielleicht nicht immer offenkundig ist, sei der Hinweis erlaubt: Dieses Buch handelt nicht nur von den Facetten des Dramas, die das Leben und das Theater in allen Gesellschaftsformen bestimmen, sondern immer auch von dieser konkreten Gesellschaft, also von der vermeidbaren »ganzen Scheiße« (Marx), die uns daran hindert, in sinnvoller Weise mit unseren unvermeidbaren Widersprüchen umzugehen.
Ein solch unvermeidbarer Widerspruch erwächst aus dem Problem der Sterblichkeit, das Anfangs- und Endpunkt der Dramaturgie des Daseins ist. Am Tod, als letzter Grenze, scheitern irgendwann all unsere Bemühungen. Deshalb ist alles, was wir versuchen, am Ende vergeblich. Dass unsere Leben endlich sind, heißt aber auch, dass jeder Moment einmalig ist, nicht wiederholbar, unwiederbringlich. Deshalb hat alles, was wir tun oder lassen, eine Konsequenz und daher eine Bedeutung. Aus dem Umstand, dass wir sterben müssen, können wir also zwei vollkommen gegensätzliche Schlüsse ziehen: entweder ist alles sinnvoll oder alles ist sinnlos. Und daraus folgen zwei ebenso gegensätzliche Regeln für unsere Lebenspraxis: »Nutze den Tag!« oder »Verschwende deine Zeit!«
Im Kapitalismus ist, zumindest für die meisten Menschen, beides unmöglich. Wir können den Tag nicht nutzen, weil ein Großteil unserer Lebenszeit für einen sinnlosen Zweck draufgeht, der nichts mit uns zu tun hat: aus Geld mehr Geld zu machen, um noch mehr Geld zu machen und so weiter, in einer end- und sinnlosen tautologischen Bewegung, bei Strafe des Untergangs. Und wir können auch nicht unsere Zeit verschwenden, weil unterm Kapital die Befriedigung noch der persönlichsten Bedürfnisse, und sei es in Form grenzüberschreitender Exzesse, zum Mittel verkümmert, montags wieder arbeiten zu können.
Weil wir weder den Tag nutzen noch unsere Zeit verschwenden können, halten wir es so schwer aus, uns mit unserer Sterblichkeit zu konfrontieren. Eine bessere Gesellschaft würde sich nicht zuletzt dadurch auszeichnen, dass sie eine solche Konfrontation ermöglichen würde. Carl Hegemann bringt das auf den Punkt mit einem Zitat, das er von Heiner Müller übernimmt, der es bei Ilja Ehrenburg gefunden hat: »Wenn der Kommunismus erreicht ist und alle ökonomischen Probleme gelöst sind, dann beginnt die Tragödie des Menschen, dann sind wir endlich so weit, dass wir uns mit der Tragödie beschäftigen können, mit der Tragödie unserer Sterblichkeit.«
Das Ende des gesellschaftlich bedingten Leidens wäre kein paradiesischer Zustand, in dem die »Sonn’ ohn’ Unterlass« scheint, wie es noch in der Internationalen hieß. Aber es wäre doch zumindest eine Situation, in der wir den Tod aus seinem Schattendasein holen könnten. Womöglich könnten wir dann wirklich, wie es in einer der ersten Überschriften dieses Buches heißt, »glücklich im Unglück« werden.
Aus diesem Grund ist die Dramaturgie des Daseins, die auf das Problem der Sterblichkeit zuläuft, nicht nur ein Buch fürs Hier und Jetzt, sondern auch für eine mögliche bessere Gesellschaft der Zukunft. Oder für vernunftbegabte Aliens, denen es vielleicht irgendwo im All gelungen ist, sich menschlicher zu organisieren, als wir Menschen das bisher geschafft haben.
1Vgl. Carl Hegemann: Identität und Selbst-Zerstörung. Grundlagen einer historischen Kritik moderner Lebensbedingungen bei Johann G. Fichte und Karl Marx, Alexander Verlag 2017.
2Ebd., S. 175.
3Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Dietz Verlag 1968, S. 529.
B-Seite des Lebens
Vorwort für die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten
Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.
(Friedrich Hölderlin)
Es gibt neben dem Dichtergenie und neben dem Wahnsinnigen auch einen fast alltäglichen Hölderlin, der mit den Widersprüchen des Daseins kämpft, der sein Leben nicht im Griff hat und in seiner Verzweiflung Dinge zu Papier bringt, die uns in ihrer schlichten, manchmal paradoxen Einfachheit auf eine fast selbstverständliche Weise ansprechen und fesseln. Kein hoher Ton, keine Huldigung an das alte Griechenland und seine Götter und Helden, sondern profanes Leiden, Ratlosigkeit und Überanstrengung sind dann seine Themen, trübe, voller Selbstzweifel und angewidert von den dumpfen Verhältnissen und stumpfen Mitmenschen und der Einsicht, selber auch nicht unbedingt besser zu sein. Auf der B-Seite des Lebens macht Hölderlin zum Beispiel die Erfahrung, dass eine junge Dame es ablehnt, ihn zu heiraten. Er notiert dies sofort auf dem gleichen Blatt, auf dem er gerade noch eine seiner bedeutendsten Hymnen (»Mnemosyne«) entworfen hat: »Und ledig soll ich bleiben«, und schickt gleich eine kleine Drohung an die Unwillige hinterher: »Leicht fanget aber sich / In der Kette, die / Es abgerissen, das Kälblein.«
Oder gegen die ihm nicht unbekannte Euphorie des Dichters, die Gefahr abzuheben und den Boden unter den Füßen zu verlieren, schreibt er: »Man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe«, nämlich dann, wenn »die Nüchternheit dich verläßt«, die, für jeden unterschiedlich, die »Grenze deiner Begeisterung« markiert. Hölderlins Werk beschäftigt sich intensiv mit profanen Lebensfragen, die ihn ganz persönlich quälten. Er war nicht nur der heroisch leidende Dichter, er war auch einfach eine arme Kreatur, die litt, »weil sich ein Traum mir nicht erfüllte« und die sich fragte, »was ist mir fehlgeschlagen?« Hölderlin wusste, dass seine Oden, seine Hymnen und Gesänge, zwar sehr ernst waren, aber so ernst auch wieder nicht. Das Leben selbst jedenfalls war noch viel ernster, als es etwa sein berühmtes Gedicht »Hälfte des Lebens« zum Ausdruck bringt. Und seine dichterische Hochbegabung war immer nur ein schwacher Trost, zumal wenn Goethe und Schiller mit allerlei unverschämten Invektiven, in konzertierter Aktion versuchten ihn kleinzuhalten, womit sie ihn zwar als ernsthaften Konkurrenten anerkannten, aber auch an seinem gesellschaftlichen und ökonomischen Ruin beteiligt waren, den er allerdings hauptsächlich seiner »sparsamen« Mutter zu verdanken hatte, die ihm von dem ihm eigentlich zustehenden Erbe immer nur Kleinstbeträge auszahlte. Selbst als er nach seinem Rausschmiss aus dem Bankhaus Gontard in Frankfurt und der damit verbundenen Trennung von seiner Geliebten zu seinem besten Freund Isaac von Sinclair nach Bad Homburg zog, musste er feststellen, dass er dessen vermeintlich reine und exklusive Zuneigung, die starke homoerotische Züge trug, mit einem ganzen Haufen »auffallender Gestalten« zu teilen hatte, die Sinclair (Alabanda im Hyperion) ihm lange verschwiegen hatte. »Mir war, wie einer Braut, wenn sie erfährt, daß ihr Geliebter insgeheim mit einer Dirne lebe.«
Die B-Seite des Lebens bringt immer wieder ungeahnte Höhepunkte hervor. Das sieht man in der Musikindustrie, wo die eigentlichen Meisterwerke oft auf der B-Seite zu finden sind und genauso schon bei Hölderlin, der schrieb, zur »wahrsten Wahrheit« gehöre auch der »Irrtum«. Und der auch dem »Inferioren« und sogar dem »Barbarischen« einen legitimen Platz zugestand, zumindest in der Sprache der Poesie, die ihn gleichzeitig anwiderte. »Man schämt sich seiner Sprache. Zum Tone möchte man werden und sich vereinen in Einen Himmelsgesang.«
Im profanen Scheitern, in den kleinen und großen Fehlschlägen, aber auch in Hirn zermarternden Denkanstrengungen, denen kein Paradox fremd ist, bewegen sich »die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten« in Christoph Marthalers so betitelter Hölderlininszenierung am Deutschen Schauspielhaus, tapfer, ergeben und verschwindend, übergehend in Töne, in Musik. Sie wirken oft wie Illustrationen der Klagen des Dichters, aber sie sind keine Illustrationen, sie sind einfach. »Freilich ist das Leben arm und einsam. Wir wohnen hier unten wie der Diamant im Schacht.«
Um diese gerade so gegenwärtige Erfahrung der sozialen Distanz und der Abkapselung selbst zu machen, brauchen wir keine coronabedingte Isolation, wir brauchen nur ein bisschen Hölderlin. Oder anders ausgedrückt: Die Coronaregeln formulieren ein Extrem, das für Hölderlin ein ganz unvermeidlicher Teil moderner Tragik ist. »Das ist das tragische bei uns, daß wir ganz stille in irgend einem Behälter eingepakt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn, nicht daß wir [wie die tragischen Griechen] in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen vermochten.«
Ich glaube, Christoph Marthalers freundlicher Sarkasmus und Friedrich Hölderlins »In-die-Höhe-Fallen« passen ganz gut zusammen, und auch ein »zerrissen Saitenspiel« ist zu schönen Tönen fähig.
Das ist das tragische bei uns, daß wir ganz stille in irgend einem Behälter eingepakt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn, nicht daß wir in Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen vermochten.
Abb.: Ida Müller, »Torpedo«, Entwurf einer Flammenplastik vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, beidseitig bemalte Holzplatten und Metallgestänge, zwischen den Flammen begehbar, freistehend, abbaubar und transportabel, ca. 3 – 30 x 25 x 25 m (H x B x T), 2020.
I.WIE DEN TAGÜBERSTEHEN?
Glücklich im Unglück
Paradoxien des Genießens
Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort;
Sie streicht das Haar dir von der Stirne
Und küßt dich rasch und flattert fort.
Frau Unglück hat im Gegenteile
Dich liebefest an’s Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir an’s Bett und strickt.
(Heinrich Heine)
Nicht nur Heine in seiner Matratzengruft, selbst Goethe, das Weltkind und der Liebling der Götter, hielt Glück für einen ausgesprochen flüchtigen Zustand. Die glücklichen Momente in seinem Leben ließen sich an einer Hand abzählen, gab er als alter Mann zu Protokoll, dabei hatte er an »leichten Dirnen« bis ins hohe Alter keinen Mangel. (Es nagte an ihm, weil er seine Leistung für die Menschheit nicht in seinen Dichtungen sah, deren Wert er eher für gering erachtete, sondern in seiner revolutionären Farbenlehre, die aber niemanden interessierte.)
Wenn man die Flatterhaftigkeit und Vergänglichkeit des Glücks für seine wichtigsten Merkmale hält und trotzdem das Glück in den Mittelpunkt seiner Bestrebungen stellt, kommen etwas triviale Theorien dabei heraus, wie sie vorzugsweise unter Gymnasiasten kursieren: Das Leben ist eine lange dunkle Straße, die nur an wenigen Stellen durch Laternen erleuchtet wird. Und die Aufgabe, die man im Leben hat, ist, möglichst schnell von einer Laterne zur nächsten zu kommen. Das heißt sich immer dann zu verabschieden, wenn Dunkelheit und Kälte drohen, und schnell wieder Licht und Land zu finden.
Solche Vorstellungen sind wahrscheinlich etwas für eher einfachere Gemüter. Überhaupt sehen viele im »Glücksgebimmel« (F.-P. Steckel) nur eine Ablenkung von den wirklich wichtigen Fragen. Komplexere Gemüter wie Karl Heinz Bohrer erklären Glück sogar für prinzipiell inexistent, weil Glück für Lebende nicht erreichbar und für Tote nicht erfahrbar sei. Sie sprechen vom Glück genauso wie Giorgio Agamben von der Erlösung. Sie sei zwar möglich, aber nur, wenn wir sie nicht mehr wollen. Weil Leben und Unerlöstheit untrennbar sind, ist Erlösung nur jenseits des Lebens vorstellbar. Aber wir können diesen Zustand der Erlösung nicht genießen, weil, wie es bei Kleist (im Prinz Friedrich von Homburg) heißt, »das Auge modert, das diese Herrlichkeit erblicken soll«. Deshalb sagt Agamben: »Erlösung ist möglich, aber nicht für uns.« Dauerhaftes Glück wäre so etwas wie Erlösung bei lebendigem Leibe. Diese paradoxe Vorstellung vollkommenen Glücks bei vollem Bewusstsein treibt die Menschheit nach wie vor um, ob sie sich nun in religiös fundamentalistischer Weise auf eine positive Transzendenz bezieht oder ob sie diesseitig liberalistisch oder sozialistisch angestrebt wird. Selbst große und kritische Denker gehen wie selbstverständlich von der Hoffnung auf ein dauerhaftes und allgemeines Glück aus, selbst wenn sie wissen, dass dies noch kein Sterblicher erfahren und keine bekannte gesellschaftliche Organisation ermöglicht hat. Die Denkanstrengungen, die sie unternehmen müssen auf der Suche nach dem Glück, sind in der Regel von anderer Qualität als die des Schönheitschirurgen oder des Genetikers, die ja auch an der Verlängerung oder Verewigung von Glück arbeiten und am »Abschied vom Jammertal«.
Ein radikales Beispiel für ein reflektierteres Glücksmodell findet sich bei Theodor W. Adorno, dessen Kryptoauswirkungen auf die Gegenwart wahrscheinlich gar nicht überschätzt werden können. Adorno hat dem Glücksbegriff, auch wenn er sicher nicht konstitutiv ist für seinen negativen Begriffsapparat, im Sinne der abendländischen Utopie zumindest am Ende seines Lebens einen entscheidenden Wert zugestanden, ohne wie sein Kollege Horkheimer den kritischen Impuls einer altersreligiösen Kehrtwende zu opfern.
In einem seiner letzten Aufsätze, Resignation, in dem Adorno sich 1969 gegen den Vorwurf seiner Studenten wendet, er habe resigniert, findet er das Glück, ja sogar das universelle Glück der Menschheit ausgerechnet im Denken des Unglücks:
Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt: indem er es ausspricht. Damit allein reicht Glück ins universale Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern läßt, der hat nicht resigniert.
Nicht nur reicht Glück ins Unglück hinein, das dich nach Heine »liebefest an’s Herz gedrückt«, das heißt sich umfassend und auf Dauer bei dir einquartiert hat, das Glück wird durch die Anstrengung des Denkens nach Adorno auch selbst umfassend und dauerhaft: Die »leichte Dirne« wird sozusagen zur Ehefrau.
»Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend: Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muß, will er es auch den anderen nicht antun.« Die Eiswüste der Abstraktion als Ort eines Glücks, das universal ist und darin besteht, sich nichts vorzumachen. Das ist ein zwiespältiges Modell. Zumindest für Menschen, die nicht im Denken ihren Hauptlebensinhalt sehen, scheint diese Konstruktion vollkommen unbrauchbar. Was macht man als Glück suchender Nichtphilosoph? Vielleicht geht man ins Theater. Ist Philosophie »ihre Zeit in Gedanken erfaßt« (Hegel), so fasst das Theater die Zeit in Bilder und Vorgänge. In der Tragödie bestimmt das Theater das Glück, indem es das Unglück ausspricht, vielleicht noch drastischer und deutlicher als dies im Bereich des reinen Denkens möglich ist. Und für den Regisseur Peter Stein war eine gelungene Tragödie, das Bild notwendigen Scheiterns, das »Glück, das [ihn] im Theater am Leben hält«. Zum Beleg kann die kleine Tragödientheorie aus seiner Goethepreisrede von 1988 dienen, die mich damals sehr beeindruckt hat:
Was man auch tut, was man auch unternimmt, führt grundsätzlich zu nichts Gutem. Diese Vorstellung, daß man im Grunde genommen nichts tun kann, und wenn man etwas tut, man im Verbrechen endet, diese entsetzliche Wahrheit müßte eigentlich zum sofortigen Selbstmord der Menschheit führen, wenn sie ernst genommen würde. Sie wird im Theater so schonungslos und rücksichtslos und so bewegend und so wahr durch Lüge zum Ausdruck gebracht, daß sich in der Tat eine – auch heute kann man so etwas noch herstellen – lähmende Hoffnungslosigkeit über den Zuschauerraum und über die Theatermacher selber herniedersenkt. Und dann gibt es seltsamerweise einen Moment, den kann man organisieren, aber er ist glückhaft, wenn er eintritt, einen Moment, in dem diese Hoffnungslosigkeit seltsamerweise umschlägt in die Bereitschaft, genau dieses Schicksal, diese Dichotomie der menschlichen Existenz auf sich zu nehmen, und zwar freudig und hoffnungsvoll. Das ist das Seltsame, das nennt man, glaube ich, in anderen Theorien Katharsis.
Ich weiß nicht, ob man dieses Bekenntnis als eine theaterbezogene Variante von Adornos Gedanken betrachten kann, aber die Produktion äußerster Vergeblichkeit als Basis eines »glückhaften« Umschlags in Freude und Hoffnung verweist zumindest auf eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen dem Glück der Tragödie bei Peter Stein und dem glücklichen Unglücksbewusstsein bei Adorno.
Dass Erlösung für Sterbliche nicht zu haben ist und Scheitern nicht nur dazugehört, sondern unvermeidlich ist, kann offenbar auch im Theater Glück evozieren.
Dass es etwas gibt, das wir nicht im Griff haben, sondern das uns im Griff hat, ist nicht nur der Grund unseres Unglücks, sondern gleichzeitig ein Grund zu stetiger Freude. Die klassischen Dichotomien, die dahinterstecken, wie »Selbst und Welt«, »Form und Stoff«, »Freiheit und Determination« sind offenbar nicht totzukriegen.
Auch die Dekonstruktivisten, die solche Dualismen als konstitutive Form beseitigen und nur noch Monismen und Vielheiten oder die »différence« untersuchen wollten, kehren in entscheidenden Situationen wieder zu tragödienkonstitutiven Antinomien zurück. Beim späten Derrida zum Beispiel kehrt der Dualismus wieder als Antinomie von Gleichheit und Alterität. Alle Menschen sind gleich und trotzdem ist jeder anders als alle anderen. Derridas ganzes Demokratiemodell basiert auf diesem Gegensatz, den er »tragisch« nennt:
Keine Demokratie ohne Achtung vor der irreduziblen Singularität und Alterität. Aber auch keine Demokratie […] ohne Berechnung und Errechnung der Mehrheiten, ohne identifizierbare, feststellbare, stabilisierbare, vorstellbare, repräsentierbare und untereinander gleiche Subjekte. Diese beiden Gesetze lassen sich nicht aufeinander reduzieren; sie sind in tragischer und immer verletzender Weise unversöhnbar.
Aber Derrida bleibt sich trotz seiner Rückkehr zum Dualismus treu und erweist sich vielleicht gleichzeitig als einer von Adornos konsequentesten Schülern. »Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es läßt sich nicht ausreden, daß etwas davon überlebt. Denn Denken hat das Moment des Allgemeinen«, schreibt Adorno gegen die Resignation. Und dieses Überleben, das »weder vom Leben noch vom Sterben abgeleitet« ist, ist auch das letzte Thema Derridas. In einem Interview kurz vor seinem Tod führt er Adornos Glücksreflexion auf eine sehr persönliche und doch allgemeine Weise weiter und über sich selbst hinaus. Aus dem Raum des Denkens und des Theaters kommt er zurück zum gewöhnlichen Leben und damit zum Tod:
Nie werde ich derart von der Notwendigkeit zu sterben heimgesucht als in den Augenblicken des Glücks und des Genießens. Genießen und den ungeduldig lauernden Tod beklagen, das ist für mich ein und dasselbe.
Genuss verwandelt sich in Klage. Aber die Klage ist Genuss. Und das Unglück wird als Glück erfahrbar:
Wenn ich mir mein Leben in Erinnerung rufe, bin ich geneigt zu denken, daß ich das Glück und die Chance gehabt habe, selbst die unglücklichen Momente meines Lebens zu lieben und für sie dankbar zu sein (sie zu segnen). Fast alle, von einer Ausnahme abgesehen. Und wenn ich mir die glücklichen Momente in Erinnerung rufe, so bin ich auch für sie dankbar (segne ich natürlich auch sie), gleichzeitig drängen sie mich jedoch dem Gedanken an den Tod, dem Tod entgegen, denn es ist vergangen, vorbei …
Für Derrida ist die Fähigkeit zum Glück, die unglücklichen Momente des Lebens »lieben« zu können, von der Theorie ins tägliche Leben übergegangen, mit »einer Ausnahme«, sonst wäre diese Transformation ein bloßer Automatismus. Nur mit den glücklichen Momenten hat er Probleme: Sie sind nicht wirklich glücklich, weil sie stark an den Tod gekoppelt sind, weil sie als Momente, in denen nichts fehlt, in denen alles eins wird (hen kai pan), auf den Abschied von der Dualität verweisen, die unser Dasein in der Welt ausmacht. Das deutet darauf hin, dass wir mit dem Unglück offenbar ganz gut zurande kommen können. Wir müssen aber noch lernen, mit den glücklichen Momenten umzugehen. »Genießen als Chance«, »Erfolg als Chance«, »Glück als Chance«: So lauten die wahrscheinlich heute subversiveren Parolen. Deshalb heißt es noch gar nicht viel, wenn wir uns Derrida als glücklichen Menschen vorstellen. Glück ist kein Ziel, sondern nur eine Chance, genau wie der Tod, der Abschied allen Abschieds. Von diesem Abschied haben wir keine Ahnung und keine Meinung. Das ist kein öffentliches Thema unserer Kultur. Auch den Tod als Chance zu sehen, fällt schwer, ist aber vielleicht das Beste, was uns bei lebendigem Leibe passieren kann.
Brecht ist einer der wenigen nicht religiösen Dichter, die auch hier noch weiter gedacht haben, wie die folgenden Zeilen aus seiner »Sterbelehre«, dem Badener Lehrstück vom Einverständnis, zeigen: »Habt ihr, die Wahrheit vervollständigend die Menschheit verändert, so verändert die veränderte Menschheit. Gebt sie auf! Marschiert! Ändernd die Welt, verändert euch! Gebt euch auf! Marschiert!« Vorwärts und nicht vergessen: den Tod.
Ich wünsche nur, was ich bereits besitze
Romantische Liebe überleben
Es gibt vielleicht keine größere Liebe als die zwischen einem revolutionären Paar, bei dem beide bereit sind, den andern in jedem Augenblick zu verlassen, wenn es die Revolution erfordert.
(Slavoj Žižek, Isolde rennt)
Zu Shakespeares 450. Geburtstag, im April 2014, hat ein in Deutschland weltberühmter konservativer Theaterkritiker diesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als den »jüngsten und frischesten aller Jungdramatiker« bejubelt, der »jedem Zeitgeist hohnspricht« und dabei »Phantastisches« geschaffen habe. Aber ein Werk dieses »größten und wunderbarsten Menschentheaterzauberers aller Zeiten« nimmt er aus, und zwar ausgerechnet das berühmteste. »Romeo und Julia ist die unsägliche Kolportage einer Husch-husch-Liebe, samt Dolch und unkonzessioniertem Ausschank giftiger Substanzen.«
Und tatsächlich wirkt der Handlungsrahmen im Vergleich zu anderen Shakespeare-Dramen weder originell noch komplex. Es geht, wie allgemein bekannt, um zwei Liebende, die aus verfeindeten Familien stammen und durch schlimme Verhältnisse, böse Zufälle und phantastisch schiefgehende Rettungsaktionen schon kurz nach der Hochzeitsnacht in den Selbstmord getrieben werden. Aber die Wirkung dieser scheinbar einfachen Tragödie ist bis heute grenzenlos. Was Shakespeare aus dem Stoff gemacht hat, ist so etwas wie die Keimzelle aller romantischen Liebesgeschichten, Muster und Maßstab in der Kunst und im Leben. Die große, alles sprengende Liebe erweist sich bei Romeo und Julia in der Bereitschaft, für die Liebe zu sterben. Ihre Liebe scheitert nicht nur am feindlichen Umfeld, sie braucht es auch. Es geht nicht um die gute Partie, um die kluge Partnerwahl, sonst müsste Julia den Grafen Paris, »ein Kerl wie aus dem Katalog«, heiraten. Es geht um die Liebe, die eigentlich keine Chance hat, die sich durch nichts begründen lässt, die jeder Vernunft spottet und deshalb unbedingt und grundlos ist. Diese Liebe ähnelt der mystischen Erfahrung des Göttlichen, dem Absoluten. Wenn Julia ihre Liebeserfahrung mit den Worten feiert: »Ich wünsche nur, was ich bereits besitze«, verweist das auf diese Erfahrung des Göttlichen, die der Philosoph Baruch de Spinoza hundert Jahre nach Shakespeare nahezu mit den gleichen Worten charakterisiert: »Begehren, was man besitzt, das ist das höchste Gut.«
Im Theater und in der Oper müssen die Liebenden sterben, ob sie nun Romeo und Julia, Tristan und Isolde oder Bonnie und Clyde heißen. Die amour fou fürchtet nicht den Tod, sondern sehnt ihn als größte und endgültige Vereinigung herbei. Die Liebe ist ewig, wenn die Liebenden sterben. Im realen Leben ist das normalerweise keine Option, dort stirbt statt der Liebenden die Liebe und verwandelt sich, meistens nach drei bis sieben Jahren, in irgendetwas Pragmatisches, Lebbares, Vernünftiges, wenn nicht in Hass und Überdruss. Eine Liebe, die niemals aufhört und die Liebenden noch nach 50 Jahren Ehe beim Anblick des Partners in Seligkeit versetzt, ist die absolute Ausnahme, soll aber vorkommen.
»Die Menschen, die sich heute lieben, müssen zusammen sterben, wenn sie vereint sein wollen«, vermutet Albert Camus und er behauptet, das Leben sei für die Liebenden »eine Qual, denn Leben trennt.« Und der Ausweg, den er fand, in den Gerechten, ist nicht sehr vielversprechend:
Aber kann man sich nicht jetzt schon vorstellen, dass zwei Menschen auf alle Freuden verzichten, sich im Schmerz lieben und auf keine andere Begegnung mehr hoffen können als im Schmerz? Kann man sich nicht vorstellen, dass der gleiche Strick diese beiden Menschen vereint?
Das ist eine überraschend christliche Vorstellung, in der sich die Liebenden im Leiden vereinigen, so wie sich Jesus durch den Kreuzestod mit den Sterblichen vereinigt hat. Seitdem dürfen wir Christenmenschen gerade im Leiden die Nähe Gottes erfahren, wenn wir es können. »Das Reale des Christentums« hat hier für den Philosophen Slavoj Žižek seinen Ursprung:
Wir sind nur dann eins mit Gott, wenn dieser nicht mehr eins ist mit sich selbst, sondern sich selbst aufgibt, den radikalen Abstand ›verinnerlicht‹, der uns von ihm trennt. Unsere radikale Erfahrung der Trennung von Gott ist genau jenes Merkmal, das uns auch mit ihm vereint […]. Es ist anmaßend zu glauben, ich könne mich mit der göttlichen Glückseligkeit identifizieren – nur dann, wenn ich den unendlichen Schmerz der Trennung von Gott erlebe, teile ich eine Erfahrung mit Gott selbst, mit Christus am Kreuz.
Derselbe Slavoj Žižek ist es aber auch, der in seiner Auseinandersetzung mit Richard Wagners Oper Tristan und Isolde eine Alternative zum Liebestod entdeckt, die vielleicht nicht weniger romantisch oder spirituell ist, die aber den Liebenden eine gemeinsame und individuelle Lebensgeschichte ermöglicht, ohne den Absolutheitsanspruch ihrer Liebe aufzugeben. Žižeks Lösung besteht überraschenderweise in der Bereitschaft der Liebenden, den Partner jederzeit zu verlassen! Seine Begründung für dieses Paradox ist bemerkenswert. In Isolde rennt schreibt er:
Die wichtigste Lektion für einen liebenden Mann, der wissen will, ob seine Liebe erwidert wird, ist die Einsicht in die Notwendigkeit zu prüfen, ob er in der Lage ist auch ohne das geliebte Wesen zu leben, also ob er in der Lage ist, seinen Beruf oder seine Bestimmung diesem vorzuziehen.
Dabei gäbe es auf den ersten Blick nur die beiden folgenden Antworten: »1. Meine berufliche Karriere ist mir das Wichtigste überhaupt, die Geliebte dient nur zum Amüsement, zur kurzzeitigen Ablenkung.« Dann wäre die Frage mit Ja beantwortet. »2. Die geliebte Frau bedeutet mir alles, ich bin bereit, mich für sie in jeder Hinsicht zu kasteien und meine öffentlichen und beruflichen Verpflichtungen aufzugeben, wenn sie es will.« Das wäre ein klares Nein. Wie man sich denken kann, erklärt Žižek beide Antworten für falsch. Denn »sie führen zur Ablehnung des Mannes durch die Frau«. Was natürlich auch im umgekehrten Falle denkbar ist. Und dann kommt die für Žižek einzig richtige Antwort, die die absolute Liebe bei lebendigem Leibe ermöglicht und den Tod der Liebenden und den Tod der Liebe gleichermaßen vermeidet: »Auch wenn du alles für mich bist, kann ich doch ohne dich leben. Ich bin bereit und in der Lage, dich zu verlassen, wenn meine Aufgabe oder mein Beruf das erfordern.«
Für Julia und alle romantisch Liebenden wäre eine solche Antwort wie eine kalte Dusche. Und auch für Romeo wäre es sicher sehr ernüchternd, wenn Julia, auf den Spuren Žižeks, mit ihrem Geliebten das folgende Experiment anstellen würde:
Wenn eine Frau wissen will, ob ein Mann sie wirklich liebt, ist die beste Art das herauszufinden, ihn im wichtigsten Moment seiner Karriere zu verlassen oder (scheinbar) zu betrügen, etwa vor seinem ersten öffentlichen Konzert, vor einem entscheidenden Examen oder vor einem wichtigen Geschäftsgespräch, das über seine berufliche Zukunft entscheidet. Nur wenn er es schafft, die Prüfung erfolgreich zu bestehen, obwohl er verlassen und erniedrigt ist von der geliebten Frau, wird er sie von seiner Liebe überzeugen und sie kommt zu ihm zurück!
Das klingt wie eine Absage an die bedingungslose Liebe und nach üblem Kalkül. Die Begründung für eine solche Haltung bei Žižek ist aber ganz anders: »Das Paradox, das dieser Erfahrung zugrunde liegt, besteht darin, dass Liebe genauso wie das Absolute nicht als ein direktes Ziel angegangen werden kann – sie sollte eher den Status eines nicht intendierten Effekts haben, der uns wie eine unverdiente Gnade trifft!«
Das heißt: Um der Absolutheit der Liebe willen muss man etwas haben oder fingieren, das wichtiger ist als der Partner, denn sonst wird der oder die Geliebte zu einem bloßen Objekt instrumentalisiert, so wie in der ersten und zweiten Antwort auf Žižeks Ausgangsfrage. Es geht dann nur um die Liebe, aber nicht um den Geliebten. Als besonderer eigenständiger Mensch spielt er dann für uns in Wirklichkeit keine Rolle. Die absolute und dauerhafte Liebe, die Žižek vorschwebt, ist dagegen ein »Effekt«, der uns einfach passiert (oder auch nicht) und uns im äußersten Glücksfall ein Leben lang begleitet (oder eben nicht). Die absolute Liebe kann nicht direkt angestrebt werden, weil das Absolute allumfassend ist und daher kein Objekt sein kann, das mir gegenübersteht.
Vielleicht sollte man mal einige von den wenigen gemeinsam alt gewordenen Liebespaaren fragen, warum sie sich nach 50 Jahren immer noch so leidenschaftlich lieben, warum ihre Liebe in dieser langen Zeit nicht gestorben ist, und warum sie nicht an ihrer Liebe gestorben sind. Vielleicht antworten sie dann: weil jeder von uns bereit war, den anderen jederzeit zu verlassen, wenn seine Aufgabe es erforderte. Oder auch nicht.
Lie to me, I promise I’ll believe
Kann man echte Liebe kaufen?
Wahre Liebe ist jetzt käuflich! – Aber nur für kurze Zeit! (Werbetext für Romeo all’Arrabbiata und Julia Crema di Yogurt & italienische Kräuter, Brunch-Brotaufstrich 2007)
Kann Liebe gleichzeitig echt und bezahlt sein? Diese Frage interessiert offenbar nicht nur Hersteller von Brotaufstrich oder deren Werbeagenturen, sie markiert auch zwei zentrale Problemkomplexe, mit denen René Pollesch sich in seinen Stücken herumschlägt.
Der erste Komplex bezieht sich auf die Ökonomie, von der alles, was wir leben und erleben, letztlich abhängt. Alle unsere Bedürfnisse verweisen auf Geld, weil wir sie ohne Geld nicht befriedigen können. Wer zahlungsunfähig ist, dem sind die Schätze der Natur und der Reichtum der Gesellschaft verschlossen. Neben den Dingen, die wir zum Leben brauchen, gibt es ein abstraktes Ding, das als solches zu nichts zu gebrauchen ist, das aber für alle anderen Dinge tauschbar ist. Dieses Ding, eben das Geld, ist etwas, das in der Natur nicht vorkommt. Auf seine »Naturalform«, das Gold, ist es nicht angewiesen, es kann auch als Stück Papier oder als Zahl im Computer existieren. Diese abstrakte Ware, die selbst wertlos ist, die man aber anscheinend in jeden beliebigen Wert verwandeln kann, ist in unserer Gesellschaftsordnung das Objekt der Begierde schlechthin, etwas, auf das alle scharf sind, und etwas, das uns scharf macht. Selbst ernsthafte Künstler, von denen man annehmen könnte, sie seien nur ihren ästhetischen Obsessionen verpflichtet, neigen dazu, mit Frank Zappa zu sagen »We’re Only in It for the Money«, wenn sie mal ehrlich sein wollen. Wenn wir in erster Linie Geld anstreben, wenn es letztlich immer die Frage ist, ob sich das, was wir tun, als marktgängig und lukrativ erweist, wird es gleichgültig, was wir tun. Daraus resultiert Entfremdung und Verdinglichung, unser eigener Lebensprozess erscheint uns fremd, unsere Verhältnisse zu anderen Menschen erscheinen als Verhältnisse von Dingen. Der Schein, das »Als-ob« tritt an die Stelle wirklicher zwischenmenschlicher Vorgänge. Und damit sind wir, wie Pollesch gerne sagt, »getrennt von unserem Leben« oder, wie Marx gerne sagte, »atomisierte Individuen«. Die Wirtschaftsform, die diese Isolation und Gleichgültigkeit in wachsendem Maße erzeugt, ist gleichzeitig so produktiv wie keine andere in der Geschichte. Die beschriebenen unangenehmen Nebenfolgen kann sie nicht vermeiden, ohne sich selbst in Frage zu stellen. Deshalb sind Versuche, menschliche Beziehungsformen wie Liebe und Solidarität oder religiöse oder nationale Gefühle über den Marktmechanismus zu stellen, eine Bedrohung für das System. Diese Beziehungsformen müssen, um sie kompatibel zu machen mit dieser Wirtschaftsform, in Waren transformiert werden. Es gibt in Zeiten der Globalisierung nur wenig, das dieser Transformation Widerstand leistet, vielleicht die Selbstmordattentate, vielleicht der fundamentalistische Krieg gegen den Terror. Beide Phänomene speisen sich nicht aus ökonomischen, sondern eschatologischen Motiven. Die Absage an den Markt, sieht man an diesen Beispielen, kann heute vielleicht nur noch als Absage an das Leben gedacht werden.
Wie verhält es sich aber mit der Vermarktung solcher Beziehungsformen wie Liebe und Solidarität? Liebe, so sagt man seit 2000 Jahren (seit Christi Liebestod am Kreuz), ist das Wichtigste im Leben. Nach Liebe gibt es eine unerschöpfliche Nachfrage. Sie ist ein knappes Gut. Denn, wie Adorno sagte, fühlen wir uns alle »ausnahmslos zu wenig geliebt«. Deshalb ist Liebe und nicht nur Sex das große Thema der Werbung. Aber es hat noch nie eine Geschäftsidee gegeben, die Liebe unmittelbar als Ware behandelt. Liebe lässt sich reell nicht unter die Warenstruktur subsumieren. Woran liegt das? Warum lässt sich Liebe nicht wie Sex oder Wellness verkaufen? Und warum ist auch Solidarität nicht käuflich zu erwerben? Natürlich kann ich mir einen Menschen engagieren und ihn als meinen Geliebten vorstellen, oder eine Gruppe, die sich solidarisch mir gegenüber verhält und dafür bezahlt wird, aber jedem ist klar, dass eine Solidarität, die endet, wenn die Zahlungen ausbleiben, genau so wenig Solidarität ist, wie Liebe Liebe ist, wenn für jeden einzelnen »Liebesdienst« oder »Liebesbeweis« gezahlt werden muss. Das ändert sich auch nicht, wenn pauschal bezahlt wird (zum Beispiel in der Ehe). Warum ist das so? Ganz einfach, Phänomene wie Liebe und Solidarität folgen strukturell einer Logik, die nicht die Logik des Marktes sein kann. Schon bei Shakespeare wird dies äußerst klar ausgesprochen, zum Beispiel wenn Julia sagt: »Ich wünsche nur, was ich bereits besitze. So grenzenlos ist meine Liebe, so tief das Meer, je mehr ich gebe, je mehr auch hab ich: beides ist unendlich.« Liebe entzieht sich jedem Kalkül, deshalb lässt sie sich nicht verkaufen. Das ist tragisch für den Markt, dass seine wunderbare Kraft, die Bedürfnisbefriedigung der Menschen dynamisch in ungeahnten Ausmaßen zu fördern, ausgerechnet bei einem der wichtigsten Güter des täglichen Bedarfs versagt: der Liebe. Und beunruhigend ist dabei, dass der Markt, um zu funktionieren, eigentlich keine Ausnahmen dulden darf. Das ist schon sein Problem bei unverkäuflicher Arbeitskraft, die man nicht wie andere unverkäufliche Waren einfach auf den Müll schmeißen kann, weil da ja lebendige Menschen dranhängen. Dass sich das Problem der Arbeitslosigkeit nicht durch das »freie Spiel der Kräfte« lösen lässt, weil man sonst die überflüssigen Arbeitskräfte verhungern lassen müsste, ist ein ruinöses Problem der Marktwirtschaft und der Menschen, die ihr ausgeliefert sind. Und nun, wenn wir feststellen, dass ein so wichtiges Gut wie die Liebe schlechterdings nicht für den Markt geeignet scheint, weil es wesentlich die dort herrschenden Gesetze unterläuft oder überwindet, stehen wir vor einem schweren Dilemma. Und das ökonomische Marktprinzip, dem die Welt den Fortschritt zu verdanken hat und sogar ihre demokratische Ordnung, scheitert ausgerechnet da, wo es für die liebesbedürftigen Menschen wirklich wichtig wird. Die Globalisierung nach innen, das heißt die Tendenz der Marktwirtschaft, sich jeden menschlichen Lebensbereich einzuverleiben, findet hier ihre Grenze.
Die Liebe, nach der wir uns sehnen, ist unvernünftig. Und Unvernunft gefährdet den Markt. Der berühmte Autovermieter und Erfolgsunternehmer Sixt verkündete neulich: »Die oberste Vorraussetzung unserer Wirtschaftsordnung ist, dass die Beteiligten immer rational handeln. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt.« Das heißt, die Rationalität des Marktes, das, was Konkurrenz überhaupt erst ermöglicht, dass alle Marktteilnehmer rational auf ihren Vorteil aus sind, lässt sich empirisch nicht bestätigen. Es gibt offenbar viele Handlungsmotive, die nicht marktmäßig kalkulierbar sind.
Dostojewski war vor 150 Jahren wahrscheinlich einer der Ersten, die dieses Leck im rationalen Vorteilsdenken gesehen haben. In seinem Roman Aufzeichnungen aus dem Kellerloch lesen wir etwas, das wie ein Kommentar zu der Einsicht von Sixt klingt:
Nach unserem eigenen, uneingeschränkten und freien Wollen, nach unserer allerausgefallensten Laune zu leben, die zuweilen bis zur Verrücktheit verschroben sein mag? Das, gerade das ist ja jener übersehene allervorteilhafteste Vorteil, der sich nicht klassifizieren lässt, und durch den alle Systeme und ökonomischen Theorien fortwährend zum Teufel gehen.
Dostojewski erlaubt sich in diesem Text, den größten Vorteil ausgerechnet in der Vorteilsablehnung, in der Nicht-Rationalität, im Ignorieren des Kalküls zu finden.
Jemanden nicht zu heiraten, nur weil er eine Erbschaft gemacht hat, jemandem alles zu geben, was man hat, ohne jegliche Gegenleistung: solche Verhaltensweisen – es gibt sie nicht nur bei Dostojewski – sind unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht mehr zu fassen. Und hier wird auch der Widerspruch deutlich, der die Ausgangsfrage von René Pollesch charakterisiert. Liebe echt und bezahlt? Wenn sie bezahlt ist, folgt sie einem Kalkül, ist also von etwas anderem abhängig als ihr selbst, wird instrumentalisiert und damit entwertet. Wenn sie aber außerhalb des Kalküls liegt, widerspricht sie den obersten Voraussetzungen unserer Wirtschaftsordnung und ist nach deren Maßstäben ein gefährlicher Unsinn (Wie kann ein vernünftiger Mensch Julia zustimmen, wenn sie sinngemäß sagt: »Je mehr ich ausgebe, je mehr hab ich im Portemonnaie«?). Liebe auf dem Markt zu kaufen scheitert genauso wie Liebe, die sich jenseits des Marktes verwirklichen will. Die marktkompatible Liebe ist unecht. Die reine Liebe jenseits des Marktes tritt ihre eigenen Überlebensbedingungen mit Füßen. Vielleicht enden deshalb Liebesgeschichten zumindest im Theater gerne tödlich. Man kann nicht sagen, dass wir bis heute eine überzeugende Lösung für dieses Dilemma gefunden hätten. Wer kalkuliert, lebt länger, aber er kann und darf nicht lieben, wenn er konsequent ist. Und ein Leben ohne Liebe ist vielleicht kein Leben. Wer nicht kalkuliert, kann sich zwar, wenn er Glück hat, auf eine wahre Liebe einlassen, aber er gefährdet sein Leben. Wer beides gleichzeitig versucht, landet wieder bei Polleschs Frage: Kann Liebe echt sein und gleichzeitig bezahlt?
Die slowenischen Joseph-Beuys-Schüler von der Rockgruppe Laibach zogen auf ihrer CD Kapital folgende Konsequenz aus diesem Dilemma: »Der Jäger, der zwei Hasen jagt, verfehlt beide. Wenn du schon scheitern musst, scheitere glanzvoll: Jage zwei Tiger!« Das klingt verblüffend: Wir lösen den Widerspruch nicht auf, wir lassen ihn stehen und steigern ihn ins Extrem. Wir müssten ein Höchstmaß an Kalkül mit einem Höchstmaß an Nicht-Kalkül konfrontieren. Unternehmerisch denken und gleichzeitig in Liebesdingen die Bereitschaft entwickeln, jedes Kalkül über den Haufen zu schmeißen. Dann wäre durch die Extreme hindurch vielleicht so etwas wie ein Ausgleich möglich, der nicht bloß ein fauler Kompromiss ist. Der gewissenhafte Unternehmer, der rational handelt, aber für die Liebe jedes Geschäftsinteresse sausen lässt, wäre das ein Beispiel für ein gelingendes Liebesleben? Dieses wackelige Konzept, das doppeltes Scheitern zur Tugend macht, scheitert aber möglicherweise zusätzlich auch an der Ungewissheit, die der unter solchen Bedingungen Geliebte in uns auslöst. Denn ob auch er zwei Tiger jagt und ob wir für ihn bei seinen Bestrebungen der »Kalkültiger« oder der »Liebestiger« sind, lässt sich grundsätzlich nicht mit Sicherheit klären.
René Pollesch versucht in seinen gegenwärtigen Arbeiten, die Enttäuschung, dass Liebe Zwecke verfolgt und instrumentalisiert wird, probeweise zu verarbeiten durch Reinvestition in den Markt, durch Bejahung der Käuflichkeit der Liebe. Mit folgendem Argument: Auch wenn meine Liebe bezahlt ist, kann ich in dieser Scheinliebe zumindest etwas von dem erfahren, was Liebe sein könnte, wenn sie nicht bezahlt wäre. Es muss nur gut gespielt sein. Auch das bloß Vorgespielte, Unechte hat seinen Wert. Das Theater lebt schließlich nicht schlecht vom ästhetischen Schein und vielleicht kann große Nähe und große Zuneigung auch dann angenehm sein, wenn ihr durch finanzielle Gegenleistung nachgeholfen wurde. Es gibt Leute, die sagen, dass Liebe gar nicht anders möglich ist als unter diesem Vorbehalt. Dass das Echte sich sozusagen im Unechten verstecken oder tarnen muss. Hinzu kommt die Vermutung, dass das Geld selbst es ist, das verliebt macht, das eine erotische Qualität besitzt, die über das mit ihm verbundene Kalkül hinausweist. Das behauptete zum Beispiel Andy Warhol, für den Geld explizit zu den Dingen gehörte, die verliebt machen, oder die Pet Shop Boys: »I love you, you pay my rent.« Wir müssten also möglicherweise, wenn wir in Zeiten der Globalisierung unseres Innenlebens so etwas wie Liebe haben wollen, die gelogene Liebe annehmen. Denn wenn wir an die gelogene Liebe glauben, obwohl sie gelogen ist, dann hat sie vielleicht psychische und körperliche Effekte, die fast identisch sind mit denen der echten Liebe, die unter diesen Bedingungen unlebbar und unerreichbar ist. Das führt zu der Frage, ob eine schöne, aber gelogene Liebesbeziehung besser ist als eine echte, aber beschissene. Dahinter steckt die Vermutung, dass in unserer Gesellschaft vielleicht nur aus Berechnung Hingabe und große Liebe möglich werden, dass ohne Berechnung einfach keiner den Willen und den Mut aufbringen würde, große Gefühle zu riskieren. Das würde heißen, dass es Mischformen sind, die wir leben, dass Zweifel dazugehört und dass wir uns angewöhnen müssen, auch Lügen zu glauben. Das gehört zum Spiel und könnte auch gesünder sein als eine radikale, aber illusionäre Liebesvorstellung. Die amerikanische Sängerin Sheryl Crow (ich habe das Gefühl, sie ist nicht die Einzige) kann das anscheinend. In einem ihrer Songs heißt es: »Lie to me, I promise, I’ll believe.«
Vielleicht kann man das Gefühl, das mit echter Liebe verbunden ist, also kaufen. Darüber, wie echt sie wirklich ist, braucht man sich als nicht kalkulierender Liebender nicht den Kopf zu zerbrechen. Und tiefe Gefühle, die überhaupt nicht gefälscht sind, sind für uns schwache Menschen womöglich sowieso viel zu gefährlich. Dies ist keine befriedigende, aber, wie ich fürchte, eine weit verbreitete Lösung in Zeiten intensiver Totalisierung der Märkte.
Es gibt noch eine andere Vorstellung, nach der Liebe nicht an Wahrheit gebunden ist und gerade auch echte Liebe Lügen nicht ausschließt, weil Liebe stärker ist als Wahrheit. Niemand anders als Shakespeare behauptet, dass »Scheinvertraun« das Beste sei, was einem in der Liebe passieren kann. Diese These entfaltet er im Sonett 138. Was hätte Julia dazu gesagt?
Wenn sie mir schwört, sie sei die Wahrheit selbst,
So glaub ich ihr, obgleich ich weiß, sie lügt,
Damit sie in mir einen grünen Jungen sieht,
Der mit der Welt Finessen nicht vertraut.
Indem ich wähn’, dass sie für jung mich hält,
Wiewohl sie weiß, was hinter mir schon liegt,
Glaub’ einfach ihrer falschen Zunge ich:
So leidet schlichte Wahrheit beiderseits.
Warum verhehlt sie aber, dass sie lügt?
Und warum sag ich nicht, wie alt ich bin?
Der Liebe bestes Teil ist Scheinvertraun,
Und Liebe weiß nichts von der Jahre Zahl.
Darum lüg ich sie an und sie mich auch,
Und lügend schmeicheln unsern Fehlern wir.
Flucht in die Familie
Die Keimzelle des Staates gebiert Ungeheuer
Gerade dadurch, dass der Einzelne egoistisch nur seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er das Wohl der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Alle, die jemals vorgaben, ihre Geschäfte dienten dem Wohl der Allgemeinheit, haben ihr niemals etwas Gutes getan.
(Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen)
1.
Das Theater beschäftigt sich seit 2500 Jahren mit der Familie und fast alles, was es zu diesem Thema produziert hat, bestätigt die Statistik von heute: nirgends gibt es so viel Mord und Totschlag wie in der Familie, zwischen Leuten, die sich (zu) gut kennen und die aneinander gebunden sind durch Umstände, die sie nicht selbst gewählt haben. Das Theater beschäftigt sich auch heute, wie zu den Zeiten von Sophokles und Euripides, von Ödipus und Medea mit der Familie als einer gefährlichen Zusammenballung gegenseitiger Abhängigkeiten und abgründiger Konflikte. Schon Goethe wollte den archaischen Zwang der Blutsverwandtschaften durch Wahlverwandtschaften ersetzen und Marx sah mit der Entfaltung des Kapitalismus nicht nur die Auflösung der »Vaterländer«, sondern auch das »Ende der Familien« heraufziehen und zwar als durchaus positive und humane Tendenz. Im Kommunistischen Manifest war die Abschaffung der Familien eine zentrale Forderung. Die Familie hat sich aber trotz steigender Scheidungsrate und sinkender Kinderzahl bis heute gehalten, wenn auch nur in ihrer Schrumpfform. Von der traditionellen Großfamilie, die drei Generationen unter einem Dach zusammenhielt, entwickelte sie sich über die Kleinfamilie zum Alleinerziehenden als kleinstmöglichem Familiengebilde. Dies ist nur folgerichtig in einer sich ausbreitenden Marktwirtschaft, die atomisierte Individuen produziert, die sich nicht direkt aufeinander beziehen, sondern nur indirekt über den Markt. Das isolierte Individuum, das sich alles kauft, was es für ein glückliches Leben braucht, ist Produkt, Legitimationsbasis und Ideal dieser Marktwirtschaft, für die alles Statische und Langfristige eine Behinderung darstellt. Die Protagonisten in Michel Houellebecqs Romanen sind Prototypen dieses Ideals. Der hierarchische Familienverband mit seinen persönlichen Dauerabhängigkeiten und außerökonomischen Verpflichtungen passt nicht in diese Gesellschaft der individualisierten Marktteilnehmer. Seine Aufgaben müsste deshalb entweder der Markt übernehmen oder die Familie müsste sich selbst »fit« machen für den Markt, Kinder müssten als Kapital investiert werden und ihre Aufzucht müsste ein bezahlter Job sein wie jeder andere. Aber Familien, die sich als profitorientierte Unternehmen definieren, sind Geschäfte und keine Familien. Wenn die Kinder, wie schon von Marx beobachtet, zu »bloßen Handelsartikeln und Arbeitsinstrumenten« werden, kann man von Familie nicht mehr sprechen. Die Sicherheit und Geborgenheit der Familie schwindet, aber die Möglichkeit für den Einzelnen, Freiheit und Selbstbestimmung zu erlangen, wächst. Das sinnlose Opfer und die schicksalhafte Ausgeliefertheit, die seit Urzeiten Merkmale der Familie sind, fallen ebenfalls weg. Allerdings ist es, unter ökonomischen Nutzenserwägungen betrachtet, heute offenbar widersinnig, in den sogenannten entwickelten Ländern noch Kinder in die Welt zu setzen. Kinder liefern keinen Gewinn, sie kosten mehr, als sie jemals einbringen, sie sind ökonomisch betrachtet unvertretbare Investitionen, die sich niemals amortisieren.
2.
Das heißt: Familie als auf Dauer angelegtes System gegenseitiger Hilfe und verantwortlicher Kontinuität passt nicht in die Marktwirtschaft und bietet anscheinend niemandem mehr einen rationalen Vorteil. Als eigenständiger Wert ist die Familie schon lange fragwürdig geworden, das lehrt u. a. die Theatergeschichte. Es scheint nun so, als würde, nach dem Ende des kommunistischen Projekts, der Kapitalismus selbst die Auflösung der Familie nicht nur geschehen lassen, sondern auch aktiv betreiben. Fieberhaft scheint die Gesellschaft daran zu arbeiten, die Bedingungen zu schaffen, durch die sie ohne dieses lästige und gefährliche und wirtschaftlich kontraproduktive Gebilde auskommen kann. War es zu Zeiten von Marx und Engels Mode, die Ökonomisierung der Familie anzuprangern, so ist es heute offenbar eher angesagt, ihre ökonomieresistente Seite als Anachronismus und Hemmschuh zu sehen und sich für deren Abschaffung einzusetzen. Zwangsbeziehungen, die man in keinem Fall verlassen darf, auch wenn sie nicht produktiv sind, und Verpflichtungen, die keine vertraglichen Ausstiegsklauseln haben, solche Bestandteile der Familienstruktur kann sich eine liberale Marktwirtschaft nicht leisten. Sie sind nicht zweckrational. Sie torpedieren das System und sind anachronistisch, denn sie widersprechen der Selbstbestimmung der Marktteilnehmer und dem freien Spiel der Kräfte. Soweit sie Voraussetzungen liefern für die Marktteilnahme, zum Beispiel indem sie Kinder auf die Anforderungen des Marktes vorbereiten, hat der Staat die Erfüllung solcher Aufgaben zu übernehmen, weil er für die Bereitstellung und Erhaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortlich ist. Soweit sich die traditionellen Leistungen der Familie durch den Markt regulieren lassen, sind sie wie alles andere dem freien Spiel der Kräfte zu unterwerfen. Dies ist, etwas zugespitzt, die Situation, in der wir uns gerade befinden.
3.
Die Familie ist entweder veraltet oder subversiv den Existenzbedingungen unserer Gesellschaftsordnung gegenüber. Sie ist an alte Werte gebunden und gleichzeitig so etwas wie eine antiökonomische Infragestellung der Grundlagen der Gesellschaft. Ihr Verschwinden ist möglicherweise nur eine Frage kurzer Zeit. Sie ist ja schon fast weg. Auch wenn wir dieses Verschwinden als Mangel verspüren und ein sentimentaler Wille zur intakten Familie unsere Sehnsucht und Sinnsuche bestimmt, treten an die Stelle der Familienbande immer häufiger Geschäftsbeziehungen von »Waisenkindern«. Die Funktionen und Bedürfnisse, die früher die Familie erfüllte, muss heute der Markt erfüllen. Tagesmütter, Ganztagsschulen, qualifizierte Kinderbetreuung, alles ist für Geld zu haben und alles kann von sich auf dem Markt anbietenden Fachkräften geleistet und/oder vom Staat produktiv organisiert werden. Für das tägliche Mittagessen und die Wohnungspflege stehen andere Fachkräfte zur Verfügung. Lohn für Hausarbeit ist seit langem eine seriöse, auch feministische Forderung. Die Verantwortung erwachsener Kinder für die Eltern und Großeltern wird durch Pflegeversicherung und spätere Abschiebung nach Mallorca oder in die Dritte Welt ersetzt, wo die zahlungskräftigen Alten die Freiheit haben, sich gleichaltrige Wahlverwandtschaften zu suchen oder Rundumbetreuung im Wellnessaltenheim zu buchen. Schmale Renten können in den armen Ländern kaufkräftiger gemacht werden und dort Arbeitsplätze schaffen. Das Ende der Familie und des Wohlfahrtsstaats lässt nur noch eine einzige Art von legitimer Hilfsleistung zu: Hilfe zur Selbsthilfe. Marktteilnahme von der Wiege bis zum Sterbebett.
4.
Diese Entwicklungen sind so ungeheuer wie ambivalent. Die Familie gilt vielen als beklemmende und anachronistische Institution, als ausgehöhltes Auslaufmodell. Die staatliche und/oder marktgesteuerte Alternative andererseits wirkt bedrohlich und unmenschlich: Sie vereinzelt, macht einsam und verbreitet Kälte. Liebe, Nähe, Zuverlässigkeit, Hilfe und Verantwortung für andere, wenn sie überhaupt zum Gegenstand von Kaufen und Verkaufen gemacht werden können, müssen sehr teuer bezahlt werden und müssen, anders als in der Familie, entsprechend den Marktgesetzen jederzeit ordentlich oder außerordentlich gekündigt werden können. Freiheit und Einsamkeit sind die Resultate dieses Wandels. Freiheit und Einsamkeit treten an die Stelle familiärer Sicherheit und Geborgenheit, aber auch an die Stelle familiärer Enge und familiären Terrors. Sieht so der Konflikt aus? Sind das die Alternativen? Wahrscheinlich nicht ganz, denn Sicherheit ist heute auch innerhalb der Familie nicht unbedingt garantiert. Eltern verweigern die Verantwortung für Kinder, die zu hässlich sind, um bei Deutschland sucht den Superstar aufzutreten, oder die das Gymnasium nicht schaffen. Im Extremfall lassen sie ihre Kinder zu Hause verdursten, während sie selber eine Woche auf Sauftour sind. Die Fähigkeit, Glückshindernisse zu verdrängen und sich momentane Entlastungen zu schaffen, indem eigene Verantwortlichkeit und unvermeidliche Verpflichtungen ausgeblendet werden, scheint zu wachsen. Kinder, die sich nicht rechnen und sich nicht selbst helfen können, haben schlechte Karten. Eltern, deren erwachsene Kinder nicht ausziehen, weil es zu Hause billiger ist, ebenfalls. Manche Eltern vergraben ihre überzähligen Babys lieber in Blumenkästen auf dem Balkon und manche Kinder stehen mit Messern vor der Haustür und erstechen die Eltern ihrer Freundin.
Es spricht einiges dafür, endlich das Ende dieser Verzweiflung produzierenden Institution zu betreiben, aber man sträubt sich trotzdem vehement gegen die Vorstellung, nun auch die Funktionen der Familie dem freien Spiel der Kräfte und der grenzenlosen Konkurrenz zu unterwerfen.
Aber wenn, wie René Pollesch behauptet, Liebe gleichzeitig echt und bezahlt sein kann, lässt sich das vielleicht auch auf die Familienliebe übertragen. Schließlich war die familiäre Bindung da, wo sie in der Vergangenheit funktioniert hat, häufig auch ein gutes Geschäft zum Vorteil für alle Beteiligten und ist es in ärmeren Ländern immer noch. Dort sind viele Kinder immer noch die einzige Lebensversicherung. Aber muss die Familie, wenn diese Vorteile nicht mehr zu sehen sind, nicht gemäß den Gesetzen der Warenproduktion verschwinden und durch ein besseres Modell ersetzt werden?
5.
Natürlich handelt es sich bei solchen Fragen um Spekulationen und Denkspiele. Ich breite sie hier aus, weil ich denke, dass das Theater, in seiner traditionellen Bezogenheit auf Familienthemen, derartige Spekulationen zulassen muss. Dagegen sträubt sich aber die Institution des Theaters bisher häufig. Im gegenwärtigen Theater – gleichgültig, ob es neue, alte oder ganz alte Stücke spielt – wird fast immer in einer Weise auf die Familie Bezug genommen, als hätte sich seit 2500 Jahren nichts Wesentliches geändert. Ich kenne nur wenige Stücke und Inszenierungen, in denen die hier thematisierten Entwicklungen wahrgenommen und explizit behandelt werden. Der Konflikt zwischen einer aufkommenden »Waisenkindergesellschaft« aus selbstbestimmten, aber einsamen Marktteilnehmern und dem Beharren auf einem nicht marktmäßig organisierten System menschlicher Bindungen und Verpflichtungen ist offenbar im Theater schwer zum Thema zu machen. Vielleicht weil das Theater seine eigenen Voraussetzungen mit den Voraussetzungen der traditionellen Familie analogisiert und sich nicht darüber stellen kann, gerät ihm dieser Konflikt aus dem Blickfeld. Ausnahmen gibt es dennoch einige, etwa Botho Strauß, der in seinem ersten großen Bühnenwerk, nämlich Groß und klein (1978), schon das Ende der Familie und die Probleme der vereinzelten Einzelnen nicht bloß als privates Ausnahmeunglück, sondern nahezu als gesellschaftlichen Normalfall beschrieben hat. Beziehungsunfähige Ich-AGs und Kinder ohne kontinuierliche Bezugspersonen bildeten schon damals das Personal. Auch Heiner Müllers Shakespeare- und Laclos-Adaptionen beschäftigen sich spezifisch mit dem modernen Zwiespalt der Familie. Die Elementarteilchen-Romandramatisierung von Johan Simons ist hier ebenfalls zu nennen. Und viele Stücke von René Pollesch, die alle nach dem Ende der Familie zu spielen scheinen und in denen Kinder, wenn überhaupt, als eigenwillige Aliens mit großem Risiko für den sehnsuchtsvollen Käufer vorkommen. Und gleichzeitig rufen die selbst Kinder gebliebenen Erwachsenen: »Ich will nicht scharf sein, ich will Fürsorge.«
Vielleicht regeln die unsichtbare Hand und das wohlverstandene Eigeninteresse doch nicht alles.
Anmerkung: Melinda Cooper weist in ihrem 2019 erschienenen Buch Family Values (Princeton University Press) auf einen in diesem Text vollkommen übersehenen Aspekt hin. Sie liefert den Nachweis, dass ausgerechnet der Neoliberalismus schon seit den 1970er-Jahren die Notwendigkeit von (auch gleichgeschlechtlicher) Ehe und Familie vehement betont. Um Sozialausgaben zu minimieren und dadurch Steuern zu senken, sollen soziale Versorgungsleistungen privatisiert werden, indem sie zur Aufgabe der Familie statt des Staates erklärt werden. So werden die Ehe für alle und die Solidarität in der Familie zu genuin neoliberalen Forderungen, die den Abbau des Sozialstaats flankieren. – Danke, Helene! (C. H. 2021)
Flucht in die Kunst
oder: Der ideale Staat
Eben mal zwischen Volksbühnenabwicklung, Dernierenmarathon, dem großen Abschiedsfest und der letzten Gastspielreise nach Avignon den idealen Staat entwerfen? Für Theater heute? Mit nicht mehr als 7500 Zeichen? Kein Problem: Dem Dramaturgen in seiner berufsbedingten Vermessenheit ist nichts zu schwer und diese Aufgabe gehört, bei der Vielfalt seiner Tätigkeiten, vielleicht noch zu den leichteren.
Den idealen Staat gibt es nämlich schon. Man findet ihn im Bienenstock oder im Ameisenhaufen. Da läuft’s doch. Alles ist perfekt geregelt und greift ineinander wie in einer gut geölten Maschine. Und alle menschlichen Entwürfe eines idealen Staats laufen auf eine solche maschinelle Konstruktion heraus. Friedrich Hölderlin, der nebenbei auch ein tiefschürfender Staatstheoretiker war, behauptete allerdings, dass man von einer Maschine keine Idee haben kann und vom Staat also genauso wenig. »Nur, was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee«, schreibt er mit Hegel im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Und Maschinen, die sich ja grundsätzlich durch Berechenbarkeit definieren und zuverlässig Erwartbares produzieren, schließen genau deshalb jede Freiheit aus. Der ideale Staat ist daher ein Unding oder ein Unfug. Der Staat ist lediglich »die raue Hülse um den Kern des Lebens«, sagt Hölderlin. Und das Gegenteil von Freiheit. Im Systemprogramm