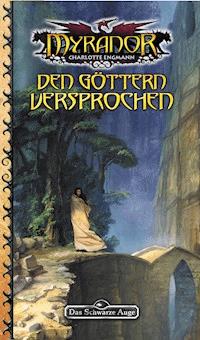
DSA 78: Den Göttern versprochen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Unvermutet in einen Strudel aus erschreckenden Visionen und heimtückischen Intrigen stürzend, muss die junge Heilerin Lycadia versuchen, das Geheimnis ihrer Herkunft zu lösen, bevor sie als Menschenopfer für eine seelenverschlingende Gottheit aus düsterer Vergangenheit endet. Aber kann sie sich auf ihre Gefährten in diesem Streit wirklich verlassen - auf den desertierten Myrmidonen Valorian, ihre katzenhafte Freundin RaoRi, oder auf Rishuran, den väterlichen Freund ihrer Ziehmutter? Und wie werden die Optimaten des Imperiums reagieren, falls es ihr nicht gelingt, ihre verbotenen Zauberkräfte in diesem Kampf um Leben und Tod geheimzuhalten? Einem ungleichen Kampf zwischen einer jungen Frau, die nach Antworten sucht, und der Sekte der Göttin des kalten Lichts. Oder wird sie Erijschu holen, noch bevor sie ihr Ziel erreichen kann - der gespenstische Kinderschreck aus den Tiefen des Meeres, der doch mehr zu sein scheint als eine Legende?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charlotte Engmann
Den Göttern versprochen
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 78
E-Book-Gestaltung: Nadine Hoffmann
Copyright © 2014 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 3-89064-579-8
...für meine Eltern und Renate, Verena,Rolf und Christei, Alex und vor allem für Linda, weil ich weiß, was sie tut.
1. Kapitel
Lycadia erwachte schlagartig. Ein Albdruck lastete auf ihrer Brust. Das Gefühl der Einsamkeit schnürte ihr die Luft ab. Sie spürte, der Tod stand vor der Tür,bereit, über die Schwelle zu treten.
Die junge Heilerin atmete tief durch, um den Schrecken zu vertreiben. Sie wusste, ihre Empfindungen entsprangen einem Albtraum, der sie seit ihren Kindertagen immer wieder heimsuchte. Zumindest nahm sie an, dass es stets der gleiche bedrückende Traum war, denn die Erinnerung verflüchtigte sich, sobald sie die Augen aufschlug. Nur der Drang, den Tod zu bekämpfen, blieb zurück und trieb sie an, ihren Patienten mit all ihrer Kraft zu helfen.
Ein hartes Klopfen an der Eingangstür schreckte sie auf. »Heilerin?«, rief eine gehetzt klingende Frauenstimme. »Heilerin!«
»Einen Moment!« Lycadia tastete sich zum Fenster, schob den Riegel zurück und öffnete den hölzernen Laden, um auf die nächtliche Straße vor ihrer Wohnung zu schauen. »Wer ist da?«
»Bitte, Heilerin. Wir brauchen Eure Hilfe.« Eine Frau kam von der Eingangstür unter das Fenster. Sie hob die Laterne, so dass Lycadia ihr Gesicht sehen konnte. »Mein Kamerad ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn Ihr ihm nicht helft.«
Lycadia zögerte. Es war nicht ungewöhnlich, dass jemand nachts an die Türe klopfte und um Hilfe bat. Früher war ihre Ziehmutter,die Heilzauberin Dha´veru, an das betreffende Krankenlager geeilt, aber mit dem Ende ihrer Ausbildung hatte Lycadia diese Pflicht übernommen.
Doch irgendetwas stimmte nicht mit der Bitte dieser Fremden. Ein verletzter Kamerad, das klang nach einem Soldaten der Stadtgarde oder der imperialen Streitkräfte - und die hatten ihre eigenen Heiler. Warum also kam die Frau zu ihr?
Aufmerksam musterte Lycadia die Fremde. Offensichtlich war sie eine Kämpferin, denn sie trug eine feste Ledertunika zu ihrem Schutz, sowie Schwert und Dolch an ihrem Gürtel. Ein Abzeichen, das ihre Einheit verraten hätte, fehlte jedoch.
»Wie heißt du?«, erkundigte sich Lycadia vorsichtig. »Und wo befindet sich dein Kamerad?«
»Ich bin Shiniope. Wir haben ein Quartier im Goldenen Luftwal.«
Lycadia zog die Augenbrauen zusammen. Die Kämpferin sah nicht aus, als könne sie sich ein Zimmer in einem so vornehmen Gasthaus wie dem Luftwal leisten. Vielleicht ist sie die Leibwächterin eines reichen Händlers, überlegte Lycadia. Oder sie und ihr Kamerad wurden als Wachen angeheuert, um die Gäste und ihr Gut zu schützen. Mit diesen Gedanken zufrieden beschied sie Shiniope: »Ich komme.«
Sie schloss das Fenster und schlüpfte aus dem Nachthemd. Rasch zog sie sich an und nahm den Mantel aus Varkenwolle, der sie vor der Kühle der Nacht schützen sollte. Als letztes griff sie nach ihrer Umhängetasche, in der sich die wichtigsten Heilkräuter und -tränke sowie Verbandszeug befanden.
Sie trat aus ihrem Zimmer in den kleinen Flur und öffnete die Wohnungstür, die auf die Straße der Garküchen hinausführte. Auf der Schwelle blieb sie stehen. »Zwei Argental jetzt und drei, wenn ich deinem Kameraden geholfen habe.«
Die Erfahrung hatte sie gelehrt, ihr Geld schon vorher zu verlangen. Konnte sie einem Patienten helfen, wurde sie oft zusätzlich belohnt, doch war die Behandlung langwierig oder gar erfolglos; gab es regelmäßig Streit um die Bezahlung.
Shiniope zögerte, ehe sie einen schmalen, schmucklosen Armreif von ihrem Handgelenk zog. »Ich habe kein Geld. Nehmt Ihr dies als Pfand, bis ich Euch bezahlen kann?«
Lycadia sah auf den silberglänzenden Armreif. Er war die geforderten fünf Argental vermutlich wert.»Einverstanden. «
Sie eilten durch die leeren Straßen; vorbei an den dunklen Umrissen der mehrstöckigen Mietshäuser, die drohend wie schlafende Drachen über ihnen aufragten. Nur vereinzelt störten die Schreie eines hungrigen Säuglings oder die lustschweren Stimmen zweier Liebender die Stille der Nacht.
Als Shiniope von der Hauptstraße in eine schmale Gasse abbog, erwachte Lycadias Misstrauen erneut. Verunsichert fragte sie sich, ob das Ganze nicht doch eine Falle war. Was, wenn Shiniope sie zu ihren Spießgesellen führte, die sie überfallen und versklaven wollten? In anderen Bezirken von Balan Cantara sicherlich, versuchte sie sich zu beruhigen, aber nicht hier in Basantia. Hier verschwindet niemand so einfach.
Die Gasse endete an einem alten Lagerhaus. Shiniope sah sich rasch um, dann zog sie die Tür auf. Dunkelheit lauerte hinter dem Eingang, ein unangenehmer Geruch stieg Lycadia in die Nase.
Sie griff in ihre Tasche und fasste nach einem Beutelchen Tarnaillenpulver,einem scharfen Gewürz, das in den Augen brannte und heftigen Niesreiz auslöste. »Das ist nicht der Goldene Luftwal«, sagte sie bestimmt.
»Verzeiht mir.« Shiniope sah ihr in die Augen. »Ich habe Euch angelogen, weil ich befürchtete, Ihr würdet sonst nicht kommen.«
Durch die offene Tür drang schmerzerfülltes Stöhnen. Lycadia merkte auf. Zwar hatte Shiniope ihr ein falsches Quartier genannt, aber dort drinnen brauchte wirklich jemand ihre Hilfe. Entschlossen trat sie über die Schwelle in die Dunkelheit.
Der Gestank von Blut und Schweiß nahm ihr fast den Atem. Wo das Licht von Shiniopes Laterne auf den Boden fiel, konnte Lycadia dunkelrote Flecken erkennen, die unzulänglich von einer dünnen Schicht Sand verdeckt wurden. Hier hatte zweifellos ein Kampf stattgefunden.
Aber wer gegen wen?, überlegte sie flüchtig, während sie Shiniope tiefer in das düstere Lagerhaus folgte, in dem unterhalb einer Zwischendecke ein paar zerschrammte Kisten und Fässer standen. Hinter diesen Behältern hatte die Kämpferin für ihren verletzten Kameraden ein notdürftiges Lager bereitet.
Überrascht starrte Lycadia ihren Patienten an. Er war ein Leonir, ein Angehöriger jener Rasse, die böse Zungen als Löwenmenschen bezeichneten. Das erklärt, warum Shiniope gerade an unsere Tür geklopft hat, dachte sie. Wie ihre Ziehmutter Dha´veru gehörte sie zu einer Gruppe von Heilern – dem Cirkel der Klingenden Alazeeren –, die sich vor allem mit rassenübergreifenden Erkrankungen beschäftigte. Nur dass ich noch nie einen Leonir behandelt habe.
Ohne sich ihre Unsicherheit anmerken zu lassen, kniete sie neben dem Verletzten nieder. Das ockerfarbene Fell, das seinen menschlichen Körper bedeckte, war struppig und verdreckt. Hellrote Abschürfungen und dunkle Prellungen überzogen seine Glieder, frisches Blut tränkte die behelfsmäßigen Verbände um Oberschenkel und Bauch. Es stand schlecht um den Leonir.
»Ich bin Heilerin, mein Name ist Lycadia«, sagte sie mit ruhiger Stimme, die ihre Sorge nicht verriet. »Wie heißt du?«
Der Verletzte wandte ihr sein Löwengesicht zu. Seine goldenen Augen blickten müde und verschwommen, dennoch brachte er ein verächtliches Schnauben zustande.
»Sein Name ist Groarhach.« Shiniope entzündete eine weitere Laterne, die an einem Pfeiler der Zwischendecke hing. »Er ist stumm.«
Lycadia nickte kurz. Soweit sie die Leonir kannte, war es besser, wenn sie ihr Mitgefühl für sich behielt. Sie wollte ihren Patienten nicht durch missverstandene Anteilnahme beleidigen.
»Was ist passiert?«, fragte sie stattdessen. Ihr fiel auf, dass Groarhach noch sehr jung war,nicht lange dem Knabenalter entwachsen. Trotz der stark ausgeprägten Muskeln wirkten seine Arme und Beine noch jugendlich schmal und lang.
»Er hat gekämpft.« Shiniope wies mit einem Nicken in den Hauptraum des Lagerhauses. Sie wollte weitersprechen, doch ein leises Grollen von Groarhach unterbrach sie.
Lycadia runzelte die Stirn. Der Magnat von Basantia hatte alle Gladiatorenkämpfe außerhalb der Bezirksarena verboten, dennoch kam es immer wieder zu heimlichen Veranstaltungen mit hohen Wetteinsätzen, in denen freie Gladiatoren und Krieger gegeneinander antraten.
Verärgert schlug die Heilerin ihre Tasche auf und legte ihre Sachen bereit. Alle Gladiatorenkämpfe, ob verboten oder erlaubt, widerten sie an. Niemals würde sie den Fuß in eine Arena setzen oder das Lob eines so genannten Helden des Sandes singen! Tag für Tag kämpf te sie um das Leben ihrer Patienten -da würde sie niemanden preisen, der für Geld tötete oder sich töten ließ.
»Ich brauche frisches Wasser«, wandte sie sich an Shiniope. So sehr sie auch Gladiatoren und ihr blutiges Handwerk verabscheute, sie verweigerte keinem ihre Hilfe. In ihren Augen waren alle Patienten gleich.
»Ich werde mich zuerst um deine Bauchwunde kümmern«, teilte sie Groarhach mit, nachdem Shiniope das Lagerhaus verlassen hatte, um am Brunnen Wasser zu holen. Sie streckte die Hand aus, um prüfend über das Fell des Leonir zu streichen.
Das Gesicht eines Mannes blitzte vor ihren Augen auf. Dunkle Haare wehten im Halbdunkel des Raumes. Eine glänzende Klinge raste auf sie zu. Das Klirren von Stahl auf Stahl schallte in ihren Ohren, begleitet von lautem Gejohle und Gejammer. Der Gestank von Schweiß und Blut stieg in ihre Nase, ebenso der Duft von Safran, Cuinana und Kerhi.
Als hätte sie sich verbrannt, zog Lycadia die Hand zurück. Sie schüttelte den Kopf, um die Bilder und Geräusche aus ihrem Geist zu vertreiben. Die Gerüche blieben, denn sie erfüllten die Luft des Lagerhauses.
Lautlos seufzend schob Lycadia eine unbändige Locke unter ihr Stirnband zurück. Was gerade geschehen war, war nichts Ungewöhnliches. Jedes Mal, wenn sie einen Sterbenden berührte, überkam sie eine Vision der Ursache seines bevorstehenden Todes.
»Gütige Satu, sieh gnädig auf diesen Mann herab«, betete sie leise. »Rette und schütze ihn.« Sie atmete tief durch und verschloss ihren Geist vor der unerwünschten Vision. Unbehelligt löste sie den Verband, unter dem eine lange, schmale Wunde zum Vorschein kam. Doch die Verletzung war weder lebensbedrohlich, noch schwer zu behandeln, wie Lycadia überrascht feststellte. Der Leonir drohte zu sterben, doch nicht an dieser Wunde. Es muss die andere sein, dachte sie mit steigender Unruhe. Was sollte sie jetzt zuerst tun?
»Ich werde die Wunde nähen«, entschied sie. Vermutlich bedrohten beide Verletzungen zusammen Groarhachs Leben und mussten so schnell wie möglich versorgt werden, egal in welcher Reihenfolge. Sie sah Shiniope an, die mit einem Eimer Wasser zurückgekehrt war.» Hilfst du mir bitte?«
Gemeinsam mit der Kämpferin verschloss sie die Wunde und legte einen neuen Verband an. Die Arbeit ging ihr leicht von der Hand, da sich Leonir und Menschen mehr im Aussehen und im Wesen unterschieden als bei der Behandlung von Schnittwunden.
Nachdem die Bauchverletzung versorgt war,wandte sich Lycadia Groarhachs Bein zu. Sie löste den festen Verband. Blut schoss aus der Wunde, lief warm und klebrig über ihre Hände.
»Renosterdung!« Hastig presste sie die Finger auf die verletzte Ader. Ihre Zuversicht verschwand schlagartig. Wenn sie jetzt einen Fehler machte, würde Groarhach unter ihren Händen verbluten.
Aber vielleicht kam bereits jede Hilfe zu spät. Zweifelnd sah sie den Gladiator an, während sie erneut einen festen Verband anlegte. Eben noch hatte er sich mannhaft jeden Schmerzenslaut verbissen, jetzt war er einer Ohnmacht nahe. Sein Atem ging flach und der Puls war kaum zu fühlen. Groarhach hatte zu viel Blut verloren. Er war dem Tod geweiht.
»Nein!« Lycadia ballte die rechte Hand zur Faust. Sie würde nicht tatenlos zusehen, wie ein Patient starb! Dha´veru wusste sicherlich Rat. Shiniope konnte zu der gemeinsamen Wohnung laufen ... und würde umsonst an die Tür klopfen. Siedend heiß fiel Lycadia ein; dass ihre Ziehmutter Dha´veru nicht zu Hause war. Kurz nach dem allabendlichen Regen war die Heilzauberin zu einem Patienten in einen anderen Bezirk gerufen worden.
Aber Dha´veru ist nicht die Einzige, die zaubern kann, dachte Lycadia trotzig. Sie blickte von Groarhach zu Shiniope und wieder auf den Gladiator. Entweder konnte sie seine Wunden auf die übliche Art versorgen und zusehen, wie er starb. Oder sie unternahm selbst etwas. Dha´veru hatte sie nicht nur die Wirkung der verschiedensten Kräuter gelehrt, sondern auch eine Reihe von Zaubern. Zweifellos war nun die Zeit gekommen, dieses Wissen anzuwenden.
»Während ich das nähe, wird er verbluten.« Sie sah Shiniope an. »Also werde ich ihm auf eine andere Art helfen. Du musst mir jedoch schwören, darüber Stillschweigen zu bewahren. Niemand darf jemals davon erfahren.« Sie bemühte sich um eine grimmige Miene. »Wenn einer von euch redet, werde ich alles abstreiten und euch beim Magnaten wegen unerlaubter Gladiatorenkämpfe anzeigen.«
Erst überrascht, dann misstrauisch erwiderte die Kämpferin den finsteren Blick, bis sie schließlich nickte. Sie legte die rechte Hand auf den Griff ihres Schwertes. »Ich schwöre.«
»Gut.« Lycadia atmete tief durch. Bis jetzt hatte sie ihre Fähigkeiten nur an verletzten Tieren erprobt; dies war das erste Mal, dass sie ihre Zauberkraft bei einem kulturschaffenden Wesen anwandte. Es wird nicht anders sein, sprach sie sich Mut zu. Ich werde die heilende Kraft des Humus rufen und damit Groarhachs Leben retten.
Sie verschränkte die Beine zu einem lockeren Schneidersitz und entspannte sich. Ruhig atmete sie tief ein und aus, fühlte ganz bewusst, wie die Luft ihren Körper erfüllte und wieder verließ. Mit jedem Atemzug versank Lycadia tiefer in sich selbst. Ihr war,als tauche sie in einem warmen Sumpf, als glitte sie in weiche Erde hinunter. Sie schloss die Augen. Wohlige Dunkelheit hieß sie willkommen. Langsam hob sie die Hände und begleitete mit ruhigen Gesten den bedächtigen Gesang, der leise über ihre Lippen quoll. Ihre Hände wogten wie Baumkronen im Wind, sie fuhren hin und her, nach rechts und links, dann vor und zurück, hinauf und. hinab. Sie tanzten gemächlich zu ihrem Gesang, der immer langsamer und unverständlicher wurde. Die Worte wichen lang gezogenen Silben. Lycadia fühlte, wie sie mit jeder Bewegung mehr Magie rief, wie sich die Kraft des Elements Humus um sie sammelte. Ihre Haut prickelte, so als liefen tausend Käfer darüber hinweg. Die Magie hüllte sie ein wie ein wärmender Mantel. Er legte sich fester und fester um sie. Sie spürte seine Umarmung, die sie plötzlich nicht mehr beschützte, sondern erdrückte. Ihr die Luft abschnürte.
Abrupt beugte sie sich vorwärts und legte die Hand auf Groarhachs verletzten Oberschenkel. Der Mantel aus Magie zerriss. Wie ein Erdrutsch brach die heilende Kraft des Humus aus ihren Händen und strömte in das verletzte Bein.
Als Lycadia fühlte, wie der Fluss langsam schwächer wurde, löste sie die Berührung. Wenn sie an dieser Stelle der Zauberei nicht vorsichtig war,würde auch die eigene Kraft ihren Körper verlassen und sie würde Groarhachs Leben mit dem ihrigen bezahlen.
Die Magie versiegte. Ihr Werk war vollendet. Lycadia atmete erleichtert auf.
»Ihr seid eine Heilzauberin«, flüsterte Shiniope ehrfürchtig »Ich danke Euch, auch in Groarhachs Namen: Wir stehen tief in Eurer Schuld, Serra Lycadia.«
Lycadia machte eine unwillige Geste. Der Ehrentitel stand ihr nicht zu. Dha´veru war eine echte Heilzauberin, kein adoptiertes Waisenkind mit einem bescheidenen Talent.
»Ich bin weit davon entfernt«, sagte sie rau. Sie bemerkte, wie Shiniope auf das hellbraune Stirnband starrte, mit dem Lycadia ihre kurzen, dunklen Locken zurückhielt. Das Verlangen, sich nach Hause in die Geborgenheit ihres Zimmers zu flüchten, wurde übermächtig. Hastig sammelte sie ihre Gerätschaften ein. Ihre Aufgabe war erfüllt. Die Blutung war gestillt und die Elementarkraft des Humus würde den Tod fern halten, während die Wunde vollständig verheilte.
»Sieh zu, dass er sich nicht bewegt«, wies sie Shiniope an. »Er braucht unbedingt Ruhe. Und viel Wasser.« Als sie sich erhob, wurde ihr leicht schwindelig. Nur noch rasch nach Hause, dachte sie benommen. Erschöpft verließ sie das Lagerhaus und eilte zu ihrer Wohnung zurück.
Valorian rückte seinen Waffengürtel zurecht, so dass seine Machira weiter hinten an seiner rechten Hüfte hing. Das Schwert mit der lang gezogenen, tropfenförmigen Klinge hatte sich im Kampf gegen den Leonir bewährt. Mit wahrhaft einem Schlag hatte Valorian sein Geld vervielfacht, da er als einziger auf seinen Sieg gewettet hatte. Wer rechnete schon damit, dass ein einfacher Menschenkrieger gegen einen der gefürchteten Leonirgladiatoren gewänne!
Der Krieger grinste. Von wegen unbesiegbar. Erstens wurden die Leonir von den meisten Menschen überschätzt und zweitens war sein Gegner jung und unerfahren gewesen; so ein richtiger Schlagfänger, den der Wechsel der Schwerthand völlig überrascht hatte. Nach diesem Sieg besaß Valorian jetzt das nötige Kleingeld, um eine Entlassungsmarke zu besorgen und sich endlich von dieser tausendfach verfluchten Tätowierung zu befreien.
Er trat an eine Anlegestelle und winkte einem schmalen Fährboot. Es war zwar schon spät in der Nacht, aber die Flussarme zwischen den einzelnen Stadtbezirken waren noch befahren, wenn auch spärlicher als am Tage. Unter den mehr als vierhunderttausend Einwohnern von Balan Cantara gab es genügend lichtscheues Gesindel, aber auch viele ehrliche Angehörige nachtaktiver Rassen wie Neristu und Amaunir, so dass die Stadt niemals zur Ruhe kam.
Er nannte dem Fährmann sein Ziel, gab ihm das verlangte Geld und wurde von dem vornehmen, ruhigen Basantia in den Bezirk der Neristu übergesetzt. Dort, auf dem felsigen Untergrund einer Landzunge, lebte das so genannte bleichblaue Volk, das lieber unter sich blieb und daher in Balan Cantara wie in allen Städten des Imperiums sein eigenes, reinrassiges Viertel bewohnte – den Nerenith.
Valorian erreichte einen Marktplatz, der sich entsprechend den Vorlieben seiner Erbauer in einem unterirdischen Gewölbe befand. Zwischen den Stützpfeilern reihten sich die Marktstände aneinander, an denen die Händler Gewürze, Schmuck, Nahrungsmittel und andere Waren feilboten. Vereinzelte Laternen tauchten das Gewölbe in ein schwaches, graues Licht. Obwohl es hier von Kaufwilligen wimmelte, war es weit ruhiger als auf anderen Märkten. Die Neristu waren ein stilles Volk, still in ihrer Art und still in ihrer Arbeit, die nicht selten verbotenen Wegen folgte.
An einem Marktstand mit betäubend duftenden Gewürzen blieb Valorian stehen. »Guten Abend«, grüßte er in Myranisch, der weit verbreiteten Handelssprache, »ich suche Jenoru, den Tätowierer.«
Er zwang sich, nicht auf die vier Brüste der Marktfrau zu starren, die unter ihrer locker geschnürten Weste hervorblitzten. Mit ihren vier Armen, der graublauen Haut und den drei senkrechten Schlitzen, die sie statt Nasenlöchern hatten, faszinierten ihn die Neristu von allen Völkern Myranors am meisten. Sie waren so ganz anders als die tierähnlichen Amaunir und Leonir und viel interessanter als die menschlichen Bansumiter oder Vinshina.
Für Augenblicke, die sich scheinbar ins Endlose dehnten, sah ihn die Nerista schweigend an. Unter ihrem Blick wurde Valorian unruhig. Wie um eine Erklärung zu geben, rieb er seinen nackten, linken Oberarm, wo knapp unter der Schulter die verachtete Tätowierung prangte.
»Keilgasse. Drittes Haus. Erster Stock«, sagte die Frau unvermittelt. »Neben der Goldschmiede.« Obwohl sie keine Miene verzog, glaubte Valorian, einen belustigten Unterton gehört zu haben. Er bedankte sich und verließ den unterirdischen Marktplatz.
Nach mehrmaligem Fragen fand er das dritte Haus in der Keilgasse und stieg in den ersten Stock hinauf, wo er ratlos an der Treppe stehen blieb. Das Innere des Gebäudes war ein düsteres Labyrinth aus Vorhängen, Wänden, Türen und Durchreichen. Wie sollte er Jenoru nur finden?
Neugierige Blick streiften ihn, während er unschlüssig auf dem Treppenabsatz verharrte. Er spürte die Missbilligung der Bewohner ihm gegenüber, dem Fremden in ihrer Mitte. Plötzlich wünschte er,in einem anderen Bezirk zu sein, und wäre am liebsten umgekehrt. Aber er brauchte nicht nur eine neue Tätowierung auf seinem Oberarm, sondern auch eine Entlassungsmarke, die ihm nur ein verschwiegener Neristu besorgen konnte.
Das helle Klingen eines feinen Hammers ließ ihn aufhorchen. Hatte die Marktfrau nicht gesagt, Jenoru wohne neben einer Goldschmiede? Valorian folgte dem glockenhellen Klang durch dunkle, verwinkelte Gänge, stieg erst ein paar Stufen abwärts, dann wieder aufwärts, musste einmal umkehren, da er in einer lichtlosen Sackgasse gelandet war,und erreichte schließlich einen Raum, der eine Goldschmiede beherbergte.
»Seid gegrüßt«, rief er einem Neristu zu, den er im Dämmerlicht ausmachen konnte. »Wo finde ich Jenoru, den Tätowierer?«
»Hinter dem Vorhang dort.«
Valorian wandte sich nach links, wo in einer Türöffnung ein Vorhang aus Holzperlenschnüren vor neugierigen Blicken schützte. Als er die Schnüre zur Seite schob, verriet das leise Klappern der Holzperlen sein Eintreten. Er betrat einen schmalen Raum, der von mehreren Lampen für neristische Verhältnisse ungewöhnlich hell erleuchtet wurde. Seine Wände waren bunt bemalt, offensichtlich mit Motiven für Tätowierungen, von kleinen Schmuckbildern bis hin zu körperdeckenden Gemälden. Beherrscht wurde der Raum von einem Werktisch, auf dem Farbtöpfe, Tätowiernadeln, Kreidestifte und andere Gerätschaften standen. Der Künstler selbst trat gerade aus einer zweiten Türöffnung an der gegenüberliegenden Seite der Werkstatt.
Valorian stutzte. Er kannte den Mann – aber nur als Hehler mit einem anderen Namen. »Du? Warum hast du nicht.«
»Du meinst meinen Zwillingsbruder.« Jenoru winkte dem Krieger, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. »Er sagte mit ein Mensch namens Valorian würde hierher kommen. Du bist derjenige?«
»Ja. Dein Bruder sagte, du seist der Beste in deinem Handwerk.« Valorian setzte sich und zeigte Jenoru seinen linken Oberarm, auf dem das Zeichen der verfluchten Einheit prangte, der er einst angehört hatte. Die Tätowierung zeigte eine zweistellige Zahl und das achteckige Symbol für Eis. »Das muss weg.«
»Ich verstehe.« Jenoru strich prüfend mit seinem oberen Paar Hände über die bemalte Haut, während er mit der rechten unteren Hand eine Lampe näher holte. »Das wird nicht einfach sein.« Geschwind zeichnete er die Tätowierung mit Kreide auf eine Holztafel. »Hast du eine Vorstellung, was du stattdessen haben willst?«
»Nein. Egal.« Valorian machte eine wegwerfende Geste. »Was lässt sich machen?«
»Etwas Großes mit dichten Flächen, würde ich vorschlagen. Ein Luftschiff der Vinshina vielleicht? Oder lieber ein bansumitisches Ornament?«
Valorian ließ den Blick über die Bilder an den Wänden schweifen. Einige waren schlichte Skizzen, mit ein oder zwei Farben gezeichnet, andere sehr aufwendig und bunt wie ein Regenbogen. Wilde und zahme Tiere waren zu erkennen, einzelne Blumen und ganze Landschaften, verschlungene Bänder und Symbole.
Eine Zeichnung fiel Valorian besonders ins Auge. Sie zeigte ein schuppenbedecktes Ungeheuer, teils Tiefseefisch, teils Neristu. Die Kreatur besaß einen ungefähr menschlichen Körper, doch wo bei einem Neristu das obere Armpaar saß, breiteten sich fledermausartige Flügel aus. Nadelspitze Zähne ragten aus einem riesigen Maul hervor und lange Stacheln krönten den wuchtigen Schädel.
»Was ist das?«
»Erijschu, der Mholurenschreck.« Jenoru ließ seinen Blick von Valorians Scheitel zu den Sohlen seiner Schnürstiefel wandern. »Ein Ungeheuer,das einst hier in den Gewässern des Louranath gelebt haben soll. Es frisst Mholuren und Kinder, die morgens nicht brav ins Bett gehen.« Er griff nach Kreidestiften, schwarz und blau und weiß und türkis. Seine vier Hände fuhren wie ein Sturmwind über das Blatt und die bunten Farben verschlangen die vorherige Zeichnung.
»Sehr gut.« Valorian gefiel die Idee, das Abbild eines neristischen Ammenmärchens auf dem Arm zu tragen. Dieses Ungeheuer sah Furcht einflößend aus – vielleicht versetzte es seine Gegner in Angst und Schrecken. »Wie lange wirst du dafür brauchen? Und was soll es kosten?«
»Mehrere Nächte«, erklärte Jenoru und nannte seinen Preis.
Sie feilschten eine Weile um die geforderten Argental, ehe der Neristu mit seiner Arbeit begann. Valorian biss die Zähne zusammen und dachte an andere, erfreulichere Dinge. Endlich würde er die Siedlung der chamäleonartigen Shingwa am Flussufer verlassen können und in einen von Menschen bewohnten Bezirk von Balan Cantara umziehen. Nur wohin? In Basantia lebten viele reiche Händler und vor allem die Honoraten, die Würdenträger von Stadt und Imperium, die gut für die Dienste eines Leibwächters bezahlten. Viel Geld und Gut gab es auch in Laternenhöh zu bewachen, einem vornehmen Viertel von Krysirenis, dem Westhafen von Balan Cantara.
»Ich nehme an, deine ...Trennung von den Myriaden fand nicht im gegenseitigen Einverständnis statt?«, unterbrach Jenoru mit gesenkter Stimme Valorians Überlegungen.
Der Krieger nickte langsam. Die Frage des Neristu hatte auf sumpfigen Boden geführt: Sein Abschied von den Myriaden, den Streitkräften des Imperiums, war im wahrsten Sinne des Wortes fluchtartig vonstatten gegangen.
»Es gibt da ein kleines Problem«, gab Valorian zu, in der festen Überzeugung, dass Jenoru neben dem Tätowieren noch einem anderen Handwerk nachging, wie etwa der Fälscherei; immerhin war sein Zwillingsbruder ein Hehler. »Ich habe meine Entlassungsmarke verloren.«
Sicherlich durchschaute Jenoru die Lüge, doch er ging nicht darauf ein. Immerhin war sein Volk berühmt dafür, Geheimnisse zu wahren. »Vielleicht kenne ich jemanden, der deine Marke gefunden hat«, meinte der Neristu mit unbewegter Miene. »Welcher Name und welche Myriade stehen denn drauf?«
Darüber hatte Valorian schon längst nachgedacht. Es war riskant, angeblich zu einer Myriade zu gehören, die er nicht kannte. Früher oder später würde jemand nach ehemaligen Kameraden fragen. Und so hatte er seinen Namen geändert, lange bevor er nach Balan Cantara gekommen war.
»Ich heiße Valorian. Und die Myriade ist die Sechzehnte Irreka.« Er wies auf seinen Oberarm, dessen Brennen und Stechen er tapfer ertrug. »Ich nehme an, ein Finderlohn wird erwartet?«
Zum zweiten Mal handelten sie, sprachen von einer Belohnung und den Schwierigkeiten, die ein Wiederfinden so mit sich bringen mochte. Als sie einig wurden, erlaubte sich Valorian ein zufriedenes Grinsen. Sein nächtlicher Ausflug war ein voller Erfolg: Er hatte bekommen, was er wollte, und es blieb sogar noch etwas Geld übrig für neue Kleidung und einen Ausflug in die Therme, ein Vergnügen, das er lange vermisst hatte.
Nerethero wusch Schmutz und Blut von seinen Händen. Er hasste es, sich in Asnarion mit dieser Bande von Piraten zu treffen. Der Weg hin und zurück war gefährlich und der Aufenthalt in dem Bezirk der Schurken und Halsabschneider nicht minder. Der Anführer der Roten Hand lechzte jedes Mal nach mehr Geld und wenn er das Maul noch weiter aufriss, würde Nerethero es ihm stopfen müssen. Genauso, wie er es bei diesem verräterischen Gardisten getan hatte.
Der Schreiber schnaubte verächtlich. Er goss das schmutzige Wasser fort und füllte die Waschschüssel erneut, ehe er aus der alten, verschlissenen Tunika schlüpfte und sich ganz säuberte. Was für eine jämmerliche Gestalt war der einst so stolze Gardist doch gewesen, verdreckt, versoffen und verlaust. Für einen Becher Wein hatte er einen Namen verraten, dessen Wichtigkeit er nicht mal erahnen konnte. Nun, der Verräter hatte seinen Lohn erhalten und Nerethero war mit seiner Suche fast am Ziel angelangt.
Er schaute zum kleinen Fenster, das hoch in der Wand der schmalen Kammer lag. Bald würde der Morgen heraufdämmern; es lohnte nicht, sich noch schlafen zu legen. Nerethro griff nach seiner guten Tunika im Grau der Familie Onachos, da fiel sein Blick zur Tür. Ein Mann stand im Durchgang.
Erschrocken zuckte Nerethero zusammen. Er hatte seinen Herrn Antamyrkhe Onachos nicht kommen hören. Und ihn fast nicht erkannt. Normalerweise bedeckte der Optimat wie alle anderen Angehörigen der Hohen Häuser sein Antlitz mit einer Triopta, einer Maske, die das Gesicht je nach Art halb oder ganz bedeckte und deren Stirn das Dritte Auge der Magier zierte. Doch in dieser frühen Stunde, in seinem eigenen Haus, zeigte Antamyr sein wahres Gesicht.
Nerethero hoffte, dass sein Herr sein Erschrecken nicht bemerkte. Der Optimat war blass wie der Mond. Seine Wangen waren eingefallen, die Augen lagen tief in den Höhlen, von dunklen Ringen schwarz umrandet. Antamyr wirkte zu Tode erschöpft. Dabei wusste Nerethero, der Mann stand in Wahrheit in der Blüte seiner Jahre - die Verbannung hatte ihn offensichtlich über seine Zeit hinaus altern lassen. Er sah aus wie ein Draydal, ein untoter Diener des namenlosen Schädelgottes.
Hastig senkte der Schreiber den Kopf, um dem Blick seines Herrn nicht zu begegnen. Kurz schien ihn Antamyr durchdringend zu mustern, dann verging das Gefühl und der Optimat fragte ruppig: »Was ist mit dem Kind? Hast du es endlich gefunden?«
»Es wurde von einem Gardisten mitgenommen, Exzellenz«, antwortete er.»Nicht von den Priestern der Oktade, wie wir zuerst angenommen hatten. Ich weiß auch den Namen des Mannes. Ihn zu finden, wird nicht schwer sein.«
»Du hast noch acht Tage Zeit.«
»Acht?« Verwundert sah Nerethero den Optimaten an. »Aber das Fest der Madharya ...«
Antamyr unterbrach ihn unwirsch. »Das Opfer wird diesen Neumond stattfinden.«
»Zu Neumond? Ist das denn die rechte Zeit?«
»Für dieses Ritual ja.« Mit einer Geste unterband der Optimat jeden weiteren Widerspruch. »Wenn du bis dahin das Kind nicht gefunden hast, wirst du seinen Platz einnehmen.«
»Sehr wohl, Exzellenz.« Nerethero verneigte sich, um den Zorn in seinen Augen zu verbergen. Er würde auf keinen Fall das Opfer auf Madharyas Altar werden, weder für dieses noch ein anderes Ritual. Er war weder so verrückt wie dieses Weib, das einst ihr eigen Fleisch und Blut als Opfer hergeben wollte, noch so von seinem Glauben besessen wie sein Herr. Antamyr glaubte noch an die Macht der Göttin, doch Nerethero hatte aus den Geschehnissen der Vergangenheit gelernt. Er wusste, wie ohnmächtig Madharya war. Schon damals, vor knapp zwanzig Jahren, hatte sie ihre Anhänger nicht vor dem Angriff der Brajansgarde beschützt. Die Stadtwache hatte ungehindert das Heiligtum überfallen, die Priester ermordet und die Gläubigen entweder ebenfalls getötet oder in alle acht Winde verstreut.
Antamyrkhe Onachos stand zu jener Zeit kurz vor der Priesterweihe. Er überlebte den Überfall, wurde verhaftet und in die Verbannung geschickt. Vor vier Jahren kehrte er dann zurück und begann in aller Heimlichkeit, Madharya wieder zu verehren. Mit Neretheros Hilfe versammelte er die Überlebenden von damals und neue Gläubige, um zu vollenden, was damals unterbunden worden war: Er würde sich zum Priester der Madharya weihen, indem er der Göttin des kalten Lichts das einst versprochene Opfer darbrachte. Ein unsanftes Rütteln an der Schulter weckte Lycadia. Mit verschlafenem Blick sah sie hoch in das vorwurfsvolle Gesicht ihrer Ziehmutter Dha´veru. »Es ist schon spät«, murrte die hagere Frau. »Steh auf.«
Lycadia unterdrückte ein Gähnen und setzte sich auf. Stechende Schmerzen schossen durch ihren Kopf, trieben ihr die Tränen in die Augen. Aufkeuchend presste sie die Hände auf die Schläfen.
»Lycadia, was hast du?« Dha´verus Stimme klang streng, aber Lycadia wusste, darunter verbarg sich auch Sorge. Die Heilzauberin behandelte ihre Patienten immer sehr bestimmt, um sicher zu gehen, dass diese ihre Anweisungen befolgten. Bei ihrer Ziehtochter und ehemaligen Schülerin machte sie keine Ausnahme.
»Nichts. Ich bin bloß müde«, wich sie mit einer Halbwahrheit aus. Sie wusste, die Kopfschmerzen waren eine Folge des Zaubers, der sie erschöpft und ihrer eigenen magischen Kraft beraubt hatte. »Während du gestern in Thalesipur warst, bin ich ebenfalls zu einem Patienten gerufen worden.«
»Kanntest du die Leute?«
Lycadia verdrehte die Augen. Seit sie mit ihrer Ausbildung zur Heilerin fertig war und keiner Aufsicht mehr bedurfte, warnte Dha´veru sie jedes Mal davor,nicht mit Fremden mitzugehen, vor allem nicht allein in der Nacht. Doch gestern war es ein Notfall gewesen; Groarhachs Leben hatte davon abgehangen.
»Nein«, beantwortete sie Dha´verus Frage leicht gereizt. »Aber es war dringend.«
»Nichts ist so dringend, dass du dich in Gefahr bringen solltest. Selbst hier in Basantia ist es nicht sicher. Du hättest Protero um Begleitung bitten können.«
»Ich habe nicht daran gedacht«, redete sich Lycadia heraus. Protero gehörte die Garküche nebenan. Er hatte ein Auge auf die junge Heilerin geworfen und hätte sie sicher gerne begleitet. Lycadia schüttelte sich. Vor ihm musste sie sich weit eher in Acht nehmen als vor einer fremden Kämpferin.
»Das nächste Mal wirst du es tun. Oder ich lasse dich nachts nicht mehr aus dem Haus.« Dha´veru unterstrich die Ernsthaftigkeit ihrer Worte mit einer Geste »Aber vielleicht sollte ich dich überhaupt nicht mehr allein arbeiten lassen. Du hast gezaubert!«
»Ich hatte keine Wahl. Er wäre sonst gestorben.« Mit einem Mal waren die Kopfschmerzen vergessen. »Es war eine tiefe Wunde, und ich habe sie mit der Heilenden Hand des Humus verschlossen, so wie du es mich gelehrt hast.«
»Nun gut.« Dha´veru richtete sich auf. »Ich vertraue darauf, dass du mir die Wahrheit sagst und dich nicht leichtfertig entschieden hast, einen Zauber zu wirken.« Sie wandte sich um. »Und jetzt steh endlich auf, die Arbeit wartet.«
Sie verschwand durch den Vorhang, der Lycadias Zimmer vom Flur abtrennte. Die junge Heilerin rieb ihre Stirn, um den wiederkehrenden Kopfschmerz zu lindem. Jedes Mal, wenn sie zauberte, überkam sie diese Qual, die erst im Laufe eines Tages abklang. Vermutlich meint Dha´veru deshalb, ich wäre noch nicht zum Zaubern bereit, dachte sie ärgerlich. Aber ich werde mein persönliches Wohlbefinden nicht über das Leben eines anderen stellen.
Von einem Regal über ihrem Bett nahm sie eine Phiole Lotosblütenessenz, die nicht nur als Parfüm diente, sondern auch Kopfschmerzen linderte. Sie tupfte sich je einen Tropfen davon auf die rechte und linke Schläfe und wartete auf die Wirkung, während sie sich ankleidete. Mit einem geflochtenen Gürtel schnürte sie die sandfarbene Leinentunika und bürstete ihre kurzen, schwarzen Locken.
Flüchtig berührte sie die schmale Narbe auf ihrer Stirn, als sie sich an das Staunen und die Ehrfurcht in Shiniopes Blick erinnerte. Große, reine Magie konnten allein die Optimaten wirken, die Angehörigen der Hohen Häuser. Nur in ihren Adern floss noch das Blut der Alten, jener legendären dreiäugigen Magier, die einstmals, vor langer, sehr langer Zeit, das erste Imperium gegründet hatten. Ganz bestimmt hatte Shiniope gestern Abend vermutet, Lycadia würde unter dem Stirnband das Dritte Auge verbergen, so wie es jeder Optimat unter seiner Maske besaß.
Lycadia legte die Bürste zur Seite und versteckte die sichelförmige Narbe wie üblich hinter einem schmalen Stoffband, um lästige Fragen und falsche Anteilnahme zu verhindern. Schon seit frühester Kindheit zeichnete sie diese Narbe, doch über deren Herkunft hatte Dha´veru sich bisher immer ausgeschwiegen.
Lycadia trat in den Wohnungsflur. Rechts von ihr lag die Eingangstür,links das Zimmer ihrer Ziehmutter. Eine schmale, steile Treppe führte in den ersten Stock, wo sich die Küche befand. Früher hatte Lycadia dort oben geschlafen, doch mit dem Ende ihrer Ausbildung hatte sie das Zimmer zur Straße hinbekommen, damit sie den Kunden, die nachts an die Tür klopften, antwortete.
Langsam stieg Lycadia die Treppe hinauf. Die Kühle der Nacht war schon verflogen und die Schwüle des Tages begann ihre Tyrannei. Es würde noch wärmer und feuchter werden, ehe mit Einbruch der Dunkelheit der allabendliche Regen einsetzte und Nebel und Feuchtigkeit aus der Luft spülte. Balan Cantara, die zweitgrößte Stadt des Imperiums, lag im Louranath, einem großen Sumpfgebiet, das die Landenge zwischen dem Meer der Schwimmenden Inseln und dem Thalassion bedeckte. Das ganze Jahr über hingen Nebel und Dunst über den sechzehn Bezirken der Stadt, die sich über zwei Landzungen und mehrere Flussinseln verteilten. Lycadia goss lauwarmen Tee in einen Becher und nahm einen Schluck. Dha´veru hatte recht: Es war Zeit, dass sie mit ihrem Tagwerk begann. Die ewig gleiche Hausarbeit wartete. Dann mussten frische Heilmittel hergestellt und die Kranken versorgt werden, die schon bald an die Türe klopfen würden. Außerdem wollte Lycadia am Abend nach dem verwundeten Groarhach schauen und anschließend ihre Freundin RaoRi besuchen, um ihr die gewünschten Fellfarben zu bringen.
2. Kapitel
Mit gleichmäßigen Zügen durchmaß Valorian das längliche Schwimmbecken der Lisanthero-Therme. Das kühle, saubere Wasser strömte um seinen Körper, erfrischend wie ein Schluck kalten Hirsebiers oder der Kuss einer Geliebten. Dieses Vergnügen hatte er seit seiner Ankunft in Balan Cantara am meisten vermisst. Zwar gab es im Umland reichlich Flussarme und sumpfige Teiche, für deren Benutzung er keinen müden Obulos bezahlen musste, in denen dafür aber wilde Tiere und giftige Pflanzen lebten und vielerlei Krankheiten ihre Brutstätte hatten.
Kurz vor dem Ende des Beckens beschleunigte er. Wie ein angreifender Ghurik schoss er aus dem Wasser,stützte beide Hände auf den Rand und zog sich in kraftvoller Bewegung aus dem Becken. Er strich sich das Wasser aus den Haaren und von der hellen Haut, auf der die unterschiedlichsten Waffen ihre Spuren hinterlassen hatten: Eine breite, rote Narbe stammte von einer Reiteraxt, die durch den Brustpanzer gedrungen war; drei parallele Kratzer auf seinem Bein zeugten von einem Kampf mit Amaunir und eine inzwischen weiß gewordene Schramme auf seiner Schulter von dem Angriff einer Fischforke.
Valorian ging zu der steinernen Bank am Rande des Wasserbeckens, auf der sein Handtuch lag. Im Vergleich mit den anderen Bädern von Basantia war die Lisanthero-Therme eine schlichte Anlage, die zum größten Teil von Gardisten und Wachsoldaten der reichen Häuser besucht wurde. Dadurch herrschte ein kameradschaftlicher, wenn auch etwas rauer Ton unter den Besuchern.
Während Valorian sich abtrocknete, bemerkte er, dass jemand ihn beobachtete. Schon zu oft hatten ihn Feinde im Dschungel belauert, hatten ihn ihre Blicke verfolgt, so dass er das beunruhigende Gefühl sofort einzuschätzen wusste. In der Gewissheit, hier und jetzt in keiner unmittelbaren Gefahr zu sein, trocknete er sich erst fertig ab, bevor er das Handtuch um die Hüften schlang und sich dem Beobachter zuwandte.
Es war ein kupferhäutiger Krieger mittleren Alters, mit gestählten Muskeln und bei bester Gesundheit. Seiner Haltung nach war er kein einfacher Soldat, eher ein Offizier oder Anführer einer kleinen Wache, die ein reicher Händler oder Honorat zum Schutz seiner Besitztümer unterhielt. Er stand im Eingang zum überdachten Teil der Therme, so dass Valorian auf dem Weg zu den Umkleideräumen an ihm vorbei musste.
Was er wohl von mir will?, überlegte der Krieger,während er sich langsam in Bewegung setzte. Von der Larantis-Therme drüben in Laternenhöh wusste er,dass sie von vornehmen Herren frequentiert wurde, die Leibwächter oder einen neuen Geliebten suchten. An einer Stellung der letzteren Art hatte Valorian kein Interesse, aber einen guten Schwertauftrag würde er nicht ablehnen.
»Du führst eine schnelle Klinge«, sagte der Fremde unvermittelt, als sie auf gleicher Höhe waren. Seine kupferfarbene Haut glänzte im Licht der Sonne, die sich jetzt zur Mittagszeit durch den üblichen Dunstschleier gekämpft hatte. Die mandelförmigen Augen und die kurz geschnittenen Haare waren dunkelblau, eine übliche Färbung bei den Bansumitern. Ebenso typisch für sein Volk waren die Schmucknarben, die Stirn und Wangen zierten.
Valorian blieb stehen und sah den Bansumiter wortlos an. Siedend heiß fiel ihm ein, dass er sich inzwischen auch ein paar Feinde in Balan Cantara geschaffen hatte. Vielleicht wollte dieser Mann für einen Kameraden irgendeine Scharte auswetzen. Doch Valorian ließ sich seine plötzliche Unruhe nicht anmerken.
»Ich hätte nie gedacht, dass du den Leonir besiegst«, fuhr der Fremde fort. »Ich bin Rishuran.«
»Valorian.« Er nickte kurz. Der Ma nn hatte ihn also bei diesem verbotenen Zweikampf in dem leer stehenden Lagerhaus gesehen. Er grinste. »Ich war der Einzige, der an meinen Sieg geglaubt hat.«
Rishuran lehnte sich gegen den Türstock und verschränkte die Arme, während er Valorian interessiert musterte. Seine Miene verfinsterte sich, wirkte noch bedrohlicher durch die dunklen Narben in seinem Gesicht. »Das klingt nach einer Absprache«, meinte er nachdenklich.
»Mit einem Leonir? Mach dich nicht lächerlich.« Niemand konnte einen Leonir überreden, einem anderen den Sieg zu überlassen. Sie waren die einzigen Gladiatoren, die sich nicht bestechen ließen, denn sie kämpften allein zu Ehren ihres Gottes Khorr. Absichtlich zu verlieren kam einer Gotteslästerung gleich. »Ich war einfach besser.«
Rishuran entspannte sich. Er deutete auf die Tätowierung auf Valorians linkem Oberarm. »Du bist ein ehemaliger Myrmidone. Warum bist du weg von den Myriaden?«
Valorian zögerte. Bis jetzt schien das Gespräch auf einen Schwertauftrag hinauszulaufen, vielleicht sogar eine Anstellung als Wachsoldat. Da wäre es unklug zu behaupten, er hätte Probleme mit seinen Vorgesetzten oder im Ausführen von Befehlen gehabt. »Die Freundin vom Hektagu war hinter mir her«,log er. »Und was machst du so?«
»Ich arbeite für Khyreta Serra Phraisopos.« Wieder musterte er Valorian prüfend. »Sie unterhält eine Hand voll Wachen für die Villa und die Lagerhäuser. Aber ich suche noch jemanden, der gelegentlich einen Auftrag für andere Familienmitglieder übernehmen würde.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause. »Aufträge, von denen die Matronin nichts erfahren darf.«
Valorian unterdrückte ein Grinsen. Die Matronin Khyreta diente dem Optimatenhaus Phraisopos und führte höchst erfolgreiche Handelsgeschäfte mit den Städten am Rande des Thalassions. Bei ihrer vielköpfigen Nachkommenschaft achtete sie streng auf Sitte und Etikette, doch ihre erwachsenen Enkelkinder galten als verwöhnt genug, um verbotene und exotische Vergnügungen zu suchen.
»Ich kann mein Maul halten«, sagte Valorian. »Je mehr Aureal, desto fester.«
Rishuran lachte auf. »Reden wir in der Taverne weiter.«
Die thermeneigene Schankstube lag am Rande des offenen Platzes, indessen Mitte das Schwimmbecken eingelassen war. Die beiden Männer setzten sich an einen Tisch im Schatten des Arkadenganges. Nachdem eine magere Schankmaid Kokoswein gebracht hatte, begann Rishuran: »Kleadorea, die Enkeltochter von Serra Khyreta, möchte morgen Abend an einem Fest teilnehmen, dessen Besuch die Matronin zweifellos verbieten würde.«
Valorian überlegte rasch. »Ihr braucht also einen Leibwächter, der die Dame zu dem Fest geleitet und sie später sicher nach Hause bringt. Und sie während des Festes diskret im Auge behält, ohne sich selbst zu amüsieren?« Als Rishuran nickte, erkundigte er sich: »Wo wird das Fest stattfinden?«
»In Thalesipur.«





























