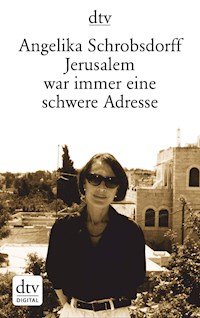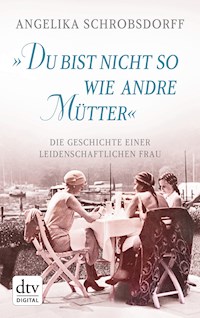
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Als Frau meiner Generation war ich etwas Neues, Ungewöhnliches und Suspektes. Ich fiel sozusagen aus dem Rahmen ...« Else Kirschner verbringt eine unbeschwerte Kindheit und Jugend in Berlin: Ferien an der See, Theater, Konzerte, Tanzabende, erste Liebe, frühe Ehe, Eifersucht und neue Leidenschaften. Doch dann: Verfolgung durch das NS-Regime, Flucht und Exil im fernen Sofia. Lebendig, ohne Pathos und mit feinem Humor erzählt Angelika Schrobsdorff von den zwei Leben ihrer Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Angelika Schrobsdorff
»Du bist nicht so wie andre Mütter«
Die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau
Du bist nicht so wie andre Mütter,
Hast keine alten Hände,
Keine weißen Haare,
Und Du umhüllst mich nicht mit
schwerer Sorgfalt.
Die erste Strophe eines Gedichts
von Peter Schwiefert an seine Mutter
Das ganz andere
Heute, am 30. Juni, ihrem Geburtstag, habe ich das schmale, hohe Büchlein aus meiner Truhe der Vergangenheit geholt. Es ist aus festem Karton mit schwarz-goldener Randverzierung und goldener Aufschrift.
LEBENSLAUF
UNSERES KINDES
ELSE
steht darauf.
Die Ecken des Buches sind ein wenig abgestoßen, sonst macht es den Eindruck, als sei es neu. Es ist 98 Jahre alt. Auch die ersten eingehefteten Löckchen des Kindes Else sind 98 Jahre alt und sehen aus, als wären sie vorgestern abgeschnitten worden. Sie sind braun, dann honigblond, schließlich, im Jahr 1897, kupferrot. Sind Haare etwas Unvergängliches? Werden sie nicht zu Staub? Sie fühlen sich seidig an unter meinen Fingerspitzen. Als ich Else, meine Mutter, kennenlernte, war ihr Haar bronzefarben und stark wie das einer Pferdemähne. Sie sah immer unfrisiert aus, auch wenn sie gerade vom Friseur kam. Die dichten, kurz geschnittenen Locken waren nicht zu bändigen. Es war nicht das Einzige an ihr, das nicht zu bändigen war. Ich hätte gerne ihr Haar geerbt und ihre Vitalität. Aber in diesen Punkten – und in noch einigen mehr – ist mein Vater bei mir durchgeschlagen.
O Gott, die ungereimten Gedanken, die mich beim Anblick des kleinen roten Buches überfallen, die Erinnerungen, die Sehnsucht! Sehnsucht nach der Vergangenheit, die ich gelebt habe, Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die ich nicht gelebt habe. Berlin um die Jahrhundertwende. Was stelle ich mir darunter vor? Eine heile, da vergangene Welt wahrscheinlich: Trambahnen und zweistöckige Autobusse von Pferden gezogen; Kopfsteinpflaster und Gaslaternen; solide, milchkaffeefarbene Wohnhäuser und »herrschaftliche« Villen in großen Gärten; Leierkästen, Blumen- und Obststände, Würstchen- und Zeitungsverkäufer; die ersten Warenhauspaläste; Ballsäle, Cafés mit Stehgeigern, elegante Speiselokale mit befrackten Obern, Varietés, Theater; Parks, in denen sich Grün auf Grün türmt, düstere Prachtbauten, eherne Denkmäler; der Kurfürstendamm und Unter den Linden, auf denen Herren im Stresemann und Damen mit Muff, blumenbewachsenen Hüten und hochgeschnürtem Busen auf und ab flanieren; und rings um die Stadt herum Seen, die Spree, Fichtenwälder, wohin man in Droschken fuhr, picknickte, ruderte, in Gartenlokalen mit flotten Militärkapellen Weißbier trank und Buletten aß.
Die Kindheitswelt meiner Mutter. War sie so? War sie heil? Es sieht danach aus.
»Ich war das kleine, geliebte Mädchen zärtlicher Eltern, jüdischer Eltern, die ja die zärtlichsten sind, die es gibt. Wir, mein drei Jahre jüngerer Bruder Friedel und ich, waren glückliche Kinder, denen es an nichts gefehlt hat.« So schrieb sie.
Die Lebenslaufeintragungen ihrer Mutter Minna fallen spärlich aus, und ich kann mir denken, warum. Minna hatte einen strengen literarischen Geschmack, und das Buch, das ihr wahrscheinlich eine ihrer zahllosen Verwandten geschenkt hatte, war gespickt mit peinlichen Gedichten, wie etwa: »Drauß blüht’s so prächtig/Alles steht in Duft und Glanz/Um die schaukelnde Wiege/Schweben die Engel in himmlischem Tanz.«
Überkandidelt nannte sie so was. Sie machte viel Gebrauch von diesem Wort. Ein Hut konnte überkandidelt sein, eine Person, eine Nachspeise, sogar ein Begriff. Die Vorstellungen, die sich mancherlei Menschen, besonders junge, von der Liebe machten, waren zum Beispiel vollkommen überkandidelt. Liebe zwischen Mann und Frau war nichts anderes als Einbildung. Die einzig große Liebe und das einzig wahre Glück einer Frau waren Kinder, und zu diesem Zweck ging man eine Ehe ein, eine vernünftige, von den Eltern überdachte und geplante Ehe. Was ging einen die Welt an, wenn man eine Familie hatte, in der man sich geborgen fühlte, die einen brauchte, für die man da sein musste und wollte, vom ersten bis zum letzten Tag.
Das war Minnas Einstellung, und das war die Voraussetzung, unter der sie den lustigen, warmherzigen Daniel Kirschner heiratete, der einen kleinen Bauch hatte, Augen wie Wassertropfen und ein Engrosgeschäft für Kleider, Blusen und Morgenröcke. Zwei Jahre später wurde Else geboren.
Die Geburtsanzeige, gewiss in einer jüdischen Zeitung erschienen und auf die erste Seite des roten Büchleins geklebt, ist bescheiden:
»Durch die glückliche Geburt eines munteren Töchterchens wurden hocherfreut
DANIEL KIRSCHNER UND FRAU MINNA, GEB. COHN
BERLIN, DEN 30. JUNI 1893«
Wie mag sie ausgesehen haben damals, die kleine, zarte Minna, die ich nie anders gekannt habe als in schwarzen Kleidern, aus denen allein die Hände und das Gesicht hervorragten, ein langes, schmales, von Skepsis und Melancholie verdüstertes Gesicht, das sich sofort aufhellte und leuchtete, wenn sie ihre Enkel um sich hatte. Sie trauere immer noch um ihren Sohn, hatte mir meine Mutter erklärt, sie käme nicht über seinen Tod hinweg. Siegfried, der glücklicherweise Friedel genannt wurde, war 1918 an der Spanischen Grippe gestorben. Ich habe nie ein Foto von ihm gesehen oder ein Wort von meinen Großeltern über ihn gehört, denn schon die Erwähnung seines Namens hätte sich auf Minnas Gemütsverfassung verheerend ausgewirkt.
Ich kann mir also kaum vorstellen, wie sie als junge Frau ausgesehen hat, in hellen Kleidern, ein übermütiges Lachen im Gesicht. Nein, übermütig war sie wohl nie, aber bestimmt zufrieden, denn ihr Leben, an das sie keine überkandidelten Ansprüche stellte, hatte sich ja in einer vernünftigen Ehe mit einem guten, sanften Mann und der Geburt eines gesunden Kindes erfüllt. Vielleicht war sie sogar heiter gewesen oder zumindest heiterer, eine Veranlagung zur Melancholie hat sie wohl immer gehabt.
Ihre Vorfahren kamen aus Spanien, und das sephardische Blut hatte ihr Äußeres geprägt: den hellen Olivton ihrer Haut, die fast schwarzen, mandelförmigen Augen, die Pracht ihres dichten, gewellten Haares, das sie, zu meiner Zeit, in einen dicken, eisengrauen Zopf auf ihrem Kopf feststeckte. Die gotische Schrift, mit der sie die wichtigsten Entwicklungsfortschritte ihrer Tochter in das rote Buch eintrug, ist so zart und ordentlich, wie sie selber war. Sie vermerkt Gewichtszunahme, Impfungen, den ersten Zahn, die ersten Schritte, die ersten Worte. Aus den Seiten mit dem Titel ›Tagebuch‹ erfahre ich, dass Elschen bereits mit zweieinhalb Monaten ihr erstes Kleidchen trägt, mit neun Monaten ihr erstes Trotzköpfchen aufsetzt, mit einem Jahr fotografiert wird – das Bild ist gut getroffen –, mit eineinhalb Jahren ›Anna Marie‹, ›Fuchs, du hast die Gans gestohlen‹ und ›Nun reibet euch die Äuglein wach‹ singt, mit zwei und einem Viertel Jahren den ganzen ›Struwwelpeter‹ auswendig aufsagen kann, mit viereinhalb Jahren in die Spielschule kommt und ihre erste Handarbeit macht, die recht niedlich gelungen ist.
Diese Notizen lassen bereits klar den vorgeschriebenen Lebensweg der kleinen Else erkennen. Sie wird vom Babyalter an auf eine wohlsituierte Ehe getrimmt, in der sie nichts anderes sein muss und darf als Weibchen und Mutter.
Es ist zweifellos Minna, die in der Familie den Ton angibt, und Daniel lässt es protestlos zu. Er liebt und achtet seine Frau, die ihm nie die Wärme und Zärtlichkeit gibt, die ihm mehr wert gewesen wäre als die tadellose Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten. Er anerkennt sie als die Gescheitere und Gebildetere, denn sie kommt aus einem weitaus besseren Haus als er. Sigmund, ihr Vater, war Arzt in Westpreußen, Aaron, sein Vater, Bäcker an der polnischen Grenze. Sie hatte fünf Geschwister und eine gute Erziehung, er hatte neun Geschwister und musste mit vierzehn Jahren die Schule verlassen. Sie hatte Bücher gelesen und Klavier gespielt, er hatte mit seinen acht Brüdern die Brote ausgetragen und im Synagogenchor gesungen. Seine Mutter war früh an der elften Entbindung gestorben, sein Vater, ein orthodoxer Jude, hatte tagsüber in der Bäckerei geschuftet und abends bis spät in die Nacht die Thora gelesen und den Talmud studiert. Nach vorzeitigem Schulabgang waren die neun Söhne in die Welt geschickt worden, damit sie, wo und wie auch immer, ein Handwerk lernten. Sie waren alle neun in dem vielversprechenden Berlin gelandet und hatten sich dort eine gutbürgerliche Existenz aufgebaut. Im Alter zog der fromme Vater ebenfalls nach Berlin, wo er bei einem seiner Söhne lebte. Er stellte mit Schaudern fest, dass seine in strenger Gesetzestreue erzogenen Kinder die Gebote des Herrn aufs ärgste vernachlässigten und sich von der gottlosen Zeit verführen ließen.
Ich kenne nur eine Geschichte über meinen Urgroßvater Aaron. Vermutlich war es die einzige, die Else, in ihrer Folgenschwere, nie vergessen hat. Sie muss sie mir irgendwann nach meinem dreizehnten Lebensjahr erzählt haben, denn davor hatte ich – und das durch meinen Vater – nur von einem Juden gehört – und der war Jesus.
Hier also die Geschichte: Mit viereinhalb kam Else in die sogenannte Spielschule und dadurch zum ersten Mal mit christlichen Kindern in Berührung. Die waren genauso wie sie, lachten wie sie, spielten wie sie, trieben Unfug wie sie, sprachen wie sie. Doch als sich Weihnachten näherte, trat eine Veränderung ein. Die Kinder sprachen anders als sie, sprachen nur noch über Dinge, von denen sie nie zuvor gehört hatte: vom Christkind und Weihnachtsmann, von Joseph, Maria und den drei heiligen Königen, darunter ein Mohr. Sie sprachen von Geschenken, Weihnachtsbäumen, Engeln, Christsternen und Krippen mit sämtlichem Zubehör: Jesuskindlein, das hochheilige Paar, Esel und Ochs.
»Lauter dummes Zeug«, sagte Minna, als ihre Tochter sie mit Mitteilungen und Fragen bestürmte, »hör nicht hin.«
Doch Else hörte hin, dachte an nichts anderes mehr, träumte davon. Kurz vor dem großen Fest wurde in der Spielschule ein Weihnachtsbaum aufgestellt und von den Kindern herrlich bunt und glitzernd geschmückt. Sie standen mit gefalteten Händen davor und sangen ein Weihnachtslied nach dem anderen. Else, die ja schon mit eineinhalb Jahren ›Fuchs, du hast die Gans gestohlen‹ singen konnte, schnappte die Lieder sofort auf und sang sie zu Hause ihren Eltern vor. Die zuckten bei dem »holden Knaben im lockigen Haar« zusammen und beschlossen, Else während derart gefährlicher Feiertage nicht mehr in die Spielschule gehen zu lassen. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Das Kind wollte unter allen Umständen einen Weihnachtsbaum. Es tobte und schluchzte so lange, bis die Eltern, zermürbt und selber den Tränen nahe, ein kleines Bäumchen anschleppten, dazu ein paar Kugeln und Lametta. Kerzen gab es keine, denn Daniel hatte panische Angst vor einem Brand und war in diesem Punkt fest entschlossen, den »Goyim naches« nicht nachzugeben. Als nun die Tanne, karg geschmückt, dastand und Else mit gefalteten Händen ›Stille Nacht, heilige Nacht‹ anstimmte, klingelte es. Daniel, Böses ahnend, lief zur Tür, spähte durchs Guckloch und sah einen aufgefächerten weißen Bart und einen großen schwarzen Hut. Wenn das kein Zeichen des Herrn war, was war es dann! Er rannte ins Zimmer zurück, packte das Bäumchen und warf es in die Besenkammer. Daraufhin warf sich Else auf den Boden und brüllte nach ihrem Weihnachtsbaum. Der Großvater, endlich hereingelassen, stand auf der Schwelle und betrachtete stumm und ernst die Szene: seine Enkelin, die vom bösen Geist besessen war, seinen Sohn, dem der Schweiß über das Gesicht lief, seine Schwiegertochter, die weiß wie die Wand war. Die Kleine sei vollkommen überkandidelt, sagte Minna schließlich, und das sei ja auch kein Wunder bei diesem ganzen Weihnachtsbaumrummel.
Überall Weihnachtsbäume, sagte Daniel, und jetzt habe das Kind Fieber und phantasiere.
Else wurde ins Bett gesteckt, und Minna setzte sich zu ihr und streichelte ihr heißes, verzweifeltes Gesicht. Es gebe Wichtigeres als Weihnachtsbäume, tröstete sie, und morgen würde sie die Chanukka-Kerzen anzünden.
Am nächsten Tag nahm Daniel seine Tochter auf den Schoß und weihte sie in das Judentum ein. Er erzählte ihr von einem Tempel im fernen Morgenland, der zerstört, und von einem Volk, das in die ganze Welt zerstreut worden war. Er erzählte ihr von einem einzigen Gott, der keinen weißen Bart und schon gar nicht einen Sohn hatte. Und der sei ihr Gott.
Else fand die Geschichte vom Christkind schöner, und ein Gott, der kein Gesicht und keinen Familienanhang hatte, sagte ihr auch nicht zu.
Es war der erste Sprung im heilen Leben der kleinen Else, und wenn sie überhaupt etwas verstanden hatte, dann das, dass sie aus merkwürdigen Gründen anders war als die Kinder in der Spielschule und darum nie mehr einen Weihnachtsbaum in der eigenen Wohnung haben würde.
Die Kirschners wohnten in Charlottenburg, in der Bismarckstraße. Es ist eine typische Berliner Innenstadtstraße: breit, gerade, lang, weder schön noch ausgesprochen hässlich. Von den alten Häusern habe ich nur noch eins entdeckt, ein behäbiges graues Bürgerhaus, in dem sich unten ein blaugekacheltes Fischgeschäft befindet. So ähnlich werden die Häuser damals alle ausgesehen haben, und die Straße mag schmaler, die Bäume mögen zahlreicher gewesen sein. Die Wohnung, in der Else von ihrer Geburt bis zu ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr wohnte, war sicher nicht viel anders als die mir später bekannte in der Grolmanstraße, die für mich der Inbegriff schutzbietender Gemütlichkeit war. Kann sein, dass sie etwas größer war und nicht im Parterre lag. Aber die schweren, schwarzen, mit Schnörkeln versehenen Möbel, die ja für sesshafte Generationen gezimmert waren, die Vitrine mit mehr oder weniger wertvollen Porzellanfiguren, Kristallgläsern und silbernen Sakralobjekten gefüllt, die bestickten Decken und gerüschten Gardinen werden schon da gewesen sein. Die Küche lag bestimmt zu einem quadratischen, mit etwas Gras und ein paar Bäumen bepflanzten Hinterhof hinaus, und der Herd, in dem Minna ihre Gans briet oder die mit Marmelade gefüllten Mürbeteigkreppchen buk, wurde mit Briketts gefüttert. Damals hatten die Kirschners noch ein Dienstmädchen, doch das wurde nicht an den Herd gelassen. Was verstand ein christliches Dienstmädchen schon von guter jüdischer Küche! Minna war eine überzeugte Hausfrau, und ich werde nie begreifen, warum sie nicht wenigstens einen Bruchteil dieser Überzeugung an ihre Tochter weitergegeben hat. Else war zeit ihres Lebens unfähig, ein essbares Schnitzel zu braten oder einen Besen richtig zu halten. Die einzige hausfrauenähnliche Tätigkeit, bei der ich sie einmal entdeckt habe, war das Auswaschen eines Taschentuchs, das sie dann zum Trocknen und Glätten an die Badezimmerkacheln pappte. Dieses Verfahren hat mir einen derartigen Eindruck gemacht, dass ich meine Taschentücher heute noch derselben Prozedur unterziehe und dabei jedes Mal kopfschüttelnd in mich hineinlache. Minna muss von dem Glauben durchdrungen gewesen sein, dass ihre Tochter die Partie machen würde, die ihr ein dauerhaftes Salondamen-Leben bescheren und sie nie in die Verlegenheit bringen würde, eine wie auch immer geartete Hausarbeit verrichten zu müssen. Oh, wie hat sie sich geirrt!
Else wuchs also als höhere jüdische Tochter auf, in einem warmen, sicheren Nest, über dem die Eltern mit ausgebreiteten Flügeln, scharfen Augen und spitzem Schnabel wachten; an der Seite ihres kleinen, geliebten und verzärtelten Bruders, in einem Clan mit zahllosen Onkeln und Tanten, Vettern und Cousinen. Sie war und blieb ein vergnügtes, gesundes, unkompliziertes Menschenkind, das vor Lebenslust und Übergewicht aus den Nähten platzte. Aber für Minna und Daniel wäre jedes Pfund weniger der Vorbote einer unheilvollen Krankheit gewesen, und darum achteten sie ängstlich darauf, dass ihr Elschen in Hülle und Fülle das bekam, was ihr besonders gut schmeckte. »Ein junger Mensch muss essen«, war ihre Devise, und damit legten sie den Grundstein zu Elses späterer Figur.
Ihre Pummeligkeit tat ihrem Charme jedoch keinen Abbruch. Unter dem Babyspeck zeichnete sich ein reizvolles Gesicht mit großen, klaren Flächen, riesigen dunklen Augen und einer schönen, kräftigen Nase ab. Ihr bronzefarbenes Haar, zu einem Zopf geflochten, hatte die Länge und Dicke einer Riesenschlange und machte ihr das Leben schwer.
»Nimm den Zopf nach vorne«, rief ihr jeden Morgen, wenn sie zur Schule ging, die Mutter nach. Minna war in ständiger Sorge um das Prachtstück, denn zu der Zeit ging in Berlin ein Bösewicht um, der den Mädchen hinterrücks die Zöpfe abschnitt.
Else lernte Klavier und Geige, bekam Privatunterricht in Französisch, wurde in Oper und Theater geführt und reich mit Büchern von deutschen Klassikern beschenkt. Sie ging in eine christliche Mädchenschule, da sich die in nächster Nähe befand und die Eltern eins der vielen Großstadtunglücke, die einem jungen Mädchen zustoßen konnten, mehr fürchteten als eine unjüdische Schulausbildung. Sie lernte leicht, musste sich nicht anstrengen, war eine gute Schülerin und bei Lehrern und Klassenkameradinnen sehr beliebt. Else muss in einer Zeit, in der ein Mädchen aus gutem deutschem Haus ein Höchstmaß an vornehmer Zurückhaltung und femininer Lieblichkeit zur Schau stellte, eine Offenbarung gewesen sein. Schon damals scherte sie sich nicht um Verhaltensregeln und war ein Ausbund an Natürlichkeit, Offenherzigkeit und Impulsivität.
Eine der wenigen Geschichten, die ich von ihr selber aus ihrem Leben zu hören bekam, beeindruckte mich so stark, dass ich sie noch heute Wort für Wort im Gedächtnis habe:
»Zum Schulabschluss«, erzählte sie, »veranstaltete meine Klasse eine kleine Vorstellung. Jede Schülerin musste irgendetwas darbieten, und ich beschloss, mein Lieblingslied ›Es war in Schöneberg, im Monat Mai …‹ zu singen, denn das brauchte ich nicht erst lange einzustudieren. Der große Tag kam, und ich zog mein schönstes Kleid an, mit lauter Spitzen, Rüschen und Volants, die mich noch dicker machten, als ich war. Dazu der dicke Zopf und ein Blumenkränzchen auf dem Kopf. Na ja, ich war sechzehn und bin vor nichts zurückgeschreckt. Der Saal war voll mit Lehrern, Eltern, Verwandten und Freunden. Vor meinem Auftritt hat ein wunderschönes, blondes Mädchen das ›Gretchen am Spinnrad‹ vorgetragen, und mir wurde etwas mulmig, weil ich sie so eindrucksvoll und schön fand und mir dachte: Dagegen hast du aber wenig zu bieten, liebes Kind! Als sie fertig war, haben die Leute geklatscht, aber nur kurz und gar nicht begeistert. Danach hab’ ich mein Liedchen gesungen und ein paar Schritte dazu getanzt. Es war ganz niedlich, aber nichts Besonderes. Ich verstehe bis heute nicht, was in die Menschen gefahren ist. Sie haben wie besessen applaudiert und ›bravo‹ geschrien und ›da capo‹. Ich musste das ganze Lied noch einmal singen, und zum Schluss habe ich mir den Kranz vom Kopf gerissen und ins Publikum geworfen. Na, da war was los!«
Es ist eine bezeichnende Geschichte, eine Art Leitmotiv, das sich durch Elses erste Lebenshälfte zog. Menschen, ob Männer, Frauen oder Kinder, flogen ihr zu, suchten ihre Nähe, ihre Wärme, ihre Liebe, ihre Freundschaft. Sie gab sie vielen, allzu vielen, gab aus dem Vollen, rückhaltlos, verschwenderisch, oft unbesonnen.
Ich habe mich immer wieder gefragt, was das Geheimnis ihrer Faszination war, habe Menschen, die mit ihr befreundet waren, befragt. Aber keiner, ich inbegriffen, konnte den Finger darauf legen. Gewiss, sie hatte ein schönes Gesicht, war klug, witzig, überströmend in ihrer Liebe, Vitalität und Großzügigkeit. Sie kannte keine Konventionen, keine Berechnung, keine Prätentionen. Aber das allein war es nicht. Sie hatte eine Ausstrahlung, die nicht mit physischen, menschlichen oder intellektuellen Gaben zu erklären ist.
Wenn ich sie mir oder anderen zu beschreiben versuche, dann komme ich immer wieder auf das Wort »echt« zurück. Sie war, in einer Welt des Selbstbetrugs, der Verstellung und Heuchelei, so echt und elementar, wie nur ein Geschöpf der Natur es sein kann. Und gleichzeitig hatte sie einen scharfen Intellekt, war in ihrem Denken viel schneller, beweglicher, selbständiger, als es Frauen der damaligen Zeit waren. Ja, sie war anders – nicht nur weil sie Jüdin war und dadurch einen gewissen exotischen, vielleicht sogar verbotenen Reiz auf ihre deutschen Mitbürger ausübte, sondern weil sie autonom war und ihrer Generation weit voraus.
Kurz vor ihrem Tod schrieb sie in ihrem letzten Brief an mich: »Als Frau meiner Generation war ich etwas Neues, Ungewöhnliches und Suspektes. Ich fiel sozusagen aus dem Rahmen, musste sehr stark sein und mir meine eigenen Gesetze machen. Keiner half mir dabei, im Gegenteil, man nahm mich im besten Fall als komisch hin, im schlechtesten als entartet.«
Die Kirschners beobachteten die Entwicklung ihrer Tochter mit Stolz und Besorgnis. Das Mädchen erregte zu viel Aufmerksamkeit, zeigte zu intensives Interesse an ihrer christlichen Umwelt, hatte Umgang mit Personen, von denen Minna so gut wie gar nichts hielt. Was, zum Beispiel, trieb sie so oft zu dieser überkandidelten Lilly, einer früheren Mitschülerin, über die sie anschließend verschrobene Geschichten erzählte: Lilly trage zu Hause ein indisches Gewand, zünde Räucherstäbchen an und deklamiere Gedichte, von denen sie, Minna, noch nie eine Zeile gehört hätte. Und Lillys Bruder schreibe Romane.
Was sie daran so schön finde, wollte ihre Mutter wissen, die indische Schmatte oder die bestimmt schlechten Romane?
Das Künstlerische, erwiderte Else, das Freie, das ganz andere. Minna schüttelte befremdet den Kopf. Als ob Else nicht genug Vettern und Cousinen hatte, junge, anständige Menschen, die auch nicht dumm waren. Einer war sogar ein Sprachgenie, und Selma, ein bildhübsches Mädchen, hatte eine herrliche Stimme und sang bereits auf privaten Veranstaltungen. Sie waren alle viel gefügiger als ihre Tochter, hatten nicht deren Flausen im Kopf.
Daniel, immer gutgläubig, meinte, das würde sich auswachsen, Elschen sei ja erst siebzehn Jahre alt und sehr lebhaft und neugierig auf das Leben, wie jeder junge Mensch.
Ja, Elschen war neugierig auf das Leben, aber hauptsächlich auf das der Christen. Ihr eigenes Milieu kannte sie zur Genüge, und je älter sie wurde, desto weniger gefiel es ihr. Es war das Milieu der sogenannten Konfektions-Juden, die beim jüdischen Großbürgertum als nicht gesellschaftsfähig, bei den jüdischen Intellektuellen als Banausen galten. Über sie schrieb Else: »Ich konnte die Leute unseres Kreises nicht leiden. Sie handelten alle mit Stoffen, Leder oder Pelzen, sprachen in einem so grässlichen Jargon und waren grob und ungebildet. Sie sagten mir: ich müsse eine gute Partie machen. Ich wurde wütend, wenn ich das hörte. Heiraten selbstverständlich, aber aus Liebe. Die gute Partie, das war so jüdisch, und ich konnte das Jüdische in dieser Beziehung nicht ertragen.«
Hätten ihre Eltern gewusst, was für furchterregende Gedanken sich in dem Kopf ihrer Tochter eingenistet hatten, sie hätten keine ruhige Minute mehr gehabt. Aber von Wissen konnte gar keine Rede sein, nicht einmal von einem vagen Ahnen. Für sie war es einfach nicht im Bereich des Denkbaren, dass Else, die sie dem Christentum so fern und dem Judentum so nah wie möglich erzogen hatten, sich ersterem nähern und vom letzteren entfernen könnte. Sehr vieles, was ihre Tochter in den kommenden Jahren tun sollte, war für sie nicht im Bereich des Denkbaren, und eine komplette Enthüllung ihres Lebenswandels blieb ihnen zeit ihres Lebens erspart. Else, der es vollkommen egal war, was die Leute über sie dachten, machte bei Eltern und Töchtern eine Ausnahme.
Aber damals, siebzehnjährig und noch ganz gute jüdische Tochter, lag auch für sie die weite, freie, christliche Welt im Bereich des Unmöglichen, und der Sog ins andere Lager erschöpfte sich in Phantasien und Träumereien. Nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, ernstlich an einen Ausbruch aus ihrem Milieu zu denken, auch wenn es ihr nicht behagte und sie an vielem Anstoß nahm. Sie liebte ihre Eltern und ihren jetzt dreizehnjährigen Bruder, einen sanften, stillen Jungen mit einer ungewöhnlichen Begabung für Mathematik; sie hing an ihren warmherzigen Onkeln und Tanten, Vettern und Cousinen; und wenn sie auch von der jüdischen Religion wenig Gebrauch machte, so war sie doch im Bund mit jenem Gott, den ihr Vater »ihren Gott« genannt hatte. Was ihr fehlte und was sie irrtümlich nur auf der christlichen Seite zu finden glaubte, war eine anregende geistige Atmosphäre. Sie las sich quer durch die Leihbibliothek, wurde auch von den Eltern dazu ermuntert, aber dann, in ihrem Bedürfnis, über das Gelesene zu sprechen, zu diskutieren, belehrt zu werden, alleine gelassen. Minna las ausschließlich Shakespeare und Goethe, Daniel die Zeitung. Minna wollte auch nur Theaterstücke von ihren Lieblingsdichtern sehen, während Daniel Komödien oder Stücke mit jüdischem Sujet bevorzugte. Minna ging gerne ins Konzert, Daniel in die Oper. Oft konnten sie sich nicht einigen und ließen es bleiben.
Else wäre am liebsten jeden Abend in Oper, Konzert oder Theater gegangen, und sie hätte so gern einmal alleine die ganze Stadt Berlin durchstreift.
Berlin, das in rasendem Tempo wuchs, sich immer weiter in die märkische Landschaft hineinfraß, ein sich ständig wandelndes, immer aufregenderes Gesicht zeigte: neue Straßen, Boulevards, Avenuen, neue Viertel, neue Bauten, neue Kunstwerke, neue Warenhäuser, neue Lokale und Amüsierbetriebe, neue Kulturgebäude, neue Verkehrsmittel, neue Geräusche, neue Gerüche. Eine Zweieinhalb-Millionen-Stadt in pausenloser Betriebsamkeit, zweieinhalb Millionen Menschen, von denen jeder ein anderes Leben führte, ein anderes Schicksal hatte; Menschen, die durch die Straßen schlenderten, liefen, hetzten, hinter deren Fenstern sich Geheimnisse verbargen, Dramen, Geburten, Tod, Liebesstunden, Langeweile. Eine Stadt, mit der Else sich verwachsen und verwandt fühlte, die sie erforschen wollte, weit über die Grenzen, die ihre Eltern gesteckt hatten, hinaus.
Was kannte sie schon von Berlin? Charlottenburg und seine unmittelbare Nachbarschaft, die berühmten Straßen, auf denen man promenierte, die Sehenswürdigkeiten, zu denen man am Sonntag pilgerte, Potsdam und Grunewald, wo man gemächlich spazierenging, das Schloss, den Charlottenburger Park, den Zoologischen Garten, das Konfektionsviertel, in dem ihr Vater sein Geschäft hatte, das Lieblingscafé ihrer Eltern, ein gigantisches, zweistöckiges Etablissement, in dem langweilige Musik gespielt wurde und langweilige Leute Kuchen aßen. Musste sie zu irgendeinem Zweck in ein weiter entfernt gelegenes, ihr unbekanntes Viertel, begleiteten sie Mutter oder Vater, Onkel oder Tante, und man ging schnurstracks, ohne nach rechts oder links zu sehen, auf das Ziel los und genauso wieder nach Hause. Manchmal wagte sie heimliche Ausflüge in die belebten Geschäftsstraßen, in denen es wimmelte und lärmte: Menschen aller Schichten, vom Laufmädchen bis zur pelzverbrämten Frau Kommerzienrat, vom Bettler bis zum feisten Fabrikanten; Fahrzeuge, vom Pferdewagen bis zum Automobil; Geschäfte, vom Kramladen bis zum Warenhauspalast; Lokale, von der Bierbudike bis zum Nobelrestaurant.
Das Leben, das sich in immer neuen Bildern vor ihr ausbreitete, faszinierte Else; die Blicke, die ihr junge Männer zuwarfen, gefielen ihr. Manchmal erwiderte sie einen, kurz, verlegen und mit dem beklommenen Gedanken: O weh!, wenn Mutter wüsste, wie verworfen ich bin.
Ich habe aus dieser Zeit ein Bild von ihr. Ein junges, hübsches, immer noch unfertiges Mädchen, das der Fotograf in eine neckische Pose gesetzt hat: Der dicke Zopf hängt über ihrer rechten Schulter, der Kopf ist nach links geneigt, sie lächelt und drückt ein Blumensträußchen an die Brust. Minna wird das Bild gut getroffen gefunden haben, denn es drückte die Vorstellung aus, die sie von ihrer Tochter hatte: ein süßes Mädchen, unschuldig und etwas schelmenhaft, das nun bald in den sicheren Hafen der Ehe einlaufen und ihr Liebe, Enkel und damit neues Glück schenken würde.
Männer, jüdische natürlich, begannen Else den Hof zu machen. Einer ihrer Vettern verliebte sich kopflos in sie und versetzte den Kirschner-Clan damit in Aufruhr. Ein junger Rabbiner schrieb hymnische Gedichte auf ihre Augen. Zwei »gute Partien« machten ihr Heiratsanträge.
Else fühlte sich von all dem geschmeichelt, fand es abwechslungsreich, interessant, manchmal komisch und wartete auf die Liebe.
»Wir haben ja noch Zeit«, sagte Minna zu Daniel, »erst ab zwanzig wird’s brenzlig.«
Else war neunzehn, als sie Fritz Schwiefert begegnete und damit der größten Liebe und der schlechtesten Partie ihres Lebens.
In einem langen, undatierten und nie abgeschickten Brief, von dem ich bis heute nicht weiß, wann sie ihn geschrieben hat, ruft sie sich noch einmal den Anfang dieser Liebe ins Gedächtnis: »Du warst ein Christ, ein Poet, ein junger Mann ohne richtigen Beruf und ohne Geld. Du warst ein Mann, den man liebte, ein Künstler, aber kein Ehemann. Ehemänner sahen ganz anders aus, waren ganz anders, boten einem ganz andere Dinge – materielle, nicht geistige.« In anderen Worten, Fritz, der Auserwählte, war für Daniel und Minna Kirschner eine Katastrophe, wie nur Aaron, der fromme Großvater, sie hätte voraussagen können. Doch das ganze Ausmaß dieser Katastrophe entdeckten sie erst zweieinhalb Jahre später, denn so lange wussten Fritz und Else ihre Liebe zu verbergen.
Sie begann im Sommer, an einem Samstagnachmittag in dem Stammcafé der Kirschners, jenem gigantischen, zweistöckigen Etablissement, in dem langweilige Musik gespielt wurde und langweilige Leute Kuchen aßen.
Else hatte sich zuerst geweigert, zum hundertsten Mal »Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmre, flimmre …« zu hören, war dann aber, als ihr die Eltern sagten, ihr Lieblingsvetter, Emanuel, würde auch hinkommen, mitgegangen. Sie hatte verdrossen das spießige Publikum betrachtet und sich dabei vorgestellt, wie sie dort in einigen Jahren sitzen würde, eine fette, die Leere mit Schlagrahm füllende Matrone, an der Seite einer »guten Partie«. Emanuel erschien in Begleitung eines langen, dünnen, etwa 25-jährigen Mannes, den er als Fritz Schwiefert, seinen Freund und ehemaligen Kommilitonen vorstellte. Man saß nun zu fünft um den runden Tisch mit graumelierter Marmorplatte und machte artig Konversation. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass Herr Schwiefert Klavier spiele, Russisch spreche und Gedichte schreibe, nebenbei Theaterkritiken und zurzeit ein Buch über Rilke. Während Fritz sprach, fröhlich, liebenswürdig, eine Spur ironisch, sah er Else unverwandt an, und sein Blick, mehr aber noch seine Eröffnungen, waren wie die Anschläge einer mächtigen Glocke, die sie in ihrem unberührten Inneren erzittern ließen.
»Und da saßest Du«, schrieb sie in demselben nostalgischen Erinnerungsbrief, »ein wahrhaftiger Poet, und ich verschlang Dich mit hungrigen Blicken: Dein feines, kluges Gesicht mit den grauen Augen, der großen Nase, dem schönen, ein wenig spöttischen Mund; Dein langes, braunes Haar, das Dir immer in die Stirn fiel, Deine schmalen, hellen Hände.«
Minna plauderte, Daniel machte seine üblichen Witzchen, die Kapelle spielte ein Potpourri von Paul Lincke, und Emanuel, der Einzige, der merkte, dass etwas Unheilvolles im Gange war, versuchte Fritz und Else aus der Hypnose zu wecken. Es gelang ihm nicht. Die beiden saßen da, sprachen kein Wort miteinander und sahen sich an.
»Ein sehr sympathischer und kultivierter junger Mann«, sagte Daniel auf dem Heimweg, und Minna fragte Else, warum sie so still sei, sie habe sich doch nicht etwa erkältet.
Else erwiderte, ja, sie fühle sich etwas angegriffen, und zog sich zu Hause in ihr Zimmer zurück. Sie schaute lange in den Spiegel, aber was sie sah, überzeugte sie nicht. Hübsch war sie ja, aber das war auch alles. Ein Mann wie er, ein Poet, ein Künstler, hatte Ansprüche, die sie, ein unbedarftes, bürgerliches Mädchen, nie erfüllen konnte. Er war ein Trugbild gewesen, eine Halluzination, die ihre Sehnsucht nach dem »ganz anderen« heraufbeschworen hatte. Niemals, so glaubte sie, würde sie ihn wiedersehen.
Am nächsten Tag erhielt sie das erste Gedicht von ihm.
»Ich fand es sehr schön«, schrieb sie, »verstand es aber nicht ganz. Es lag so etwas Schweres, Melancholisches darin. War Liebe denn nicht heiter?«
Fritz Schwiefert kam aus einem unbürgerlichen Haus. Sein Vater, schon einige Jahre tot, war Musiker gewesen, seine Mutter, eine zierliche, bunt geschminkte Dame, kam aus Frankreich. Luzie, die einzige ältere Schwester, war Mutter von drei Kindern und geschieden, nachdem ihr Mann sie mit Syphilis angesteckt hatte.
Fritz, ein nervöser Intellektueller, ein begabter Träumer, ein charmanter, geistreicher und gebildeter Wirrkopf, durfte tun und lassen, was er wollte. Er tat oft das Falsche und ließ das Richtige, aber das nahm ihm, in Anbetracht seiner geistigen und künstlerischen Gaben, keiner übel. Am wenigsten Else, die, in naiver Anbetung alles »Künstlerischen«, den unausgegorenen Fritz bei weitem überschätzte.
»Was ich mit allen meinen Kräften zu ergründen suchte«, schrieb sie, »was ich unablässig mit meinen Gedanken umkreiste, das war die künstlerische Begabung. Nichts konnte mich mehr erschüttern als ein Kunstwerk, nichts mir mehr Respekt und Hochachtung abnötigen als ein begabter Mensch. Er schüchterte mich derart ein, dass ich mir klein und minderwertig vorkam und wieder und wieder die Frage stellte: Wie sieht es in einem Menschen aus, der Musik komponieren, der malen, der dichten kann? Was denkt er? Wie lebt er?«
Diese Frage sollte ihr von Fritz nachhaltig beantwortet werden. Allerdings zu spät.
Es war für beide die erste Liebe, und obgleich sie bei Fritz sehr tief ging, war sie mit der Elses nicht vergleichbar. Sie war typisch männlich: fordernd, triebbetont, eifersüchtig, egoistisch, leicht verletzbar, oft unduldsam. Für Else dagegen, die in der Falle elterlicher Liebe, Fürsorge und Prinzipien Kind geblieben war, war sie die Erfüllung ihres Lebens. Denn Fritz war ja nicht nur der geliebte Mann, der sie das Küssen lehrte und ihr die Freuden der Erotik nahezubringen versuchte, er war der Lehrmeister, der ihr sagte, welche Bücher sie lesen, welche Musik hören, welche Theaterstücke und Bilder sie sehen müsse; er war der geistige Führer, der sie in Form, Kunstrichtung und Gehalt eines Werkes einweihte, ihr Beurteilung und Kritik beibrachte, ihren instinktiv sicheren Geschmack weiterentwickelte; kurzum, er war es, der ihr das Tor zur weiten, herrlichen Welt christlicher Liebe, Kunst und Kultur öffnete.
Sie trafen sich heimlich auf ein, zwei Stunden, deren Verlauf Else vor ihrer Mutter vertuschen konnte; sie trafen sich in kleinen Konditoreien und Parks, saßen Hand in Hand auf abgewetztem Plüsch, standen eng umschlungen hinter Büschen, hockten, großen Vögeln gleich, auf verschneiten Bänken. Sie schrieben sich täglich postlagernde Briefe, manchmal nur Zettel, in denen sie sich ihrer Liebe versicherten:
»Mein Pitt, ich will gar nicht viel schreiben, ich will Dir nur zeigen, dass ich an Dich denke. Pitt, ich hab’ Dich so lieb! Ich küsse Dich, mein Pitt!
Deine Babuschka
P. S. Es sind noch genau 49 Stunden, bis wir uns sehen!«
Aus Else war Babuschka geworden, aus Fritz Pitt, zwei neue Namen, zwei neue Menschen, in größter Heimlichkeit geboren, namenlos für den Rest der Welt.
Fritz, besonders aber Else, hatten es schwer. Sie, die ihre Liebe am liebsten von den Dächern geschrien und mit jedem nur und immer wieder darüber gesprochen hätten, waren zum Schweigen verurteilt. Sie hatten keinen Vertrauten, keine Zuflucht, nicht einmal genügend Geld, um ihre knapp bemessene Zeit etwas stimmungsvoller zu gestalten. Und jedes Rendezvous glich einem Hindernisrennen, das Else lange Überlegungen kostete, Erfindungsgabe, List und Schliche.
Wie lange das noch so weitergehen solle, fragte Fritz nach etwa einem Jahr an einem kalten Regentag im Park, ob sie den Rest ihres Lebens in Konditoreien und auf Parkbänken verbringen wollten?
Else, sofort eingeschüchtert, wenn er ungeduldig wurde, wusste keine Antwort. Sie griff nach seiner Hand, aber er entzog sie ihr und schob sie in die Manteltasche.
Er verstehe nicht, sagte er, wie ihre Eltern derart rückständig sein könnten. Immerhin sei sie ein erwachsener Mensch und lebe im 20. Jahrhundert in Berlin und nicht im 16. Jahrhundert in einem polnischen Stedtl, in dem er als säbelschwingender Kosake eingeritten sei. Oder ob sie, Else, das Verhalten ihrer Eltern billige?
Sie schüttelte den Kopf.
Dann solle sie jetzt zu ihm nach Hause in sein Zimmer kommen und sich den Teufel darum scheren, ob es ihr Vetter Emanuel durch seine Mutter oder Schwester erführe. Oder sie solle ihn mit in ihre Wohnung nehmen und ihren Eltern sagen, dass sie es satthätten, im Regen zu sitzen. Er fände diesen ganzen Klimbim mit Juden und Christen jetzt gar nicht mehr komisch. Benähmen sich die einen einigermaßen normal, spielten die anderen verrückt und umgekehrt.
Else begann zu weinen. Sie hatte ständig Angst: Angst, ihn zu irritieren, wenn sie über alltägliche Dinge schwatzte, Angst, ihn zu enttäuschen, wenn sie auf eine tiefsinnige Frage keine kluge Antwort wusste, Angst, ihn zu verärgern, wenn sie ihn daran hinderte, ihre Bluse aufzuknöpfen, Angst, ihn zu verdrießen, wenn sie ein Rendezvous absagen musste, Angst vor seiner Ironie und Reizbarkeit, Angst vor seinem Drängen und Begehren, Angst vor seinen ständig wechselnden Launen.
»Immer warst Du anders«, schrieb sie, »mal kleiner Junge, mal eindringlicher Lehrer, mal verträumter Dichter, mal übermütiger Komödiant, mal verständnisvoller Freund und oft auch unverständlicher Mann, der aus heiterem Himmel mürrisch, böse, unerträglich werden konnte. Wie furchtbar wurde ich mir dann Deiner himmelweiten Überlegenheit bewusst, wie hilflos war ich und wie verzweifelt. Aber nie lehnte ich mich dagegen auf. Künstler müssen eben so sein, sagte ich mir, und die merkwürdigen Vorgänge in ihnen nicht zu verstehen erhöhte nur meine Bewunderung und Liebe.«
Was blieb Else anderes übrig, als zu weinen. Sie konnte die jüdische Welt ihrer Eltern nicht verlassen, und sie konnte auf die christliche Welt ihres Geliebten nicht verzichten. Zwei Welten in einem Körper. Zwei Köpfe, die aus ihm herauswuchsen. Eine Missgeburt!
Fritz nahm sie in die Arme, küsste sie, streichelte ihr nasses Haar, sagte ihr, dass er sie liebe und kein Christ oder Jude sie trennen könne. Else, selig über seine Worte und angesteckt von seinem Mut, mit dem er Christen und Juden die Stirn zu bieten gedachte, beschloss, ihn das nächste Mal mit in ihre Wohnung zu nehmen und den Eltern zu erklären, sie habe ihn zufällig auf der Straße getroffen.
Eine neue Phase brach an und verlief zunächst unerwartet harmonisch. Minna und Daniel hatten überhaupt nichts gegen die Bekanntschaft ihrer Tochter mit dem sympathischen und kultivierten jungen Mann einzuwenden. Er spielte so herrlich Klavier, rezitierte wunderbar Gedichte von Goethe und Sonette von Shakespeare, führte mit Friedel, ihrem Sohn, lange philosophische Gespräche, brachte Else erstklassige Literatur, spielte vierhändig mit ihr auf dem Flügel, führte sie in Theater und Konzert. Und er konnte so einfallsreich und gescheit, so amüsant und witzig sein, dass sogar Minna Tränen lachte.
»Er ist wirklich zum Verlieben«, sagte sie, und Daniel fügte mit einem Seufzer hinzu: »Ein Jammer, dass er kein Jude ist.«
Ja, Fritz war ein ungeheurer Gewinn für die Familie Kirschner, ein täglich herzlich begrüßter Gast und außerdem ein junger, viel zu dürrer Mann, den man mal richtig aufpäppeln musste. Sie sahen mit Freude, dass Else jetzt selten das Haus verließ und zu einer so schönen und glücklichen Frau aufblühte, dass kein Mangel an Heiratskandidaten herrschte. Und wenn sie auch alle abwies, so war das insofern nicht schlimm, als auch Minna und Daniel noch nicht den Richtigen unter ihnen entdeckt hatten.
Die Naivität und Gutgläubigkeit ihrer Eltern kam Else mitunter unheimlich vor. War ihr Vertrauen in das jüdische Gewissen der Tochter so unerschütterlich, dass ihnen das Offensichtliche unter dem Motto: »Weil nicht sein kann, was nicht sein darf« verborgen blieb? Manchmal taten sie ihr leid, und sie schwor sich: bis dahin, aber keinen Schritt weiter! Es war ein ernstgemeinter Schwur, von dem sie nicht abwich. Die Eltern ein bisschen beschwindeln und hintergehen, das ja, das tat ihnen nicht weh, aber ihnen ein Leid antun, das nie und nimmer.
Im August 1914 brach der Krieg aus und im Hause Kirschner die Panik.
Ihre Tochter, gerade zwanzig geworden, war noch immer nicht in den sicheren Hafen der Ehe eingelaufen, und in Kriegszeiten wurden die Männer knapp oder hatten Dringenderes zu tun, als zu heiraten. Ihr Sohn, Friedel, war nach dem Abitur im wehrdienstpflichtigen Alter und in der Gefahr, einberufen zu werden. Etwas Schlimmeres konnten sich die Eltern nicht vorstellen. Was, um Himmels willen, sollten sie unternehmen, um das eine zu verhindern, das andere zu beschleunigen?
»Und dieser ganze Schlamassel wegen eines Kinkerlitzchens«, sagte Minna und meinte damit die Ermordung des österreichischen Thronfolgers.
Minna und Daniel waren unpolitische, friedliebende Menschen, die, im Gegensatz zum gehobenen jüdischen Bürgertum, auf keine deutsch-nationalen Abwege geraten waren. Dementsprechend gering war auch ihr Patriotismus. Deutschland war ihre Heimat, deutsch ihre Sprache, deutsch ihre Kultur und jüdisch ihr religiöses und familiäres Bewusstsein. Sie respektierten den Kaiser, weil er nun eben mal ein Kaiser war und außerdem ein Mensch, unter dessen Herrschaft sie in Ruhe und Freiheit leben, arbeiten, studieren, zu Geld und hoher Position kommen und sich trotzdem ihr Judentum bewahren konnten. Das war selten genug vorgekommen, und sie wussten es zu schätzen, waren dafür dankbar. Aber Chauvinismus war ihnen fremd. Gewiss, man musste sein Land und Volk schützen, wenn es angegriffen wurde, aber wenn es um Ehre und Glorie eines Landes – und sei es das eigene – ging, dann war ihnen die in dem Maße unwichtig, in dem ihnen das Wohl ihrer Kinder wichtig war.
Die gleiche gesunde Einstellung hatte Else. Sie schrieb: »Ich bewundere nicht den Kaiser, und für mein Vaterland habe ich vielerlei, aber keine patriotischen Gefühle. Ich verabscheue den Krieg und werde nie verstehen, dass ein Mensch die Macht haben kann, junge Männer in den Tod zu schicken.«
Es ist übrigens die einzige Bemerkung zu diesem Thema. In den zahlreichen Briefen, die sie aus jener Zeit hinterlassen hat, wird der Krieg nie wieder erwähnt.
Ich frage mich, inwieweit Else ihn überhaupt wahrgenommen hat. Da er sich außerhalb der deutschen Grenzen abspielte und nicht, wie heutzutage üblich, tötend und verwüstend in das zivile Leben eingriff, konnte sie ihn getrost beiseiteschieben, um ihre ganze Zeit, ihre Kraft, ihr Gefühl in Fritz zu investieren. Aus eigener Weltkriegerfahrung weiß ich, dass kein Krieg so bestürzend, kein Friede so beseligend sein kann wie die erste Liebe.
Fritz wurde wegen hochgradiger Kurzsichtigkeit vom Militär zurückgestellt, Friedel, Elses Bruder, einberufen. Da man jedoch erkannte, dass dessen Fähigkeiten weniger auf militärischem als auf mathematischem Gebiet lagen, wurde er nicht an die Front geschickt, sondern blieb in Berlin in der Administration.
Die Kirschners, denen die Angst tagelang Appetit, Schlaf und Sprache geraubt hatte, dankten Gott mit eintägigem Fasten und gingen zur normalen Tagesordnung über. Zu der gehörte Else. In Minna war plötzlich ein Verdacht aufgezüngelt. Vielleicht hatte die Angst um den Sohn ihre Sinne geschärft, oder ihre angeborene Skepsis hatte endlich über das unerschütterliche Vertrauen in das jüdische Gewissen ihrer Tochter gesiegt – was immer es war, sie begann, Else und Fritz mit dem Blick eines Raubvogels zu beobachten, der im Begriff ist, auf seine Beute niederzustoßen. Und sie erspähte das Offensichtliche. Elses fieberhaftes Interesse galt keineswegs nur der hohen Bildung und den künstlerischen Gaben des jungen Mannes und Fritz’ Besuche nicht der gesamten Familie, sondern einem einzigen Mitglied. Die harmlose Freundschaft war eine klassische Liebesgeschichte. Und wenn Else sich auch bestimmt nichts hatte zuschulden kommen lassen und nicht einmal im Traum an eine feste Verbindung dachte, so drohte doch die Gefahr, dass sie die besten Jahre in einer hoffnungslosen Beziehung vergeudete.
Daniel, der noch nicht bis zum Verdachtschöpfen vorgedrungen war, sah nur – aus welchen Gründen auch immer – die Vergeudung der besten Jahre, nahm seine Tochter beiseite und fragte sie, ob sie sich ihr Leben verpfuschen und eine alte Jungfer werden wolle. Die Jungen glaubten, sie blieben ewig jung, aber dem sei nicht so, ab zwanzig ginge es sehr schnell.
Die Eltern kamen überein, dass schleunigst ein Mann für Else gefunden werden musste, und in diesem kritischen Moment griff das Schicksal ein und bescherte ihnen Alfred Mislowitzer. Er war, so wie Daniel, in der Konfektion tätig, hatte sich in Frankfurt als erstklassiger Geschäftsmann einen Namen gemacht und war erst kürzlich mit Mutter und Schwestern nach Berlin übersiedelt, wo man in seiner Branche, wie er sich ausdrückte, »erst richtig auf den grünen Zweig kam«. Sein Zweig, wie sich im weiteren Verlauf des Gespräches herausstellte, war schon jetzt sehr grün, und in Daniels Kopf begann es ebenfalls zu knospen. Er machte einen rundum positiven Eindruck, der Herr Mislowitzer: ein ziemlich großer, schwerer Mann, dem man das reichliche Essen, den guten Schneider, die robuste Gesundheit, den untrüglichen Geschäftssinn und die konservative, solide Lebenshaltung ansah. Was wollte man mehr!
Daniel erkundigte sich nach Familienstand, Alter und politischer Einstellung der rundum positiven Erscheinung und wurde auch da nicht enttäuscht: ein 35-jähriger, kaisertreuer Junggeselle.
Sie rauchten Zigarren, sprachen über Geschäfte, beklagten den Krieg und die steigenden Preise.
Daniel lud Alfred Mislowitzer zum Freitagabendessen ein.
Else wurde von Minna herausgeputzt und von Daniel ermahnt, nach dem Essen etwas auf der Geige zu spielen, etwas »fürs Herz«.
Alfred Mislowitzer erschien in dunklem Anzug aus ausgezeichnetem Tuch, eine goldene Uhrkette auf der sich wölbenden Weste. Er sah Else, und seine Entscheidung war gefallen. So etwas würde ihm nicht zweimal angeboten.
Beim Abendessen, für dessen Zubereitung Minna weder Mühe noch beste Zutaten gescheut hatte, begann er ihr bereits den Hof zu machen. Er lachte und aß viel und laut, warf ihr dabei tiefe Blicke aus runden, lehmfarbenen Augen zu, sparte nicht mit Komplimenten, reichte ihr die verschiedenen Schüsseln, wobei er es darauf anlegte, ihre Hand zu berühren. Man sprach nicht über Textilien, sondern über die Vor- und Nachteile des Berliner Lebens, über jüdisches Bewusstsein, gute Küche und Familie. Minna erzählte Geschichten aus Elses Kinderjahren, Daniel wartete mit Witzen auf. Alfred Mislowitzer war entzückt. Er war noch entzückter, als Else nach dem Essen etwas fürs Herz geigte. Beim Abschied küsste er ihr die Hand. Der Abend war ein lückenloser Erfolg, Elses Schicksal besiegelt.
Sie wusste nicht, ob sie die neue Wende als Komödie oder angehende Tragödie betrachten, ob sie lachen oder weinen sollte. Und vor allem wusste sie nicht, wie sie Fritz das alles beibringen sollte. So beschloss sie zu schweigen und zu warten. Vielleicht geschähe ein Wunder, und Alfred Mislowitzer, der 35 Jahre alt geworden war, ohne zu heiraten, würde plötzlich Bedenken bekommen und noch ein paar Jahre dazulegen. Aber das Wunder trat nicht ein. Im Gegenteil! Sowohl Alfred als ihre Eltern hielten alle Präliminarien für überflüssig und gingen geradewegs auf ihr Ziel los. Nach zwei weiteren Besuchen und einem gemeinsamen Ausgang in das Lieblingscafé der Kirschners hielt Herr Mislowitzer bei Daniel um Elses Hand an, und der gab sie ihm. Was konnte ihr, was konnte ihm Besseres passieren! Sie hatte eine glänzende Partie gemacht und er einen erstklassigen Geschäftspartner gewonnen, denn Alfred hatte beschlossen, in die Firma seines zukünftigen Schwiegervaters einzutreten. Zwei fette Fliegen auf einen Schlag.
Alfred Mislowitzer erschien mit feierlichem Ernst. Er gab Else einen Brillantring und einen Kuss. Der Ring war so kostbar wie der Kuss schal. Sie war verlobt.
Ich kannte meine Großeltern nur als die liebevollsten, nachgiebigsten Menschen auf der Welt und meine Mutter als die Frau, die ohne Rücksicht auf Verluste ihren eigenen Weg ging. Die unbeugsamen Eltern, die den materiellen Nutzen über das menschliche Glück ihrer Tochter stellten und sie praktisch verkauften, sind mir unbekannt und rätselhaft. Ebenso die Tochter, die drauf und dran war, sich von ihren Eltern in eine Ehe zwingen zu lassen, die ihr Leben zerstört hätte. Selbst wenn man die damalige Zeit mit einbezieht, die jüdische Tradition, Minnas Überzeugung, dass Kinder, und Daniels, dass materielle Sicherheit Zweck und Voraussetzung einer glücklichen Ehe sind, habe ich Schwierigkeiten, ihr Verhalten zu verstehen. Mehr aber noch das der jungen Else, die in Fritz all das gefunden hatte, was sie liebte, und in Alfred all das sah, was ihr zuwider war. Wie also konnte sie, und wenn auch nur für kurze Zeit, eine derartige Fehlhandlung begehen? Die Zeilen, die sie darüber schrieb, lassen nichts anderes erkennen als das Kind, das der Verlockung eines guten Lebens folgte und dem Schicksal, eine alte Jungfer zu werden, entfliehen wollte:
»Um ehrlich zu sein, so schlecht gefiel mir das anfangs gar nicht. Es schmeichelte mir sogar. Da war ein reifer, in dem Kreis meiner Eltern angesehener Mann, der mich umwarb und bewunderte, der mir einen wertvollen Ring schenkte und ein gesichertes, sorgloses Leben bot. Es lockte mich, eine beneidete junge Frau zu sein, teure Kleider zu tragen, in einer schönen Wohnung zu wohnen, Reisen zu machen. Und mit Fritz war es ja wirklich aussichtslos. Er konnte mich nicht heiraten, weil er kein Geld hatte, ich konnte ihn nicht heiraten, weil er ein Christ war, und selbst wenn wir uns über diese Widerstände hinwegsetzten, die Eltern würden es niemals zulassen. Also was blieb? Nachmittags in schäbigen Konditoreien, Spaziergänge im Grunewald. Angst und Heimlichkeiten und schließlich das Los einer alten Jungfer.«
Ja, sie war ein Kind, das folgsam die Worte seiner Eltern nachplapperte, vielleicht sogar nachempfand. Denn wenn Else auch durch Fritz das »ganz andere« entdeckte und sich ihm mit Begeisterung geöffnet hatte, so war sie doch noch nicht fähig, es zu leben. Die Nabelschnur zu ihren Eltern war noch nicht durchschnitten, und die Wurzeln ihrer jüdischen Erziehung waren noch so stark wie die neu angesetzten Triebe christlicher Lebensform schwächlich. Nur ein Schock, ein gewaltsames Herausreißen, würde aus dem kleinen jüdischen Mädchen eine von Familie und Tradition unabhängige Frau machen. Aber bis dahin war es noch ein weiter, mit immer neuen Anläufen und immer neuen Rückschlägen gepflasterter Weg.
Die Verlobung mit Alfred Mislowitzer ließ sich nicht länger geheim halten, und sie sah sich gezwungen, Fritz endlich die Wahrheit zu sagen. Sie traf ihn im Charlottenburger Schlosspark. Fritz, ausgerechnet an diesem Tag in übermütiger Stimmung, kam ihr, den Schauspieler Alexander Moissi imitierend, entgegen, begrüßte sie mit dessen hoher, brüchiger Stimme und dramatischen Gesten. Else, die sich an Leib und Seele abgestorben fühlte, hatte nur einen Gedanken: der Qual ein schnelles Ende zu bereiten. Sie stürzte sich also kopfüber in die Mitteilung, dass sie sich verlobt hätte und in einem halben Jahr heiraten würde. Er gefror mitten in einer schwungvollen Gebärde, starrte ihr in die Augen, erkannte, dass es bitterer Ernst war, und schlug die Hände vors Gesicht. Er stand vor ihr und weinte, schluchzte wie ein kleiner Junge, und sie, die seinen Schmerz nicht ertragen konnte, floh.
In dieser Nacht schlief sie nicht, und am nächsten Tag blieb sie im Bett. Minna wollte sofort den Arzt holen, aber Else, so zornig, wie ihre Mutter sie noch nie gesehen hatte, schrie, sie wolle keinen Arzt, keinen kalten Wickel, keine Milch mit Honig, sie wolle nur in Ruhe gelassen werden.
»Vollkommen überkandidelt«, murrte Minna und ging.
Am Abend klingelte es, und Fritz stand vor der Tür. Er wurde von den Kirschners herzlich begrüßt und hereingebeten. Else kam aus ihrem Zimmer. Sie sah sehr blass aus und war in einen Umhang kupferroter Haare gehüllt, die sie nicht in einen Zopf geflochten hatte.
»Ophelia im letzten Akt«, sagte Minna und ging kopfschüttelnd in die Küche, um das Abendessen zuzubereiten.
Fritz nahm Elses Hand, führte sie zum Flügel, zog sie neben sich auf die Bank und spielte den Rosenkavalierwalzer.
»Meine Babuschka«, sang er leise dazu, »meine Babuschka …«
Von da an kamen sie beide, Alfred Mislowitzer, der Verlobte, zweimal die Woche, Fritz Schwiefert, der Geliebte, fast täglich. Die Kirschners, in der seligen Gewissheit, dass die Verlobung Elses jegliche andere Gefahr gebannt habe und Fritz jetzt wirklich nur noch ein platonischer Freund und eine geistige Bereicherung sei, ließen es gerne zu. Sie fanden es sogar erfreulich, dass nun auch Alfred in den Genuss der Kunstabende kam. Und während Minna an ihrem Nähtisch saß und stickte, Daniel in seinem Ohrensessel eine Zigarre rauchte und Alfred, vom schweren Essen überwältigt, in einem anderen ein Nickerchen hielt, spielten Fritz und Else vierhändig auf dem Klavier, schmiegten sich aneinander und flüsterten sich Liebesworte zu. Mit der Zeit fanden sie mehr und mehr Gefallen an ihrer Durchtriebenheit, in der Fritz eine gerechte Strafe sah und Else ein letztes Sich-Aufbäumen, bevor das Tor zur weiten, freien Welt zuschlug. Fritz genoss es, Alfred vor Else lächerlich zu machen, ihn mit leiser, doppelzüngiger Ironie zu berieseln, mit komplizierten Betrachtungen zu verwirren oder mit bösem Spott zu überfallen, den der arme, schwerfällige Mann in keiner Weise parieren konnte. Else bedauerte ihn zwar, konnte aber eine tückische Freude trotzdem nicht unterdrücken. Bald würde sie Tisch und Bett mit ihm teilen, seine Plattitüden anhören, in dem stehenden Wasser der Langeweile ertrinken müssen. Also sollte er ruhig ein wenig leiden, bevor ihr unvergleichlich größeres Leid begann. Aus der Zeit dieser merkwürdigen Dreierbeziehung habe ich zwei Gedichte, die Fritz Schwiefert und Alfred Mislowitzer in das Gästebuch von Paula und Bruno Kirschner – einem Vetter Elses – eintrugen. Sie sagen alles über diese zwei Männer und ihr Verhältnis zueinander aus.
Alfred Mislowitzer schreibt:
»Im Jahr des Weltkrieges war alles danieder/Und grau noch die Hoffnung vor uns liegt/Erfreut mich der Tag bei Kirschners wieder/Wo man vergisst, dass die Welt sich bekriegt.«
Fritz Schwiefert erwidert:
»O weh! Ich kann so schön nicht dichten!/Ich bin ein blödes, dummes Vieh;/Weiß keine niedlichen Geschichten/Und geistreich war ich wohl noch nie./Mein Pegasus ist eine krumme Mähre,/Sie kriegt die Karre nicht vom Fleck, sie steht!/Ach! Wenn ich noch ein bisschen klüger wäre/Wie Alfred Mislowitzer Majestät.«
Als Paula Kirschner, die seit 1936 in Jerusalem lebte, mir die Gedichte gab, war sie 90 Jahre alt. Sie hatte keine Ahnung mehr, wer Alfred Mislowitzer oder Fritz Schwiefert waren. Doch an Else, ihre angeheiratete Cousine, erinnerte sie sich genau: »Sie war allerliebst«, strahlte sie, »ein richtiger kleiner Wildfang!«
Der kleine Wildfang war ausgesprochen schwer zu zähmen, und Alfred Mislowitzer – kein Wunder – zeigte sich unzufrieden. Ob sich dieser junge, überspannte Tunichtgut nicht in einem anderen Haus als dem seiner zukünftigen Schwiegereltern durchschmarotzen könne, fragte er.
Um ihn zu beschwichtigen und den hartnäckigen Fritz eine Weile los zu sein, beschlossen die Kirschners, zu viert nach Hiddensee, an die Ostsee, zu reisen.
Fritz, der Elses Verlobung und bevorstehende Heirat mit jedem Tag weniger ernst genommen hatte und sich ihrer immer sicherer geworden war, brach diesmal nicht in Tränen aus, sondern in Wut: Wenn es so sei, schrie er, wolle er ihrem Unglück nicht länger im Wege stehen, packte die Bücher und Noten zusammen, die er ihr geliehen hatte, und ging.
Sie fuhren nach Hiddensee, und Else wurde von ihrem Kummer durch die Reise abgelenkt. Sie liebte jede Art von Gewässer, aber das Meer, von dem sie allerdings nur die Ost- und Nordsee kannte, war für sie das schönste. Und wenn dann auch noch die Sonne schien, konnte sie sich selbst im Unglück des Glücks nicht erwehren. »Wenn es mir schlechtgeht«, pflegte sie zu sagen, »brauche ich nur Wasser und Sonne, und ich bin gesund.«
Es war Hochsommer. Die Sonne schien, lag wie ein Heiligenschein über der flachen Insel mit ihren Dünen, Wiesen und weißen, reetgedeckten Gehöften. Ein leichter Wind fächelte das Laub der Bäume, zeichnete Schlangenlinien in den Sand, kräuselte das Meer. Else lief barfuß, den Rock hochgeschürzt, am Strand entlang, den Blick in das blendende, endlose Blau getaucht, die Füße mal im warmen Sand vergraben, mal vom Wasser umspült. Der Zopf löste sich auf ihrem Rücken, in ihrem gebräunten Gesicht war ein Ausdruck verzückter Hingabe. Sie öffnete die Bluse bis zum Brustansatz, schob die Ärmel bis zum Ellenbogen, hob den Rock bis zu den Knien hoch, ging ein paar Schritte ins Meer hinein, lachte, jauchzte. Wasser, Sonne, Luft – ihr Körper, immer verpackt und verschnürt, sehnte sich danach wie nach der Liebe.
Minna, Daniel und Alfred saßen in Strandkörben. Die Männer rauchten Zigarren und sprachen über Geschäfte. Minna stickte und hielt besorgt nach Else Ausschau.
»Was sie nur wieder treibt!«, sagte sie.
»Sie fängt Fische«, witzelte Daniel.
»Ein bisschen Auslauf tut ihr gut«, bemerkte Alfred.
Als Else zurückkam, windzerzaust, der Rocksaum durchnässt, die Füße mit Sand paniert, runzelte Minna die Stirn.
Sie solle bitte die Bluse zuknöpfen, die Schuhe anziehen, das Haar flechten und den Hut aufsetzen, befahl sie, sie sehe ja aus wie eine Wilde – braun und halb nackt. Und außerdem würde sie sich erkälten.
Sie wolle baden, sagte Else, richtig ins Meer gehen, wie die anderen jungen Leute am Strand.
Ja, das fehle gerade noch, rief Minna, und Daniel fügte hinzu: Goyim naches.
Die Reise der glücklichen kleinen Familie wurde auf einem Foto festgehalten: im Strandkorb eingezwängt, sitzen ein heiterer Daniel, eine misstrauisch in den Apparat blinzelnde Minna, eine lächelnde Else. Zu deren Füßen lagert Alfred – auf Hüfte und Ellenbogen gestützt, eine Art Seehund mit kessem Strohhut.
Eine Woche später kehrten sie nach Berlin zurück. Elses erster Gang war zum Postamt. Aber es lag kein Brief von Fritz dort. Das war zwar eine böse Überraschung, doch da es ja jetzt ein Telefon gab, würde er gewiss im Lauf des Tages anrufen. Er rief nicht an. Also musste er am Abend kommen. Er kam nicht.
Else, die Fritz’ Drohung, ihrem Unglück nicht länger im Wege stehen zu wollen, ebenso wenig ernst genommen hatte wie er ihre Verlobung, sah sich jetzt plötzlich mit der Möglichkeit konfrontiert, ihn nicht mehr wiederzusehen. Es war eine so unausdenkbare Möglichkeit, dass sie die gleich wieder ausschloss. Ein Mann, der zwei Jahre auf Schritt und Tritt Hindernisse in Kauf genommen hatte, Heimlichkeiten und Beschwernisse, Regen und Schnee, die Verbote ihrer Eltern, die Suppen ihrer Mutter, die Witze ihres Vaters und schließlich auch noch ihre Verlobung, der ihr Gedichte geschrieben, sie leidenschaftlich geküsst und die zärtlichsten Worte für sie erfunden hatte, liebte sie. Und ein Mann, der sie liebte, musste wiederkommen. Also wartete sie, wartete, bis ihr vor Anspannung die Muskeln weh taten und vor Grübeln der Kopf. Sie setzte die ganze Kraft ihres Wunsches ein, um ihn zurückzuholen, dann die ganze Inbrunst ihres Gebets. Als die nicht halfen, versuchte sie es mit abergläubischen Tricks: Wenn ich die Post erreiche, ohne ein einziges Mal mit den Augen gezwinkert zu haben, liegt ein Brief für mich da; wenn in der nächsten halben Stunde zehn Männer mit Bart an meinem Fenster vorbeikommen, ist er auf dem Weg zu mir; wenn die Patience aufgeht, klingelt das Telefon, und er ist dran. Aber ob die Patience nun aufging, zehn bärtige Männer vorbeikamen und sie nicht mit den Augen zwinkerte, er schrieb nicht, er kam nicht, er rief nicht an.
Als eine Woche vergangen war, gestand sie sich in einer schlaflosen Nacht die Wahrheit ein: Er hatte die Hoffnungslosigkeit der Situation eingesehen, war ihrer unergiebigen Küsse, ihrer rückständigen Eltern, ihres unzumutbaren Verlobten müde und hatte aufgegeben. Und selbst wenn sie ihm schreiben oder ihn anrufen würde, was sollte sie ihm sagen? Komm zurück, aber erwarte nicht, dass sich etwas geändert hat. Oder: Bitte verlass mich nicht, bis ich geheiratet habe! Schöne Angebote!
Mit der Erkenntnis, dass sie ihn verloren hatte, begann für Else eine Zeit tiefen und wahrhaftigen Leidens.
»Die Welt, in die Du mich eingeführt hattest«, schrieb sie, »diese ganz andere, weite, herrliche Welt voller Poesie und Musik, war mir nun wieder verschlossen. Keiner brachte mir Bücher, keiner schrieb mir Briefe, keiner las mir Gedichte vor, keiner spielte auf dem Klavier den ›Rosenkavalierwalzer‹, keiner nahm mich ins Theater mit. Keiner war da, mit dem ich sprechen konnte. Das Einzige, was noch in mir lebte, war die Sehnsucht nach Dir und dieser Welt.«
Warum denn der Fritz nicht mehr komme, wollten ihre Eltern wissen. Weil er keine Lust mehr dazu habe, sagte Else verbittert.
Minna und Daniel waren darüber traurig. Ein so charmanter, gebildeter, geistreicher Mann! Er war ihnen richtig ans Herz gewachsen, und sie vermissten ihn sehr.
Der Einzige, der ihn nicht vermisste, war Alfred Mislowitzer. Endlich hatte er den Schmarotzer aus dem Feld geschlagen! Alfred blühte in dem Maße auf, in dem Else welkte. Sie aß kaum noch, sie schlief kaum noch, und sie lachte überhaupt nicht mehr. Sie nahm ab. Ihre Augen, noch größer als zuvor, traten in die Höhlen zurück, ihre starken, slawischen Backenknochen sprangen vor, die Wangen fielen ein. Zum ersten Mal sah man den schönen Schnitt ihres Gesichts, die hohen, gewölbten Lider, die konkave Linie, die sich von den Spitzen ihrer Backenknochen über die Wangen hinab zum Kinn schwang. Es war das Gesicht, das sie in späteren Jahren haben sollte. Aber Alfred gefiel es gar nicht. Er hatte sich eine dicke, fröhliche, umgängliche Frau gewünscht und nicht ein verhärmtes Geschöpf mit eingefallenem Gesicht, das im Essen herumstocherte und traurige Lieder auf dem Klavier spielte.
So gehe das nicht, erklärte er mit Nachdruck, und bis zur Hochzeit müsse sie wieder so rund und froh wie früher sein.
Er nahm sie zu seiner Familie mit, die, von den Strapazen des Umzugs erholt, nun schnellstens die Braut kennenlernen wollte.
»Sie hausten in einer schmuddeligen, mit geschmacklosen Möbeln vollgestopften Wohnung«, schrieb Else, »und genauso schmuddelig und geschmacklos wie die war seine Mutter. Sie sprach ein jiddisch gefärbtes Deutsch. Es hörte sich grauenhaft an. Die Schwestern waren nicht besser als die Mutter, und alle drei stellten mir dumme, indiskrete Fragen. Hier begegnete mir das Jüdische, das ich von ganzem Herzen ablehnte und dem ich entkommen wollte, in seiner schlimmsten Form.«
Zu Elses Trauer um den Geliebten und die weite herrliche Welt, die er ihr geboten hatte, gesellte sich der Hass auf den Bräutigam und das enge, hässliche Ghettoleben, das er ihr zumuten wollte. Zu dem Verlust ihrer Fülle und ihrer Fröhlichkeit kam als Gewinn eine neue Haltung, die sich in verächtlichen Bemerkungen, Beleidigungen und Spott entlud. Alfred Mislowitzer glaubte, in sein Elslein sei der Dibbuk gefahren. Die Eltern fürchteten, ihr Kind könne ernstlich krank werden.
Ob sie den Mislowitzer denn gar nicht ein bisschen möge, fragte Daniel. Und Minna, zum ersten und letzten Mal auf der Seite ihrer Tochter, erklärte, der Mann sei ein toter Fisch.
Es war November geworden, nasskalte, dunkelgraue Tage, endlose Nächte. Der Krieg machte sich bemerkbar. Kohlenund Lebensmittelknappheit, immer mehr Menschen in Trauer, immer beunruhigendere Nachrichten von der Front. Else kümmerte es nicht. In ihr waren auch Winter und Krieg, und sie war dabei zu verlieren.
An einem stürmischen Tag überkam sie das Bedürfnis, in den Charlottenburger Schlosspark zu gehen. Der Sturm entsprach ihrer Stimmung. Sie wollte ihn in ihrem Gesicht, durch die Kleider hindurch auf der Haut spüren, sie wollte mit ihm und gegen ihn rennen, sie wollte mit ihm jammern und heulen.
Ihre Mutter rang die Hände. Sie solle doch, um Gottes willen, vernünftig sein und zu Hause bleiben. Sie würde sich den Tod holen!
Sie holte sich nicht den Tod, sondern das Leben.
Auf einer der breiten, menschenleeren Alleen kam eine hohe, dünne Gestalt auf sie zu, hutlos, den Oberkörper vorgebeugt, den Kopf gesenkt. Der Sturm verlangsamte seinen Schritt, aber Else, die ihn im Rücken hatte, flog ihm entgegen. Er sah sie erst, als sie vor ihm stand.
»Babuschka«, sagte er ohne Überraschung und schlang die Arme um sie. Sie hing an seinem Hals und heulte mit dem Sturm, weinte mit dem Regen um die Wette.
Da war sie wieder, die Welt der Poesie und Musik, die Welt der Angst und Heimlichkeiten.