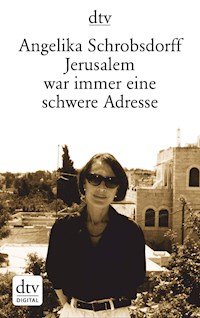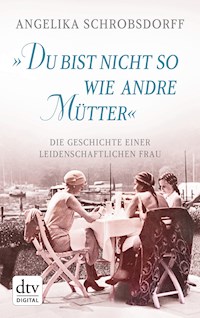6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leben in einem schwierigen Land: Angelika Schrobsdorff erzählt von den Menschen und der Stadt, die sie liebt. »Es begann alles so hoffnungsvoll.« Als sie damals in das schöne arabische Haus im Niemandsland zog, unweit der historischen Altstadt und mit malerischem Blick über die Judäische Wüste, da glaubte Angelika Schrobsdorff, in Jerusalem endlich den Ort gefunden zu haben, der für sie Heimat bedeuten könnte. Heute, fast zwanzig Jahre später, sind Frieden und Sicherheit mehr denn je eine Illusion, und die Hoffnung schwindet. Ein Prozeß, mit dem Angelika Schrobsdorff sich nicht abfinden will. Für sie gibt es »nichts Lohnenderes als die Gerechtigkeit per se, egal um welches Volk es sich handelt«. Und sie hat sowohl israelische als auch arabische Freunde. Von diesen Menschen, denen ihre Zuneigung gehört, aber auch von denen, die sie verabscheut, erzählt sie. Von den Katzen, denen ihre ganze Fürsorge gilt, und von der Stadt, der sie verfallen ist und die ihr Alpträume beschert. »In Jerusalem hab ich zum zweiten Mal das Licht der Welt erblickt, und es war und ist ein so magnetisches Licht, daß man daran klebenbleibt und sich, wenn man wieder loskommen will, die Haut in Fetzen runterreißt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Angelika Schrobsdorff
Wenn ich dich je vergesse, oh Jerusalem …
Der Prediger Salomo
Alles Reden ist so voller Mühe,
daß niemand damit zu Ende kommt.
Das Auge sieht sich niemals satt,
und das Ohr hört sich niemals satt.
Was geschehen ist, eben das wird hernach sein.
Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder,
und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Kohelet, Kapitel 1. 8,9
Das Millennium
Es begann alles so hoffnungsvoll. Viele neue Hotels wurden gebaut, eins häßlich-pompöser als das andere, Straßen wurden verbreitert und frisch asphaltiert, Plakate an allen Ecken und Enden angebracht: »Jerusalem 2000«.
Dabei war Jerusalem eine rein jüdische Stadt – wie immer wieder unter Beweis gestellt wird –, nach jüdischem Kalender nicht zwei-, sondern fünftausendsiebenhundertsechzig Jahre alt. Aber man richtete sich in diesem Fall eben nach der christlichen Zeitrechnung, denn die Christen würden das Geld bringen, in den häßlich-pompösen Hotels wohnen und in die Restaurants gehen, in denen die schon vorher unverschämten Preise rasch noch um ein Weiteres in die Höhe schossen.
In Bethlehem, wo sich die Festlichkeiten konzentrieren sollten, Feuerwerk abgeschossen, 2000 weiße Tauben gen Himmel geschickt, Chöre singen und Arafat eintreffen würden, herrschte Chaos. Auch dort wurde gebaut, renoviert und verschönert. Die seit Jahrzehnten nicht mehr ausgebesserte Hauptstraße in ihrer ganzen Länge und der große Platz vor der Geburtskirche, den man bis dahin als Parkplatz für zahllose Autos und Busse mißbraucht hatte, waren aufgerissen worden, damit sie sich am Stichtag in neuem Glanz präsentieren könnten. Aber dieser Moment schien noch sehr weit, und verfrühte, verstörte Besucher mußten sich durch dröhnende Baumaschinen, Staubwolken und Geröll ihren Weg bahnen.
»Bethlehem 2000 welcomes you«, hieß es auf einem Transparent am Ortseingang.
Euphemia, meine christlich-palästinensische Putzfrau, die mich seit siebzehn Jahren, trotz Intifada und Golfkrieg, Straßen- und Ausgangssperren, nicht einen Tag versetzt hat, war sich der großen Stunde des »Heiligen Landes« gewiß: »Sechs Millionen werden kommen«, kreischte sie beglückt, »sechs Millionen Pilger und Touristen aus der ganzen Welt, Americans and Russians, Clinton und …«, der Name des russischen Staatschefs fiel ihr nicht ein.
»Wie kommst du auf sechs Millionen?« fragte ich argwöhnisch. Sollte diese ominöse Zahl bis in die palästinensischen Gebiete gedrungen sein und dort als Maßstab freudiger Ereignisse gelten?
Aber Euphemia schien sich der Bedeutung der Zahl keineswegs bewußt zu sein: »Sechs Millionen, sagt man«, wiederholte sie triumphierend, »oder noch mehr!«
In Israel sprach man nur von drei Millionen, darunter von vielen verdächtigen Sekten, die gedroht haben sollen, in Jerusalem Massen-Selbstmord zu verüben oder, viel schlimmer noch, das muslimische Heiligtum auf dem Tempelberg, die Al-Aksa-Moschee, in Brand zu setzen. Vielleicht würden sie auch beides zusammenlegen, denn schließlich war Jerusalem prädestiniert, spannende Ereignisse und Endzeitkatastrophen zu produzieren. Doch der israelische Geheimdienst war den Sekten bereits auf der Spur und entschlossen, sie am Flugplatz abzufangen und dahin zurückzuschicken, woher sie gekommen waren. Dies immerhin schien gelungen zu sein, denn nicht ein Sektenmitglied, geschweige denn ein ganzes Rudel, hat sich hier umgebracht, was die hohen Erwartungen, die wir an den Jahrhundertwechsel gestellt hatten, erheblich enttäuschte.
Auch die Anschaffung von Lebensmitteln, Mineralwasserflaschen in großen Mengen, Kerzen, Sturmlampen und Radios, die auf Batterie laufen, war umsonst gewesen. Meine Mutter-Freundin, Evchen, neunzig Jahre alt und nach wie vor positiv eingestellt, hatte mir dringendst geraten, mich mit diesen überlebenswichtigen Dingen einzudecken.
»Auch in den Zeitungen stand es«, erklärte sie, »und im Fernsehen wurde es gesagt.« Ihr Glaube an die Unfehlbarkeit der Medien war unerschütterlich. »Man soll auch alle Computer ausschalten«, fuhr sie fort, »denn wenn da was schiefgeht mit der Technik, explodieren sie.«
»Nein, nein, das hast du falsch verstanden«, wagte ich, es selber nicht verstehend, einzuwenden, »da ist irgendein ›bug‹, der die Zahlen und Programme durcheinanderbringt, aber das heißt nicht …«
»Na ja, das sage ich doch«, unterbrach sie mich ungeduldig, »sie geraten durcheinander und explodieren.«
»Sollen sie«, sagte ich ermattet, denn wenn unsere Gespräche bereits an den simpelsten Themen scheiterten, wie da erst, wenn es sich um etwas so Unbegreifliches wie Computer handelte. Ich versuchte also, das Thema zu wechseln, doch das ließ sie nicht zu. Für sie, so wie für viele ihrer Generation, war die potentielle Apokalypse ein ebenso anregender Gesprächsstoff wie etwa der Simpson-Prozeß oder die Sexaffäre zwischen Clinton und Monica.
»Hältst du es für möglich«, fragte sie hoffnungsfroh, »daß die Welt untergeht?«
»Nein«, enttäuschte ich sie, »ich fürchte, das dauert noch ein Weilchen.«
Für sie wäre es zweifellos eine gute Nachricht gewesen, denn die Vorstellung, daß die Welt nach ihrem Tod noch weiter existieren könnte, empfand sie als ungerecht.
»Also sehr viele Menschen halten es für möglich«, belehrte sie mich, »besonders die Deutschen. Ich sehe doch manchmal RTL, und was man da so alles sagt! Richtig gruselig! Stell dir vor, die Flugzeuge fallen plötzlich vom Himmel und der Computerbug ist nicht mehr aufzuhalten und zerstört die ganze Technik.«
»Ich hoffe, als erstes zerstört er RTL.«
»Du scheinst das nicht ernst zu nehmen«, warf sie mir vor, »aber ich sage dir, viele kluge Leute, mit denen ich gesprochen habe und die etwas von diesen Dingen verstehen, haben große Zweifel, daß die Sache gutgeht.«
Die hatte ich nun leider nicht. »Die Welt geht nicht unter mit einem Knall, sondern mit einem Gewimmer«, hatte ein wirklich kluger Kopf einmal gesagt, und so sah ich es auch. Möglicherweise würden ein paar Pannen eintreten und die Versorgung der Stadt mit Elektrizität, Wasser und Telefon unterbrochen werden. Aber solange ich genug Katzenfutter hatte, konnte mir persönlich gar nichts passieren. Ich rief meine Tierhandlung an und bestellte vorsichtshalber hundert Dosen »Cat-Star«.
»Na ja«, sagte Harry, der seit einiger Zeit bei mir wohnte und die schwere Bürde der Katzenbetreuung mit mir teilte, »das reicht ja dann auch für uns.«
Harry ist ein Stoiker, anderenfalls würde er es auch gar nicht bei mir aushalten. Er nimmt alles mit ernster Gelassenheit hin: meine Wut- und Angstausbrüche, das zügellose Treiben einer 25-köpfigen Katzenmeute, das irrationale Verhalten meiner Freunde, die geistesgestörte Politik des israelischen Staates, die Terroraktionen der Palästinenser, verstopfte oder geplatzte Wasserrohre in meiner Wohnung, Euphemias merkwürdige Putzmethoden, bei denen der Dreck unter den Möbeln und die Spinnweben in den Ecken der Zimmer alle Kalamitäten unseres Lebens überdauern, und Kater Dinos senile Spleens, die den 16jährigen dazu veranlassen, zehnmal am Tag absichtlich seinen Wassernapf auszukippen oder auf der Badematte, die grün und weich an Rasen erinnert, ein ordentlich geschichtetes Häufchen zu hinterlassen.
»Kann man nichts machen«, sagt Harry und betrachtet mit schief geneigtem Kopf das Häufchen, mein verzerrtes Gesicht, die schmutzige Schaumwolke, die aus dem Abflußrohr in der Küche steigt, die munteren Spinnen und die irrwitzigen Katzen, die sich zu bestimmten Stunden, ohne ersichtlichen Grund, kreischend durch die Wohnung jagen und ein Schlachtfeld an zerknüllten Teppichen, zerkratzten Ledercouchen, umgeworfenen Gegenständen und Pelzbüscheln hinterlassen.
Auch dem heraufziehenden Millennium stand er mit Gleichmut gegenüber, und all die finsteren Szenarien, Mutmaßungen und Prognosen, mit denen sich die Leute Zeit und Langeweile vertreiben, fielen bei ihm auf unfruchtbaren Boden.
»In der Nacht des 31. Dezember stellen die meisten Fluglinien ihre Flüge ein«, gab ich ein Gerücht, das in Jerusalem kursierte, an ihn weiter.
»Blödsinn«, sagte er, »die haben längst alles im Griff.«
»Woher willst du das wissen?« fragte ich, denn wenn man schon nicht an den Weltuntergang glaubte, wollte man sich wenigstens an der dramatischen Endzeitstimmung beteiligen.
Er sah mich schweigend an, ein kleines, arrogantes Lächeln um den Mund und unter der Brille.
»Dann erklär mir doch endlich mal, was es mit diesem berühmten Computerbug auf sich hat«, rief ich verärgert und setzte mich auf das behaarte Polster eines Sessels.
Die Erklärung, mit der er mir das Entstehen, Leben und Treiben des Bugs darzulegen versuchte, war anschaulich und ausgiebig, und ich tat, als hörte ich aufmerksam zu. In Wahrheit verlor ich mich schon bald in eigenen Gedanken, und die kreisten um den dreijährigen Sohn meiner russischen Nachbarin, Elena, der, obgleich er noch kein Wort sprechen konnte und den Eindruck erweckte, zurückgeblieben zu sein, in Windelhöschen vor dem Computer saß und sich seine Kinderprogramme einstellte. Während ich mein unkompliziertes, wenn auch mit grellbunten Lichtspielen ausgestattetes Stereogerät nach zwei Jahren immer noch nicht bedienen konnte. Ich wußte tatsächlich nicht, was anomaler ist: Max, das Windelhöschenkind, unbeirrt vor dem Computer oder ich, alte Ziege, verwirrt vor dem wetterleuchtenden Stereogerät.
»Sehr interessant«, sagte ich, nachdem Harry seinen Vortrag beendet hatte, »aber ich könnte mir denken, daß man doch nicht alles im Griff hat.«
Wozu schließlich ein Millennium in Jerusalem, der »Heiligen Stadt«, wenn es genauso ereignislos verlaufen würde wie irgendeine Neujahrsnacht in irgendeiner unbedeutenden Stadt? Ich konnte mich an keine gelungene Silvesterfeier in meinem langen Leben erinnern, es sei denn, man rechnete die mit dem makabren Ausgang zu den gelungenen.
Die hatte in München stattgefunden, in einem faden Mietshaus im fünften Stock. Auch die Gäste waren fade gewesen und krampfhaft darum bemüht, sich zu amüsieren. Die einzige, die mir gefallen hatte, war die Gastgeberin gewesen, eine gutaussehende junge Anwältin von erfrischender Natürlichkeit. Nachdem wir das Mitternachtsritual mit mahnenden Glockenschlägen, Sekt und Küssen hinter uns gebracht hatten, hatte sie uns eine dicke Linsensuppe mit Würstchen serviert, war ins Nebenzimmer gegangen und aus dem Fenster gesprungen. Sie war auf der Stelle tot und hatte uns mit dem Rätsel ihres Suizids zurückgelassen. Niemand hatte einen konkreten Anlaß dafür finden können. Ihr Leben soll von Kindheit an unter den günstigsten Bedingungen verlaufen sein. Noch heute fasziniert mich diese ungewöhnliche Kombination aus dicker Linsensuppe und unerklärbarem Selbstmord.
Nicht, daß ich auf eine Wiederholung dieser kuriosen Neujahrsnacht Wert gelegt hätte, aber etwas, das den außergewöhnlichen Umständen im »Gelobten Land« gerecht werden würde, erwartete ich eben doch. Und damit war ich wahrlich nicht allein. Infolge meines Kabelfernsehens, dem ich die Verknüpfung mit der ganzen absonderlichen Welt verdanke, wußte ich, daß das Millenniumsfieber die gesamte christliche und merkantile Menschheit ergriffen hatte und man sich dementsprechende Sensationen und Geschäfte von ihm erhoffte. Es wurden also die vielversprechendsten Reisen, Hotels, Restaurants, Dinners und Unterhaltungsprogramme, die gigantischsten Millenniumsbusen, knackigsten Millenniumsärsche, Berühmtheiten aus Film, Wirtschaft und Politik angekündigt. Die Mode-, Kosmetik- und Andenkenbranche lockte mit tollen Millennium-Sonderangeboten, und Städte wurden mit den ausgefallensten Kreationen geschmückt. Dann allerdings wurden die erwartungsfrohen Bürger dieser Städte eindringlichst vor Millenniums-Terroraktionen gewarnt. Und was nun?
Die Geschäftemacher waren empört, die erwartungsfrohen Bürger verschreckt und die Medien über diesen guten, die Auflagen- und Einschaltquoten steigernden Einfall erfreut. Die Hysterie, die natürlich in Amerika ausgebrochen war, griff schnell um sich, und die Touristengastronomie und Unterhaltungsindustrie erlitten schwere Einbußen.
Ich weiß nicht, ob Jerusalem und Bethlehem unter diese Geschädigten fielen. Mag sein, denn wir halten ja den Spitzenplatz, was Terroraktionen betrifft. Doch davon abgesehen, steht die Bevölkerung dieses Landes dem christlichen Fest ohnehin teils erzürnt, teils gleichgültig gegenüber. Für die hohe Anzahl orthodoxer Juden ist es nichts anderes als »Gojim naches«, ein Fest, das ausschweifend und unter dem Einfluß von Alkohol gute Juden noch ein Stück weiter von den Gesetzen der Sittlichkeit abbringt. Also verhängten sie für Silvesternächte über alle Hotels, die in ganz Israel obligatorisch koscher zu sein haben, ein Feierverbot, das selbst ein weltuntergangsträchtiges Millennium nicht zu brechen vermochte. Und was den palästinensischen, muslimisch geprägten Teil unseres Landes betrifft, so fürchtete der einen Weltuntergang wohl weitaus weniger als etwa eine israelische Polizeikontrolle.
Wie auch immer, die angekündigten Millionen blieben aus, die Selbstmördersekten, die gewiß Schwung in die Geschichte gebracht hätten, waren uns dummerweise ferngehalten worden, und die säkularen Israelis flogen entweder in Länder, in denen sie sich amüsieren konnten, oder fügten sich den Sitten und Unsitten ihres Staates. Es drohte ein sehr lahmes und verlustbringendes Fest zu werden, das auch von der kleinen, offenbar harmlosen Sekte, die sich ausgerechnet in dem renovierten Haus mir schräg gegenüber eingenistet hatte, nicht aufgelockert werden würde. Es war eine Schweizer Sekte, die aus unattraktiven Kindern und deren nicht minder unattraktiven Lehrern bestand und sich »Die Verkünder« nannte. »Die Verkünder« sangen langweilige christliche Lieder und spielten ein Ballspiel, zu dem unsere Hauswand, unterhalb Harrys Zimmer, herhalten mußte.
»Ich weiß nicht, was mir mehr auf den Geist geht«, sagte Harry mit gefurchter Stirn, »der Ball oder die Lieder.«
Als der große Tag näher rückte, entstand Panik in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Keiner wußte, wie er den Jahrhundertwechsel begehen sollte, jeder fragte jeden, wo er an diesem Abend hingehen würde, ob er nicht eine Party geben oder zumindest irgendwo eine arrangieren könne. Ich, deren große Wohnung für Partys geradezu entworfen zu sein scheint, wurde so oft gefragt, daß ich kurz davor war, mich auf dieses ungute Abenteuer einzulassen. Was mich noch zögern ließ, waren meine Katzen, die Partys, Menschenansammlungen und Lärm verabscheuen, eine Tugend, die sie von mir übernommen haben. Hätte man mich nicht mit der Millenniumshysterie angesteckt und in Ruhe gelassen, wäre der Abend kein Problem für mich geworden. Ich hätte ihn mit ein paar guten Freunden verbracht oder mit den Katzen, Whisky und Zigaretten im Bett.
»Kommt gar nicht in Frage«, erklärten die, die sich auf Partys versteift hatten, »ein Millennium ist nun mal was Besonderes, und ein zweites wirst du nicht erleben.«
»Gott sei Lob und Dank dafür«, sagte ich und überlegte, was ich schon alles nicht mehr erleben würde. Es war viel und es tat mir ein bißchen leid darum, erstaunte mich auch, aber es schmerzte nicht mehr.
»Heute habe ich in der Tiefkühltruhe im Supermarkt ein Päckchen Räucherlachs gesehen«, sagte ich, »und da stand das Haltbarkeitsdatum 2009 drauf.«
»Was hat das denn jetzt mit der Neujahrsparty zu tun?«
»Gar nichts, nur habe ich da plötzlich gedacht: Der Lachs wird mich wahrscheinlich überleben.«
Es herrschte einen Moment lang teils verdutztes, teils betretenes Schweigen. Dann lachte meine Freundin Ina und sagte: »Eine viel interessantere Frage ist, ob Israel den Lachs überlebt.«
Ina war Journalistin und Kennerin des Mittleren Ostens. Sie war sehr oft in Israel und sollte diesmal über die Millenniumsereignisse im »Heiligen Land« berichten. Immerhin war hier der Brennpunkt, der Ort, Armageddon oder Megiddo genannt, an dem die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse, Gog und Magog, stattfinden sollte. Und was lag näher, als daß diese Offenbarung in der Nacht zum Jahr 2000 über uns hereinbrechen und uns, so wir nicht zu den Gerechten zählten, hinwegraffen würde.
Mary, eine junge Amerikanerin, die der internationalen christlichen Sekte der »Gläubigen« angehörte und eine Zeitlang meine Katzen verpflegt hatte, flehte mich an, der Sekte beizutreten. Nur so könnte ich Gottes jüngstes Gericht überleben. Sie hatte mir mit hochroten Wangen und irrem Blick die Offenbarung des Johannes vorgelesen, und als das nicht half, »das neue Jerusalem« zitiert: »Und ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann.« Aber auch der paradiesischen Verlockung, nach meiner Rettung in einem neuen, wie eine Braut geschmückten Jerusalem leben zu dürfen, hatte ich widerstanden und gesagt: »Mary, genug, die Katzen auf dem Dach warten auf ihre Hühnerköpfe.«
Das war das Ende unserer heilversprechenden Beziehung gewesen. Doch jetzt, in Anbetracht dessen, was uns, mit Hilfe des Computerbugs, möglicherweise bevorstünde, drang ein gewisser Zweifel in mich ein. Was wäre schon dabei gewesen, den »Gläubigen« beizutreten und damit meine stark strapazierte Haut zu retten! Ich kannte Dutzende, die von einer Religion in die andere hüpften und die Hoffnung nicht aufgaben, das zu finden, was die Angst vor dem Tod und die vor dem Leben ein wenig bannte.
Ina beschloß, auf der Suche nach einem annähernd dramatischen Ereignis wie der letzten Schlacht zwischen Gog und Magog, durch Jerusalem und Bethlehem zu fahren und sich zur entscheidenden Stunde auf dem Ölberg einzufinden. Sie fragte mich, ob ich sie begleiten wolle.
»Es wird gar nichts passieren«, sagte ich trübe, »aber wenn es nicht regnet, komme ich mit. Wir können uns ja auch ohne Weltuntergang einen vergnügten Abend machen.« Damit schien die Entscheidung gefallen zu sein: ein ruhiger Abend für die Katzen, ein vergnügter für Ina und mich, ein langweiliger für diejenigen, die eine Party brauchten, um in den Millenniumsrausch zu fallen.
Es kam dann aber doch ganz anders, denn Ina verkrachte sich aus heiterem Himmel mit ihrer Freundin, mit der sie während ihrer Jerusalemer Aufenthalte die Wohnung, das Bett und ein innig weibliches Einvernehmen teilte. Ein unvorhergesehenes Drama, was für beide dann auch noch psychosomatische Folgen hatte: Ina bekam einen Hexenschuß und Amanda, ein entzückendes Geschöpf mit einer kubanischen Mutter und einem deutsch-jüdischen Vater, eine Hautallergie.
»Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte«, sagte ich zu Harry, der gerade dem schönen, langhaarigen Kater, Puschkin, das Fell bürstete, »beide sind überdurchschnittlich intelligent, attraktiv, und Humor haben sie auch noch!«
»Und beide sind in dem gefährlichen Alter zwischen 35 und 40 und haben keinen festen Kerl und keine Kinder«, erwiderte Harry.
»Wenn das so einfach wäre, wie du es hinstellst!« rief ich.
»Die menschliche Natur ist so einfach, auch wenn die Frauen sie nach allen Regeln der Kunst zu komplizieren versuchen.«
»Also schön, dann ist es deiner Meinung nach ein rein biologisches Zerwürfnis. Aber vielleicht kannst du mir dann auch noch erklären, was es ausgelöst hat.«
»Wahrscheinlich ein Hormonschub«, sagte er ernst, »du weißt doch, wie das bei deinen Katzen ist: erst große Liebe und Köpfchen lecken, und plötzlich schlagen sie zu und beißen sich in den Hals.«
»Ein guter Vergleich«, sagte ich lachend, »aber als Frau sehe ich die Sache eben etwas komplizierter und ich würde gern erfahren, wie und warum es dazu kam.«
Um es vorwegzunehmen, ich habe alles und nichts erfahren, denn es handelte sich bei dem Vorfall um eine Verkettung so tiefgreifender Gefühlsphänomene, daß weder der Auslöser festzustellen noch das Zerwürfnis als solches zu klären und aus der Welt zu schaffen war.
In dieser prekären Situation rief mich Alexander von Trossing an und lud mich zu einem Fest im »American Colony Hotel« ein, dem schönsten Hotel unserer Region, das sich in Ostjerusalem befindet und als extrem israelfeindlich verschrien ist. Zu diesem Fest, sagte er, würden zahlreiche Verwandte und Freunde von seiner Frau und ihm aus Deutschland einfliegen, denn wo lasse sich ein Millennium standesgemäßer begehen als in Jerusalem und dort im »Pascha-Saal« des »American Colony Hotels«.
»Vorausgesetzt, die sieben Engel mit ihren sieben goldenen Schalen gießen nicht Gottes Zorn über der Stadt aus«, gab ich zu bedenken.
»Das tun sie doch sowieso schon die ganze Zeit«, lachte er.
Alexander von Trossing ist Historiker und langjähriger Leiter einer deutschen Stiftung. Außerdem verkörpert er eine interessante Kombination aus anerzogenem Konservativismus, mit dem er die Regeln seiner Klasse einhält, angeborenem Negativismus, der ihn des öfteren an sich und der Welt verzweifeln läßt, und einem scharfen Witz, mit dem er sich sowohl gegen das eine als das andere zur Wehr setzt. Lang, dünn, blaß und von nervösen Spannungen geplagt, verdankt er ein gewisses Gleichgewicht seiner Frau Elisabeth, die mit Humor, Vernunft und festen Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht und sich von nichts und niemandem erschüttern läßt – nicht vom Jerusalem-Syndrom, das die christlichen Besucher dieser Stadt gefährdet, nicht von ihren Kindern, einem Sohn und einem weiblichen Zwillingspärchen, das sie mit einem gesunden Maß an Strenge und Nachsicht erzieht.
Ich empfinde für beide eine echte, wenn auch distanzierte Zuneigung, denn vieles an ihrem Lebensstil erinnert mich an den meines Vaters und weckt damit zwiespältige Gefühle: an die Sehnsucht des Kindes nach einer scheinbar heilen Welt, die gehässige Ablehnung des enttäuschten jungen Mädchens, die Skepsis einer Frau, die mitunter immer noch zwischen zwei extremen Welten pendelt, der ihres protestantischen, schöngeistigen und auf Haltung bedachten Vaters und der ihrer jüdischen, vitalen und sich über alle bürgerlichen Gesetze hinwegsetzenden Mutter. Aus diesem Gefühl heraus erklärte ich dann auch, daß ich noch nicht wisse, ob ich kommen könne.
»Ich passe doch überhaupt nicht dahin«, sagte ich zu Harry, »also was soll ich da?«
»Hauptsache, du weißt, was du hier sollst«, gab er zur Antwort.
»Wo hier?«
»Na hier in Jerusalem, in Israel, auf diesem Planeten.«
»Das, mein Lieber, weiß ich schon lange nicht mehr.«
Zwei Tage später rief mich Elisabeth an und sagte, ich müsse unbedingt zu dem Fest kommen, sie habe bereits die Tischkarte drucken lassen und mich neben Ernst Heidebreck, einen reizenden Schriftsteller, gesetzt. Er lebe die meiste Zeit in Paris und Italien und schreibe so hohe Literatur, daß kein Mensch seine Bücher kaufe.
»Genau das Gegenteil von Ihnen«, schloß sie, und ich mußte lachen.
Elisabeth sagt immer das, was andere aus Höflichkeit verschweigen. Als wir uns kennenlernten, hatte sie mich unverhohlen von oben bis unten gemustert und gefragt: »Wie alt sind Sie nun eigentlich?«
»Älter, als ich aussehe, aber daß das so ist, verdanke ich allein meinem Schönheitschirurgen.«
Sie war auf meine Antwort ebensowenig gefaßt gewesen wie ich auf ihre Frage, und unsere gegenseitige Verblüffung endete in Heiterkeit und Zutrauen.
»Gut, dann komme ich eben«, sagte ich mit wenig Begeisterung, »vorausgesetzt, ich brauche kein Abendkleid anzuziehen. Ich habe nämlich keins.«
»Ist auch nicht nötig. Jeder zieht an, was er will. Es kommen auch ein paar Israelis.«
Ich wußte nicht, ob sich diese Bemerkung auf die unansehnliche Garderobe der Israelis bezog oder ob sie glaubte, die Anwesenheit einiger Juden wäre mir eine Bestätigung dafür, daß bei den Trossings alles rechtens zuginge. Als ich eingehängt hatte, schämte ich mich dieses engstirnigen Verdachtes, der mich wieder einmal daran erinnerte, daß das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden nach wie vor paranoid war. Die Deutschen dürfen sich den Juden gegenüber keinerlei Kritik erlauben, und wagen sie es doch einmal, sind sie prompt Antisemiten. Ein äußerst peinliches Phänomen, das allen Beteiligten mehr Schaden als Nutzen und mir, die ich mit Kritik an beiden Seiten nicht spare, abwechselnd den Ruf einer Antisemitin oder den einer Deutschenhasserin einbringt.
»Also ich feiere ein standesgemäßes Millennium«, erklärte ich meinem Freundeskreis, und der war erstaunt.
»Erst hältst du jede Party für eine Zumutung«, beschwerten sie sich, »und dann gehst du zu einem Fest mit lauter deutschem Adel und Jubel, Trubel, Heiterkeit!«
»Komisch, nicht wahr?« sagte ich, selber erstaunt.
Ich wußte wirklich nicht, was mich letztlich dazu bewogen hatte, zuzusagen: die allgemeine Unentschlossenheit, was diesen Abend betraf? Die Entschlossenheit Elisabeths, die mir bereits den reizenden Ernst Heidebreck als Tischherrn zugewiesen hatte? Der schöne Pascha-Saal, mit dem sich für mich Erinnerungen an bessere Zeiten verbanden? Oder die Enttäuschung über meine beiden Freundinnen, die sich ohne Sinn und Verstand verkrachen und dann auch noch psychosomatische Krankheiten zulegen mußten?
Auf jeden Fall, dachte ich, wird es mal was anderes sein als die unbeholfenen, inzestuösen Partys in Jerusalem, auf denen man seit Jahrzehnten mit immer denselben Leuten zusammentrifft und den unbarmherzigen Spiegel der Zeit vorgehalten bekommt:
»Warum ist denn Frau Rosenkranz heute nicht gekommen?«
»Sie ist vor sechs Monaten verstorben, wußten Sie das denn nicht? Und Dr. Sapir weilt auch nicht mehr unter uns. Ein so guter Arzt und dann ein so langes, schweres Leiden!«
Und ich in meiner irritierten Ratlosigkeit: »Hätte er doch als Arzt verhindern können, während wir …! Sind Sie eigentlich Mitglied der Organisation ›To Die in Dignity‹? Nein? Na, das ist aber leichtsinnig!«
Partygespräche der Fossilien: Ach, die Schmerzen im Rücken! Die Steine in der Galle! Die Katarakt im rechten Auge! Das Rauschen im linken Ohr!
Also dann lieber Adelsparty mit nobler Zurückhaltung, was die diversen Leiden der Alten und die manierliche Fröhlichkeit der Jungen betraf.
»Da sieht man’s mal wieder«, sagte Amanda, die Freundin mit der Hautallergie, die sich mit den ehemals diskriminierten sephardischen Juden identifizierte, »dein aschkenasisches Großbürgertum läßt sich nicht verleugnen.«
»Mein aschkenasisch-arisches«, verbesserte ich sie, und einen Moment lang wußte sie nicht, ob sie das ernst nehmen und mich anschreien oder in mein Gelächter einstimmen sollte. Sie entschied sich für letzteres, aber ihre schwarzen, kubanischen Mandelaugen blitzten mich böse an.
»Ein schrecklicher Irrtum, sich immer mit den einstigen Opfern und zukünftigen Tätern zu identifizieren«, sagte ich.
Was gibt es über das Fest zu berichten? Nicht viel. Es war standesgemäß, was das Ambiente, die Bewirtung, die Stimmung und das Benehmen betraf. Die Tische, an denen wir zu mehreren Personen saßen, waren schön gedeckt, die Bedienung war liebenswürdig, das Buffet erstklassig, die Musik angenehm gedämpft. Die Kleider der Damen bürgten für beste Qualität und schlechten Geschmack, der dezente Aftershave-Duft und die Höflichkeit der Herren für gute Erziehung, die Frische und gesittete Unbeschwertheit der mit eingeflogenen Söhne und Töchter für herrschaftliche Verhältnisse. Meine Unterhaltung mit Herrn Heidebreck entsprach Elisabeths Bewertung unserer gegensätzlichen schriftstellerischen Produktionen. Wir sprachen beide, wie wir schrieben, und das bedeutete, daß wir nie auf denselben Nenner kamen, obgleich wir in vielem einer Meinung zu sein schienen.
Zum Nachtisch wurden Reden gehalten, die sich durch kulturgeschichtliche Bildung und Wohlwollen gegenüber den Gastgebern, Jerusalem, der warmen Nacht und der einmaligen Chance, hier dem Millennium begegnen zu dürfen, auszeichneten. Danach trat eine Bauchtänzerin auf, eine junge schöne Frau mit wenig Bauch, aber großem Geschick, ihn kreisen und hüpfen zu lassen. Ihre schwarzen Augen und Haare, die honigfarbene Samthaut und die gelenkigen Finger und Hüften fesselten das gepflegte, bleichgesichtige Publikum und ließen diffuse Sehnsüchte aufkeimen.
Es war inzwischen elf Uhr dreißig – nur noch eine halbe Stunde bis zum Anbruch des neuen Jahres. Alexander und Elisabeth eröffneten den Tanz mit einem Englischen Walzer. Andere Paare folgten. Sie tanzten mit schwungvollen Schritten und steifen Oberkörpern und schienen sich dabei jung zu fühlen.
Ich sah ihnen zu und spürte einen Stich wehmütigen Neides. Sie hatten zweifellos keine Identitätsprobleme, wußten, wohin sie gehörten. Der Zweite Weltkrieg hatte gewiß auch ihnen Verluste jeglicher Art zugefügt, Erschütterungen und Krisen ausgelöst, und dennoch waren sie ganz geblieben oder es wieder geworden, eins mit dem Land, dem Stand, der Familie, der christlichen Religion und Tradition, in die sie hineingeboren worden waren.
Auch mein Vater, wäre er nicht so früh gestorben, hätte in all das zurückgefunden und in dem Bewußtsein, ein Gegner des Naziregimes gewesen zu sein, mit schwungvollen Schritten Englischen Walzer getanzt. Und er hätte versucht, auch mich in den Schoß des Vaterlandes zurückzuholen und eine ähnlich frische, kultivierte, sich ihrer Verpflichtungen bewußte höhere Tochter aus mir zu machen. Er hatte es, die kurze Zeit, die ihm noch blieb, sogar versucht, aber er war schon zu schwach und verzagt gewesen und ich, aus dem Exil zurückgekehrt, zu hart und bitter.
Jetzt wurde eine Polka gespielt, und die jungen Leute gesellten sich zu ihren Eltern auf die Tanzfläche. Sie waren gut gewachsen und hatten noch den Charme der Jugend. Ich beobachtete sie, fand sie reizend und fragte mich, ob ich gerne ein so ungebrochenes Leben geführt hätte. Ich wußte es nicht, ich konnte mich in diese Art von Leben nicht mehr hineindenken. Doch ich wußte mit Sicherheit, daß ich auf meine Vergangenheit, so schwer und grausam sie auch gewesen sein mochte, nie und nimmer würde verzichten wollen. Ich liebte sie, denn sie war meine Wurzel und meine Heimat.
Eine Viertelstunde vor zwölf stand ich auf. Ich wollte auf keinen Fall von mir fremden Menschen umarmt und geküßt werden und mit ihnen auf ein gutes, gesundes, friedliches Jahr 2000 anstoßen. Ich entfernte mich so unauffällig wie möglich, doch als ich den Saal verließ und in den Vorraum trat, hielt mich eine Hand zurück.
»Wohin wollen Sie denn?« fragte Alexander von Trossing.
»Nach Hause«, sagte ich.
»Aber es ist doch gleich Mitternacht!«
»Deshalb.«
Er hielt eine Flasche Champagner in der einen Hand, meinen Arm in der anderen und schaute beunruhigt auf mich herab. Hinter uns galoppierten, lachend und juchzend, die Polkatanzenden durch den Saal. Ich schaute zu ihnen hinüber, und Alexander folgte meinem Blick.
»Solche Feste machen Sie traurig, nicht wahr?« fragte er.
»Einsam«, sagte ich, »nicht traurig.«
»Und wenn Sie jetzt nach Hause fahren, wird es noch einsamer.«
»Nein, allein zu Hause bin ich eigentlich nicht einsam. Da tanze ich dann, und meine Katzen finden das unheimlich und starren mich mit aufgerissenen, entsetzten Augen an … so wie Sie jetzt!«
Ich brach in Lachen aus, und das schien seine Sorge, ich könnte einsam und traurig sein, zu zerstreuen.
»Dann wünsche ich Ihnen noch einen vergnügten Rutsch ins Jahr 2000«, sagte er und beugte sich tief über meine Hand.
Ich fuhr nach Hause. Die Straßen waren menschenleer, alles um mich herum war still und erstarrt. Es war, als hielte Jerusalem, in Erwartung der einen entscheidenden Minute, den Atem an. Ich hatte gehört, daß sogar die Muslime in die Moscheen und die Juden in die Synagogen gerannt waren, um, vom heidnischen Aberglauben angesteckt, für die Erhaltung der Welt, vielleicht aber auch nur für die ihrer eigenen Familie zu beten. Ich hielt vor einer roten Ampel, neben einem einzigen Auto, in dem ein ebenfalls erstarrter Fahrer saß. Es war fünf Minuten vor zwölf, und die Ampel wechselte nicht auf Grün. Möglicherweise war der Computerbug bereits aktiv geworden. Gerade als ich beschloß, bei Rot über die Kreuzung zu fahren, sprang die Ampel auf Gelb, und ich gab Gas. Als ich am Jaffa-Tor, das in das christliche Viertel der Altstadt führt, vorbeikam, sah ich endlich eine größere Gruppe Menschen. Die Furchtsamen wollten wohl schnell noch zum Beten in eine der zahlreichen Kirchen eilen, die Unerschrockenen das neue Jahr auf dem Platz innerhalb der Stadtmauer empfangen. Auch viele Polizeiwagen standen da, und das überzeugte mich, daß sich nichts geändert hatte und höchstens eine Bombe explodieren, nicht aber das alte Jerusalem in die Luft gehen und das neue vom Himmel herabschweben würde.
Als ich mein Auto parkte, begannen die Glocken sämtlicher Kirchen in Jerusalem zu läuten. Es waren viele und es hörte sich dramatisch an. Ich stieg aus und stand alleine auf dem kleinen, mir so vertrauten Platz mit seinem geborstenen, notdürftig wieder geflickten Asphalt, der bescheidenen Rasenfläche, den Bäumen, die auch im Winter nicht ihr Laub verloren, den zwei Meter hohen Buschhecken und Agaven, den ungestrichenen Holzbänken und den Kinderschaukeln an rostigen Ketten. Über mir war der Himmel, den ich in seiner leuchtenden, sternengeschmückten Klarheit so liebte, und ein halber Mond, dessen perlmuttfarbenes Licht die Nacht erhellte.
Ich ging an der alten, wuchtigen Mauer, die den Bodenbesitz der griechisch-orthodoxen Kirche umschloß, entlang, unter dem Nadeldach des sturmgebeugten Baumes hindurch, zu meinem Haus. Es waren nur etwa vierzig Meter, und mit jedem Schritt schwoll die Freude in mir an, strahlte wie ein Schmerz in alle Nervenstränge meines Körpers aus und konzentrierte sich an einem Punkt in der Herzgegend. Es war ein Gefühl, das ich von früher her kannte, nur hatte es sich damals nicht auf jahrhundertealten Stein, eine mit Bougainvillea bewachsene Hauswand, einen früchtetragenden Zitronen- und Orangenbaum, ein rotes Plastikschaukelpferd im struppigen Gras des Nachbargartens bezogen, sondern auf den jeweiligen Mann, den ich zu lieben glaubte. Ja, es war ein ganz ähnlich schmerzhaft beglückendes Gefühl, nur daß dieses hier mit nichts und niemandem austauschbar war.
In das dramatische Glockengeläut mischte sich jetzt das Kriegsgetöse eines Feuerwerks, das aus der Richtung des Ölbergs kam. Kein Zweifel, das Jahr 2000 war angebrochen und die Welt nicht untergegangen. Selbst die Pannen, stellte ich in meiner Wohnung fest, waren ausgeblieben: Das Licht brannte, das Wasser lief, und das Telefon klingelte, gewiß weil mir jemand ein frohes, gesundes, friedliches neues Jahr wünschen wollte. Ich ließ es klingeln und begrüßte meine vier Katzen, die mir lautlos und erwartungsvoll entgegengekommen waren: mein alter, schwarzer Dino, mit dem mich unter all meinen Ehe- und Lebensgemeinschaften die längste und harmonischste verband; mein junger neurotischer Puschkin, eine vollendete Kreation aus langem vielfarbigem Pelz, großen, weißen Pfoten, buschigem Schweif und gelben, schwarzumrandeten Augen, die beinahe senkrecht in das kleine Kirgisengesicht hineingesetzt waren; Nachtsche, der geschmeidige Yogakater, dessen graues, kurzhaariges Fell mit dem schwarzen, extravaganten Muster eines Frischlings gezeichnet war; und Zille-Kind, ein biederes, sich ständig putzendes Weibchen, das allein durch seinen weißen Puderzuckerbauch und die riesigen, grünen, etwas töricht dreinschauenden Augen auffiel.
»Ein glückliches neues Jahr, Katzen«, sagte ich und strich jeder über Kopf und Rücken, »bleibt mir gesund und stark.«
Da sie Futter erwartet hatten und nicht alberne Worte, wurden sie wütend und gaben sich gegenseitig, fauchend und Ohrfeigen austeilend, die Schuld an meinen miserablen Manieren. Ich holte eine Dose »Cat-Star« aus dem Küchenschrank und verteilte den Inhalt auf vier Teller: »Aber nur weil wir heute ein Millennium haben«, sagte ich.
Ich beschloß, mit einem Glas Whisky auf das Dach zu steigen, um dort das neue Jahr zu begrüßen, ging durch den Patio, in dem der schwarz-weiß gefleckte Kater mit seiner Mutter auf dem Tisch saß, winkte ihnen zu und stieg die Wendeltreppe hinauf. Der Kater, den ich unpassenderweise General Schwarzkopf genannt hatte, folgte mir. Er war der sanfteste und einfühlsamste Kater, den ich jemals erlebt habe, denn ich hatte ihm im Babyalter die durch eine hiesige Katzenkrankheit verklebten Augen behandelt und ihn damit vor dem Erblinden gerettet. Das schien er zu wissen. Und seitdem liebt er mich. Während ich auf Jerusalem hinabschaute, wurde ich wieder von jenem schmerzhaften Glück überwältigt, das ich mit dem Gefühl der Liebe und einer erfüllten Sehnsucht verband.
»Zu Hause!« sagte ich und ließ meinen Blick im Halbkreis über die Landschaft gleiten, die sich im matten Perlmuttlicht des Mondes in ihrer archaischen Schönheit und Würde zeigte. Die neuen, hohen Häuserblöcke, die roten Ziegeldächer und der abscheuliche Rohbau, den man mir wenige Meter entfernt vor die Nase gesetzt hatte, waren vom Dunkel aufgesogen, die palästinensischen Dörfer, die sich, mit goldgelben und bläulichen Lichtern betupft, in die östlichen Hügel von Jerusalem schmiegten, erweckten den Eindruck tiefsten Friedens. Die Mauer der Altstadt mit dem Davidsturm, Zions- und Tempelberg war zur Feier der Neujahrsnacht angestrahlt, und auf den flachen Gräbern des Ölbergs lag das Licht wie weißer, in breite Bahnen geschnittener Tüll.
»Scheint doch das neue, himmlische Jerusalem zu sein«, sagte ich und trank einen großen Schluck Whisky. »Auf dich, himmlisches Jerusalem, auf daß wir in Ewigkeit vereint bleiben.«
Der Kater, der sich dicht neben mich gesetzt und den Schwanz säuberlich um die Vorderpfoten gewickelt hatte, sah verliebt zu mir auf und stieß einen kleinen, gurrenden Laut aus.
»Auf dich auch, mein kleiner Kavalier«, sagte ich und trank einen weiteren Schluck. Die Glocken hatten aufgehört zu läuten, und am Himmel über Bethlehem, keine zwölf Kilometer von mir entfernt, flammte lautlos und geisterhaft schön ein Feuerwerk auf. Ich betrachtete die im Schwarz zerplatzenden und als farbenprächtige Ornamente hinabfallenden Feuerwerkskörper, und plötzlich sagte ich, ohne zu wissen, warum, und ohne irgendeine Hoffnung daran zu knüpfen: »Gott beschütze uns!«
In einem Nachbarhaus brach laute, hektische Diskomusik aus und bohrte schräge Töne in die pastorale Stimmung, die Gedanken wie »in Ewigkeit« und »Gott beschütze uns« in mir hervorgerufen hatten.
»Also doch noch das alte Jerusalem«, sagte ich, trank das Glas Whisky leer und beugte mich zum Kater hinab: »General Schwarzkopf, darf ich bitten?«
Er gurrte, und ich nahm ihn hoch und bewegte mich sacht im Rhythmus der Musik. Der Kater lag in meinen Armen, ein Samtpfötchen an meinem Hals, Hingebung in dem linken kleinen und dem rechten großen Auge, ein tiefes, glückliches Schnurren in der Kehle. Es war grotesk, dieses so zärtliche Geschöpf mit dem häßlichen Namen eines martialischen Grobians zu benennen! Auch die tief in die Stirn gezogene schwarze Kappe konnte das nicht rechtfertigen. Es waren das weiße Schnäuzchen und der rosarote Stempel seiner Nasenspitze, die seinem Wesen entsprachen. Während der amerikanische General Schwarzkopf, der uns jeden Abend als alptraumhafte Erscheinung auf dem Fernsehschirm heimgesucht hatte, von unangenehmster Natur gewesen war. Er hatte uns mit ausdrucksloser Stimme und den Augen eines toten Fisches die militärische Einmaligkeit des »Desert Storm«, die chirurgische Treffsicherheit amerikanischer Bomben (natürlich nur auf militärische Ziele), den Nutzen und die Notwendigkeit des Golfkrieges (bei dem es sich natürlich nicht um Öl handelte), den genauen, bis auf die Minute geplanten Ablauf dieses Wunderkrieges und dessen ruhm- und siegreiches Ende erklärt. Und wenn dann die Sirenen zu heulen, die Kinder zu weinen und die Alten zu zittern begannen, erschien uns Nachman Shai auf dem Schirm, ein junger, gelassener Mann in Uniform, der uns Anweisungen gab, wie wir uns zu verhalten hätten: vor allem Ruhe bewahren, ein Glas Wasser trinken, in das mit Klebestreifen abgedichtete Zimmer oder zumindest ins oberste Stockwerk gehen – Gas steigt nicht, war uns versichert worden –, Babys und Kleinkinder in isolierte Plastikzelte legen, größeren Kindern und Erwachsenen die Gasmaske überstülpen, sich bequem und entspannt hinsetzen und vor allem immer Ruhe bewahren. All das müßte in zwei Minuten vonstatten gehen, denn Raketen, ob mit oder ohne Gas, fliegen schnell.
Ich tanzte und kicherte, denn erstens hatte ich viel getrunken, und zweitens rief der Golfkrieg immer die unpassendsten Erinnerungen in mir hervor: komische, absurde, haarsträubende. In die letzte Kategorie fiel wohl die Geschichte mit den Gasmasken. Sie waren uns angeblich von Deutschland, das vorher den Irak mit den erforderlichen Ingredienzien zur Herstellung von Giftgasraketen beliefert hatte, geschenkt worden. Egal wie man das nennen mochte: Wiedergutmachung, humanitäre Hilfe oder Zynismus, sie hätten in jedem Fall ein nützliches Geschenk sein können, wären sie dicht gewesen. Aber da sie aus Beständen zu stammen schienen, die man den deutschen Bürgern – mir inbegriffen – bereits im Jahr 1937 probeweise über den Kopf gezerrt hatte, waren sie schon etwas mürbe und durchlässig geworden. Das erfuhren wir allerdings erst Monate später, was ein Glück war, denn sonst hätten die Israelis, trotz des gelassenen Nachman Shai, vielleicht keine Ruhe bewahrt und die Palästinenser, denen man zur Strafe, weil sie für Saddam Hussein waren, keine Gasmasken ausgehändigt hatte, wären vor Freude über unser Mißgeschick ganz außer Rand und Band geraten.
»Ein Jammer, Generalchen«, sagte ich, »daß diese bis ins Mark verrottete Welt nicht doch untergegangen ist.«
Ich lachte und drehte mich im Kreis. Das mochte der Kater nicht. Er fand es wahrscheinlich peinlich, daß sich eine Frau meines Alters so aufführte, und darum entwand er sich meinen Armen, setzte sich auf die erhöhte Umrandung des Daches und schaute nach Bethlehem hinüber, wo sich gerade eine Kaskade roter Sterne auf die Stadt ergoß.
»Hübsch, nicht wahr, Schwarzkopf!« rief ich, aber er würdigte mich keines Blickes mehr und begann, energisch sein Gesicht zu waschen.
»Also dann ist das Fest jetzt beendet«, stellte ich fest, nahm mein leeres Glas und stieg die Wendeltreppe hinab.
Harry war zurückgekehrt. Er trug eine schwarze Hose, einen enganliegenden schwarzen Pullover und statt der Brille Kontaktlinsen. Vielleicht sah er deshalb so unheilvoll aus.
»Auch schon wieder da«, sagte ich und machte ein paar linkische Tanzschritte.
Er starrte mich an und schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ich weiß, ich vertrage nicht mehr soviel«, lachte ich, seine Bestürzung auf mich beziehend, »aber so schlimm ist es nun auch nicht. Wir haben hier schon viel Schlimmeres erlebt. Erinnere dich nur an die zwei Kätzchen, die in Shwarzens Lichtschacht gefallen sind.«
»Die waren nichts gegen die Tauben heute abend.«
»Welche Tauben?«
»Die in Bethlehem! Ich war mit Ina und Joe dort, und da haben diese Idioten doch tatsächlich 2000 weiße Tauben zusammen mit dem Feuerwerk in die Luft gehen lassen. Glaubten wohl, diese hirnlosen Kerle, das mache sich besonders hübsch. Na ja, die armen, verschreckten Vögel sind dann … ach, frag nicht! Auf jeden Fall wird’s in Bethlehem jetzt wochenlang Täubchen zu essen geben.«
»Ist ja gräßlich! Und dabei sah das Feuerwerk, ohne die Kriegsgeräusche, so schön und harmlos aus!«
»Nicht für die Tauben! Ina hat geschrien: Das ist ja schlimmer als die Szenen mit Amanda, und Joe hat sich prompt übergeben.«
Joe, Harrys Freund, war Kopte. Eine hohe, schmale Gestalt mit einem feingeschnittenen Gesicht, das von einer schönen, großen Nase und schwarzen Augen dominiert wurde.
»Was mußte Ina auch mit ihrem Hexenschuß und Joe mit seiner Feinfühligkeit nach Bethlehem«, sagte ich zu Harry.
»Konnten wir wissen, daß man da 2000 Tauben abschießt?« regte er sich auf. »Und ich sage dir, das hat noch böse Folgen!«
»Hier hat alles böse Folgen«, sagte ich und goß mir einen Whisky ein.
»Ich habe dir schon oft genug gesagt, daß du nicht mehr soviel verträgst!«
»Ich trinke doch nur, damit du es mir immer wieder sagst und damit zu verstehen gibst, daß ich in meinem Alter jeden Moment tot umfallen kann.«
»Nicht tot«, sagte er trocken, »aber vielleicht …«
»Bitte, erspar mir deine medizinischen Weisheiten und sag mir, was für böse Folgen die toten Tauben haben können.«
»Zweitausend weiße Friedenstauben fallen in der Millenniumsnacht tot auf Bethlehem hinab. Also wenn das kein eindeutiges Zeichen ist!«
»Du meinst, ein eindeutiges Zeichen dafür, daß es hier keinen Frieden geben wird? Harry, dazu brauche ich keine weißen Tauben, sondern nur einen klaren Menschenverstand.«
»Also du glaubst auch, daß hier was schiefgehen wird.«
»Ja, aber das glaube ich nicht erst seit heute und auf Grund der toten Tauben. Prost, Harry, auf ein frohes, gesundes, friedliches neues Jahr.«
Schalom Freund – Schalom Frieden
Seit wann glaube ich, daß hier alles schiefgehen muß? Vielleicht seit Ende der ersten Intifada? Allerdings gab es da zunächst viele euphorische, in den Medien als »historisch« dargestellte Ereignisse, von denen ich mich mitreißen ließ. Dazu gehörte der an Wunder grenzende Wahlsieg Rabins, das Osloer Abkommen, bei dem erst Gaza und Jericho, dann sukzessive die meisten anderen palästinensischen Städte als autonom erklärt wurden, dann das Treffen von Arafat, Rabin und Clinton im Weißen Haus, das ich auf einem altersschwachen Fernseher im autonomen Jericho und dort im Kreis andächtig lauschender, beim Händedruck Rabins und Arafats in Applaus ausbrechender Palästinenser verfolgt hatte. Oh, dieses herrliche Gefühl der Hoffnung, dem selbst ich mich, trotz aller Skepsis, nicht entziehen konnte. In dem Moment, in dem sich die beiden Feinde die Hände reichten, mußte ich schnell die Sonnenbrille aufsetzen, um meine feuchten Augen zu verbergen.
Die fünf Jahre anhaltende Intifada, an deren Zweck und Sinn ich nie gezweifelt, die aus »den Arabern« die Palästinenser und aus den Palästinensern ein Volk gemacht hatte, das sich endlich einen Teil seines Gebietes und damit ein lebenswichtiges Maß an Ehre, Würde und Stolz zurückerobern konnte, hatte sich gelohnt. Es war trotz Angst, Schrecken und zahlreicher Verluste eine hoffnungsvolle Intifada gewesen, die vieles, so glaubte ich in gewissen Momenten, in Schwung gebracht und die Haltung der Menschen auf beiden Seiten positiv verändert hatte. Und auch das Ende war vielversprechend gewesen. Das Land, bis dahin zu einem Ghetto zusammengeschrumpft, in dem sowohl die Israelis als auch die Palästinenser auf ihren scheinbar unvereinbaren Positionen beharrten und das einzig Lebendige zwischen ihnen Haß, Verbitterung und Verachtung gewesen waren, hatte sich geöffnet. Ein Strom erwartungsvoller Touristen, ausländischer Politiker, Journalisten und Investoren war in Israel eingebrochen und hatte uns wirtschaftlich und moralisch beflügelt. Es war sogar eine große ägyptische Delegation gekommen, unter ihnen der breithüftige Ali, ein einflußreicher Politiker, den ich aus Paris kannte und dem ich mich im Zuge der allgemeinen Öffnung auch öffnete, denn nichts war wichtiger als die Zusammenarbeit auf allen Ebenen.
»Du kannst dir nicht vorstellen, was bei mir los ist«, hatte mir meine Freundin Sarah, die in der vornehmsten Gegend Tel Avivs ein Immobiliengeschäft betrieb, mitgeteilt, »alle wollen plötzlich in Israel investieren. Die russische Mafia hat mir für ein Haus am Meer gleich acht Millionen Dollar in bar auf den Tisch gelegt, die Japaner suchen ein Grundstück, um darauf ein Einkaufszentrum zu bauen, und kürzlich sind sogar die Jordanier gekommen, die einen Bauplatz für ihre zukünftige Botschaft suchen.«
Das also war der Beginn einer großen Ära, und wäre ich nicht eine so beharrliche Pessimistin – sprich Realistin –, hätte ich die andere Seite der goldenen Medaille gar nicht gesehen. Doch dank dieser unguten Eigenschaft fiel mir auf, daß hinter der schönen Kulisse alles beim alten zu bleiben schien.
Neue Siedlungen wurden gebaut und alte vergrößert. Neue vorbildliche Straßen, die um die autonomen Städte herum zu den Siedlungen führten, wurden angelegt und vielspurige Autobahnen, denen privater palästinensischer Besitz zum Opfer fiel. Die israelischen Gesetze, mit denen die Palästinenser, was freien Warenvertrieb und Bewegungsfreiheit betraf, geschlagen waren, wurden nicht geändert und die Leidtragenden auf spätere Zeiten vertröstet. Die palästinensischen Dörfer, die zu Jerusalem zählten und damit unter israelische Verwaltung fielen, waren und blieben in einem erbärmlichen Zustand, obgleich die Einwohner hohe Steuern an den Staat zahlen mußten. Über die Existenz der fünf großen israelischen Siedlungen, die in dem überbevölkerten, jetzt autonom gewordenen Gazastreifen wie fette Rosinen in einem kümmerlichen Teig klebten, wurde nicht einmal diskutiert. Und als Baruch Goldstein, ein fanatischer Siedlerarzt in Hebron, neunundzwanzig betende Muslime in der Abrahamsmoschee über den Haufen schoß und das ein allgemein gebilligter Anlaß gewesen wäre, das Siedlerpack aus Hebron rauszuwerfen, wurde nichts unternommen. Dafür aber wurde dem Mörder, der bei dieser Aktion ebenfalls umgekommen war, eine Gedenkstätte errichtet, zu der seine zahlreichen Anhänger pilgerten, um ihn als Helden des jüdischen Volkes zu verehren.
All das brachte mich auf den Gedanken, daß man den Palästinensern blauen Dunst vormachen und sich der »Friedensprozeß« nur in aufgeblasenen Worten und nicht in Taten niederschlagen könnte.
»Das Wichtigste ist«, wurde ich belehrt, »daß zwei Völker, die seit Jahrzehnten verfeindet sind, plötzlich aufeinander zugehen und an Frieden denken, das Wort aussprechen, den Zustand anstreben.«
Taten sie das wirklich? Gingen nicht nur die machthabenden Politiker unter dem Druck der amerikanischen Weltpolizei und den väterlichen Ermahnungen Clintons aufeinander zu? Während die beiden Völker, in keiner Weise darauf vorbereitet, abwartend und etwas verlegen am Rande standen und sich weiterhin mißtrauten?
»So was geht natürlich nicht von heut auf morgen«, belehrte man mich erneut, »aber Frieden wollen wir alle.«
»Ja«, sagte ich, »die Israelis wollen ihn zu ihren eigenen, unverschämten Bedingungen, und wenn die Palästinenser damit nicht einverstanden sind, sind sie eben diejenigen, die keinen Frieden wollen.«
»Du glaubst also nicht an den Friedensprozeß?«
»Bei näherer Betrachtung eigentlich nicht.«
»Und deine palästinensischen Freunde, freuen die sich wenigstens über die neue Situation?«
»Fragt sie doch selber! Geht zu den Palästinensern und unterhaltet euch mit ihnen. Das wäre doch überhaupt der erste Schritt in Richtung Frieden: Kontakt aufnehmen, Gedanken und Erfahrungen austauschen, zuhören und sich gegenseitig zeigen, daß man ein Mensch ist.«
Aber keiner ging – weder die Israelis zu den Palästinensern noch die Palästinenser zu den Israelis. Man hatte sich auf menschlicher Ebene angeblich nichts zu sagen. Die Furcht voreinander war zu groß, das Mißtrauen steckte zu tief, und die Gegensätze schienen unüberbrückbar. Man begegnete sich an Orten, an denen es etwas zu kaufen gab. Israelis gingen wieder in die Altstadt, denn das Obst und Gemüse waren da billiger, der Humus schmackhafter und die Auswahl an Kitschandenken und hübschen, bunten Fummeln größer. Die Palästinenser hingegen wurden geradezu magisch von den israelischen Geschäften und Einkaufszentren angezogen, denn dort war die Qualität besser als in ihren eigenen Läden, die Textilien moderner und die Auswahl an technischen Geräten größer und auf dem neuesten Stand. Man kaufte und kam sich im Zuge dieser beliebten Tätigkeit nahe genug, um ein paar freundliche Worte über den Friedensprozeß zu wechseln: Hatten sie nicht alle seit Jahrzehnten darauf gehofft und gewartet? Wollte nicht jeder seine Kinder in Frieden und Sicherheit aufwachsen sehen? Weinte nicht eine arabische Frau um ihren toten Sohn oder Mann genauso wie eine jüdische?
Und dann ging wieder irgend etwas in die Luft, und die palästinensischen Gebiete wurden in einer kollektiven Strafaktion abgeriegelt, und die radikalen Israelis schrien: »Tod den Arabern!«, und die radikalen Palästinenser feierten den Selbstmordattentäter als Helden und Märtyrer.
»Man kann eben nicht mit Terroristen in Frieden leben«, sagten die einen; »man kann nicht jahrzehntelang unter einer infamen Besatzung leben«, sagten die anderen. Beide hatten recht.
Aber der Friedensprozeß ging unter den Machthabenden verbissen weiter, und die beiden Völker standen noch immer abwartend und etwas verlegen am Rande und mißtrauten sich. Der Deckel, mit dem man den brodelnden Topf schnell wieder verschloß, lag schon bereit, und Clinton ermahnte seine beiden Schützlinge väterlich, ihre Völker im Griff und das höchste Gut der Menschheit, den Frieden, im Auge zu behalten.
Zwei Jahre gingen ins Land. Rabin hielt sich tapfer und folgte seiner Vision, aus Israel ein offenes, mit seinen arabischen Nachbarvölkern in Frieden lebendes Land zu machen. Die Palästinenser fielen bei dieser Vision unter den Tisch, aber sie waren im Vergleich zu den großen arabischen Staaten eben nicht so wichtig. Und da sie bei denen auch nicht beliebt waren, konnte man hoffen, das Problem später vielleicht gemeinsam auf diese oder jene Art zu lösen. Arafat und seine vier- oder fünftausend Kumpel, die er aus Tunesien mitgebracht hatte, machten es sich behaglich. Die Kumpel bekamen alle die höchsten Posten in der PA (Palestinian Authority) und Arafat hohe Summen von den europäischen Staaten. Mit denen sollte dem palästinensischen Volk auf die Beine geholfen und der utopische Grundstein zu einem Staat gelegt werden.
Doch der Grundstein verschwand spurlos in den Taschen Arafats und seiner Kumpel und die europäischen, merkwürdig blauäugigen Staaten wunderten sich und gaben weitere Summen. Die Palästinenser, die endlich bessere Zeiten und von ihrem Nationalhelden Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit erwartet hatten, waren zunächst verstört, dann verärgert. Aber da er nun mal ihr Nationalheld und der Begründer ihrer Freiheitsbewegung war, versuchten sie, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und taten, was sie seit vielen Generationen getan hatten, sie warteten weiter auf bessere Zeiten und Gerechtigkeit.
Mein Pessimismus, sprich Realismus, wuchs. Rabins Vision forderte eine Flut von Aufklebern heraus, die die Rückfenster jeglicher Verkehrsmittel zierten und in primitiven Worten genau das Gegenteil von dem verlangten, was Rabin anstrebte: ein rein jüdisches, noch dichter besiedeltes Ghetto mit allen im Sechs-Tage-Krieg eroberten Gebieten. Plakate tauchten an den Mauern der Häuser auf, die Rabin in SS-Uniform oder mit einer Kefieh um den Kopf zeigten und einem das Blut in den Adern gefrieren ließen. Kundgebungen gegen den »Verräter des israelischen Volkes« fanden statt, und der Abschaum dieses Volkes brüllte zotige Parolen gegen ihn. Die Friedensbewegung »Schalom achshav« (Frieden jetzt) und kleinere, um Frieden bemühte Gruppen protestierten gegen die Hetze. Und der zivilisierte »linke« Flügel senkte, von diesem Spektakel angeekelt, den Blick und schwieg.
Der Friedensprozeß aber ging weiter und kulminierte in einer beeindruckend großen Demonstration für die Ideen Rabins. Auf der wurde der israelische Ministerpräsident von einem rechtsradikalen orthodoxen Jüngling abgeknallt.
Es war eine Katastrophe alttestamentarischen Ausmaßes. Die Kugeln schienen nicht nur den Ministerpräsidenten, sondern das ganze Volk durchbohrt zu haben – selbst die, die seine Politik verurteilt hatten. Egal, wie sehr sich die Parteien innerhalb der Regierung zerfleischt hatten, so etwas hatten sie nicht gewollt! Ein Aufschrei ging durch das Land: »Ein Jude hat einen Juden ermordet!« So etwas hatte es in der jüdischen Geschichte noch nie gegeben, wurde behauptet, so etwas hätte es niemals geben dürfen.
Abgesehen davon, daß diese Behauptung nicht stimmte – viele Juden haben Juden ermordet –, hinterließ sie für mich noch einen unangenehmen Beigeschmack. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Juden, der einen Juden, und einem Juden, der einen andersgläubigen Menschen umbringt, überlegte ich. Und wenn man es so sah, war es dann vielleicht auf die Hybris eines Volkes zurückzuführen, das sich wertvoller dünkte als andere Völker?
Wie immer, dem fassungslosen Entsetzen darüber, daß ein Jude einen Juden ermordet hatte, folgte die viel schwerwiegendere Erkenntnis, daß es sich hier um den gemeinen politischen Mord an einem Mann handelte, der versucht hatte, andere Wege zu gehen, neue Türen zu öffnen und damit dem Frieden näher zu kommen. Mit Rabin war diese Hoffnung ermordet worden.
Die allgemeine Trauer, in die sich bei denen, die weggeschaut und geschwiegen hatten, Schuldbewußtsein mischte, artete in eine Massenhysterie aus, die an den würdelosen Rummel erinnerte, mit dem man Diana, die sogenannte Prinzessin der Herzen, ins Jenseits begleitet hatte.
Gewiß, es war eine Tragödie, doch wenn man sie retrospektiv betrachtet, fragt man sich, wie ein derart bestürztes, um Rabin und seine Friedenspolitik jammerndes Volk keine sechs Monate später den rechtsradikalen Netanjahu wählen konnte. Und wenn ich bereits angesichts der wachsenden Siedlungen und immer neuen Straßen, der Versäumnisse und Winkelzüge meine Zweifel an Rabins Politik gehabt hatte, dann kam ich mit Netanjahu zu der Erkenntnis, daß er derjenige war, den das israelische Volk verdiente.
Aber zunächst einmal hatten wir alle den Eindruck, daß die Tränenströme um Rabin, die Gebete, die man ihm hinterherschickte, die zigtausend Kerzen, die man für ihn entzündete, und die alten Chaluzlieder, die man ihm sang, zu einer Katharsis führen und ein neues, von allem Bösen gereinigtes Volk erstehen lassen würden. Trauern verbindet die Menschen und Trauern, wenn es in der Öffentlichkeit zelebriert wird, macht Spaß.
Ich sah sie überall zusammenhocken, hauptsächlich Jugendliche, die um die Kerzen wie um ein Lagerfeuer saßen und die schwermütigen, idealistischen Lieder sangen, die eine Zeit heraufbeschworen, in der das Land angeblich noch heil gewesen war. Sie klangen ein bißchen wie Elton Johns Lied auf Diana: »Good-bye England’s rose …«, und man hätte den Text nur etwas umzudichten brauchen, dann hätte er auf Rabin gepaßt. Trauer, wenn sie zu einem Volksfest mutiert, ist eben auch austauschbar und für diejenigen, die echte Trauer empfinden, eine Zumutung.
»Wo wart ihr, als Rabin noch lebte!« rief Lea, Rabins Frau, einer Gruppe Jugendlicher zu, die sich mit den unvermeidlichen Kerzen und Liedern vor ihrem Haus niedergelassen hatten, »damals, nicht heute, hätte er euch gebraucht!«
Als man den Ministerpräsidenten zu Grabe trug, waren alle da, die höchsten Rang und Namen hatten, und selbst die Palästinenser saßen gebannt vor dem Fernseher und waren erschüttert über die weltweite Anerkennung und Bedeutung eines Mannes, der während der Intifada befohlen hatte: »Wenn diese Araber keine Ruhe geben wollen, muß man sie verprügeln und ihnen die Knochen im Leibe brechen.« Doch dieser Befehl stammte aus einer Zeit, in der er noch Verteidigungsminister gewesen war, und wäre er dabei geblieben, sowohl was das Amt als was die Befehle betraf, wäre er auch nicht ermordet worden – jedenfalls nicht von einem Juden.
Und es hätte auch nicht die zahllosen Aufkleber auf den Rückfenstern der Fahrzeuge gegeben, die den vehementen Schmerz des israelischen Volkes auszudrücken versuchten: »Schalom Freund!«
Kurzer Rückblick auf die erste, »Glorious« benannte Intifada
Es war trotzdem eine schöne und für mich wichtige Zeit, die zwischen den beiden »hardlinern« Schamir und Netanjahu, zwischen Erkenntnis und Illusion, zwischen Schmerz und Hoffnung. Es war eine lebendige Zeit, die mir Augen und Ohren öffnete, eine Zeit, aus der die stärksten Beziehungen erwuchsen, die Menschen mit gleichem Denken zusammenschmiedete. Ich vermisse diese Freundschaften mehr als die Liebe, vermisse die verrückten Stunden mit Philip und Rick, deren Geist, Witz und Charme mich aus den schwärzesten Stimmungen rissen, die Gespräche mit der wunderbaren Jane, die das Gesicht und den Nimbus einer Prophetin hatte, die unfreiwillig komischen Situationen, in die ich mit Stanley, dem zerstreuten, homosexuellen Literaturprofessor, geriet. Und ich vermisse meine palästinensischen Freunde: den mir nahestehenden Arzt Ismael und seine Familie, die in Ramallah leben; den hübschen, zarten Verführer Ibrahim; George, den schlauen »Manager« meines Stammlokals in Jericho, und den vornehmen Baumeister Avi, mit dem ich meine ersten Schritte in die fremde arabische Welt wagte. Ich vermisse ihre Nähe, ihre unbedingte Freundschaft, Loyalität und Diskretion, und am meisten vermisse ich die Freude, ihnen auf diese oder jene Art helfen zu können und das Band zu knüpfen, das ihre Gegenwart mit meiner Vergangenheit verbindet.
Sie wird nie wiederkommen, diese Zeit, in der Philip, Rick und ich unsere Beklommenheit in Wodka ersäuften, Ismael zu mir nach Jerusalem kam, um bei einer friedensbewegten jungen Israelin Hebräisch zu lernen, und ich am frühen Morgen in mein geliebtes Jericho fuhr, um dort mit George unter dem Orangenbaum zu sitzen und über die Ungerechtigkeit in der Welt zu philosophieren. Sie ist unwiederbringlich verloren und mit ihr die Kraft, mit der ich mich damals in den Strudel der Ereignisse warf. Ich glaube, ich habe niemals so bewußt und aktiv gelebt wie in der Zeit der Intifada, die mich zwang, aus morschen Denkmustern auszubrechen und in neue Lebensbereiche vorzudringen. Heute, in einer Ära des Verfalls, der nicht nur zwei Völker, sondern sogar mich und meinen schwarzen Kater Dino betrifft, kommt mir die damalige Zeit wie ein letzter Aufschub vor, ein Versuch, den Niedergang zu überlisten. Aber wem kann das schon gelingen? Dino und ich haben die Kraft verloren und die zwei Völker den letzten schäbigen Rest eines Gewissens.
Natürlich ereignete sich das alles nicht von heute auf morgen. Dinos Sauf- und meine Brüllperiode, die bei ihm auf schlechte Nierenfunktion, bei mir auf schlechte Nerven schließen ließ, hatten noch lange nicht begonnen. Er konnte manchmal noch auf hohe Mauern springen und ich mich im Badeanzug zeigen.
Ironischerweise fiel die Amtsperiode Netanjahus sogar in eine sehr erfolgreiche Zeit für mich – sowohl beruflich wie privat. Eins zog das andere nach sich, und beides erstaunte mich, denn ich hatte in den letzten dreißig Jahren weder meinen Schreib- noch meinen Lebensstil geändert. Ich schrieb immer noch in der ersten Person und über ruhmlose Erdenbürger, die schuldlos in das Räderwerk verantwortungsloser Politik geraten. Und ich liebte nach wie vor die Natur, schwärmte für Katzen und befreundete mich fast immer nur mit Menschen, die an sich und der Welt zweifelten und litten. Warum mich also plötzlich gewisse, aber wohl recht große Bevölkerungsgruppen in Deutschland »entdeckten«, weiß ich nicht genau. Es könnte sein, daß sich an deren Geschmack und Weltbild etwas geändert hatte und sie auf einmal ruhmlose Menschen, die in das Räderwerk nationalistischer Politik geraten waren, interessant fanden. Hinzu kam wohl, daß ich meinen Stoff aus der Fülle wirklicher Menschen und Ereignisse schöpfte und damit den Lesern einen realistischen Einblick in deren und meine Existenz gewährte. Wie auch immer, ich wurde Mittelpunkt eines beachtlichen Leser- und Bekanntenkreises, der mir, dem Land, in dem ich lebte, den Freunden, die an der Welt litten, und den Katzen, die ich betreute, ein hohes Maß an Anteilnahme und Verständnis zukommen ließ. Und da sich sowohl die Katzen auf meinem Dach als die Leiden meiner Freunde, ganz zu schweigen von den Desastern im »Heiligen Land«, mehrten, wuchs auch deren Interesse.
Was meinen Freundeskreis betraf, so wurde er immer jünger und deutscher, und das gab mir zu denken. War es im Hinblick auf »jung« mein ästhetisches Bedürfnis, meine Freude an straffer, glatter Haut und festem Fleisch? War es der offene, wache Geist, der noch nicht von den Schlacken des Alters und den als Erfahrung getarnten Konventionen überlagert war? War es ein spät ausgebrochener »Florence-Nightingale-Tick«, der bei diesen gescheiten und verwirrten jungen Menschen einen Beschützer- und Helferinstinkt weckte? War es das Verlangen nach Lachen und Unfugtreiben, nach Geschichten, in denen die Liebe, mit all ihren schönen und bösen Begleiterscheinungen, so viel ernster genommen wurde als die weltweiten Katastrophen? Wahrscheinlich war es von allem etwas, und was das Deutsche betraf, mochte es schlicht und einfach die gemeinsame Sprache und Kultur sein. Die gleichaltrige und alte Generation, die in Israel über Jahrzehnte zu meinem Freundeskreis gehört hatte, schien mir zunehmend enger und selbstbezogener zu werden, was gewiß eine Folge der generellen Verengung, Verflachung und Selbstbezogenheit war. Allerdings gesellte sich auch noch die Altersstarre dazu, die meine Geduld mit jeder Platitüde und Wiederholung, mit jedem unkonzentrierten Abschweifen auf eine harte Probe stellte.
Die Zeit wird knapp, sagte ich mir, bald werde ich selber ein altes Kind und meine jungen Freunde werden erwachsen sein und von der Banalität des tagtäglichen Lebens abgestumpft. Also beschloß ich, mir wenigstens in dieser Hinsicht noch ein paar hübsche Jahre zu gönnen, ein Entschluß, mit dem ich mir ein permanentes Schuldbewußtsein meinen alten, lieben Freunden gegenüber einhandelte. Die Intervalle zwischen meinen Besuchen bei ihnen wurden immer länger und mein Lächeln, mit dem ich sie begleitete, immer gereizter.
Der Friedensprozeß des Bibi Netanjahu
Und der Friedensprozeß ging weiter, besser gesagt, er fing von vorne an, denn jetzt mußte er ja nach dem Konzept Bibi Netanjahus geführt werden.
Ich hatte längst den Glauben und jetzt auch jegliches Interesse daran verloren und nannte ihn, wie der ehemalige Ministerpräsident Schamir, der der englischen Aussprache des Wortes »peace« nicht mächtig war, den »piss process«. In diesem Zusammenhang kam mir dann jedesmal der uralte Witz meines Freundes Rudi in den Sinn, den er immer dann vortrug, wenn ihm gar nichts Besseres mehr einfiel: Ein alter, prostatakranker Mann kommt zu einem Arzt und beschwert sich, daß er nicht mehr richtig pissen könne. »Wie alt sind Sie«, wird er gefragt. »87.« – »Also dann, guter Mann, genug gepißt«, sagt der Arzt.
Ach, wären die in den »Friedensprozeß« involvierten Politiker doch so weise gewesen wie dieser Arzt. Sie hätten den Gutgläubigen auf beiden Seiten viel kurzatmige Hoffnung und langfristige Enttäuschung erspart. Statt dessen herrschte hektische Betriebsamkeit an allen Friedensfronten.
Ich habe keine Ahnung mehr, wer wann wo hinflog, um zu verhandeln und zu handeln, um zu drohen, zu mahnen, zu schlichten, zu versprechen, zu lügen. Jede Woche konnte man in der Zeitung lesen, im Radio hören und im Fernsehen sehen, welcher Politiker sich mit welchem traf, wer wem mit einem breiten Grinsen die Hand schüttelte, wer was zu wem sagte. Manchmal, wenn ich mich durch die Sender zappte, huschten sie zufällig über meinen Bildschirm: der selbstherrliche Bibi, dessen Gesicht immer feister wurde; Arafat, dessen fette Unterlippe zu zittern begonnen hatte; Clinton, der hochgemut zu verkünden wußte, daß dieses oder jenes Treffen »sehr positiv« verlaufen sei.