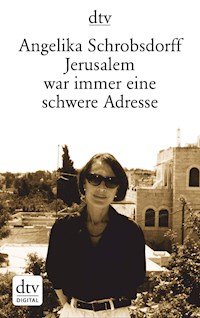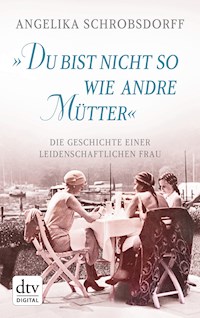6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein literarisches Reisejournal Das Ende des Kommunismus war für die Völker Osteuropas der Beginn einer Hoffnung und zugleich eine Reise ins gesellschaftliche und ökonomische Elend. Eine Schriftstellerin wie Angelika Schrobsdorff, die dort acht Jahre ihres Lebens verbracht hat, kann das nicht kalt lassen. Sie kennt die Verhältnisse, hat sie doch als Kind mit ihrer Mutter, einer deutschen Jüdin, den Naziterror in Bulgarien überlebt. Jetzt will sie selbst helfen. Als sie Anfang Dezember 1996 ein Anruf aus Sofia erreichte und ihre Nichte ihr von der Not und der Bedrückung der Menschen erzählte, machte sie sich spontan auf den Weg. Sie setzte sich in ihrer neugefundenen Heimat ins Flugzeug und flog in das Land ihres ehemaligen Exils. Während ihres Aufenthalts führte sie Gespräche mit alten und neuen Freunden und erlebte am Jahreswechsel den Beginn der Demonstrationen gegen die letzten Überreste des autoritären Regimes. Ihr Tagebuch ist ein Bericht aus erster Hand und ein erstaunliches literarisches Dokument.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Angelika Schrobsdorff
Grandhotel Bulgaria
Heimkehr in die Vergangenheit
Für meine Nichte Evelina
Jerusalem Sofia
Fallit oder ein unauffälliges Elend
Anfang Dezember rief mich meine Nichte Evelina in Jerusalem an. Sie lebt mit Mann und neunjährigem Sohn in Burgas, einer Stadt am Schwarzen Meer.
»Motektsche!« sagte sie. »Oh, du mein Motektsche!«
Sie hat eine tiefe, vom vielen Rauchen belegte Stimme, doch wenn sie Motektsche sagt, das hebräische Wort für Süße, dem sie dann noch die bulgarische Koseform tsche anhängt, hat ihre Stimme den Ton eines Kleinkindes, das sich in den ersten Worten übt.
Ihr Anruf überraschte mich nicht, denn sie ruft öfter aus der Postzentrale an, wo ihre Freundin, die dort arbeitet, sie heimlich kostenlos telefonieren läßt.
»Ich habe gerade deinen Brief bekommen«, sagte sie, »und bin natürlich sehr traurig, daß du jetzt doch nicht kommen kannst, aber für dich ist es besser so. Du hättest es hier nicht ausgehalten.«
»Evi«, protestierte ich, »ich hab es schon oft ausgehalten, und es war, trotz allem, immer sehr schön für mich.«
»Diesmal nicht, Angeli, diesmal wär es nicht schön geworden. Aber sprechen wir von was anderem. Was macht deine Schulter, und wie geht es Dino?«
Evelina ist ein offener, mitteilsamer Mensch, der immer direkt das sagt und fragt, was ihr auf dem Herzen liegt. Warum also verschwendete sie plötzlich die kostbare Zeit eines Ferngespräches mit der Erkundigung nach einem unerheblichen Schmerz in meiner Schulter und dem Befinden meines schwarzen, zehn Jahre alten Hauskaters?
»Der Schmerz ist weg und Dino geht es gut. Also, was ist, Evi? Was ist los? Ist etwas bei euch zu Hause passiert?«
»Nein, bei uns zu Hause ist noch alles in Ordnung.«
»Was meinst du mit ›noch‹?«
»Na, wenn es in Bulgarien so weitergeht …«
»Wie weitergeht?«
Sie schwieg.
Dank meiner Verbindungen zu Verwandten und Freunden wußte ich, daß in Bulgarien böse Zustände herrschten, daß es mal über Wochen kein Brot gab, mal kein Heizöl, mal nur stundenweise Elektrizität und daß die Preise für einen Normalverdienenden unerschwinglich geworden waren. Mehr wußte ich nicht, denn Bulgarien war eines der wenigen Länder, das keine Sensationsnachrichten zu bieten hatte, keine Massaker, keine Bürgerkriege, keine Flüchtlingsströme oder -lager, keine Seuchen – nichts also, was die Fernseheinschaltquoten oder Zeitungsauflagen hätte hochschnellen lassen. In Bulgarien war das Elend unauffällig und dadurch schlecht zu vermarkten.
»Evi«, rief ich, »nun sprich schon endlich. Läßt du dich scheiden? Ist dein Sohn sitzengeblieben? Ist euer Haus zusammengebrochen?«
»Nein, nicht das Haus«, sagte sie mit einem kleinen betrübten Lachen, »nur das Land.«
»Das Land, Evi, das Land! Ich weiß ja, daß es …«
»Angeli, du weißt nicht, keiner von euch weiß.« Und plötzlich schrie sie: »Der bulgarische Staat ist fallit!«
»Was ist er?«
»Fallit, Angeli, fallit! Die Kommunisten haben es geschafft! Tausende werden in diesem Winter verhungern und erfrieren.«
Das Wort fallit war mir fremd, aber daß die Kommunisten etwas Furchtbares geschafft haben mußten, lag nahe.
»Du lieber Gott«, sagte ich, um mir Bedenkzeit zu geben und nicht allzu begriffsstutzig dazustehen, »wie konnte denn das … ah, ich verstehe.«
Fallit war nichts anderes als die bulgarische Abwandlung des französischen Wortes faillite, und daraus schloß ich: Der bulgarische Staat war bankrott, die Gepflogenheiten der ehemaligen bulgarischen Bourgeoisie aber immer noch gültig. Sie bediente sich nachwievor französischer Worte. Das eine war so erschreckend, wie das andere belustigend.
»Was verstehst du, Angeli?«
»Daß der Staat pleite ist. Aber das mit den Kommunisten habe ich noch nicht ganz begriffen.«
»Ich kann dir das jetzt nicht am Telefon erklären. Ich schreibe dir.«
»Evi!«
»Ja?«
»Werden in diesem Winter wirklich Tausende verhungern und erfrieren?«
»Motek«, sagte sie, und ohne das tsche am Ende klang das Wort hart und ihre Stimme gar nicht mehr kindlich, »mach dir jetzt bitte keine Sorgen. Ich schwöre dir, Mitko, Andy und ich haben genug zu essen und zu heizen. Ich hab ja ein paar deutsche Mark zur Seite gelegt. Aber die, die weder Deutschmark noch Dollar haben und von ihren Gehältern oder Renten leben müssen, denen gebe ich wenig Überlebenschancen. Fallit, Motektsche, ist fallit.«
Ausgerechnet Bulgarien
Als ich am nächsten Morgen auf der Terrasse frühstückte, beschloß ich, nach Bulgarien zu fahren. Vielleicht verdankte ich diesen Entschluß der Butter, die ich dick auf eine Scheibe Brot strich, der Sonne, die mich fast sommerlich heiß umfing, vielleicht auch Kater Dino, der neben mir auf einem Stuhl saß, ein Stück Käse forderte und bekam, daran schnupperte und es angeekelt liegen ließ. Ja, es muß wohl der Überfluß an Nahrung und Wärme gewesen sein, der Überdruß, mit dem der Kater ein Stück Käse zurückwies. Ich stand auf, ging geradewegs zum Telefon und rief mein Reisebüro an.
»Fliegt die El Al noch nach Bulgarien?« wollte ich wissen.
»Ja, einmal die Woche.«
»Bitte, buchen Sie mir einen Platz in der letzten Woche vor Weihnachten.«
»Da wäre ein Flug am 23. Dezember.«
»Ausgezeichnet«, sagte ich, denn es war der Tag vor meinem Geburtstag und auf diese Weise würde ich ihm entkommen und nicht durch zahlreiche Glückwunschanrufe an mein Unglück erinnert werden.
»Ich fliege am 23. Dezember nach Bulgarien«, teilte ich meinen Freunden und Bekannten schroff mit. Sie sollten es bloß nicht wagen, mir mit Einwänden zu kommen.
»Ausgerechnet Bulgarien!« sagte einer von ihnen. »Und das auch noch im Winter! Hättest du dir nicht etwas Angenehmeres, Wärmeres, Erholsameres aussuchen können?«
»Was ist denn das für eine Schnapsidee?« fragte ein anderer, »in Rumänien …«
»Bulgarien«, verbesserte ich.
»Na, ist ja ein und dasselbe, in all diesen Ländern sollen chaotische Zustände herrschen.«
»Ach, wie schön!« rief eine Freundin, die einem nie richtig zuhörte. »Hab eine wunderbare Zeit!«
»Oh …«, sagte eine dritte, und da ihr zu diesem Land und meinem bizarren Vorhaben offenbar überhaupt nichts mehr einfiel, erklärte sie: »Ich fliege über die Feiertage nach Rio.«
Ich rief meine Nichte in Burgas an und erklärte, daß ich am 23. Dezember in Sofia einträfe.
»Motektsche«, gurrte sie, »ist das dein Ernst?«
»Ja.«
»Motektsche«, schrie sie, »du bist eine Heroine.«
Der Aufschrei und die höchst schmeichelhafte Bezeichnung meiner Person entschädigten mich im voraus für all das, was mir bevorstand: ein Flug, für den ich gezwungen war, um drei Uhr früh aufzustehen, die Angst um Dino und die restlichen zwölf Katzen, die ich einem ebenso beflissenen, wie inkompetenten Paar anvertrauen mußte, der Mangel an winterfester Kleidung und nicht zuletzt mein angeschlagener Zustand, den ich sowohl meinem Alter als der israelischen Politik verdankte. Doch nichts, aber auch gar nichts brachte meinen heroischen Entschluß ins Wanken.
»Bitte, ruf meinen Schutzengel Bogdan an«, beauftragte ich meine Nichte, »und sag ihm, er möchte mich am Flugplatz abholen und etwa drei Wochen lang unter seine Fittiche nehmen.«
»Natürlich, Angeli, ich mach das sofort. Ohne ihn würdest du’s ja nicht einmal vom Flugplatz bis zum Hotel schaffen.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, hier schlägt man den Leuten doch rechts und links für ein paar Dollar den Schädel ein, und Ausländer, besonders Frauen, sind freies Wild.«
»Ach so«, sagte ich und dachte: Freies Wild, Heroine – was man nicht alles in Bulgarien werden kann!
»Bitte mach dir jetzt keine Sorgen, Motektsche, mit dem großen, männlichen Bogdan an deiner Seite kann gar nichts passieren.«
»Ich weiß, Evilein. Aber frag ihn mal trotzdem, ob ich ihm nicht zu unserem Schutz eine Pistole mitbringen soll. Hier gibt’s davon mehr als genug.«
Sie lachte ein tiefes, kleinkindhaftes Lachen, sagte: »Ich liebe dich«, und hing ein.
Gore, dollo – Oben, unten
Die nächtliche Fahrt durch Jerusalem war wunderschön. Die Luft warm und weich, die Stadt in friedlichem Schlaf, die Straßen ausgestorben.
»Auf Wiedersehen, Heilige Stadt«, sagte ich und fühlte einen Stich des Abschiedsschmerzes. Wäre Jerusalem wach gewesen und die Straßen voll, ich hätte ihn nicht gefühlt.
Auf dem Flugplatz herrschte wenig Betrieb. Ich gelangte schnell und problemlos in die Wartehalle. Auf der Abflugtafel leuchtete unter vielen anderen, angenehmeren, wärmeren, erholsameren Reisezielen das Wort: Sofia.
Ich schaute es lange an und fühlte etwas wie Zärtlichkeit. Sofia – ein Stück Zuhause.
Ich begab mich zu Ausgang drei. Es saßen schon etliche Menschen auf den Bänken. Sie waren trotz unzumutbar früher Stunde sehr rege, sahen aber aus, als hätten sie sich noch nicht das Gesicht gewaschen, die Zähne geputzt und die Haare gekämmt. Ich ging ein paarmal auf und ab, um zu hören, welche Sprache sie sprachen.
Einige sprachen hebräisch, andere bulgarisch. Dann sprachen die, die eben noch hebräisch gesprochen hatten, bulgarisch und umgekehrt. Bulgarische Juden, stellte ich fest. Etwas abseits stand eine kleine Gruppe Männer. Drei von ihnen waren robuste, bäuerliche Typen, in neuen, noch steifen Jeans und billigen Lederjacken, wie sie in der Altstadt von Jerusalem verkauft werden. Der vierte, älter und schmaler als die anderen, trug einen abgenutzten braunen Anzug und sein Gesicht war verhärmt. Bei ihnen mußte es sich um Gastarbeiter handeln, von denen viele schwarz in israelischen Bauunternehmen arbeiteten.
»Wie gefällt dir deine Arbeit?« fragte der Verhärmte einen der Robusten.
»Gore, dollo«, sagte der, was wörtlich übersetzt heißt: »Oben, unten.«
»Ich habe Glück gehabt und eine ›süße‹ Arbeit gefunden«, sagte ein anderer.
»Heide dä«, rief ein dritter, »eine süße Arbeit! Hast du die vielleicht bei der Mafia gefunden?«
Jetzt brachen alle in Gelächter aus, und ich ging weiter.
Ja, das waren heimatliche Klänge, rauhe und gleichzeitig blumige Worte, die ich in meiner Kindheit und Jugend so oft gehört, so oft gesprochen hatte. Wie übersetzte man heide dä, überlegte ich, ein Wort, das man zahllose Male am Tag gebrauchte, das verwunderter Ausruf, dringende Aufforderung oder, ohne das dä am Ende, sanfte Zustimmung sein konnte. Ich fand kein Äquivalent dafür.
Als sich der Himmel lichtete und einen neuen wolkenlos warmen Tag versprach, wurden wir zum Einsteigen aufgerufen. Es war sechs Uhr und ich erleichtert, daß wir pünktlich abflogen, also um 9 Uhr 30 in Sofia landen würden. Das Flugzeug war halb leer, nur die letzten zwei Raucherreihen, in denen ich einen Platz gebucht hatte, waren voll besetzt. Ich saß wie immer am Gang, neben einer kleinen Dicken, die sich in silbrige Leggings und einen rosa Angorapullover gezwängt hatte. Auf der anderen Seite des Ganges saßen die Bauarbeiter. Als sich das Flugzeug in Bewegung setzte, über die Startbahn raste und abhob, sagte einer von ihnen mit sanfter Zustimmung: »Heide.«
Das Rauchverbotschild erlosch, und im selben Moment zündeten sich alle dreiundzwanzig Passagiere in den letzten zwei Reihen eine Zigarette an. Das wurde selbst mir, einer überzeugten Raucherin, zuviel und ich stand auf, wählte eine Reihe in der Mitte der Maschine und ließ mich dort nieder.
Auf vielen kleinen Fernsehschirmen wurde uns jetzt die bunte, heile Welt Israels gezeigt: prächtige Blumen, blühende Bäume, glitzernder Schmuck vom Juwelier Stern, schöne tanzende Mädchen, braungebrannte Wellenreiter, hübsche spielende Kinder, moderne Fabriken, luxuriöse Restaurants, Villen in Gärten, glückliche Familien in schicken Autos.
»Donnerwetter«, murmelte ich, »haben wir’s gut!«
Ich schlug ein Buch auf und versuchte mich auf die gar nicht bunte, heile Geschichte einer palästinensischen Hausfrau und Mutter von zehn Kindern zu konzentrieren, aber die kannte ich schon aus vielen ähnlichen Geschichten und außerdem wurde gerade das Frühstück serviert.
Es war ein ärmliches Frühstück, Besteck und Geschirr aus Plastik, die Brötchen vielleicht auch. Sie hatten eine blasse Farbe und eine glatte, unnachgiebige Oberfläche. Ich trank eine bräunliche, geschmacklose Flüssigkeit, die einem schon oft benützten Teebeutel zu entstammen schien. Das einzige Kind im Flugzeug begann selbstverständlich zu schreien. Es saß auf der anderen Seite des Ganges, drei Reihen hinter mir. Das Kind hörte nicht auf zu schreien. Ich schaute böse um die Ecke meines Sitzes. Die Eltern, eine hausbackene Mutter und ein großer, auf ordinäre Art gutaussehender Vater, bemühten sich, ihm den Mund mit einem der Plastikbrötchen zu stopfen. Das Kind, verständlicherweise, weigerte sich, schlug um sich, kreischte. Die Eltern, bulgarische Juden, die denkbar schlimmste Mischung was Kindererziehung anbelangt, versuchten, es mit Küssen und Liebkosungen zu beruhigen. Um mir nicht länger den Hals verrenken und meinen Ärger hinunterschlucken zu müssen, setzte ich mich ans Fenster, blickte auf eine graue, undurchlässige Wolkendecke und döste ein.
Als ich aufwachte, hatte sich das Flugzeug in eine Art Kneipe verwandelt. Man schwatzte und lachte, vertauschte die Sitze, traf sich zu einem Plausch im Gang, rauchte, wo man wollte, trank Coca-Cola, manche auch Whisky, war miteinander vertraut, wenn nicht sogar schon befreundet. In meiner Reihe, durch den Gang getrennt, saß jetzt ein sehr hübsches Mädchen, mit langem, blonden Haar und engen Jeans. Drei Männer hatten sich um sie geschart, darunter der gutaussehende Vater, mit einem Glas Whisky in der Hand. Das Kind plärrte immer noch oder schon wieder und die hausbackene Mutter, jetzt sichtbar verdrossen über die Ungezogenheit des einen und die sich anbahnende Untreue des anderen, packte den Schreihals und drückte ihn seinem Erzeuger in die Arme. Der nun hatte einen genialen Einfall: er tauchte den Schnuller des Kleinen in sein Glas Whisky und steckte ihn ihm in den Mund. Darauf herrschte Ruhe und allgemeine Erleichterung.
Die Wolkendecke war aufgerissen und ich sah unter mir schneebedeckte Berge und über mir eine Videokamera, mit der ein unbedarftes Männlein unter Anteilnahme sämtlicher Passagiere ungeschickt herumhantierte.
Selbst auf einem Flug in ein moribundes Land wird einem dieser technische Schnickschnack nicht erspart, dachte ich verärgert. Ich hoffe, das Ding wird ihm schon auf dem Flugplatz geklaut.
Inzwischen war es 9 Uhr 15 und die Landung mußte kurz bevorstehen. Ich zündete die letzte Zigarette dieses Fluges an, vergewisserte mich, daß die um meine Taille gegürtete Geldtasche noch da war, und versuchte, den Text eines Liedes zu rekapitulieren, das ich in meiner Kindheit gelernt hatte. Aber mir fiel nur die erste Zeile ein: »Bulgarien, Bulgarien, du bist ein glücklich Land …«
In der Sprechanlage knackte es, dann erklang eine männliche Stimme, die uns mitteilte, daß wir uns jetzt über Sofia befänden. Jemand klatschte voreilig und die Stimme fuhr fort: wegen dichten Nebels aber leider nicht landen könnten. Jetzt hörte man ein vielstimmiges Raunen, das während der folgenden Bekanntgabe immer mehr anschwoll: Wir würden darum etwa eine halbe Stunde über der Stadt kreisen und, falls sich der Nebel nicht lichte, nach Burgas weiterfliegen.
Das Raunen war in allgemeinen Lärm übergegangen und in den hinein schrie ein Fluggast: »Burgas, was zum Teufel machen wir in Burgas?«
Ich, die ich schon einmal vor Jahren wegen eines Schneesturmes über Sofia in Burgas gelandet war, hätte ihm das genau erklären können: Wir werden zum Übernachten in irgendein scheußliches Hotel einquartiert und am nächsten Tag in einem überfüllten Zug acht Stunden nach Sofia verfrachtet. Ich lachte.
Das hübsche blonde Mädchen in den engen Jeans sah vorwurfsvoll zu mir hinüber. Sie fand die Möglichkeit, in Burgas zu landen, gar nicht komisch. Ich im Grunde ja auch nicht.
Wir kreisten mal höher, mal tiefer, weit über eine halbe Stunde. Wenn wir aus dem Bereich des Nebels kamen, erblickte ich unter mir eine triste Landschaft: graubraune, schorfige Erde, kleine Ortschaften in demselben schmuddeligen Farbton, hier und da ein See, der aussah, als sei er aus Blei gegossen.
Die Passagiere waren aufgefordert worden, auf ihre Plätze zurückzukehren und sich anzuschnallen. Die übermütige Stimmung war in beklommene Stille umgeschlagen. »Nur noch zwei Stunden länger und wir sind in Amerika!« kam eine Stimme aus dem Hintergrund.
»Wenn das so weitergeht, reicht das Benzin nicht mal bis Burgas«, erwiderte darauf ein anderer.
»Also, wenn ihr mich fragt«, rief ein dritter, »dann stimmt das alles nicht. Tatsache ist, daß wir entführt werden.«
Gelächter, in das sich ein Unterton von Angst mischte.
Die Fernseher waren erloschen, die Stewardessen verschwunden. Das Flugzeug senkte sich, tauchte tiefer und tiefer, in ein kompaktes, weißes Nichts. Wir wurden hastig gebeten, das Rauchen einzustellen, und als die Räder der Maschine den Boden berührten, höflich darauf aufmerksam gemacht, daß wir soeben in Sofia gelandet seien.
»Baruch ha Schem«, rief eine Frau aus tiefstem Herzen. »Gesegnet sei der Name!«
Heimkehr
Bogdan, die Gottesgabe, ein Name, dem er alle Ehre machte, und Lilli, meine ehemalige Mitschülerin, mit der ich seit fünfundfünfzig Jahren befreundet bin, warteten auf mich. Nicht eineinhalb Stunden Verspätung, nicht das seltsame Verbot, die Eingangshalle zu betreten, nicht Nebel noch Schnee hatten sie vertreiben können. Ein solches Verhalten erfordert zweierlei: ein hartes Training im Ertragen von Widerwärtigkeiten und eine ungeheure Wertschätzung der Freundschaft. Bogdan sah ich sofort, denn er ist sehr groß und breit, hat im Verhältnis dazu einen kleinen, kahlen Kopf und ein Gesicht, aus dem so viel Humor, Kraft und Lebensklugheit spricht, daß es sofort den Blick gefangennimmt und gleich darauf das Herz.
Lilli sah ich nicht, denn erstens hatte ich sie nicht erwartet, zweitens war sie so klein wie Bogdan groß, und drittens war etwas mit ihren Haaren passiert. In der ersten Phase unserer Freundschaft hatte sie prachtvolle, schwarzglänzende Zöpfe gehabt; als ich sie zwanzig Jahre später wiedersah, war ihr Haar kurz, aber immer noch schwarz gewesen und während meiner folgenden häufigen Besuche auch geblieben. Jetzt hatte es plötzlich die Farbe einer zu früh gepflückten Orange, ein merkwürdiges Kolorit, das möglicherweise noch zu ihren feinen Zügen, nicht aber zu ihrem klaren und bescheidenen Wesen paßte.
Ich ging also an ihr vorbei auf die Gottesgabe zu und verschwand in seinen kompakten, anorakgepolsterten Armen. Erst als sie mich mit den Worten: »Ja, und mich siehst du überhaupt nicht«, am Ärmel zupfte, entdeckte ich sie in der Höhe von Bogdans Hüfte, beugte mich zu ihrem ungewohnt farbigen Kopf hinab und küßte sie fest auf beide Wangen.
»Woher wußtest du denn, daß ich heute ankomme, Lilli?« fragte ich.
»Äh, Angelika, das wissen wir doch alle! Evelina hat es mir gesagt, Bogdans Frau Raina hat es mir gesagt, und dann habe ich unsere Mitschülerinnen angerufen, um es ihnen auch zu sagen. Sie wollen dich alle sehen. Am 26. Dezember kommen einige zu mir zum Abendessen: Radka, Witschka, Jordanka … Du erinnerst dich doch an Jordanka?«
»Nein, an Jordanka erinnere ich mich nicht.«
Ehrlich gesagt, erinnerte ich mich an keine. Als ich sechzehnjährig die Schule verlassen hatte, waren es junge Mädchen gewesen, als ich einigen von ihnen auf einem, von Lilli organisierten, Treffen wiederbegegnet war, hatten sie sich in früh gealterte, von Mühsal und Enttäuschung gezeichnete Frauen verwandelt. Ich hatte keine von ihnen wiedererkannt und gewünscht, diese Begegnung wäre mir erspart geblieben. Die Kluft der Zeit, der übergangslose Schritt vom Schulmädchen zur Großmutter, der weit auseinander klaffende Unterschied zwischen ihrem und meinem Leben war unüberbrückbar gewesen. So blieb das einzige, was mich mit ihnen verband, die ferne Erinnerung an eine Schar lebhafter und warmherziger Schülerinnen in schwarzen Schürzen, mit denen ich ein Klassenzimmer, die Angst vor Prüfungen und die schwärmerische Vorliebe für unsere schöne Mathematiklehrerin, Schwester Anastasia, geteilt hatte. Diejenigen, mit denen ich über die Schule hinaus enge Freundschaft geschlossen und nach zwanzigjähriger Trennung mühelos wieder aufgenommen hatte, waren Ludmila, Lilli und Stefana gewesen. Seither waren weitere dreißig Jahre vergangen. Ludmila, mit der ich am engsten verbunden gewesen war, hatte sich umgebracht, Lilli und Stefana waren vor etlichen Jahren an Brustkrebs erkrankt und lebten von Kontrolluntersuchung zu Kontrolluntersuchung mit der Ungewißheit. Wieviel Zeit blieb uns noch?
Bogdan hatte sich mit meinen Koffern beladen, Lilli riß mir die Reisetasche aus der Hand.
»Ich kann auch tragen«, murrte ich, »ich kann sogar sehr viel tragen. Glaubt ihr, in Jerusalem schleppt mir jemand die …«
»Vorrrsicht«, rief Bogdan mit tiefer Stimme und knatterndem R, »hier schrecklich glatt. Halt dich fest an meine Jacke.«
»In Jerusalem sind die Straßen bei Regen auch schrecklich glatt.«
»Das hier ist nicht Regen und Jerusalem, sondern Schnee und Bulgarien«, erklärte Lilli und hakte mich energisch unter.
»Wenn ihr so weitermacht«, sagte ich, »komme ich mir vor wie eine schwache, alte Frau.«
»Na, jung sind wir nicht«, lachte Lilli, die wie alle Bulgaren keine schonenden Umwege um eine Tatsache machte.
»Das hier ist schwach und alt«, sagte Bogdan und blieb vor einem schmutzverkrusteten Lada stehen, »aber fährt noch gut.«
Da der Gepäckraum mit abenteuerlichen Sachen vollgestopft war und eine der Türen sich nur mit Mühe, die andere gar nicht aufsperren ließ, dauerte es eine Weile, bis Lilli und ich mehr unter als neben den Koffern im Auto verstaut waren.
»Glaubst du, es springt an?« fragte ich, über die Fahrtüchtigkeit des Autos zu Recht im Zweifel.
»Springt an«, sagte Bogdan, und da man sich immer auf sein Wort verlassen konnte, lehnte ich mich beruhigt auf meinem Sitz zurück.
Wir fuhren über eine Straße voller Tücken. Schlamm und Eisschollen wechselten einander ab und das Auto schlingerte mit seinem Hinterteil, als tanze es Lambada.
»Hast du keine Winterreifen?« fragte ich.
»Nä«, erwiderte Bogdan und zündete sich eine Zigarette an, »kosten zu viel.«
Der Nebel lag wie ein Leichentuch über der Landschaft. Man sah Flächen brauner, mit Schnee gesprenkelter Erde, und im Hintergrund schemenhaft die berüchtigten Wohnsiedlungen. Hier und da auch eine Ansammlung kleiner, verwahrloster Häuser, die nahe am Straßenrand in schmutzigem Schnee kauerten. Es war dieselbe Strecke, dieselbe Jahreszeit, dasselbe Wetter, in dem meine Mutter und ich, in einem Treck kopfloser Menschen aus dem brennenden Sofia in Richtung Süden gelaufen waren, nicht wissend, wo wir die Nacht, den nächsten Tag verbringen würden. Ich war sechzehn Jahre alt gewesen und nur von dem Gedanken getrieben, mein Leben zu retten.
»Schläfst du?« fragte Lilli.
»Aber nein«, sagte ich, »ich denke an unsere Flucht damals, nach den schweren Bombenangriffen auf Sofia.«
»Das war am 10. Januar 1944«, sagte Lilli. »Ich zünde an diesem Tag noch immer eine Kerze an, zum Dank, daß uns nichts passiert ist.«
»Müssen wir viele Kerzen anzünden«, sagte Bogdan, »ist viel passiert in unsere Leben.«
»Und wenn du nicht bald die Scheibenwischer anmachst«, bemerkte ich, »wird wieder etwas passieren.«
»Funktionieren nicht. Sind mir die guten aus Deutschland gestohlen worden. Die hier bulgarische Dreck.«
»Aber du kannst doch nichts sehen!«
»Nein, kann ich nicht, fahre ich mit sechste Sinn.«
Auch auf Bogdans sechsten Sinn konnte man sich verlassen, und zum Glück funktionierte wenigstens die Heizung. Es war warm und behaglich in dem alten Lada.
»Ich freue mich schon auf Stefana«, sagte ich zu Lilli. »Wie geht es ihr?«
Lilli schwieg verdächtig lange, räusperte sich, sagte schließlich: »Ich wollte noch etwas damit warten, du bist ja gerade erst angekommen. Es geht ihr nicht so gut.«
Ich drehte mich zu Lilli um, sah ihr kleines, verstörtes Gesicht unter den koketten orangefarbenen Locken und fragte: »Also was ist mit ihr?«
»Schlaganfall. Sie ist halbseitig gelähmt, aber nicht mehr in Lebensgefahr. Es geht ihr sogar schon etwas besser.«
»Nimm Zigarette«, sagte Bogdan und steckte mir eine zwischen die Lippen, »sind bulgarisch, nicht gut, aber kann man rauchen.«
Er gab mir Feuer, und ich starrte auf die beschlagene Scheibe. Stefana, ein Ausbund an Vitalität, Humor und Intelligenz, halbseitig gelähmt und wahrscheinlich für immer an Bett und Rollstuhl gefesselt. Ludmila tot. Nur noch Lilli.
»Liegt sie im Krankenhaus?« fragte ich.
»Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Da konnte man ja auch gar nichts für sie tun.«
»Krankenhäuser pleite«, sagte Bogdan, »besser man sterben zu Hause.«
»Die Zigarette schmeckt wirklich nicht gut«, sagte ich und suchte den Aschenbecher, um sie auszudrücken.
»Wirf aus Fenster. Aschenbecher geklaut.«
»Wir werden Stefana besuchen«, sagte Lilli, »ich habe ihr gesagt, daß du kommst, und sie freut sich schon sehr auf dich.«
Wir hatten die Stadtgrenze erreicht und schepperten über eine mit Kopfstein gepflasterte, mit Schlaglöchern besäte Straße. Rechter Hand erstreckte sich der Borisowa Gradina, ein großer, schöner Park, der nach dem ehemaligen Zar Boris benannt worden war. In der kommunistischen Ära hatte er einen volksnahen Namen erhalten und die Leute waren zusammengezuckt, wenn ich ihn immer noch bei seinem mir vertrauten, königlichen Namen genannt hatte. Inzwischen hat er den zurückerhalten.
»Ich muß dort wieder mal spazierengehen«, sagte ich.
»Aber bitte nicht alleine!« rief Lilli erschrocken. »Das ist hier sehr gefährlich.«
»In Jerusalem auch«, erklärte ich in dem Bestreben, gewisse Mißstände gerecht zu verteilen.
»Wegen Araber«, konstatierte Bogdan, »sind auch große Räuber.«
Das hatte ich nun von der gerechten Verteilung.
»Ihr Bulgaren seid schreckliche Rassisten«, sagte ich.
»Jede Volk Rassist. Nur die einen verstecken, die anderen zeigen.«
Der Verkehr war dichter geworden, aber mit dem einer größeren westlichen Stadt ließ er sich nicht vergleichen. Es fuhren Busse, Straßenbahnen und Trolleybusse, eine Kreuzung zwischen dem einen und dem anderen. Sie schienen alle noch aus der Vorkriegszeit zu stammen. Die Autos, die in dem hoffnungslosen Versuch, tiefen Schlaglöchern auszuweichen, im Zickzack durch die Straßen humpelten, schlingernd vor den Ampeln hielten und mit durchdrehenden Rädern wieder anfuhren, sahen nicht anders aus als Bogdans Lada. Es waren fast alle alte, aus dem Westen herbeigeschaffte Wagen mit verdreckter Karosserie. Möglicherweise verbarg sich darunter auch manchmal ein Auto neueren Datums und besseren Zustands. Ich hatte keinen Blick für solche Dinge und war überhaupt erstaunt, daß in einem Staat, der fallit war, noch so viele Autos fuhren.
»Ist das Benzin hier teuer?« fragte ich Bogdan.
»Äh«, sagte er und lachte über meine naive Frage, »was hier nicht teuer und jeden Tag teurer!«
»Ein Brot kostet schon hundert Leva«, belehrte mich Lilli, »und wenn ich viermal im Monat ein Kilo Fleisch kaufe, ist meine halbe Rente weg.«
Vor uns lag jetzt der Boulevard Zar Oswoboditel, die mit gelben Klinkersteinen gepflasterte Prachtstraße Sofias, mit der mich eine Fülle von Erinnerungen verband. Wir überquerten den Kanal, an dem ich so oft entlanggelaufen war, fuhren an dem Wohnhaus vorbei, in dessen sechstem Stock Freunde meiner Mutter, eine aus Wien emigrierte jüdische Familie gelebt hatte, und dann an der Villa der English Speaking League, in der ich an einem Englischkurs teilgenommen und mich zielstrebig lernend auf meine Flirts, Romanzen und Liebesdramen mit den Mitgliedern der alliierten Militärmission vorbereitet hatte. Jetzt näherten wir uns dem großen Platz mit dem kriegerischen Denkmal von Zar Alexander dem Zweiten, der die Bulgaren vom Joch fünfhundertjähriger türkischer Herrschaft befreit hatte, eine Tat, die ihm den Namen »Zar Befreier« und den Russen eine bis in die Gegenwart reichende Dankbarkeit einbringen sollte.
»Heimkehr, Angelintsche?« fragte Bogdan, der mein Schweigen und meine teils aufmerksam auf ein Gebäude gerichteten, teils nostalgisch nach innen gewandten Blicke richtig gedeutet hatte.
»Heimkehr in die Vergangenheit«, sagte ich, »die einzige Heimkehr, die es für mich noch gibt.«
Da, kurz vor dem Platz, stand das herrschaftliche Haus, in dem sich der englische Offiziersclub eingerichtet und ich, siebzehnjährig, meine ersten unvergeßlichen Parties durchtanzt, meine ersten Triumphe gefeiert hatte, und direkt daneben befand sich das Café Berlin, in das meine Mutter und ich so oft gegangen waren. Sie, um dort ihren Verehrer, Leo Ginis, zu treffen, ich, um Eis zu essen und den sentimentalen Liedern eines Stehgeigers zu lauschen. Vor zwei Jahren noch war es Café Berlin gewesen, jetzt war es geschlossen, die Fenster mit braunem Karton vernagelt. Wir schlidderten auf dem vereisten Klinkerpflaster über den Platz, vorbei am Zar Befreier und seiner in heldenhafter Pose erstarrten Truppe, vorbei an der ernsten Fassade des Parlaments, neben dem eine breite kurze Auffahrtsstraße zur Alexander-Nevsky-Kathedrale führte. Sie thronte auf einem runden Platz von gewaltigem Ausmaß, ein monumentales, goldbekuppeltes Bauwerk, in dem ich in schneller Folge meinen »lieben Gott« gefunden und als »bösen Gott« wieder aus meinem Leben verbannt hatte. Ich warf ihr einen langen, verschwörerischen Blick zu und beschloß, die Strafe endlich aufzuheben und sie nach fünfundfünfzig Jahren doch wieder einmal zu besuchen. Als ich sie aus meinem Blickfeld verlor, mußte ich über mich lachen, und Bogdan sagte: »Ja, bist du froh, gleich zu Hause zu sein.«
Es waren nur noch etwa hundert Meter bis zum Hotel. Da war die hübsche russische Kirche, der einstmals hinter hohen Mauern verborgene, jetzt öffentliche Schloßpark, die südliche Front des vereinsamten königlichen Palais. Ihm gegenüber das Grandhotel Bulgaria, das im Jahre 1939, als ich mit meinen Eltern dort Einzug gehalten hatte, vielleicht wirklich grand gewesen war, jetzt aber, nach fast sechzig Jahren, ein so müdes, von den Erschütterungen des Lebens mitgenommenes Gesicht hatte wie ich.
Grandhotel Bulgaria
Die Hotelhalle, ein riesiger düsterer Raum, in dem sich seit dreißig Jahren nichts geändert hatte, war gespenstisch leer. In der einen Ecke flimmerte ein Fernseher, in der gegenüberliegenden, neben der unscheinbaren Bar, saß eine dicke strickende Frau. Hinter der Rezeption, die mit einer weihnachtlichen Girlande geschmückt war, stand dasselbe apathische Mädchen wie vor zwei Jahren. Ein anderes saß vor einem Computer und starrte den schwarzen Bildschirm an. Ein junger Bursche in speckiger dunkler Hose und zerknittertem weißen Hemd steckte die Zigarette, die er gerade hatte anzünden wollen, wieder weg. Wahrscheinlich war er der Hotelboy, für dessen komplette Ausstattung das Geld nicht mehr gereicht hatte. In der Nähe der Rezeption stand ein rachitischer Christbaum, an dem vier rote Kugeln und drei goldene Sterne hingen. Aus einem unsichtbaren Radio schallte die forciert fröhliche Stimme eines Sprechers, dann das unerträgliche amerikanische Weihnachtslied Jingle Bells.
»Die Dame hier«, sagte Bogdan, »hat durch ihr Reisebüro in Jerusalem ein Einzelzimmer mit Bad reservieren lassen.« Er buchstabierte meinen Namen.
Das Mädchen blätterte lustlos in einem Heft, in dem ich vermutlich als einziger Gast verzeichnet war, der ein Zimmer bestellt hatte, nickte und verlangte meinen Paß.
»Haben Sie einen speziellen Wunsch?« fragte sie dann.
Bogdan und Lilli sahen mich aufmunternd an, und ich fragte mich, was für einen speziellen Wunsch sie wohl von mir erwarteten.
»Nur warm und ruhig soll es sein«, sagte ich und hoffte, daß das nicht die speziellsten aller Wünsche waren.
»Ist das Zimmer geheizt?« fragte Bogdan mißtrauisch.
»Selbstverständlich.«
Sie gab dem mißglückten Hotelboy einen Schlüssel, und in der Vorfreude auf das erste und vermutlich letzte Trinkgeld dieses Tages, stürtzte sich der Junge auf meine Koffer.
Wir fuhren in einem alten, aber noch rüstigen Lift in den dritten Stock. Es mußte dieselbe Etage sein, in der ich vor zwei Jahren ein Zimmer bewohnt hatte, denn auf dem himbeerroten Läufer entdeckte ich sofort die damals von mir beanstandete und erst nach zwei Tagen gereinigte Stelle, auf die ein besoffener Gast gekotzt hatte. Jetzt war da ein großer, heller Fleck.
Der Hotelboy schloß die Tür 315 auf und stellte meine Koffer sorgfältig in eine Ecke des bescheidenen Zimmers, das mit weiß lackierten Möbeln und blau-grauem Teppichboden ausgestattet war. Ich gab dem Jungen zwei Dollar, was ihn zu einem strahlenden Lächeln und Bogdan zu einem ernsten Vorwurf hinriß: »Ein Dollar, Angelika, 460 Leva. Für zwei Dollar eine ganze Familie …«
»Bitte, Bogdan«, unterbrach ich ihn, »wenn ich mir bei jedem Dollar ausrechnen muß, was eine arme Rentnerin oder eine ganze Familie dafür kaufen könnte, werde ich verrückt. Kommt, setzt euch, ich wasch mir nur schnell die Hände.«
Das Bad war ein Duschraum und der so winzig, daß die Tür beim Öffnen ans Klo stieß. Zum Glück war ich dünn, eine Person von umfangreicherer Statur hätte keine Chance gehabt hineinzukommen.
»Geheizt ist gut«, stellte Bogdan fest, als ich mich am Waschbecken vorbei wieder ins Zimmer gezwängt hatte, »brauchst du nicht frieren.«
An Frieren war gar nicht zu denken. Das Zimmer war überheizt und ich darüber ungehalten. Ich war nach Bulgarien gekommen, um die Mißstände eines bankrotten Staates am eigenen Leibe zu erfahren und darunter zu leiden.
»In Israel ist im Winter nirgends so gut geheizt«, sagte ich anklagend, »ist das hier nur in den Zimmern für Ausländer so heiß?«
»Nein, bei uns in der Wohnung ist es auch sehr heiß«, erklärte Lilli, »wir müssen dauernd die Fenster öffnen.«
»Merkwürdig«, sagte ich, »ich dachte, die Menschen erfrieren hier.«
»Nicht über Feiertage«, sagte Bogdan.
»Ach so, erst ab 2. Januar«, nickte ich und drehte am Knopf des Heizkörpers.
»Nicht doch, Angelika«, rief Bogdan, »kannst du nicht regulieren! Entweder Schwitzen oder Frieren.«
»Aber das ist doch eine schreckliche Verschwendung!« empörte ich mich und riß das Fenster auf. »Könnte man die Heizung regulieren, könnte man …«
»Ja, könnte man vieles, wenn Bulgaren hätten Verstand. Aber letzte Verstand die Kommunisten haben geraubt.« Er lachte dröhnend und Lilli kicherte.
»Na schön«, sagte ich mit einem Anflug von Erschöpfung, »lassen wir jetzt die Bulgaren, die Kommunisten, das Trinkgeld, die Heizung und was sonst noch alles und machen wir einen Plan für den Rest des Tages.«
Ich nahm meine Geldtasche ab und legte sie neben mich aufs Bett.
»Hier drin sind fünftausend Dollar. Was machen wir damit?«
Lilli und Bogdan sahen sich mit dem Ausdruck der Verzweiflung an.
»Das ist ein Vermögen«, seufzte sie.
»Das ist Aufforderung zu Raub«, rief er.
»Es wird ja wohl noch ein Plätzchen in Bulgarien geben, an dem fünftausend Dollar sicher sind.«
»Gibt nicht«, sagte Bogdan mit Überzeugung, »also machen wir jetzt Plan.«
Wer diesen Winter überlebt
Als Lilli nach mehrmaliger Versicherung, daß ich den Heiligen Abend mit ihr und ihrer Familie verbringen würde, gegangen war, gab ich Bogdan die fünftausend Dollar.
»Bei dir sind sie bestimmt sicher«, erklärte ich.
»Nä«, widersprach er, »kann ich überfallen, kann ich sogar getötet werden. Hier jetzt gibt viele Pistolen, riecht man Geld, schießt man.«
»Das verdankt ihr dem Westen«, sagte ich, die es nicht lassen konnte, die Mißstände der Welt gerecht zu verteilen. »Man kann halt nicht alles haben, die soziale Sicherheit des Kommunismus und die große Freiheit des Kapitalismus.«
»Hier nicht Freiheit, hier Kriminalität.«
»Was die betrifft, seid ihr hier noch Waisenknaben. In Amerika und Europa bringen bereits Kinder Kinder um, läuft jemand Amok und schießt gleich ein Dutzend Leute über den Haufen, tötet ein Vater seine ganze Familie, feuert ein Fahrer aus seinem Wagen, weil ihm das Gesicht oderAuto eines anderen Fahrers nicht gefällt.«
»Ja«, stellte Bogdan fest, »Westen dekadent. Gehen wir jetzt Dollar wechseln.«
Nichts schien leichter zu sein als das. Wenn es hier etwas im Überfluß gab, dann waren es Wechselstuben. Wo immer ich hinschaute, sah ich die Aufschrift Change, gewiß das einzige Wort in englischer Sprache, das jeder Mensch in diesem Land beherrschte. Change, ein Begriff, eine Verheißung, eine Hoffnung; Change, eine gehegte, für Notfälle aufbewahrte Banknote, die sich in viele Levascheine verwandelte, ein Bündel inflationsgeschwächter Scheine, mit denen man seine Elektrizitätsrechnung bezahlen, ein Medikament für seine kranke Mutter, ein kleines Weihnachtsgeschenk für sein Kind kaufen konnte.
Bogdan fuhr dicht am Straßenrand entlang und an einer Wechselstube nach der anderen vorbei.
»Was ist denn?« fragte ich. »Warum wechseln wir nicht endlich?«
»Muß ich beste Kurs finden. Sehe ich auf Tafel zehn Leva mehr, fünf Leva weniger. Gibt es vielleicht eine, wo ist fünfzehn Leva mehr. Versuchen wir bei Globus.«
Ich wollte ihm sagen, daß es mir auf zehn Leva mehr oder weniger nicht ankäme, besann mich dann aber und schwieg. Das worauf ich leichthin verzichten wollte, konnte für einen Bulgaren die Rettung sein.
Die Wechselstube, die sich »Globus« nannte, machte einen gediegeneren Eindruck als all die anderen, die ich gesehen hatte, und viele Menschen drängten sich in dem kleinen Raum, quollen über die Schwelle bis auf die Straße.
»Muß ja ein sehr guter Kurs sein«, sagte ich.
»Ja, ist in Ordnung.«
Er parkte den Wagen mit zwei Rädern auf einer Verkehrsinsel, schärfte mir ein, im Auto sitzen zu bleiben und niemandem zu öffnen, sperrte seine und meine Tür ab und verschwand.
Geht es in Bulgarien wirklich so gefährlich zu, fragte ich mich kopfschüttelnd, oder handelt es sich hier um eine Epidemie von Verfolgungswahn?
Ich sah mir die Leute auf der Straße an. Sie machten keinen gefährlichen Eindruck, waren ärmlich und farblos gekleidet, hatten müde Gesichter und einen abwesenden Blick, der erkennen ließ, daß sie in keine angenehmen Gedanken verstrickt waren. Kein Mensch lachte, keiner schien einem Ziel entgegenzugehen, auf das er sich freute. An einer Haltestelle wartete ein nasses, frierendes Menschenknäuel auf den Bus. Vor einem Schaufenster, in dem Küchengeräte und Geschirr ausgestellt waren, hatten sich zwei Frauen in einen Multimix verguckt, auf den sie immer wieder zeigten und sich gestenreich seiner außerordentlichen Fähigkeiten versicherten. Kinder fehlten im Straßenbild, Jugendliche scheinbar auch, jedenfalls stachen sie nicht durch lebhaftere Kleidung und fröhlicheres Verhalten aus der Menge hervor. Nur einmal während der viertelstündigen Wartezeit tauchte ein Farbfleck auf und näherte sich mit spitzen Schritten dem Auto. Es war eine junge, nach westlichem Muster aufgedonnerte Frau, mit sehr viel Make-up im Gesicht, einem bunten Halstuch, bronzefarbenen Stiefeln, einem kurzen grünen Cape und einem schwungvollen Filzhut auf langem strohblondem Haar.
Vielleicht eine Nutte, überlegte ich, oder die Freundin eines Mafiabosses. Vielleicht aber auch nur ein ganz normales nettes Mädchen, das sich eine amerikanische Filmschauspielerin zum Vorbild genommen und sich die extravagante Schminke und Kleidung mühseligst zusammengespart hat. Plötzlich tat sie mir leid, mehr leid als die ärmlich gekleideten Menschen, die ihr Schicksal angenommen und sich in der Misere eingerichtet zu haben schienen. Wie mußte sie sich, wie mußten zahllose junge Leute sich nach diesem westlichen nie gelebten Leben sehnen, in dem alles so glatt, so schön, so beglückend verlief wie in der Werbung für ein besonders schonendes und gleichzeitig haltbares Haarspray.
Ich blickte von dem unwegsamen Gehsteig an den verkommenen Fassaden der Häuser empor in einen Himmel, der aus einem gelblich-grauen Guß zu sein schien.
Im Frühling und Sommer sieht es hier ganz anders aus, ermutigte ich mich, du erinnerst dich doch noch, wie blau der Himmel sein kann, wie voll und grün das Laub der Bäume, wie hübsch die Frauen im Licht der Sonne, wie attraktiv die gutgewachsenen Männer mit ihren gebräunten Gesichtern! Im Frühling und Sommer sind die Straßen voller Menschen, die Gesichter voller Leben. Man geht spazieren, man lacht, man freut sich, man verliebt sich.
Bogdan schloß die Tür auf, setzte sich hinter das Steuer, zündete eine Zigarette an.
»Nicht wahr, Bogdan«, sagte ich, »im Frühling und Sommer geht es den Menschen hier viel besser. Die Heizungskosten fallen weg, man kann sich leicht anziehen, es gibt frisches Obst und Gemüse …«
»Kann man sich aber nicht kaufen.«
»Ein bißchen vielleicht doch.«
Er ließ den Motor an und fuhr los: »Habe ich zweihundert Dollar für dich gewechselt«, sagte er, »aber gebe ich dir das Geld nicht hier auf Straße.«
»Nicht wahr, Bogdan«, beharrte ich, »wenn es warm ist und sonnig, sieht alles ganz anders aus.«
Er hielt vor einer roten Ampel, sah mich belustigt an und sagte: »Ja, Angelintsche, sieht dann alles ganz anders aus. Gibt es hier eine gute Spruch, der heißt: Wer überlebt diese Winter, wird es bereuen.«
Bogdan
Bogdan ist von Beruf Ingenieur, sein Spezialgebiet sind Fahrstühle, die er montiert und repariert. Viele Jahre arbeitete er in einem staatlichen Werk, von dem er noch heute behauptet, es sei das größte und fortschrittlichste nicht nur in Bulgarien, sondern in ganz Europa gewesen. Jetzt wird dort kaum noch produziert.
Gleich nach der Wende in Bulgarien, im Jahre 1991, machte sich Bogdan, wie so viele Angestellte staatseigener Unternehmen selbständig. Er mietete gemeinsam mit einem Freund und Partner ein kleines, barackenartiges Haus, das zwischen hohen Wohnblocks auf einem unbebauten, verwahrlosten Gelände stand, und richtete dort sein Büro ein. Das Geschäft ging schlecht, und um finanziell über die Runden zu kommen, fuhr er mit einem alten, klapprigen Wagen, dem Vorgänger des Lada, Taxi.
Auf diese Weise bin ich ihm im Winter 1992 vor dem Sofioter Flugplatz, wo er auf Fahrgäste wartete, zum ersten Mal begegnet.
Da sich das Geschäft mit dem Taxi als ebenso wenig lukrativ erwies wie das mit den Fahrstühlen, überließ er letzteres seiner Frau Raina und seinem Freund Ivan und ging nach Deutschland, wo er in Hamburg einen Trupp bulgarischer Bauarbeiter beaufsichtigte. Es war, für bulgarische Verhältnisse, eine gut bezahlte Arbeit, die ihm einen finanziellen Rückhalt sicherte. Er blieb eineinhalb Jahre in Hamburg und kehrte dann mit dem Lada, einem kleinen Lieferwagen und einem Sammelsurium an Malerbedarf und Reinigungsmitteln deutschen Fabrikats nach Sofia zurück. Dort eröffnete er in demselben Haus, in dem sich sein Büro befindet, einen kleinen Laden, in dem sein Sohn die mitgebrachten und auf eigentümlichen Wegen nachgelieferten Waren verkaufte, seine tüchtige Frau die Buchhaltung führte und die Bosse, Bogdan und Ivan, sich um Aufträge bemühten.
Das Geschäft geht nachwievor schlecht und auch der kleine Laden mit Malerbedarf und Reinigungsmitteln will nicht in Schwung kommen.
Die Privatisazia, ein Wort, das in aller Munde ist, ein Schritt, in den so viel Hoffnung gesetzt wurde, hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen zigtausender Bulgaren, die ihn ohne die notwendige Erfahrung, ohne die unerläßlichen pekuniären Mittel freiwillig gewagt haben oder, da die staatseigenen Unternehmen in hoher Zahl aufgelöst wurden, wagen mußten.
Aber Bogdan, der Überlebenskünstler, der Mann mit dem unverwüstlichen Humor, der Freund mit dem großen Herzen geht nicht unter und der makabre Spruch: »Wer diesen Winter überlebt, wird es bereuen«, trifft auf ihn nicht zu. Bogdan bereut nicht, Bogdan kämpft, denn er liebt das Leben, von welcher Seite es sich auch zeigt.
Privatisazia
Raina, Bogdans Frau, war ein zartes, schönes Geschöpf mit Rehaugen. Sie saß in einem kleinen Büro mit Schreibpult, Spülbecken und geschmücktem Tannenzweig vor einem neuen Computer. Vladimir, Bogdans Sohn, stand im Laden. Ivan, Bogdans Freund und Partner, hatte es sich mit drei Männern im Chefzimmer gemütlich gemacht. Sie tranken Kaffee und rauchten Zigaretten. Die Stube, in die knapp ein großer Tisch, der als Schreibtisch diente, ein Stuhl, ein uralter Sessel und ein Sofa für Zwerge hinein paßte, sah aus, als hätte man soeben einen Brand gelöscht. Durch dichte Rauchschwaden erspähte ich ein heilloses Durcheinander, das in einem so spärlich eingerichteten Raum sicher nicht leicht zu bewerkstelligen gewesen war.
Der Laden dagegen war ungemein ordentlich. Die Waren standen säuberlich auf ihren Plätzen, was vielleicht daran lag, daß sie nicht einmal zum Vorzeigen aus den Regalen genommen worden waren. Bogdans Sohn, ein junger Mann mit hübschen, sanften Zügen, blätterte in einer Zeitung, die ihm von Zeit zu Zeit einen verächtlichen Ausruf entlockte. Ich hielt unter Farbbüchsen und Pinseln, Waschpulver und Putzmitteln nach etwas Verschenkbarem Ausschau und entdeckte schließlich eine Schachtel, die eine Tube Badegel, eine Sprühdose Deodorant und ein Stück Seife enthielt.
»Glaubst du, so was kann ich jemandem zu Weihnachten schenken?« fragte ich Bogdan.
»Wunderschöne Geschenk«, sagte er, »jeder das braucht.«
»Aber wenige Menschen haben hier eine Wanne, in der sie ein Gelbad nehmen können.«
»Darum Deodorant und Seife wichtig. Mußt du hier praktisch denken.«
Ich kaufte die Schachtel und, da ich nun schon einmal praktisch dachte, auch gleich noch ein paar Stücke Seife.
Als sich die Tür öffnete und drei Leute den Laden betraten, war ich erleichtert.
Kunden, frohlockte ich, die vielleicht ein paar Büchsen von dem teuersten Farblack kaufen. Aber schon bei der lauten, fröhlichen Begrüßung stellte sich heraus, daß es sich um Familienangehörige handelte. Die Korpulente, in einem schwarzen Lederkostüm von ungewöhnlich mißglücktem Schnitt, war die Frau von Bogdans Freund und Partner; der hochgeschossene, magere Jüngling mit der Pudelmütze ihr Sohn; und die Schwangere, deren Bauch wie eine Wassermelone im Netz eines großmaschigen Pullovers hing, eine Schwägerin. Es wurde ein Weilchen geschwatzt, gescherzt, gelacht, dann wurde geschimpft und gejammert: Der Preis der Zigaretten, die bisher fünfzig Leva gekostet hatten, war um siebzig Prozent in die Höhe geschossen, und auch das Brot und Schweinefleisch waren wieder teurer geworden. Im Haus neben der Korpulenten war eingebrochen und der Fernseher, das Radio, ja sogar ein Mantel aus weißem Kaninchenfell gestohlen worden. Im Stadtviertel der Schwangeren hatte man in der Nacht die Telefonleitungen geklaut und dadurch das Fernsprechnetz lahmgelegt.
»Das gibt es doch gar nicht«, sagte ich. »Wie und wozu soll man Telefonleitungen stehlen?«
Bogdan dröhnte vor Lachen und erklärte, daß das dauernd passiere, und es meistens Zigeunerjungen seien, die so geschickt wie Affen an den Telefonmasten hinaufklettern könnten.
»Und was haben sie dann von den Drähten?« wollte ich wissen.
»Geld natürlich! Sie verkaufen in eine andere Stadt. Wollen sie auch manchmal Hochspannungsleitungen klauen und fallen sie dann tot runter wie gebratene Hühner.«
Ich starrte ihn ungläubig an.
»Ja, Angelintsche, kommt mir dabei die Gedanke, sollst du jetzt Mittag essen.«
»Gebratenes Huhn mit Hochspannungsleitung garniert«, sagte ich.
Bogdan fand diese Bemerkung so komisch, daß er sie den anderen übersetzte und großes Gelächter erntete.
Bulgarien, Bulgarien, ging es mir durch den Sinn, du bist ein glücklich Land.
Kinder freuen sich hier über alles
Eigentlich wollte ich nichts anderes als schlafen. Ich hatte Jerusalem um drei Uhr früh unter einem milden, klaren Sternenhimmel verlassen, jetzt war es ein Uhr mittag, und ich stand in einer trostlosen Gegend Sofias zwischen Mietskasernen, Schuppen und Gerümpel, unter mir Eis und Matsch, über mir ein schwerer, grauer Himmel, aus dem Schneeregen tropfte. Zwei große Köter jagten einen dritten, der irgend etwas Eßbares im Maul hielt. Ein paar vermummte Kinder stapften an mir vorbei durch die Pfützen. Morgen war der Heilige Abend. Dachten sie daran? Freuten sie sich darauf? Würde dieser Abend überhaupt etwas bringen, auf das sie sich freuen konnten? Nichts erinnerte in dieser gottverlassenen Umgebung an Weihnachten. Und während ich da stand und den Kindern nachsah, fiel mir die deutsche Fernsehwerbung für ein Katzenfesttagsmahl von Sheba ein: Meeresfrüchte mit feinen Kräutern, in appetitliche Scheiben geschnitten und mit einem Petersiliensträußchen verziert. »Geht es dem Tier gut, freut sich der Mensch!«
»Essen fällt weg«, sagte ich zu Bogdan, »ich muß noch was zu Weihnachten kaufen.«
»Was?«
Ich hob entmutigt die Schultern, denn angesichts dieser Misere erschien mir jedes Weihnachtsgeschenk, das ich kaufen würde, wie eine Verhöhnung.
»Verdammte Scheiße«, sagte ich, und Bogdan schüttelte begeistert den Kopf, womit man in Bulgarien nicht etwa Verneinung, sondern Zustimmung ausdrückt.