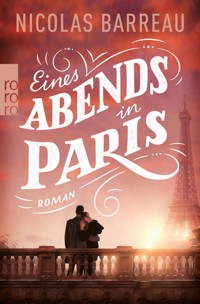Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OSTERWOLDaudio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Galerist Jean-Luc Champollion eines Morgens den Liebesbrief einer Unbekannten in der Post findet, ahnt er noch nicht, dass sein wohltemperiertes Leben von jetzt an völlig auf den Kopf gestellt werden soll. Denn bald schon hat Jean-Luc nur noch ein Ziel: Er will die kapriziöse Unbekannte finden, die sich «Principessa» nennt und die verführerischsten Briefe der Welt schreibt. Doch wer ist diese Frau, die ihn mit zarter Hand und spitzer Feder durch eine turbulente Liebesgeschichte lenkt?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicolas Barreau
Du findest mich am Ende der Welt
Roman
Über dieses Buch
Als der Galerist Jean-Luc Champollion eines Morgens den Liebesbrief einer Unbekannten in der Post findet, ahnt er noch nicht, dass sein wohltemperiertes Leben von jetzt an völlig auf den Kopf gestellt werden soll. Denn bald schon hat Jean-Luc nur noch ein Ziel: Er will die kapriziöse Unbekannte finden, die sich «Principessa» nennt und die verführerischsten Briefe der Welt schreibt. Doch wer ist diese Frau, die ihn mit zarter Hand und spitzer Feder durch eine turbulente Liebesgeschichte lenkt?
Vita
Nicolas Barreau hat sich mit seinen charmanten Frankreich-Romanen ein begeistertes Publikum erobert. Sein Buch «Das Lächeln der Frauen» brachte ihm den internationalen Durchbruch. Es erschien in 36 Ländern, war in Deutschland mit weit über einer Million verkauften Exemplaren Jahresbestseller und wurde anschließend verfilmt sowie in unterschiedlichen Inszenierungen an deutschen Bühnen gespielt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2008 by Nicolas Barreau
Copyright © 2008 by Thiele Verlag in der Thiele & Brandstätter Verlag GmbH, München/Wien
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg,
Lettering Chris Campe, All Things Letters
Coverabbildung iStock; Magdalena Russocka/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-00723-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Man sieht oft etwas hundert Mal,
ehe man es zum allerersten Mal
wirklich sieht.
Christian Morgenstern
1
Mein erster Liebesbrief endete in einer Katastrophe. Ich war damals fünfzehn und halb ohnmächtig vor Liebe, wenn ich Lucille nur sah.
Sie kam kurz vor den Sommerferien an unsere Schule, ein Geschöpf von einem anderen Stern, und selbst heute, viele Jahre später, scheint es mir, dass es einen ganz eigenen Zauber hatte, wie sie dort zum ersten Mal vor unserer Klasse stand, in ihrem himmelblauen, duftigen, ärmellosen Kleid und den langen silbrig-blonden Haaren, die das feine herzförmige Gesichtchen einrahmten.
Sie stand ganz ruhig da, ganz aufrecht, lächelnd, das Licht fiel geradewegs durch sie hindurch, und unsere Lehrerin, Madame Dubois, ließ den Blick prüfend über die Klasse schweifen.
«Lucille, du kannst dich erst einmal neben Jean-Luc setzen, da ist noch ein Platz frei», sagte sie schließlich.
Meine Hände wurden feucht. Ein leises Raunen ging durch die Klasse, und ich starrte Madame Dubois an wie die gute Fee aus dem Märchen. Selten in meinem späteren Leben habe ich dieses Gefühl gehabt, das man nur dann empfinden kann, wenn das Glück so völlig unverdienterweise über einen hereinbricht.
Lucille nahm ihre Schultasche und schwebte zu meiner Bank, und ich dankte meinem Klassenkameraden Etienne aus tiefstem Herzen, dass er so vorausschauend gewesen war, sich gerade jetzt einen komplizierten Armbruch zuzulegen.
«Bonjour, Jean-Luc», sagte Lucille höflich, es waren die ersten Worte, die sie überhaupt sagte, und der offene Blick aus ihren hellen wasserblauen Augen traf mich mit der Wucht eines Wolkengewichts.
Mit fünfzehn wusste ich nicht, dass Wolken tatsächlich viele Tonnen wiegen, und wie hätte ich das auch ahnen sollen, wo sie doch so weiß und duftig am Himmel entlangschweben wie Zuckerwatte.
Mit fünfzehn wusste ich vieles nicht.
Ich nickte, grinste und versuchte, nicht rot zu werden. Alle sahen zu uns herüber. Ich spürte, wie das Blut mir heiß in die Wangen schoss, und hörte die Jungen kichern. Lucille lächelte mir zu, als hätte sie es nicht bemerkt, wofür ich ihr sehr dankbar war. Dann setzte sie sich mit großer Selbstverständlichkeit auf den ihr zugewiesenen Platz und zog ihre Hefte heraus. Bereitwillig rückte ich ein Stück zur Seite, atemlos und stumm vor Glück.
Der Unterricht begann, und doch weiß ich von diesem Schultag nur noch eines: Das schönste Mädchen der Klasse saß neben mir, und wenn sie sich vorbeugte und die Arme aufstützte, konnte ich den zarten hellen Flaum in ihren Achselhöhlen sehen und ein winziges Stückchen verwirrend weicher weißer Haut, das zu ihrer Brust führte, die unter dem Himmelskleid verborgen blieb.
Die nächsten Tage waren ein einziger glückstrunkener Taumel. Ich sprach mit keinem, ich ging am Strand von Hyères entlang, meiner kleinen Heimatstadt am südlichsten Zipfel Frankreichs, und schickte den Ansturm meiner Gefühle übers Meer, ich schloss mich in meinem Zimmer ein und hörte laut Musik, bis meine Mutter gegen die Tür hämmerte und rief, ob ich verrückt geworden sei.
Ja, ich war verrückt. Verrückt auf die schönste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Verrückt im Sinne von verrückt. Nichts mehr war an seinem alten Platz, ich selbst am wenigsten. Alles war neu, anders. Mit der Naivität und dem Pathos eines Fünfzehnjährigen stellte ich fest, dass ich kein Kind mehr war. Ich verbrachte Stunden vor dem Spiegel, reckte mich und musterte mich kritisch von allen Seiten, um zu sehen, ob man es sah.
Unentwegt spielte ich Tausende von Szenen durch, die mir meine fieberhafte Fantasie eingab und die immer auf die gleiche Weise endeten – mit einem Kuss auf den roten Kirschmund von Lucille.
Mit einem Mal konnte ich es morgens kaum erwarten, in die Schule zu gehen. Ich war bereits eine Viertelstunde da, bevor der Hausmeister das große Eisentor aufschloss, in der unbegründeten Hoffnung, Lucille allein zu begegnen. Nicht ein einziges Mal kam sie zu früh.
Ich erinnere mich, dass ich an einem Tag in einer Mathematikstunde siebenmal meinen Bleistift unter die Bank fallen ließ, nur um meiner Angebeteten näher zu kommen, sie in vorgetäuschter Absichtslosigkeit zu berühren, bis sie ihre Füße in den leichten Sandalen kichernd zur Seite setzte, damit ich das, wonach ich angeblich tastete, wieder aufheben konnte.
Madame Dubois warf mir über ihre Brille hinweg einen strengen Blick zu und ermahnte mich, nicht so unkonzentriert zu sein. Ich lächelte nur. Was wusste sie schon?
Einige Wochen darauf sah ich Lucille mit zwei Mädchen, mit denen sie sich inzwischen angefreundet hatte, nachmittags vor der Buchhandlung stehen. Sie lachten und schwenkten kleine weiße Plastiktüten durch die Sommerluft.
Dann, welch wunderbarer Zufall, verabschiedeten sie sich voneinander, und Lucille blieb noch einen Moment vor der Schaufensterscheibe stehen und schaute in die Auslage. Ich steckte die Hände in die Hosentaschen und schlenderte zu ihr hinüber.
«Salut, Lucille», sagte ich so normal wie möglich, und sie drehte sich überrascht um.
«Oh, Jean-Luc, du bist es», erwiderte sie. «Was machst denn du hier?»
«Och …» Ich scharrte ein bisschen mit meinem rechten Turnschuh über das Pflaster. «Nichts Besonderes. Ich häng hier nur so rum.»
Ich starrte auf ihre kleine Plastiktüte und überlegte fieberhaft, was ich als Nächstes sagen konnte. «Hast du ein Buch gekauft, für die Ferien?»
Sie schüttelte den Kopf, und ihre langen schimmernden Haare flogen auf wie fein gesponnene Seide. «Nein, Briefpapier.»
«Aha.» Meine Hände verkrampften sich in den Hosentaschen. «Schreibst du gern … äh … Briefe?»
Sie zuckte die Achseln. «Ja, schon. Ich hab eine Freundin, die wohnt in Paris», sagte sie mit einem Anflug von Stolz.
«Oh. Toll!», stotterte ich und verzog anerkennend meine Mundwinkel. Paris war für einen kleinen Jungen aus der Provinz so weit weg wie der Mond. Und dass ich später einmal dort leben und als nicht ganz unerfolgreicher Galerist recht weltmännisch durch die Straßen von Saint-Germain spazieren würde, wusste ich damals natürlich noch nicht.
Lucille sah mich schräg von unten an, und ihre blauen Augen flackerten. «Aber noch lieber bekomme ich Briefe», sagte sie. Es klang wie eine Aufforderung.
Das war wohl der Moment, der meinen Untergang besiegelte. Ich sah in Lucilles lächelnde Augen, und für ein paar Sekunden hörte ich nichts mehr von dem, was sie plapperte, denn in meinem Hirn nahm eine großartige Idee allmählich Formen an.
Ich würde einen Brief schreiben. Einen Liebesbrief, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. An Lucille, die Schönste von allen!
«Jean-Luc? He, Jean-Luc!» Sie sah mich vorwurfsvoll an und zog einen Schmollmund. «Du hörst mir ja gar nicht zu.»
Ich entschuldigte mich und fragte, ob sie mit mir ein Eis essen würde. Warum nicht, sagte sie, und schon saßen wir in dem kleinen Eiscafé an der Straße. Lucille studierte aufmerksam die nicht gerade umfangreiche Plastikkarte, blätterte vor und zurück und suchte sich schließlich einen «Coup mystère» aus.
Seltsam, wie genau man sich später an diese völlig belanglosen Details erinnert. Warum merkt sich das Gedächtnis solche unbedeutenden Dinge? Oder haben sie am Ende eine Bedeutung, die sich uns nur nicht sofort erschließt? Was ich für ein Eis bestellte, weiß ich jedenfalls nicht mehr.
Der «Coup mystère», eigentlich ein kleiner, spitz zulaufender Plastikbecher mit Vanille- und Nusseis, den man auch direkt aus der großen Eistruhe nehmen konnte, wurde im Café ganz vornehm in einer Silberschale serviert.
Das Ganze klang allerdings verheißungsvoller, als es war – aber was hätte nicht verheißungsvoll geklungen an jenem Sommernachmittag, als die Welt nach Rosmarin und Heliotrop duftete, Lucille in ihrem weißen Kleid vor mir saß, hingebungsvoll mit dem langen Löffel in ihrem Eis wühlte und entzückt aufschrie, als sie erst auf die unheimlich mysteriöse Meringue-Schicht stieß und dann auf die rote Kaugummikugel, die sich ganz unten am Boden versteckte.
Sie versuchte, die Kaugummikugel herauszuangeln, und wir mussten unheimlich lachen, weil das glitschige rote Ding immer wieder vom Löffel kullerte, bis Lucille schließlich entschlossen mit den Fingern in den Becher griff und sich die Kugel mit einem triumphierenden «So!» in den Mund steckte.
Ich sah ihr fasziniert zu. Das sei das beste Eis seit Langem, erklärte Lucille ausgelassen und ließ eine riesige Kaugummiblase vor ihrem Mund zerplatzen.
Und als ich sie anschließend noch bis nach Hause begleitete und wir nebeneinander über die unbefestigten, staubigen Wege von Les Mimosas herliefen, kam es mir fast so vor, als gehöre sie schon mir.
Am letzten Schultag, bevor die endlos langen Sommerferien begannen, steckte ich Lucille mit klopfendem Herzen meinen Brief in die Schultasche. Ich hatte ihn mit der ganzen unschuldigen Inbrunst eines Jungen geschrieben, der sich für erwachsen hielt und doch noch weit davon entfernt war. Ich hatte nach poetischen Vergleichen gesucht, um meine Liebste zu beschreiben, ich hatte mit großem Pathos meine Gefühle aufgezeichnet, alle Ewigkeitswörter verwendet, die es gab, Lucille meiner unsterblichen Liebe versichert, kühne Zukunftsvisionen entworfen, und einen ganz konkreten Vorschlag hatte ich auch nicht vergessen: Ich bat Lucille, in den ersten Ferientagen mit mir auf die Îles d’Hyères zu fahren, ein romantischer Ausflug mit dem Boot auf die Insel Porquerolles, von dem ich mir einiges versprach. Und dort, an einem menschenleeren Strand, würde ich ihr am Abend den kleinen silbernen Ring schenken, den ich noch am Tag zuvor von meinem Taschengeld, das ich meiner gutherzigen Mutter vorzeitig abschwatzte, gekauft hatte. Und dann – endlich! – würde es zu dem von mir so heiß ersehnten Kuss kommen, der unsere junge, unsterbliche Liebe für immer besiegeln würde. Für immer und ewig.
«Und so lege ich mein ganzes brennendes Herz in deine Hände. Ich liebe dich, Lucille. Bitte antworte mir schnell!»
Ich hatte Stunden überlegt, wie ich den Brief beenden sollte. Den letzten Satz hatte ich erst wieder herausgestrichen, doch dann überwog meine Ungeduld. Nein, ich wollte keine Sekunde länger warten als nötig.
Wenn ich heute an all dies denke, muss ich lachen. Doch so gerne ich mich auch über den liebesenthusiastischen Jungen von damals erheben möchte, es bleibt ein kleiner Stich des Bedauerns, ich gebe es zu.
Weil ich heute anders bin, so wie wir alle anders werden.
An diesem heißen Sommertag jedoch, der so hoffnungsvoll begann und so tragisch endete, betete ich darum, dass Lucille meine übergroßen Gefühle erwidern würde: Mein Beten war allerdings rein rhetorischer Natur. Im Grunde meines Herzens war ich mir meiner Sache absolut sicher. Immerhin war ich der einzige Junge aus der Klasse, mit dem Lucille einen «Coup mystère» gegessen hatte.
Ich weiß nicht, warum ich mich an diesem Nachmittag so unbedingt in der Nähe von Lucilles Haus herumtreiben musste. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich nicht so voller Ungeduld meine Schritte in Richtung Les Mimosas gelenkt hätte, wo Lucille wohnte.
Ich wollte gerade in den kleinen Fußweg einbiegen, an dessen Seite eine alte Mauer aus Natursteinen entlangführte, die von duftenden goldgelben Mimosenbüschen nahezu überwuchert war, als ich Lucilles Lachen hörte. Ich blieb stehen. Im Schutz der Mauer, den Rücken an den rauen Stein gelehnt, beugte ich mich etwas vor.
Und da sah ich sie. Lucille lag bäuchlings auf einer Decke unter einem Baum, ihre zwei Freundinnen rechts und links neben sich. Alle drei kicherten ausgelassen, und ich dachte noch mit einer gewissen Nachsicht, dass Mädchen manchmal ziemlich albern sein können. Doch dann bemerkte ich, dass Lucille etwas in den Händen hielt. Es war ein Brief. Mein Brief!
Ich stand regungslos da, verborgen hinter Kaskaden von Mimosenzweigen, krallte meine Hände in das sonnenwarme Mauerwerk und weigerte mich, das Bild, das sich auf meiner Netzhaut in allzu grausamer Deutlichkeit einbrannte, wahrzunehmen.
Und doch, es war die Wahrheit, und Lucilles helle Stimme, die sich jetzt wieder erhob, schnitt mir ins Herz wie Glassplitter.
«Und hört euch das mal an: Und so lege ich mein ganzes brennendes Herz in deine Hände», las sie mit überzogener Betonung vor. «Ist das nicht zum Schreien?!»
Die Mädchen kicherten erneut drauflos, und eine der Freundinnen kugelte vor Lachen auf der Decke herum, hielt sich den Bauch und rief immer wieder: «Hilfe, es brennt, es brennt! Feuerwehr, Feuerwehr! Au secours, au secours!»
Unfähig, mich zu rühren, starrte ich Lucille an, die gerade mit fröhlicher Herzlosigkeit dabei war, meine geheimsten Intimitäten preiszugeben, mich zu verraten, mich zu vernichten. Alles in mir brannte, und doch lief ich nicht fort, um mich zu retten. Eine nahezu selbstzerstörerische Lust am Untergang hatte mich erfasst, ich wollte alles hören, bis zum bitteren Ende.
Inzwischen hatten sich die Mädchen von ihrem Lachanfall erholt. Die eine, die das mit der Feuerwehr gesagt hatte, riss Lucille den Brief aus der Hand. «Meine Güte, wie der schreibt!», quietschte sie. «So geschwollen! Du bist das Meer, das mich überschwemmt, du bist die schönste Rose an meinem … Busch? … Oh, là, là, was soll denn das bedeuten?!»
Die Mädchen kreischten auf, und ich wurde rot vor Scham.
Lucille nahm den Brief wieder an sich und faltete ihn zusammen. Offenbar war der ganze Inhalt zum Besten gegeben worden, und man hatte sich ausreichend amüsiert. «Wer weiß, wo er das abgeschrieben hat», meinte sie gönnerhaft. «Unser kleiner Dichterfürst.»
Ich überlegte einen Moment, aus meinem Versteck hervorzutreten, um mich auf sie zu stürzen, sie zu schütteln, sie anzuschreien und zur Rede zu stellen, doch ein letzter Rest von Stolz hielt mich zurück.
«Und?», fragte nun die andere und setzte sich auf. «Was machst du jetzt? Willst du denn mit ihm gehen?»
Lucille spielte angelegentlich mit ihren goldenen Feenhaaren, und ich stand da, hielt den Atem an und wartete auf mein Todesurteil.
«Mit Jean-Luc?», sagte sie gedehnt. «Bist du verrückt? Was soll ich denn mit dem?» Und als ob das noch nicht gereicht hätte, fügte sie hinzu: «Der ist doch noch ein Kind! Ich möchte nicht wissen, wie der küsst, igitt!» Sie schüttelte sich.
Die Mädchen schrien vor Begeisterung.
Lucille lachte, ein wenig zu laut und zu schrill, dachte ich noch, und dann fiel ich, ich stürzte, einem Ikarus gleich sank ich in die Tiefe.
Ich hatte die Sonne berühren wollen und war verbrannt. Mein Schmerz war bodenlos.
Ohne einen Laut schlich ich mich fort, taumelte den Weg zurück, betäubt von dem Duft der Mimosen und der Gemeinheit kleiner Mädchen.
Noch heute weckt der Geruch von Mimosen ungute Gefühle in mir, aber in Paris begegnet man diesen zarten Pflanzen höchstens in den Blumenläden, obwohl sie für die Vase nicht viel taugen.
Lucilles Worte hämmerten in meinen Ohren. Ich merkte nicht einmal, dass mir die Tränen über die Wangen liefen. Ich ging schneller und schneller, am Ende rannte ich.
Wie heißt es doch so schön? Irgendwann zerreißt es jedem das Herz, und beim ersten Mal tut es besonders weh.
So endete die kleine Geschichte meiner ersten großen Liebe – der silberne Ring landete noch am selben Tag im Meer vor Frankreichs Küste. Ich schleuderte ihn mit der ganzen Wut und Hilflosigkeit meiner zutiefst verletzten Seele in das hellblaue Wasser, das an diesem strahlend schönen Tag – ich weiß es noch genau – die Farbe von Lucilles Augen hatte.
In dieser dunklen Stunde, die so schmerzhaft im Gegensatz stand zu allem Heiteren um mich herum, schwor ich – und das ewige Meer war mein Zeuge, vielleicht auch ein paar Fische, die unbeeindruckt den Worten eines zornigen jungen Mannes lauschten –, ich schwor, nie wieder einen Liebesbrief zu schreiben.
Wenige Tage später fuhren wir nach Ste Maxime zur Schwester meiner Mutter und verbrachten dort unseren Sommerurlaub. Und als die Schule anfing, saß ich wieder neben dem guten alten Etienne, meinem Schulfreund, der gesund aus den Ferien zurückgekehrt war.
Lucille, meine wunderschöne Verräterin, begrüßte mich mit sonnengebräunter Haut und einem schiefen Lächeln. Sie meinte, das mit den Îles d’Hyères hätte nicht geklappt, leider, weil sie da schon etwas anderes vorgehabt hätte. Die Freundin aus Paris, blablabla. Und dann sei ich ja schon weg gewesen. Sie sah mich unschuldig an.
«Passt schon», entgegnete ich knapp und zuckte die Achseln. «War eh nur so eine Laune von mir.»
Dann drehte ich mich um und ließ sie mit ihren Freundinnen stehen. Ich war erwachsen.
Ich habe nie jemandem von meinem Erlebnis erzählt, nicht einmal meinen besorgten Eltern, die mich in den ersten schrecklichen Tagen danach nur noch auf dem Bett liegend und mit offenen Augen gegen die Decke starrend vorfanden und die abwechselnd versuchten, mich zu trösten, ohne mir mein Geheimnis entreißen zu wollen, was ich ihnen bis heute hoch anrechne. «Das wird schon wieder», sagten sie. «Im Leben geht es immer mal rauf, mal runter, weißt du?»
Irgendwann – so unglaublich es war – ließ der Schmerz tatsächlich nach, und meine alte Fröhlichkeit kehrte zurück.
Seit jenem Sommer habe ich allerdings ein etwas ambivalentes Verhältnis zum geschriebenen Wort. Jedenfalls, wenn es um Liebe geht. Vielleicht bin ich deshalb Galerist geworden. Ich verdiene mein Geld mit Bildern, liebe das Leben, bin schönen Frauen sehr zugetan und lebe in großer Eintracht mit meinem treuen Dalmatinerhund Cézanne in einem der angesagten Viertel von Paris. Es hätte nicht besser kommen können.
Meinen Schwur, keinen Liebesbrief mehr zu schreiben, habe ich gehalten, man möge es mir nachsehen.
Ich habe ihn gehalten, bis … ja, bis mir fast genau zwanzig Jahre später diese wirklich unglaubliche Geschichte passierte.
Eine Geschichte, die vor wenigen Wochen mit einem höchst merkwürdigen Brief begann, der eines Morgens in meinem Briefkasten steckte. Es war ein Liebesbrief, und er sollte mein ganzes wohltemperiertes Leben völlig auf den Kopf stellen.
2
Ich sah auf die Uhr. Noch eine Stunde. Marion kam wie immer zu spät. Prüfend schritt ich die Stellwände ab und rückte «Le Grand Rouge» gerade – eine riesige Komposition in Rot, die das Herzstück der Vernissage bildete, die um halb acht beginnen sollte.
Julien kauerte mit einem Glas Rotwein in einem der weißen Sofas und paffte schon seine elfte Zigarette.
Ich setzte mich zu ihm. «Na, aufgeregt?»
Sein rechter Fuß, der in einem karierten Van steckte, wippte. «Klar, Mann, was denkst du denn?» Er nahm einen tiefen Zug, und der Rauch stieg vor seinem hübschen jungenhaften Gesicht auf. «Ist immerhin meine erste richtige Ausstellung.»
Seine Offenheit war wie immer entwaffnend. Wie er da in den Kissen hing, mit seinem unspektakulären weißen T-Shirt über den Jeans und seinen kurzen blonden Haaren, hatte er was von einem jungen Blinky Palermo.
«Wird schon schiefgehen», sagte ich. «Ich hab schon weitaus größeren Mist gesehen.»
Das brachte ihn zum Lachen. «Mann, du kannst einem wirklich Mut machen.» Er drückte die Zigarette in dem schweren Glasascher aus, der neben dem Sofa auf einem Tischchen stand, und sprang auf. Wie ein Tiger lief er an den Wänden der Galerieräume entlang, umkreiste die Stellwände und sah sich seine großformatigen leuchtenden Bilder an.
«Hey, so schlecht sind die gar nicht», meinte er schließlich und schürzte die Lippen. Dann machte er ein paar Schritte zurück. «Wir hätten nur mehr Platz gebraucht, dann würde das alles noch besser kommen.» Er gestikulierte dramatisch mit seinen Händen in der Luft herum. «Platz … Fläche … Raum.»
Ich trank einen Schluck Rotwein und lehnte mich zurück. «Ja, ja. Nächstes Mal mieten wir das Centre Pompidou», sagte ich und musste daran denken, wie Julien vor einigen Monaten zum ersten Mal in meiner Galerie aufgetaucht war. Es war der letzte Samstag vor Weihnachten, ganz Paris glitzerte in Silber und Weiß, vor den Museen gab es ausnahmsweise mal keine Schlangen, tout le monde war auf der Jagd nach Geschenken, und auch bei mir ging die Türglocke den ganzen Tag.
Ich hatte drei relativ teure Bilder verkauft und nicht mal an Stammkunden, offenbar entfachte das bevorstehende Fest bei den Pariser Bürgern die Lust an der Kunst. Jedenfalls wollte ich den Laden gerade dichtmachen, da stand Julien plötzlich in der Tür der Galerie du Sud, wie ich meinen kleinen Kunsttempel in der Rue de Seine getauft habe.
Ich war nicht gerade erfreut, das können Sie mir glauben. Nichts ist nervtötender für einen Galeristen als irgendwelche Kleckser, die ohne einen Termin hereinstolpern, ihre großen Mappen öffnen und einem das, was sie für Gegenwartskunst halten, zeigen wollen. Und die sich – bis auf wenige bescheidene Ausnahmen – alle (alle!) mindestens für den nächsten Lucian Freud halten.
Eigentlich habe ich es Cézanne zu verdanken, dass ich dennoch mit diesem jungen Mann ins Gespräch kam, der seine Kappe tief ins Gesicht gezogen hatte und auf den ich mittlerweile große Hoffnungen setze.
Cézanne ist – ich erwähnte es bereits – mein Hund, ein drei Jahre alter, äußerst lebendiger Dalmatiner, und ich hege, wie man leicht erraten kann und obwohl ich mich Tag für Tag liebend gern mit zeitgenössischer Kunst herumschlage, eine stille Leidenschaft für den französischen Maler gleichen Namens, diesen genialen Wegbereiter der Moderne. Seine Landschaften sind für mich unerreicht, und mein größtes Glück wäre es, einen echten Cézanne zu besitzen, und wäre es der kleinste von allen.
Ich wollte Julien also gerade an der Tür abwimmeln, als Cézanne bellend aus dem Hinterzimmer hervorsprang, mit seinen Pfoten über den glatten Holzboden schlitterte, an dem jungen Mann im Parka hochsprang und ihm dann unter leisem Gewinsel hingebungsvoll die Hände leckte.
«Cézanne, aus!», zischte ich, doch wie immer hörte Cézanne nicht auf mich. Er ist leider sehr schlecht erzogen.
Vielleicht war es eine gewisse Verlegenheit, die mich bewog, dem jungen Mann, der sich nun mit meinem Hund unterhielt, Gehör zu schenken.
«Angefangen hab ich in den Vororten – mit Graffiti.» Er grinste. «War ziemlich geil, wir sind nachts losgezogen und haben gesprayt. Autobahnbrücken, alte Fabrikgelände, Schulmauern, einmal sogar einen Zug. Aber inzwischen mal ich auf Leinwand, keine Sorge!»
Meine Güte, ein Sprayer war wirklich das, was mir noch gefehlt hatte! Seufzend öffnete ich die Mappe, die er mir entgegenhielt. Ich blätterte durch das muntere Durcheinander von Skizzen, gezeichneten Graffiti und den Fotografien seiner Bilder. Sein Strich war leider nicht schlecht.
«Und?», fragte er aufgeregt und kraulte Cézanne den Nacken. «Was meinen Sie? In Wirklichkeit sehen die Bilder natürlich viel besser aus – ich mach nur große Formate.»
Ich nickte, und dann blieb mein Blick an einem Bild hängen, das «Erdbeerherz» hieß. Es zeigte ein lang gezogenes Herz, das in der Mitte eine kaum erkennbare Vertiefung hatte und die Oberfläche einer Erdbeere. Das «Erdbeerherz» war eingebettet in einen Hintergrund aus kleinen dunkelgrünen Blättern und bestand aus mindestens dreißig verschiedenen Rottönen. Ich hatte bei meinem Freund Bruno, der Arzt und bekennender Hypochonder ist, einmal eine Digitalaufnahme seines Herzens gesehen, einen Film, der in einer Diagnoseklinik gemacht worden war. (Sein Herz war übrigens kerngesund!) In der Tat glich dieser lebenswichtige Muskel mehr einer erdbeerähnlichen Frucht als den gemalten Herzen und Herzchen, wie sie einem überall begegnen.
Das «Herz» auf dem Bild des jungen Künstlers hatte jedenfalls etwas derart Organisch-Fruchtiges, dass man nicht wusste, ob man den Herzschlag der Erdbeere hörte oder doch lieber hineinbeißen wollte. Das Bild lebte, und je länger ich es mir anschaute, desto besser gefiel es mir.
«Das hier sieht interessant aus.» Ich tippte auf das Foto. «Das würde ich gern mal im Original sehen.»
«Okay, kein Problem. Ist allerdings zwei mal drei Meter. Hängt bei mir im Atelier. Sie können jederzeit vorbeikommen. Oder soll ich es herbringen? Ist auch kein Problem. Ich kann’s Ihnen bringen, heute noch!»
«Um Gottes willen, nein.» Ich lachte, doch sein Eifer rührte mich. «Ist das Acryl?», fragte ich, um etwaigen Gefühlsduseleien aus dem Weg zu gehen.
«Nein, Öl. Ich mag keine Acrylfarben.» Er schaute einen Moment auf das Foto, und seine Miene verdüsterte sich. «Hab’s gemalt, als meine Freundin mich verlassen hat.» Er schlug sich mit der linken Hand gegen die Brust. «Großer Schmerz!»
«Und … KBF, sind das Sie?», fragte ich, ohne auf seine Bekenntnisse einzugehen, und deutete auf die Signatur.
«Ja, Mann. C’est moi!»
Ich sah auf seine kleine Visitenkarte und zog die Augenbrauen hoch. «Julien d’Ovideo?», buchstabierte ich.
«Ja, so heiße ich», bestätigte er. «Aber ich signiere mit KBF. Ist noch aus der Graffiti-Zeit, wissen Sie? Kunst braucht Fläche.» Er grinste. «Ist immer noch mein Motto.»
Eine Stunde später als beabsichtigt schloss ich die Tür meiner Galerie ab, nicht ohne Julien versprochen zu haben, im neuen Jahr in seinem Atelier vorbeizuschauen.
«Mann, cool, das ist echt mein schönstes Weihnachtsgeschenk», sagte er, als wir uns verabschiedeten. Ich schüttelte ihm die Hand, er schwang sich auf sein Fahrrad, und dann spazierte ich mit Cézanne die Rue de Seine hinunter, um im La Palette noch eine Kleinigkeit zu essen.
In den ersten Januartagen fuhr ich wirklich zu Julien d’Ovideo und besuchte ihn in seinem etwas heruntergekommenen Atelier im Bastille-Viertel. Ich sah mir seine Arbeiten an, fand sie recht bemerkenswert, und am Ende nahm ich das «Erdbeerherz» mit und hängte es versuchsweise in meiner Galerie auf.
Zwei Wochen später stand Jane Hirstman, eine amerikanische Sammlerin, die zu meinen besten Kunden zählt, davor und stieß laute Begeisterungsschreie aus. «It’s amazing, darling! Just amazing!»
Sie schüttelte ihre feuerroten Locken, die in alle Richtungen abstanden, was ihr eine äußerst dramatische Note verlieh, trat einen Schritt zurück und musterte das Bild einige Minuten mit zusammengekniffenen Augen. «Das ist die Verteidigung der Leidenschaft in der Kunst», sagte sie dann, und ihre großen goldenen Creolen erzitterten bei jedem Wort. «Wow! I love it, it’s great!»
Nun, groß war das Bild wirklich. Ich wusste mittlerweile, dass Jane Hirstman ein Fan großformatiger Bilder war, eine spezielle Macke von ihr, aber das allein war auch für sie, die im Laufe der letzten Jahre immerhin einige nicht ganz unbedeutende Gemälde aus der Wallace Foundation erworben hatte, kein Kriterium.
Sie wandte sich zu mir um. «Wer ist dieser KBF?», fragte sie mit lauerndem Blick. «Hab ich was verpasst? Gibt es noch mehr zu sehen?»
Ich schüttelte den Kopf. Fast alle Sammler, die ich kenne, haben einen Zug ins Manische, wenn es darum geht, etwas Neues als Erster zu entdecken. «Ich würde Ihnen doch nie etwas vorenthalten, meine liebe Jane! Das hier ist ein junger Pariser Künstler, Julien d’Ovideo. Ich vertrete ihn erst seit Kurzem», erklärte ich und beschloss, mit Julien umgehend einen Vertrag aufzusetzen. «KBF steht für seine Auffassung von Kunst: Kunst braucht Fläche.»
«Aaaah», gurrte sie. «Kunst braucht Fläche. Das ist gut, das ist sehr gut.» Sie nickte anerkennend. «Kunst braucht Fläche, und Gefühle brauchen Raum, so ist das! Julien d’O… wie? Na, egal … Machen Sie was mit ihm, sag ich, der Typ wird heiß! Meine Nase kribbelt!»
Wenn Jane Hirstman ihre Nase, die im Übrigen recht groß war, ins Spiel brachte, musste man das ernst nehmen. Sie hatte schon so manches Bild erschnüffelt, das später richtig teuer gehandelt wurde.
«How much?», fragte sie, und ich nannte einen völlig überzogenen Preis.
Jane kaufte das «Erdbeerherz» noch am selben Tag und legte dafür eine beachtliche Summe in Dollar auf den Tisch.
Julien war außer sich vor Glück, als ich ihm die Neuigkeit persönlich überbrachte. Er umarmte mich spontan mit seinen farbverschmierten Händen, deren Abdrücke nun für alle Zeiten auf meinem schönen hellblauen Kaschmirpullover verewigt sein werden. Aber wer weiß, vielleicht wird dieser profane Pullover, der leider mein Lieblingspullover war, eines Tages unglaublich wertvoll sein – als eine Art ready-made, das den glücklichsten Moment im Leben eines Künstlers dokumentiert. In Zeiten, in denen alles Kunst sein kann und selbst die in Dosen abgefüllten Exkremente italienischer Künstler als «merda di artista» in Mailand bei Sotheby’s für unglaubliche Summen versteigert werden, halte ich das nicht für ausgeschlossen.
An diesem glücklichen Januarabend jedenfalls tranken Julien und ich einige Gläser zusammen in seinem ungeheizten Atelier, ein paar Stunden später duzten wir uns und zogen noch in eine Bar weiter.
Am nächsten Tag kam der hoffnungsvolle Jungkünstler mit einem ziemlichen Kater in die Galerie du Sud, und wir planten die Ausstellung «Kunst braucht Fläche», die in nunmehr weniger als einer Viertelstunde eröffnet werden sollte.
Wo blieb Marion? Seit sie diesen motorradfahrenden Freund hatte, war auch kein Verlass mehr auf sie. Marion hatte Kunst studiert und machte nun ein Praktikum in meiner Galerie. Und sie war wirklich gut, sonst hätte ich manchmal schon gute Lust gehabt, sie rauszuwerfen.
Marion organisierte kaugummikauend die kompliziertesten Abläufe und wickelte alle Kunden um den Finger. Auch ich konnte mich ihrem lässigen Charme nicht entziehen.
Draußen ertönte lautes Geknatter. Einen Augenblick später wurde die Tür aufgerissen, und Marion stöckelte in einem unverschämt kurzen schwarzen Samtkleidchen zur Tür herein.
«Da bin ich», erklärte sie strahlend und mit verräterisch geröteten Wangen und rückte den breiten Haarreif in ihren langen blonden Haaren zurecht.
«Marion, irgendwann fliegst du raus!», erklärte ich. «Solltest du nicht schon vor einer Stunde hier sein?»
Lächelnd zupfte sie eine weiße Fluse von meinem dunklen Jackett. «Aaah, Jean-Luc, komm, bleib locker. Ist alles im Plan.» Sie gab mir ein Küsschen auf die Wange und murmelte: «Nicht böse sein, aber es ging wirklich nicht eher.»
Dann gab sie den Mädchen vom Catering-Service noch ein paar Anweisungen, fragte: «Was habt ihr denn da gemacht?», und zupfte an dem riesigen Blumenstrauß im Eingangsbereich herum, bis er ihrem ästhetischen Feingefühl entsprach.
Als ich die ersten Gäste die Rue de Seine entlangschlendern sah, drehte ich mich zu Julien um.
«Showtime», sagte ich, «es geht los.»