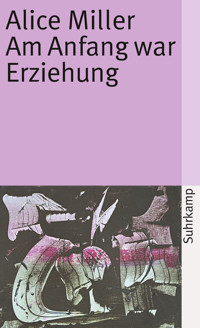14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Du sollst nicht merken« - nämlich: was dir in deiner Kindheit angetan wurde und was du in Wahrheit selbst tust - ist ein niemals ausgesprochenes, aber sehr früh verinnerlichtes Gebot, dessen Wirksamkeit im Unbewußten des einzelnen und der Gesellschaft Alice Miller zu beschreiben versucht. Ihre Analyse dieses Gebots führt sie zu einer grundsätzlichen Kritik an der Triebtheorie Sigmund Freuds. Die Wirksamkeit des Gebots »Du sollst nicht merken« zeigt sie anhand ihrer Analysen von Träumen, Märchen und literarischen Werken auf, wobei aus ihrer Auseinandersetzung mit dem Œuvre Franz Kafkas ein neues Kafka-Bild hervorgeht und implizit eine Theorie menschlicher Kreativität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
»Du sollst nicht merken« – nämlich: was dir in deiner Kindheit angetan wurde und was du in Wahrheit selbst tust – ist ein niemals ausgesprochenes, aber sehr früh verinnerlichtes Gebot, dessen Wirksamkeit im Unbewußten des Einzelnen und der Gesellschaft Alice Miller zu beschreiben versucht. Ihre Analyse dieses Gebots führt zu einer Kritik der Triebtheorie Freuds; deren gesellschaftliche Hintergründe veranschaulicht sie u. a. durch eine ausführliche Interpretation des »Wolfsmanns«, des berühmten Patienten Freuds, und durch eine Auseinandersetzung mit dem Werk Kafkas, aus der ein neues Kafka-Bild hervorgeht (und implizit eine Theorie menschlicher Kreativität).
Alice Miller studierte in Basel Philosophie, Psychologie und Soziologie. Nach der Promotion machte sie in Zürich ihre Ausbildung zur Psychoanalyse und übte 20 Jahre lang diesen Beruf aus. 1980 entschloß sie sich, ihre Praxis und Lehrtätigkeit aufzugeben, um zu schreiben. Seitdem veröffentlichte sie elf Bücher, in denen sie die breite Öffentlichkeit mit den Ergebnissen ihrer Kindheitsforschungen bekannt machte. Am 14. April 2010 verstarb Alice Miller im Alter von 87 Jahren.
Im Suhrkamp Verlag sind u. a., zum Teil in veränderten Neuauflagen, folgende Bücher erschienen: Dein gerettetes Leben (2007); Die Revolte des Körpers (2004); Abbruch der Schweigemauer (2003); Evas Erwachen. Über die Auflösung emotionaler Blindheit (2001); Wege des Lebens. Sechs Fallgeschichten (1998); Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. Eine Um- und Fortschreibung. Neufassung (1997); Das verbannte Wissen (1988); Der gemiedene Schlüssel. Erweiterte und revidierte Auflage (1988); Am Anfang war Erziehung (1980); Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst (1979).
Alice Miller
Du sollst nicht merken
Die Realität der Kindheit und die Dogmen der Psychoanalyse
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 19. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 952.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1981
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Alice Miller
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75057-5
www.suhrkamp.de
INHALT
Vorwort
Einleitung
A PSYCHOANALYSE ZWISCHEN DOGMA UND ERFAHRUNG
1. Zwei Haltungen in der Psychoanalyse
2. Analysanden beschreiben ihre Analysen
3. Unbewußte Pädagogik in der Psychotherapie
4. Warum so radikal?
B DIE FRÜHKINDLICHE REALITÄT TIN DER PRAXIS DER PSYCHOANALYSE
Einübung ins Stummsein
1. Einleitung
2. Psychoanalyse ohne Pädagogik
3. Warum braucht der Patient einen Anwalt im Analytiker?
4. Die kastrierende Frau oder das gedemütigte kleine Mädchen?
5. Gisela und Anita
6. Trennungsschmerz und Autonomie (Neuauflagen der frühkindlichen Abhängigkeit)
Aus dem Buche Genesis
C WARUM WIRD DIE WAHRHEIT ZUM SKANDAL?
Galileo Galilei
1. Die Einsamkeit des Entdeckers
2. Gibt es eine »infantile Sexualität«?
Die Ödipus-Sage
3. Ödipus – das schuldige Kind
4. Der sexuelle Mißbrauch des Kindes (Die Geschichte des Wolfsmanns)
5. Die nichtsexuellen Tabus
6. Der Vater der Psychoanalyse
7. Facetten des falschen Selbst
8. Achtzig Jahre Triebtheorie
Aus dem Buche Hiob
D ABER DIE WAHRHEIT ERZÄHLT SICH DOCH …
1. Einleitung
2. Märchen
3. Träume
Die Brücke
4. Dichtung (Das Leiden des Franz Kafka)
Nachwort
Die Töchter schweigen nicht mehr (1982)
Nachwort (1983)
Literaturverzeichnis
VORWORT
Der Titel des vorliegenden Buches formuliert ein nirgends ausgesprochenes Gebot, dessen strikte Befolgung dadurch gewährleistet ist, daß es sehr früh in unserer individuellen und kollektiven Geschichte verinnerlicht wurde. Ich versuche, die Wirksamkeit dieses Gebotes im Unbewußten des Einzelnen und der Gesellschaft zu beschreiben, und tue das, ähnlich wie in Das Drama des begabten Kindes und Am Anfang war Erziehung, mit Hilfe allgemein verständlicher Geschichten. Die in diesen beiden früheren Büchern enthaltenen Beispiele bieten vielfältiges zusätzliches Ausgangs- und Anschauungsmaterial für die hier gezogenen theoretischen Schlüsse.
Meinen herzlichen Dank möchte ich denjenigen Kollegen aussprechen, die an der Entwicklung meiner Gedanken kritisch teilnahmen, mir durch die Prüfung meiner Hypothesen im »therapeutischen Alltag«, der mir jetzt fehlt, geholfen haben, meine Entdeckungen ernstzunehmen und weitere Schritte zu wagen. Die Versuchung, den eingeschlagenen Weg aufzugeben, war angesichts der Schlüsse, die ich ziehen mußte und die auch in mir Widerstand auslösten, nicht unerheblich.
Aber auch den anderen Kollegen, die meine Gedanken mit Empörung, Befremden, offener Ablehnung oder Angst entgegennahmen, schulde ich einen Dank. Ohne diese Reaktionen hätte ich nicht so deutlich gemerkt, daß ich mich in tabuisierten Regionen befand, und wäre nicht darauf gekommen, die Hintergründe dieser Tabus zu analysieren. Ich verdanke also gerade den negativen Reaktionen mein Verständnis für den gesellschaftlichen Hintergrund der Freudschen Triebtheorie, von der ich mich in diesem Buch distanziere.
Die Entdeckung der Kindheitsgeschichte im Unbewußten des Erwachsenen sowie deren Verleugnung und Verdrängung haben mich zu anderen Ergebnissen als Freud geführt. In diesem Buch werden sie im einzelnen erläutert.
EINLEITUNG
»Mich selbst kann ich so schlecht machen, als es sein muß, aber andere Personen muß ich schonen.« Diesen Satz einer seiner Patientinnen zitiert Freud in seinem Brief an Wilhelm Fließ vom 28. April 1897. Ich nehme ihn zum Ausgangspunkt bei der Darstellung meiner Gedanken, weil er mir eine Wahrheit auszudrücken scheint, die für sehr viele Menschen, zumindest für viele, die ich kannte, zutrifft. In meinen früheren Arbeiten habe ich zu zeigen versucht, wie die Schonung und Idealisierung der Eltern der ersten Lebensjahre einerseits aus der vollständigen Abhängigkeit des Kindes und andererseits aus dem Nachholbedarf der Eltern an Achtung, Bejahung und Verfügbarkeit verständlich wird (vgl. A. Miller, 1979). Anhand verschiedener Lebensläufe bin ich auch der Frage nachgegangen, was mit dem in der Kindheit aufgestauten, reaktiven Haß in Extremfällen geschehen mußte, um die Schonung der Eltern zu gewährleisten (vgl. A. Miller 1980).
Während ich mich in Am Anfang war Erziehung vornehmlich mit der Frage der Entstehungsgeschichte der menschlichen Destruktivität und Selbstdestruktivität befaßt habe und zu Ergebnissen gekommen bin, die sich der Annahme eines Todestriebes im Freudschen Sinn direkt entgegenstellen, will ich in diesem Buch u. a. die Wege schildern, auf denen mir die die Psychoanalyse beherrschenden Vorstellungen von der »infantilen Sexualität« immer fragwürdiger erschienen, bis ich schließlich gewagt habe, die Konsequenzen meiner Erfahrungen zu Ende zu denken.1Die persönliche Erfahrung der Psychoanalyse anhand des eigenen Unbewußten und die berufliche Möglichkeit, auch dem Unbewußten anderer Menschen zu begegnen, bedeuten zweifellos für jeden werdenden Analytiker zunächst eine große Befreiung. Schon das grundlegende, oft verblüffende Erlebnis der eigenen Abwehrmechanismen (wie Verleugnung, Verdrängung, Projektion usw.) verändert in hohem Maße unsere bisherige Seh- und Denkperspektive. Die einengenden Vorstellungen und Ideen der eigenen Kindheit werden uns klarer bewußt, und verglichen mit ihnen ist die Psychoanalyse, weil sie in der breiten, bürgerlichen Bevölkerung lange bekämpft, verspottet oder kaum wahrgenommen wurde, bereits ein revolutionäres Faktum. Wenn ein Mensch in einem engen abgelegenen Bergtal aufgewachsen ist und plötzlich in eine breite Ebene kommt, wird er sich zunächst in einer ähnlichen Weise befreit fühlen, wie ein streng religiös erzogenes Kind, das später das Denksystem der Psychoanalyse entdeckt. Es kann hier zunächst alle Richtungen einschlagen, die Welt steht ihm offen, es stößt nicht immer auf die hohen Berge. Was muß aber dieser Mensch empfinden, wenn er feststellt, daß diese wunderbare Ebene, die in die Welt hinausführt, von Verbotstafeln umstellt ist und daß das weite Tal nicht der Anfang seines neuen Weges ist, sondern ein endgültiges Ziel sein soll? Die Erfahrung der Ebene weckte in ihm die Lust zum Wandern und machte ihm durch den Gegensatz bewußt, wie eingeengt seine Kindheit gewesen war. Wenn er froh ist, die Enge verlassen zu haben, wird er sich mit dem eingezäunten Flachland nicht lange zufriedengeben. Sein Bedürfnis nach Freiheit ist geweckt und damit auch der Wunsch, die Welt hinter den Verbotstafeln zu entdecken. Denn nun weiß er aus Erfahrung, daß diese Tafeln, ähnlich wie die hohen Berge, nicht das Ende der Welt bedeuten.
Die Zäune und Verbote ließen sich mit verschiedenen Dogmen der psychoanalytischen Theorie vergleichen, während die große Ebene zunächst mit den ersten Erfahrungen des Unbewußten vergleichbar ist. Allerdings darf sie durch keine Verbotstafeln eingeschränkt werden, wenn der Weg zu neuen Erkenntnissen in alle Richtungen offen bleiben soll; denn auch wenn diese Ebene viele Spaziergänge ermöglicht, gleicht sie einem Gefängnis, solange die Ausflüge aus diesem Areal verboten sind. Das gleiche gilt für die psychoanalytische Theorie, die in Gefahr kommt, durch ihre Dogmatisierung gerade das Wertvollste an ihr, d. h. die schöpferischen, im besten Sinne revolutionären und bewußtseinserweiternden Elemente im Dienste des Überlieferten, des die Geborgenheit der Gruppenzugehörigkeit Sichernden, aufzugeben.
Die fundamentale Erkenntnis von der Bedeutsamkeit der frühen Kindheit für das ganze spätere Leben verdanken wir Sigmund Freud – eine Erkenntnis, die für alle Gesellschaften und zu allen Zeiten Gültigkeit haben dürfte. Daß die Kindheit das spätere Leben des Individuums prägt, ist freilich eine formale Aussage und nur als solche kann sie Allgemeingültigkeit beanspruchen. Das Wie dieser Prägung ist kulturspezifisch und dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen; es muß in jeder Generation neu untersucht und in jedem einzelnen Leben im Besonderen verstanden werden. Jeder Versuch, dieses Wie für alle Zeiten bestimmen zu wollen, z. B. mit Hilfe des Ödipuskomplexes und der Triebtheorie, trägt für die Psychoanalyse die Gefahr einer Selbstverstümmelung in sich. Denn wie soll ihr Instrumentarium schöpferisch eingesetzt werden, wenn die Frage nach der jeweiligen Kindheitsprägung einer Generation bereits mit dem Ödipuskomplex ein für alle Male beantwortet worden ist? Statt das neue Material in seiner Einmaligkeit zu verstehen, muß sich der Analytiker während seiner Ausbildung darin üben, es nicht als neu, sondern als Beispiel der ein für allemal gültigen Theorien zu sehen. Er lernt so, auf die weittragenden, Wahrheit erschließenden Kräfte seines Instrumentariums zu verzichten, bevor er sie entdecken konnte.
Das Bild der eingezäunten Ebene habe ich gezeichnet, um meinen Ansatz verständlich zu machen. Obwohl ich persönlich der Psychoanalyse meine Befreiung verdanke, sehe ich in ihrem entfremdeten Vokabular und in ihren Dogmen die Entwicklung von Theorie und Praxis hemmende Faktoren. Im folgenden möchte ich, auch mit Hilfe von Beispielen, diese These begründen, doch hier schon will ich andeuten, zu welchen Ergebnissen ich gekommen bin, nachdem ich bereit war, die Verbotstafeln nicht mehr zu beachten und die mir erreichbaren Wege zu beschreiten.
Die Überzeugung von der Bedeutung der frühen Kindheit für das ganze spätere Leben des Individuums war mein Ausgangspunkt. Die Sensibilisierung für das kindliche Leiden verschaffte mir den emotionalen Einblick in die Situation des abhängigen Kindes, das ohne begleitende Person seine Traumatisierungen nicht artikulieren kann und sie daher verdrängen muß. Auf der andern Seite öffnete sich mir immer deutlicher der Blick auf die Machtausübung der Erwachsenen über das Kind, die in den meisten Gesellschaften sanktioniert oder zugedeckt wird, die aber mit Hilfe psychohistorischer Studien, der Psychosen-, Kinder- und Familientherapien und vor allem dank der psychoanalytischen Behandlung der Eltern in den letzten Jahrzehnten immer offensichtlicher wird. So bin ich nach langem Zögern, das wohl mit meiner Loyalität, Dankbarkeit und guter Erziehung zusammenhing, zu der Annahme gekommen, daß nicht nur die Destruktivität (also die Fehlentwicklung der gesunden Aggression), sondern auch sexuelle und andere Störungen, vor allem narzißtische, besser zu verstehen sind, wenn man den reaktiven Charakter ihres Entstehens mehr berücksichtigt. Das Kind ist in seiner Hilflosigkeit eine Quelle des Machtgefühls des unsicheren Erwachsenen und darüber hinaus in vielen Fällen sein bevorzugtes Sexualobjekt. Wenn man bedenkt, daß jeder Analytiker Bände darüber erzählen könnte, erscheint es auf den ersten Blick seltsam, daß diese Erkenntnis so lange verborgen geblieben ist.
Es gibt dafür mehrere Gründe, von denen ich hier zwei nenne.
1. Das narzißtisch besetzte Kind wird vom Erwachsenen als ein Teil seines Selbst erlebt. Darum kann sich dieser kaum vorstellen, daß das, was ihm Lustgefühle bereitet, für das Kind eine andere Bedeutung haben könnte. Sobald er es aber ahnt, wird er sein Tun vor der Umwelt verbergen. (Pädophile kämpfen neuerdings um ihr (!) Recht, den Kindern offen sexuelle »Liebe« geben zu dürfen. Sie zweifeln nicht daran, daß die Kinder genau das brauchen, was die Erwachsenen ihnen »geben« wollen.)
2. Auch jeder Patient ist daran interessiert, das, was mit ihm geschehen ist, also den narzißtischen und den sexuellen Mißbrauch seiner Person (wenn dieser stattgefunden hat), zu verheimlichen, zu verbergen oder sich selbst deswegen zu beschuldigen. Diese Tatsache wird oft übersehen, läßt sich aber leicht feststellen. Wenn man z. B. die Zwänge eines Menschen als Ausdruck seiner verdrängten Aggressionen deutet, ohne die zu den Aggressionen führenden Traumatisierungen zu berühren, wird sich der Patient wegen seiner Aggressionen nur noch mehr beschuldigen; oder wenn man z. B. das Mißtrauen der Frauen gegenüber Männern als Ausdruck ihrer unterdrückten, »libidinösen Wünsche und Phantasien« deutet, wird man unter Umständen eine gute Kooperation und sogar die Besserung der Symptome, die auf der Übertragungsliebe beruhen, erreichen können. Aber beides wiederholt schließlich das ursprüngliche Trauma des Nichtverstehens und des Mißbrauchs, das zu neuen Symptomen führen kann, weil auch das letzte Trauma (die Behandlung) nicht als Trauma, sondern als Hilfe, Wohltat, Heilung angesehen werden soll und vom Patienten meistens auch so angesehen wird.
Da die psychoanalytische Triebtheorie die Tendenz des Patienten, sein Trauma zu leugnen und sich selbst zu beschuldigen, unterstützt, ist sie eher dazu geeignet, den sexuellen und narzißtischen Mißbrauch des Kindes zu verschleiern, als ihn aufzudecken.
Weshalb geht der Analytiker in den meisten Fällen nicht an die realen Traumatisierungen der Kindheit heran? Seine Gründe mögen ebenfalls vielfältiger Natur sein: (1.) die unaufgelöste Idealisierung seiner eigenen Eltern, (2.) die Einzäunungen durch Theorien, die er gelernt hat, und vor allem vermutlich (3.) die Angst vor der Konfrontation mit dem eigenen Trauma. Dazu kommt bei manchen Analytikern, (4.) daß sie bisher die Verbotstafeln nie gesehen und an der Richtigkeit der Dogmen noch nie gezweifelt haben.
Von diesen vier Gründen kann ein Buch nur den letzten tangieren, denn die Verleugnung des eigenen Kindheitstraumas läßt sich ohne tiefgehende Selbsterfahrung nicht auflösen. Was den Einfluß der angelernten Theorien betrifft, so habe ich in meiner langjährigen Supervisionsarbeit immer wieder feststellen müssen, wie sehr sie den Analytiker hindern können, aus Erfahrungen zu lernen und lehrreiche Erfahrungen zu machen. Auf der andern Seite durfte ich feststellen, daß es emotional offenere Kandidaten gab, die sich nicht zur Loyalität der Triebtheorie gegenüber verpflichtet fühlten, d. h., daß sie das Material des Patienten nicht als Phantasien und als Ausdruck von dessen Triebwünschen sahen, sondern direkt mit der Annahme der frühen Traumatisierungen arbeiteten. Dadurch ermöglichten sie dem Patienten die Artikulierung der Kindheitstraumen, was diesem in viel kürzerer Zeit, als ich es früher für möglich gehalten hatte, zu einer »strukturellen« Veränderung verhelfen konnte. Diese Kollegen wagten es, neue Erfahrungen zu machen und aus ihnen zu lernen, und machten mich, nachdem sie mir diese Erfahrungen mitteilten, wiederum zur Lernenden. Ich verdanke ihnen daher nicht nur die empirische Überprüfung meiner Theorie, sondern auch die Gewißheit, daß die Ergebnisse meiner Arbeit in einzelnen Fällen vermittelt werden können und sich in schöpferischer, individueller Art anwenden lassen.
Bei Analytikern, deren Haltung durch ihre Identifizierung mit dem Kind als Opfer (und nicht mit dem Erzieher) geprägt ist, wird sich vermutlich der Schwerpunkt der Ausbildung vom intellektuellen Studium der Fachliteratur auf die emotionalen Erfahrungen der eigenen Analyse verschieben, in der die Trennungsängste der frühen Kindheit erlebt werden müßten (vgl. S. 103 f.). Die Entdeckung der eigenen Subjektivität vermittelt dem Analytiker den Zugang zu der Subjektivität seines Patienten, von dem und mit dem er über dessen Leben lernt. Erst die (begrenzte) Erfahrung meines Unbewußten und die Kenntnis des Wiederholungszwanges macht es mir möglich, die Subjektivität eines Menschen zu verstehen. Sie zeigt sich dann für mich in allem, was dieser sagt, tut, schreibt, träumt oder flieht. Die Fähigkeit des Analytikers, seine Subjektivität zu fühlen, ist die Voraussetzung des Verstehens, aber die dabei gewonnenen Erkenntnisse über das Leben des Patienten sind alles andere als subjektive Einfälle. Sie sind Versuche, den Sinn und das verborgene Leiden eines einmaligen Lebens auf dem Hintergrund einer ganz spezifischen Kindheit mit Hilfe der Inszenierungen aus dem Wiederholungszwang in der Übertragung und Gegenübertragung zu verstehen.
Am Beispiel meiner Studien über verschiedene Lebensläufe zeigt sich, daß solche Erkenntnisse überprüfbar sein können. Fühlen braucht wissenschaftliche Genauigkeit nicht auszuschließen; ich meine sogar, daß es Bereiche gibt (wie z. B. den der Psychoanalyse), deren Wissenschaftlichkeit durchs Fühlen sehr viel zu gewinnen hätte; sei es nur, um das Arsenal von falschen Behauptungen aufzudecken, die mit Hilfe unverständlicher Begriffe lange Zeit geschützt werden können. Nur ein fühlender Mensch kann die Machtfunktion einer leeren Begriffsbildung durchschauen, weil er sich nicht durch Unverständlichkeit einschüchtern läßt.
A Psychoanalyse zwischen Dogma und Erfahrung
Wird man Françoise einmal erzählen, daß sie fast gestorben wäre? Vielleicht wird sie erfahren, daß sie von ihrem bewundernswürdigen Vater gerettet wurde … Man wird ihr nicht erzählen, daß er dieses nicht von ihm gezeugte kleine Mädchen töten wollte … So wird Françoise auch vielleicht wiederholen, daß etwas mit ihr passiert ist, als sie klein war, daß sie nicht weiß, was, und daß sie seitdem wegen ihrer Hüfte, ihres Beines oder ihres Fußes in die Klinik geht, um eines Tages genauso zu gehen, wie die anderen … übrigens hat sie Fortschritte gemacht, und man hat ihr gesagt, daß sie neue orthopädische Schuhe anziehen könne …
(Aus: Leïla Sebbar, Gewalt an kleinen Mädchen, 1980)
A 1. ZWEI HALTUNGEN IN DER PSYCHOANALYSE
Die Unterdrückung der Frage, wie Eltern mit ihren Kindern in deren ersten Lebensjahren bewußt und meistens unbewußt umgehen, ist selbstverständlich nicht nur innerhalb der klassischen Psychoanalyse anzutreffen, sondern kennzeichnet alle mir bekannten Humanwissenschaften, auch diejenigen, die zu den entsprechenden Fakten freien und täglichen Zugang haben, nämlich die Psychiatrie, Psychologie und verschiedene Richtungen der Psychotherapie. Warum ich besonderen Wert darauf lege, die Unterdrückung dieser Frage auch innerhalb der Psychoanalyse herauszustellen, mag vor allem gerade damit zusammenhängen, daß meiner Meinung nach die Psychoanalyse den tiefsten und reinsten Einblick in dieses Geschehen hätte, wenn sie sich nicht mit Hilfe ihrer Theorien dagegen abschirmen würde, was ganz automatisch und unbewußt geschieht. Ich muß daher etwas weiter ausholen, um diese Mechanismen zu beschreiben.
Wenn ich z. B. mein Interesse und meine Aufmerksamkeit darauf richte, bei einem Menschen, der zum erstenmal mein Zimmer betritt, herauszufinden, welche Triebwünsche er im Moment unterdrückt, und wenn ich meine Aufgabe darin sehe, ihm das im Laufe des analytischen Prozesses klarzumachen, werde ich zwar freundlich zuhören, wenn er mir von seinen Eltern und von seiner Kindheit erzählt, doch von dem damaligen Geschehen nur das aufnehmen können, was die Triebkonflikte des Patienten erklärt. Die einstige Realität des Kindes, die meinem Patienten seit jeher nicht mehr emotional zugänglich ist, wird auch für mich nicht zugänglich werden. Sie bleibt ein Teil der »Phantasiewelt« des Patienten, an der ich mit meinen Konzepten und Konstruktionen teilnehmen kann, ohne daß die wirklich geschehenen Traumen aufgedeckt werden.
Wenn ich hingegen den Menschen, der mein Zimmer betritt, von Anfang an mit Fragen konfrontiere, die sich darauf beziehen, was ihm in der Kindheit zugestoßen ist, und wenn ich mich bewußt mit dem Kind im Patienten identifiziere, dann wird sich von der ersten Stunde an ein frühkindliches Geschehen vor uns ausbreiten, das unmöglich hätte auftauchen können, wenn statt der bewußten Identifizierung mit dem einstigen Kind die unbewußte Identifizierung mit den verheimlichenden, erziehenden Eltern meine Haltung bestimmt hätte. Um dieses Auftauchen zu ermöglichen, genügt es nicht, Fragen nach der Vergangenheit zu stellen; es gibt außerdem Fragen, die besser dazu geeignet sind, zuzudecken, als zu öffnen. Wenn aber das Interesse des Analytikers auf die frühkindlichen Traumen gerichtet ist und er nicht mehr unter dem inneren Zwang steht, die Eltern (die seinen und die des Patienten) schonen zu müssen, wird er in der gegenwärtigen Klage des Patienten bereits ohne Schwierigkeiten die Wiederholung einer früheren Situation entdecken. Wenn er z. B. hört, wie der Patient mit unbeteiligtem Gesicht über seine gegenwärtige Partnerbeziehung erzählt, die ihm, dem Analytiker, als äußerst qualvoll vorkommt, wird er sich und den Patienten fragen, welche Qualen er bereits in seiner Kindheit hat aushalten müssen und sie als solche nicht hat erkennen dürfen, um jetzt so ohne jegliche Gemütsbewegung über seine Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit und die ständigen Demütigungen in dieser Partnerbeziehung sprechen zu können. Es kann aber auch sein, daß der Patient mit starken Affekten kommt, die auf andere, neutrale Personen verschoben sind, und völlig affektlos bzw. idealisierend über seine Eltern spricht. Wenn sich der Analytiker für das frühe Trauma interessiert, wird er in kurzer Zeit anhand dessen, wie der Patient sich selber schädigt, realisieren, wie die Eltern einst mit diesem Kind umgegangen sind. Auch die Art, wie der Patient den Analytiker behandelt, ist voll von Hinweisen darauf, wie die Eltern ihn behandelt haben: verachtend, spöttisch, enttäuscht, oder aber Schuldgefühle machend, beschämend, ängstigend, verführend. Alle einstigen Register der Kinderstube können sich bereits im ersten Interview zeigen, wenn man darauf hören darf. Ist der Analytiker in seinen eigenen Erziehungszwängen befangen, dann wird er seinem Supervisor oder seinem Kollegen erzählen, wie »unmöglich sich sein Patient benimmt«, wieviele unterdrückte Aggressionen in ihm schlummern, welchen Triebwünschen sie entspringen, und er wird sich bei den erfahrenen Kollegen Rat holen, wie man diese Aggressionen deuten bzw. »hervorholen« könne. Kann er aber das Leiden des Patienten spüren, das der Patient selber noch nicht spüren darf, dann wird er sich lediglich an seine Voraussetzung halten, daß die demonstrierten Haltungen des Patienten eine Mitteilung und eine Sprache sind, die über Geschehnisse erzählen, von denen dieser vorläufig noch gar nicht anders als eben nur so, wie er es tut, berichten kann und muß. Er wird auch wissen, daß die unterdrückten oder manifesten Aggressionen Antworten und Reaktionen auf Traumatisierungen sind, die zwar vorläufig im Dunkeln bleiben, aber deren bewußtes, emotionales Erlebnis das Ziel der Analyse sein müßte.
Ich habe hier zwei verschiedene, ja ausgesprochen entgegengesetzte Haltungen des Analytikers geschildert. Nehmen wir an, daß ein Patient oder ein Ausbildungskandidat auf der Suche nach einem Behandlungsplatz mit je einem Analytiker dieser verschiedenen Richtungen spricht; nehmen wir ferner an, daß von diesem Erstinterview, sei es für die Klinik oder zu Händen des Unterrichtsausschusses Berichte erstattet werden müssen. Man kann sich leicht vorstellen, daß die beiden Berichte nicht nur voneinander abweichen, sondern von zwei verschiedenen Menschen sprechen. Das ist an sich nicht sehr wichtig, denn solche Berichte bleiben meistens in den Schubladen. Wichtig aber ist der Umstand, daß sich der Interviewte in diesen Gesprächen entweder als Subjekt oder als Objekt erleben kann. Im ersten Fall sieht er, manchmal überhaupt zum erstenmal, die Chance, sich selber und seinem Leben zu begegnen und damit seinen unbewußten Traumen näherzukommen, was ihn sowohl mit Angst als auch mit Hoffnung erfüllen kann. Im zweiten Fall ist er in der ihm gewohnten, intellektuellen Selbstentfremdung bereit, sich als Objekt einer weiteren Erziehungsarbeit zu sehen, in deren Verlauf er, um mit den Worten von Freuds Patientin zu sprechen, sich so schlecht machen darf, wie es für ihn notwendig ist.
Diese Unterschiede in der Haltung des Patienten zu sich selber scheinen mir von weittragender Bedeutung zu sein, nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft. Die Art, wie ein Mensch zu sich selber steht, wirkt sich auch auf seine Umgebung aus, vor allem auf diejenigen, die von ihm abhängig sind, auf seine Kinder und auf seine Patienten. Einer, der sein Innenleben vollständig objektiviert, wird auch die andern zu Objekten machen. Es ist vor allem diese letzte Konsequenz, die mich dazu bewogen hat, diesen Unterschied in der Haltung deutlich herauszuarbeiten, obwohl ich ja weiß, daß die der zudeckenden Haltung zugrunde liegenden Motive (der Schonung der Eltern, der Verleugnung des Traumas) tiefe, unbewußte Wurzeln haben und kaum mit Büchern oder Argumenten zu ändern sind.
Darüber hinaus haben mich andere Gründe dazu bewogen, über den Unterschied in der Haltung des Analytikers nachzudenken: Ich begegne häufig der Meinung, daß die analytische Arbeit am Selbst, wie ich sie verstehe, nur im Rahmen einer sehr langen klassischen Analyse geleistet werden könne; im Rahmen einer kürzeren Psychotherapie sei dieses Ziel nicht erreichbar. Auch ich war früher davon überzeugt, bin es aber jetzt nicht mehr, weil ich sehe, wieviel Zeit der Patient u. U. verliert, wenn er sich gegen die Theorien seines Analytikers wehren muß, um schließlich nachgeben zu können und sich »sozialisieren« oder »erziehen« zu lassen. Ähnliches gilt für Gruppen. Wenn den Mitgliedern der Gruppe zwar das Recht auf ihre Gefühle verbal zugestanden wird, der Therapeut aber vor »Ausbrüchen« gegen die Eltern Angst hat, kann er die Gruppenteilnehmer nicht verstehen und wird u. U. ihre Ratlosigkeit, ihre Aggressionen noch verstärken. Er kann dann entweder diese Gefühle im Chaos enden lassen, oder aber zu mehr oder weniger verschleierten erzieherischen Maßnahmen greifen, indem er an die Vernunft, Moral, Versöhnungsbereitschaft usw. appelliert. Oft ist das Bemühen des Therapeuten auf die Versöhnung des Patienten mit seinen Eltern ausgerichtet, weil er bewußt davon überzeugt ist und es auch so gelernt hat, daß nur das Verzeihen und Verstehen den inneren Frieden gibt (was in der Welt des Kindes ja auch tatsächlich stimmt!). Unbewußt aber fürchtet der Therapeut möglicherweise den unterdrückten Zorn auf seine eigenen Eltern, wenn er den Patienten zur Versöhnung führt. So rettet er im Grunde (in der therapeutischen Arbeit) seine Eltern vor dem eigenen Zorn, den er – in der Phantasie – für tödlich hält, weil er nie erfahren durfte, daß Gefühle nicht töten. Kann aber der Therapeut seine unbewußte Identifikation mit den erziehenden Eltern ganz aufgeben und sich, als sein Anwalt, mit dem leidenden Kind identifizieren, können dank seines angstfreien Verständnisses in kurzer Zeit Prozesse in Gang kommen, die man früher als Wunder bezeichnet hat, weil ihre Dynamik noch nicht konzeptualisierbar war.
Der Unterschied zwischen den zwei Haltungen könnte auch an einem ganz banalen Beispiel des sogenannten Agierens, das jeder Psychoanalytiker aus seiner Praxis kennt, illustriert werden. Nehmen wir an, ein Patient ruft in einer bestimmten Phase seiner Analyse den Analytiker zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten privat an. Ein unbewußt erziehender Analytiker wird in diesem Verhalten die »mangelnde Frustrationstoleranz« (der Patient kann nicht bis zur nächsten Stunde warten), ein gestörtes Verhältnis zur Realität (der Patient realisiert nicht, daß sein Analytiker, neben den Stunden mit ihm, auch sein eigenes Leben hat) und andere narzißtische »Defekte« sehen. Da der Analytiker selber ein erzogenes Kind ist, wird er Mühe haben, aus seiner eigenen Freiheit heraus dem Patienten Grenzen zu setzen. Er wird nach Regeln suchen, die ihm erlauben, die durch die häufigen Telefonanrufe erzeugten Störungen zu beseitigen, d. h. eigentlich den Patienten zu erziehen.
Kann aber der Analytiker im Verhalten des Patienten die aktive Inszenierung eines passiv erlittenen Schicksals sehen, wird er sich fragen, wie die Eltern mit diesem Kind umgegangen sind und ob das Verhalten des Patienten nicht möglicherweise die Geschichte der Verfügbarkeit des Kindes erzählt, die so weit zurückliegt, daß der Patient sie nicht mit Worten, sondern nur mit seinem unbewußten Verhalten erzählen kann. Dieses Interesse des Analytikers für die frühere Realität wird praktische Konsequenzen haben: er wird nicht versuchen, »richtige Maßnahmen zu treffen«, wird aber auch nicht in Gefahr sein, dem Patienten die Illusion einer ständigen Verfügbarkeit zu geben, die dieser bei den Eltern nie hatte und die er, in illusionärer Weise, seinen Eltern zu geben versuchte. Sobald er mit dem Patienten die frühere Situation sehen kann, braucht er keine erzieherischen Maßnahmen und kann trotzdem oder gerade deshalb seine private Sphäre und Freizeit ernstnehmen und schützen.
Im Begriff des Agierens, das unter den Analytikern beinahe die Bedeutung des »schlechten Benehmens« hat, spiegelt sich die erzieherische Haltung. Ich ziehe es vor, auf diesen Begriff zu verzichten und spreche lieber von Inszenierungen, denen ich eine zentrale Rolle zuschreibe und die für mich nicht eine Unart bedeuten. Es handelt sich dabei vielmehr um eine notwendige, oft dramatische, unbewußte Mitteilung über die frühe Realität.
In einem mir bekannten Fall stellte es sich heraus, daß eine Patientin, die ihren ersten freundlichen und geduldigen Analytiker und seine Familie mit ihren nächtlichen Anrufen zur Verzweiflung brachte, beim nächsten Analytiker sehr schnell herausfinden konnte, daß sie hier unbewußt traumatische Erlebnisse aus ihrer frühen Kindheit inszenierte. Ihr Vater, der ein erfolgreicher Künstler war, kam oft nach Hause, wenn das Kind schon schlief, nahm es aber dann gerne aus dem Bettchen heraus und spielte mit ihm schöne und spannende Spiele, bis er selber müde wurde und dann das Kind wieder in sein Bettchen zurücklegte. Dieses Trauma des plötzlichen Einbruchs in den ruhigen Schlaf, der starken Stimulierung und des plötzlichen Alleingelassenwerdens inszenierte die Patientin unbewußt mit ihrem Analytiker, und erst, nachdem sie dies beide herausgefunden hatten, konnte sie zum erstenmal ihre aus der damaligen Situation stammenden Gefühle erleben: die Empörung über das Gestörtwerden, die Anstrengung, sich als gute Spielpartnerin zu behaupten, damit der Vater nicht weggehe, und schließlich die Wut und die Trauer über das Verlassenwerden. In der Inszenierung kam dem Analytiker zuerst die Rolle des geweckten Kindes zu, das sich ja richtig verhalten möchte, um die geliebte Bezugsperson nicht zu verlieren, und zugleich auch die Rolle des realen Vaters, der mit dem Beenden des Telefongespräches das Kind wieder alleine läßt und kränkt. Der erste Analytiker hat dieses sogenannte Agieren nicht in seinem biographischen Sinn verstanden und daher mitagiert. Der zweite ließ sich in der Inszenierung eine frühe Geschichte erzählen, die ihm geholfen hat, im Zuschauerraum mit voller Teilnahme einem Drama beizuwohnen, ohne auf die Bühne zu springen und mitzuspielen. Da er sich von hier aus den Blick auf die Kindheit des Patienten bewahrte, sah er in dessen Übertragungsverhalten nicht den »Widerstand«, sondern die szenische Darstellung des Vaters.
A 2. ANALYSANDEN BESCHREIBEN IHRE ANALYSEN
Ich will versuchen, die von mir hier geschilderten zwei verschiedenen Haltungen des Analytikers an drei literarischen Selbstdarstellungen des analytischen Prozesses zu illustrieren: Marie Cardinal: Les mots pour le dire; deutsch: Schattenmund (1977); Tilmann Moser: Lehrjahre auf der Couch, (1974); Dörte von Drigalski: Blumen auf Granit, (1980).
Sofern ich orientiert bin, handelt es sich bei allen hier betroffenen vier Analytikern um redlich bemühte Persönlichkeiten, die als gut ausgebildete, geschätzte und anerkannte Mitglieder der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung gelten. Ich kenne nur zwei von ihnen persönlich, aber zu flüchtig, um daraus etwas über ihre Arbeitsweise zu wissen. So beruht alles, was ich im folgenden über ihre Methoden sagen werde, einzig und allein auf der Lektüre der drei Bücher. Da alle drei Autoren nichts anderes wollen, als ihre subjektive Realität darzustellen, erzählen sie die pure Wahrheit. Wie ich mich in meiner analytischen Arbeit von den Gefühlen des Patienten leiten lasse, so tue ich es auch bei der Lektüre dieser drei Bücher.
Ich bekam aus den Berichten den Eindruck, daß sich alle vier Analytiker (D. v. Drigalski hatte zwei) mit vollem Einsatz um diese Patienten bemühten, sie zu verstehen versuchten und ihnen ihr ganzes fachliches Wissen zur Verfügung stellten. Warum sind die Resultate so verschieden? Kann man sich die Erklärung dafür so leicht machen, daß man einen Analysanden als unheilbar bezeichnet, wenn seine Analyse ein vier Jahre währendes Mißverständnis war? Begriffe wie »negative therapeutische Reaktion« oder »Vorwurfspatienten« erinnern mich an das böse, weil »eigensinnige Kind« der Schwarzen Pädagogik, in der das Kind immer schuld war, wenn die Eltern es nicht verstanden haben. Es mag vorkommen, daß wir den Patienten in ähnlicher Weise beschuldigen und ihn als schwierig bezeichnen, wenn wir ihn nicht verstehen können. An diesem Nichtverstehenkönnen ist aber der Patient ebensowenig schuld wie das Kind an den Schlägen seiner Eltern. Wir verdanken es unserer Ausbildung, die genauso irreführend sein kann wie die »altbewährten Prinzipien« unserer Erziehung, die wir von unseren Eltern übernommen haben.
Der Unterschied zwischen der Analyse von Marie Cardinal auf der einen Seite und denjenigen von Tilman Moser und Dörte von Drigalski auf der andern Seite liegt meiner Meinung nach darin, daß im ersten Fall die sehr schwer kranke, unter Lebensbedrohung stehende Patientin im analytischen Raum herausfinden durfte, was ihr ihre Eltern angetan haben, und die Tragik ihrer Kindheit erleben konnte. Dies ist so stark möglich gewesen, daß der Leser diesen Prozeß mitvollzieht und mitfühlt. Die unbändige Wut und tiefe Trauer über das ihr zugefügte Schicksal führen zur Befreiung von den gefährlichen, chronischen Blutungen in der Gebärmutter, die früher nur chirurgisch und erfolglos behandelt worden waren. Das Aufblühen der vollen Kreativität ist die Folge dieser Trauer. Aus dem Bericht von Marie Cardinal sieht man deutlich, daß hier nicht im Sinne z. B. einer Familientherapie oder einer Transaktionsanalyse gearbeitet wurde, sondern psychoanalytisch, weil sich die Verknüpfungen der tragischen, emotionalen Entdeckungen der kindlichen Realität mit dem Geschehen in der Übertragung für einen fachlich ausgebildeten Leser nachvollziehen lassen.
Auch die andern drei Therapeuten haben sich analytisch verhalten, aber man spürt hier in allen drei Fällen die Bemühung, alles, was der Patient sagt und tut, von der Triebtheorie her zu verstehen. Wenn es in der Ausbildung als Axiom gilt, daß alles, was dem Patienten in der Kindheit geschah, Folge seiner Triebkonflikte war, dann muß der Patient früher oder später dazu erzogen werden, sich als böse, destruktiv, größenwahnsinnig, homosexuell zu erleben, ohne den Grund dafür zu verstehen. Denn die als Erziehung bezeichneten narzißtischen Traumen der Kindheit, die Erniedrigung, Verachtung und Mißhandlung, bleiben unberührt und können vom Patienten nicht erlebt werden. Indessen könnte erst das Einbeziehen dieser konkreten Situationen ihm helfen, seine Gefühle der Wut, des Hasses, der Empörung und schließlich der Trauer anzunehmen.
Es gibt zweifellos viele Analysanden, die die Erziehung in der Therapie »gut« überstehen, weil sie sie gar nicht merken. Sie sind durch die Schwarze Pädagogik so daran gewöhnt, daß man sie nicht versteht und häufig noch für ihr Schicksal beschuldigt – sie werden das gleiche in der neuen Situation nicht merken können und sich dem neuen Erzieher anpassen. Mit einem ausgewechselten Überich verlassen sie die Analyse. Doch darüber, daß Menschen wie Tilmann Moser und Dörte von Drigalski, beide schöpferische Persönlichkeiten, daran verzweifelt sind, muß man sich nicht wundern. Bei Tilman Moser ist die Verzweiflung zwar noch hinter der Idealisierung seines Analytikers verborgen, aber sein nächstes Buch, Gottesvergiftung, zeigt, daß die Aggressionen gegen die Eltern in der Analyse nicht erlebt werden konnten, weil offenbar sowohl der Analytiker als auch die Eltern geschont werden mußten. Bei Dörte von Drigalski führt ihre persönliche Enttäuschung an ihren beiden Analysen zur Ablehnung der Psychoanalyse überhaupt, was begreiflich, aber bedauerlich ist. Denn zumindest am Beispiel von Marie Cardinal (und es gibt deren viel mehr, auch in anderen Ländern,) läßt sich zeigen, daß die Psychoanalyse auch zur Entfaltung eines schöpferischen Menschen beitragen kann.
Im Bericht von Dörte von Drigalski sind die tragischen Spuren der Schwarzen Pädagogik besonders deutlich. Abgesehen vom Verhalten der Ausbildungsinstitute, die mancherorts einen wahren Horror vor Originalität zu haben scheinen, stehen wir vor der Tragik der jahrelangen Bemühungen der beiden Analytiker und der Patientin selber, denen es verwehrt war, zu den narzißtischen Traumen der frühen Kindheit Zugang zu bekommen, weil alle drei Menschen unter dem Gebot der Schonung der Eltern und der Beschuldigung des Kindes standen. Was die Autorin über ihre Kindheit, ihre Eltern und ihre Brüder berichtet, bleibt deshalb schemenhaft, frei von starken Gefühlen, ähnlich wie bei Tilman Moser und im großen Gegensatz zu Marie Cardinal. Ihre ganze Empörung gilt nun der Psychoanalyse und ihrem letzten Analytiker, der sie nicht verstanden hat. Aber hätte diese Frau vermocht, vier Jahre lang gegen ihre Gefühle anzukämpfen und diese Qual zu ertragen, wenn sie nicht dazu erzogen worden wäre, sich zu überhören und auf die Zähne zu beißen? Doch die Erzieher ihrer ersten Jahre bleiben von ihrer Wut verschont. Das ist auch die Regel, denn das mehr oder weniger bewußte Ziel der Säuglingserzieher ist: das Kind soll niemals in seinem späteren Leben herausfinden, wie man ihm das Nichtmerken beigebracht hat. Ohne Schwarze Pädagogik gäbe es keine Schwarze Psychoanalyse, denn die Patienten würden von Anfang an darauf reagieren, wenn man sie nicht verstehen, sie übersehen, überhören oder »verkleinern« würde, damit sie endlich in das Prokrustesbett der Theorien passen.
Ohne Schwarze Pädagogik gäbe es auch vieles andere nicht; es wäre z. B. undenkbar, daß phrasendreschende Politiker auf demokratischem Wege höchste Machtpositionen erlangen könnten. Wenn aber den Wählern in ihrer Kindheit, als sie noch dazu befähigt gewesen wären, das Phrasendreschen mit Hilfe ihrer Gefühle zu entlarven, gerade dies verboten wurde, wird ihnen diese Fähigkeit später abhanden kommen. Die Erlebbarkeit der starken Gefühle der Kindheit und Pubertät (die aber so oft durch Prügel, Erziehung oder gar durch Drogen abgetötet werden) könnte dem Einzelnen eine wichtige Orientierungshilfe bieten. Mit dieser Hilfe würde er schneller durchschauen, ob der andere, z. B. der Politiker, aus eigener, erlebter Erfahrung spricht oder nur bewährte Sprüche klopft, um seine Wähler zu manipulieren. Unser Erziehungssystem bietet das fertige Geleise, dem man nur seine Züge anzupassen braucht, um dahin fahren zu können, wohin einen der Machthunger lockt. Man muß nur die Register ziehen, die die einstigen Erzieher eingebaut haben.
Die lähmende Bindung an bestimmte Normen, Bezeichnungen und Etiketten ist auch bei manchen Menschen deutlich zu erkennen, die sich durchaus ehrlich und mit vollem Einsatz im politischen Kampf engagieren. Aber der politische Kampf ist bei ihnen nicht von Partei, Organisation, Ideologie wegzudenken. Da die folgenschwere, unser Leben und den Frieden bedrohende Rolle der Erziehung bisher so lange verborgen geblieben ist, haben die Ideologien diese Tatsache noch nicht aufnehmen bzw. keine intellektuellen Waffen gegen diese Erkenntnis (falls sie sie leugnen müssen) entwickeln können. Der Tatsache der sehr frühen Konditionierung des Menschen zum Gehorsam, zur Abhängigkeit und zur Gefühlsunterdrückung und deren Folgen hat sich meines Wissens nach keine Ideologie »angenommen«. Das ist auch verständlich, denn es würde sie vermutlich das Leben kosten. So halten sich viele Menschen für politisch aktiv, wenn sie mit Hilfe des Lüftens versuchen, den aufsteigenden Rauch zu beseitigen, sich allenfalls mit abstrakten Theorien begnügen, die dessen Herkunft erklären, und in aller Ruhe die Tatsache ignorieren, daß es in ihrer Nähe lichterloh brennt. Und solange für dieses Feuer keine Etikette besteht, wird es in bestimmten Kreisen je nachdem als »apolitisch« oder »unanalytisch« bezeichnet.
Meine Hypothese, daß Adolf Hitler seine große Anhängerschaft den unmenschlichen, grausamen Prinzipien der Säuglings- und Kindererziehung verdankte, die damals in Deutschland herrschte, bestätigt sich auch in Ausnahmen. Ich bin der Frage nachgegangen, wie die beiden jungen Widerstandskämpfer im Dritten Reich, Sophie und Hans Scholl, aufgewachsen sind. Es hat sich herausgestellt, daß sie es tatsächlich der toleranten und freien Umgebung ihrer Kindheit verdankten, daß sie, bereits in der Hitlerjugend, die Parolen des Führers während des Nürnberger Treffens durchschauten, während ja beinahe alle ihre Altersgenossen vom Führer restlos begeistert waren. Aber die Geschwister Scholl trugen in sich bereits ein anderes, freieres Menschenbild, mit dem sie Hitler vergleichen konnten und das ihren Kameraden fehlte (vgl. A. Miller, 1980). Die Seltenheit dieser Voraussetzung erklärt auch, warum manipulatorische, therapeutische Methoden von den Patienten kaum durchschaut werden können: sie repräsentieren ein System, das dem Patienten ganz selbstverständlich erscheint und daher gar nicht auffallen kann.2
Was wäre mit einer Frau wie Marie Cardinal geschehen, wenn sie zu einem Analytiker gekommen wäre, der ihr ihre Blutungen nur als Abwehr der Weiblichkeit, als Ausdruck des Penisneides, als Wendung der Destruktivität gegen sich selbst gedeutet hätte? Darüber kann man nur spekulieren. Wäre der Analytiker sonst ein netter Mensch gewesen, hätte sie sich vielleicht in ihn verliebt und zunächst die Symptome verloren. Aber wenn sie nicht bis zur Realität ihrer Mutter durchgedrungen wäre, hätte sie ihre unbändige Wut und ihren Haß auf die Mutter niemals in diesem Ausmaß zulassen können, weil sie sich, solange ihr ihre Gefühle nicht als Reaktionen begreiflich geworden wären, wie ein Ungeheuer vorgekommen wäre. Das Ergebnis wäre gewesen, daß sie in ihrer Verzweiflung wahrscheinlich die Analyse nach Jahren hätte aufgeben müssen oder mit ihren »unbegründeten«, unverstandenen Haßgefühlen in einer Klinik gelandet wäre. Ihre Falldarstellung hätte nicht sie geschrieben, sondern ihr Analytiker als Beispiel einer unheilbaren Krankheit, einer negativen therapeutischen Reaktion oder so ähnlich. Wenn der Analytiker ihr aber von Anfang an nicht sympathisch gewesen wäre, hätte sich sehr früh eine sado-masochistische Übertragung eingestellt, in deren Verlauf Deutungen immer mehr den Charakter von verkappten Beschuldigungen angenommen hätten. Und doch gibt es immer häufiger Patientinnen in der Art von Marie Cardinal, denen wir mit den üblichen Etiketten nicht mehr beikommen können.
Der Unterschied zwischen den zwei entgegengesetzten Haltungen, die ich hier anhand der drei Beispiele zu illustrieren versucht habe, läßt sich nicht mit dem Begriff »rekonstruktive Deutungen« umschreiben. Wenn der Analytiker unter dem Tabu des Vierten Gebotes steht, wird er sich bei aller Bemühung um Rekonstruktionen mit den verurteilenden Eltern gegen den Patienten verbünden und ihn früher oder später erziehen wollen, indem er an das Verständnis des Patienten für dessen Eltern appelliert. Ohne jeden Zweifel waren unsere Eltern auch Opfer, aber primär nicht die ihrer Kinder, sondern ihrer eigenen Eltern. Es ist notwendig, die ungewollte, aber von der Gesellschaft sanktionierte Verfolgung der Kinder durch ihre Eltern, die man Erziehung nennt, zu sehen, damit der Patient von dem ihm von klein auf anerzogenen Gefühl, daß er am Leiden seiner Eltern schuld sei, frei wird. Das setzt beim Analytiker die Befreiung von Schuldgefühlen den eigenen Eltern gegenüber und die Sensibilisierung für narzißtische Kränkungen im frühen Alter voraus. Wenn ihm das letztere fehlt, wird er das Ausmaß der Verfolgung bagatellisieren. Er wird sich nicht in die Demütigungen eines Kindes einfühlen können, da seine eigenen frühkindlichen Demütigungen niemals aus der Verdrängung aufkommen konnten. Wenn er gelernt hat, sich nach dem Motto »Du bringst mich noch ins Grab« für alles schuldig zu fühlen, um die Eltern zu schonen, wird er die ihm unverständlichen Aggressionen des Patienten so beruhigen wollen, daß er immer wieder die positiven Seiten der Eltern hervorhebt, was man auch als »die Aufrichtung der guten Objekte« im Patienten bezeichnet.
Wenn die Mutter ihren Säugling als böse und destruktiv erlebt, dann muß sie ihn zähmen und erziehen. Wenn sie aber seine Wut und seinen Haß als Reaktionen auf schmerzhafte Erlebnisse bezieht, deren Bedeutung ihr selber noch verschlossen bleiben mag, dann wird sie nicht versuchen, das Kind zu erziehen, sondern es seine Gefühle erleben lassen. Das gilt auch für den analytischen Prozeß. Das Beispiel von Marie Cardinal zeigt, warum es nicht notwendig ist, ein »gutes Objekt im Patienten aufzurichten« und ihm immer wieder zu sagen, daß seine Eltern auch positive Seiten hatten und sich um ihn bemühten. Das ist ja nie von ihm in Frage gestellt worden, im Gegenteil: das Kind braucht das Positive nicht im Dienste des Überlebens zu verdrängen (vgl. A. Miller, 1979). Wenn der Zorn der frühen Kindheit und die spätere Trauer erlebt worden sind, können sich die freundlichen Gefühle, die nicht auf Pflichtgefühl, Schuldgefühlen und Verleugnungen gründen, von selber einstellen, sofern Voraussetzungen dafür vorhanden waren. Sie sind aber auf jeden Fall von der bedingungslosen, abhängigen, alles verzeihenden und daher tragischen Liebe des kleinen Kindes zu seinen Eltern zu unterscheiden.
Wir können Sigmund Freud keinen Vorwurf daraus machen, daß er ein Kind seiner Zeit war und daß er als Schöpfer der Psychoanalyse noch keine Möglichkeit hatte, für sich selber eine Couch zu beanspruchen. Das ist kein Fehler, sondern eine Not. Dies anzuerkennen schließt aber wiederum nicht aus, daß man die Grenzen von Freuds Selbstanalyse sieht. In der verbliebenen Idealisierung der Eltern und in der Zurückführung der Ursache des »neurotischen Elends« auf die Triebkonflikte des Kindes treten diese Grenzen deutlich zu Tage. Die hinter der Idealisierung verborgenen reaktiven Aggressionen als Antworten auf narzißtische Kränkungen konnte Freud mit niemandem erleben. Vielleicht übertrug er sie später auf Anhänger, die ihn nicht gut genug oder, wie er meinte, nicht richtig verstanden, wie Jung und Adler. Begreiflicherweise aber konnte er diese Enttäuschungen nicht im Zusammenhang der frühen Kindheit verarbeiten.
Freuds Situation ist indes nicht die unsere. Wir haben als Analytiker die Möglichkeit, eine Analyse durchzumachen und eine zweite und dritte wenn nötig. Außerdem leben wir mit einer Jugend, die viel offener, ehrlicher und kritischer ihren Eltern gegenübersteht, als es zu Freuds Zeiten je möglich gewesen war. Von dieser Jugend, von unseren Kindern, Schülern und Patienten können wir einiges lernen, sobald wir uns von der ängstlichen Dogmenabhängigkeit freigemacht haben.
A 3. UNBEWUSSTE PÄDAGOGIK IN DER PSYCHOTHERAPIE
Die Trias Elternschonung – Triebdeutung – Zudecken des Traumas ist nicht nur in der klassischen Psychoanalyse zu finden. Das traumatisierende Verhalten der Eltern mit Hilfe von Triebdeutungen (d. h. im Grunde mit der Beschuldigung des Kindes) zudecken zu können, gibt verschiedenen psychologischen Richtungen die Möglichkeit, modern und fortschrittlich zu erscheinen und doch die Gebote der Schwarzen Pädagogik zu erfüllen. Dies ließe sich an unzähligen Beispielen demonstrieren. Ich will es aber nur anhand eines Buches versuchen, weil hier die Aussagen der Patienten nicht durch Interpretationen entstellt, sondern, da in Briefform mitgeteilt, dem Leser in ihrer vollen Unmittelbarkeit zugänglich bleiben. Es handelt sich um ein Buch von Klaus Thomas (1979), der eine Lebensmüden-Klinik in Berlin leitet und sehr viele Adoleszente nach Selbstmordversuchen erfolgreich behandelt. Die große Zeitnot und Überforderung führte ihn zur Ausarbeitung einer neuen Methode der Selbstanalyse, die darauf beruht, daß Patienten tagebuchartige Briefe an den Therapeuten schreiben, aus denen nur einige Probleme in den in großen Abständen stattfindenden Sitzungen herausgegriffen und besprochen werden können. Ich könnte mir vorstellen, daß eine wesentliche therapeutische Wirkung schon in der Möglichkeit besteht, eigene Gefühle zu artikulieren, die Klagen zu formulieren, die Wut auf die Eltern zu erleben, wenn die Voraussetzung dafür da ist, nämlich die Gewißheit, daß jemand alles das aufnimmt, ernstnimmt und nicht urteilt. Aus den von Thomas zitierten Beispielen gewann ich den Eindruck, daß im Schreiben und im nachträglichen Sprechen darüber eine ernsthafte Alternative zur Psychoanalyse, besonders im Jugendalter, liegen könnte. Da die Sitzungen sehr selten stattfinden, kann die Erkenntnis der an sich normalen Grenzen des Verstehens des Therapeuten für eine längere Zeit hinausgeschoben werden, so daß der Patient, dank dieser Begleitung, inzwischen u. U. besser an seine Traumen herankommt als in einer orthodoxen Psychoanalyse, die ihn durch ihre Konzepte an der Entwicklung der wahren Gefühle leicht hindern kann. Es kann aber auch geschehen, daß die auch dieser Behandlungsform immanente, mehr oder weniger bewußte erzieherische Haltung des Therapeuten in seinem Verhältnis zum Patienten stark wirksam wird und die emotionale Entwicklung letztlich doch noch blockiert. Das schließt nicht aus, daß in vielen Fällen die von allen gewünschte Resozialisierung erreicht wird, nämlich die Anpassung an die Leistungsansprüche der Eltern und der Gesellschaft, denen das wahre Selbst des Patienten, wie einst dasjenige des Kindes, zum Opfer fällt. Gerade bei künstlerisch begabten Menschen kann das nicht ohne Folgen bleiben. Um das zeigen zu können, werde ich längere Passagen aus dem Buch von Thomas zitieren:
Beispiel einer Selbstanalyse mit besonderen Aggressionen gegen die Eltern und mit Beziehungen zu den Geschwistern
Ebenso aufschlußreich für die Möglichkeiten der Selbstanalyse wie für die Bedeutung freigelegter Aggressionen ist die folgende Krankengeschichte, bei der (wegen Schweigepflicht) die Namen, nicht aber die Daten verändert sind.
Die Vorgeschichte: Am 23. November 1965 erscheint erstmals ein 28jähriger Kandidat der Medizin. Er sieht sich in einer Zwangslage, aus der ihn – seiner Meinung nach – nur noch der Selbstmord befreien kann. Seine Eltern, die am Rande des Spessart in einer Kleinstadt wohnen, haben den ältesten Sohn ebenso wie die drei jüngeren Geschwister studieren lassen. Der Vater besitzt die einzige Apotheke des Ortes und genießt auch als Kirchenvorsteher das Ansehen der Bürger. Er legt auf einen raschen Studienabschluß seines Sohnes Wert, da er mit seiner Apotheke zusätzlich noch für zwei eigene ältere Schwestern aufkommen muß.
Bei seinen häuslichen Besuchen – wenigstens einmal im Monat – hat unser Patient – wir nennen ihn Dieter – stets den elterlichen Erwartungen gemäß von den Fortschritten im klinischen Studium in Frankfurt gesprochen und schließlich auch wahrheitswidrig nach seinem 15. Semester seine Meldung zum Examen mitgeteilt. In Wirklichkeit hatte er während der letzten drei Jahre kaum die Vorlesungen, ein Praktikum oder eine Klinik besucht, sondern untätig grübelnd zu Bett gelegen, gelegentlich mit Freunden zusammengesessen, dem Alkohol zugesprochen oder teilnahmslos ferngesehen. Nunmehr kündigte der Vater seinen Besuch bei dem Professor an, bei dem Dieter angeblich seiner Doktorarbeit wegen die Staatsexamensprüfung immer wieder hinausgeschoben hatte. Das Lügengebäude mußte zusammenbrechen. Der Schande vor den Eltern und der ganzen Gemeinde wollte er durch den Selbstmord entgehen.
Bei dem Streben, sich über die zuverlässigsten Selbstmordmethoden zu unterrichten, war er auf die Bücher der Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung Berlin gestoßen und unternahm die Reise, um sich hier beraten zu lassen. Bei der ersten Untersuchung stand das Bild einer eher schweren, gehemmten Depression, ausgelöst und unterhalten durch eine »ekklesiogene Neurose«, im Vordergrund.
…
Nach dem ersten Besuch der Eltern faßt die Krankengeschichte den Eindruck zusammen: Vater – selbstgerechter, kleinbürgerlicher Beamtentyp, Mutter – zwangsneurotischer Putzteufel, beide pietistisch und ihrerseits »ekklesiogen« neurotisch.
Am 2. Oktober bringt er seinen ersten aufgezeichneten, äußerst kennzeichnenden Traum:
»Ich lag morgens faul im Bett, halb schlafend, halb wach, da kam mein Vater …, schimpfte mit mir und sagte, ich müsse mich jetzt entscheiden, ob ich im Bett bleiben oder mit der Familie frühstücken wolle. Gleichzeitig drehte er das Radio leiser und ging hinaus. Ich stellte es wieder recht laut, um ihn zu provozieren, blieb im Bett und hoffte, daß mein Vater bald wiederkomme, um sich zu ärgern.«
Als Einfälle berichtet er zu diesem Traum ähnliche Erlebnisse aus dem Familienleben.
Schon der nächste Traum aber, drei Tage später, berührt ein tieferes Problem. Er überschreibt ihn:
»Kirchentraum: Ich stand vor dem Schaufenster eines Geschäftes, es hieß, darin sei Gottesdienst, allerdings in Japanisch oder Chinesisch. Durch die Scheiben sah ich einen japanischen Pfarrer im Talar, an der Seite hing ein Anschlag wie ein Börsenbericht bei einer Bank, jedoch mit japanischen Schriftzeichen. Da sagte ich mir, es hat ja keinen Zweck, dort hineinzugehen, denn das verstehe ich ja doch nicht.«
Seine Einfälle zu diesem Traum berichten – zunächst ohne nähere Begründung – von seinen Aggressionen gegen die Kirche im allgemeinen und den noch immer von den Eltern erwarteten sonntäglichen Kirchgängen im besonderen:
»Die denken doch nur an ihr Geschäft, und verstehen tut man das theologische Salbadern doch nicht«, lautet sein hartes Urteil. Am 3. 11. schreibt er nach dem Mittagsschlaf selbstanalytisch die Gedanken auf, die ihn bei dem Versuch bewegen, sich an den Traum zu erinnern:
»Ich denke mir stets Situationen aus, in denen ich gegen jemanden aufbegehren, ja revoltieren kann, aus einer gewaltigen inneren Trotzhaltung heraus, darum arbeite ich auch so langsam. Und wenn mich ein Professor noch etwas fragt, setzt bei mir praktisch jede Denkfähigkeit aus, als ob ich sagen wollte: »Wenn du mich schubst und drängelst, dann tu’ ich’s gerade nicht«.
»Diese Trotzhaltung habe ich in meiner Kindheit schon häufig eingenommen, zuerst gegen meinen Vater. Mit vier Jahren saß ich einmal auf dem Klo und wurde mit meinem Geschäft nicht fertig, da kam er plötzlich herein, wurde ungeduldig und hat mich furchtbar ausgeschimpft. Ich sehe ihn noch genau vor mir mit dem Abzeichen auf seiner Uniformjacke und seinem strengen Blick, genauso streng wie meine Mutter, die mich manchmal halb schreiend und halb weinend mit einem Stock und einmal sogar mit dem Feuerhaken verprügelte.«
In der anschließenden Besprechung sieht er in diesen – selbstanalytisch niedergeschriebenen – Erinnerungen den Schlüssel zu seiner späteren Lebenshaltung und seiner Erkrankung.
Das Wintersemester bricht er vorzeitig ab; gearbeitet hat er fast nichts; am 11. Februar 1968 schreibt er in einem wilden Affektausbruch den Anfang seines Lebensbekenntnisses nieder:
»Es ist alles so furchtbar zerfahren, nichts geht, nichts kommt vorwärts; ich kann nur noch an Inge denken (seine jüngste Schwester), ich könnte stundenlang mit ihr spielen, ihre V. küssen, mit ihr f … furchtbar, furchtbar, furchtbar – ich könnte alles verfluchen, die ganze Welt und sie mit, und doch, sie unendlich lieben und zärtlich mit ihr sein. Diese Vorstellung ist zum Auswachsen. So schön und rund und weich ist alles bei ihr. Und wie schön streichelt sie mir das Glied – ach, wie furchtbar. Was kann ich denn dafür, die anderen Jungen taten es doch auch – warum denn ich nicht mit meinen Schwestern. Immer wollte ich möglichst im gleichen Zimmer sein wie sie. Ich durfte doch sonst keine Freundin haben. Eine Zeitlang schlief Inge in dem Zimmer neben mir. Dann packte mich nachts oft ein solches Begehren, daß ich heimlich zu ihr hinüberschlich. Es war ganz still, und ich hörte nur mein Herz schlagen, so erregt war ich. Vorsichtig griff ich unter ihre Bettdecke und unter ihr Nachthemd und fuhr auch mit meinem Finger in ihre Scheide, meistens merkte sie es nicht in ihrem festen Schlaf …« (?)
In der 80. Stunde, in der er diese Aufzeichnungen mitbringt, erzählt er nun Erinnerungen von außerordentlicher Intensität und Belastung. Bis ins 4. Lebensjahr zurück reichen die Inzestwünsche und -handlungen mit beiden jüngeren Schwestern, bis er schließlich mit seiner Inge, als er 16 und sie 13 Jahre alt war, regelmäßigen Geschlechtsverkehr aufnahm. Ein Jahr später drohte eine Katastrophe: sie wurden von der anderen Schwester im Bett überrascht. In der äußersten Angst vor der elterlichen Strafe erhielten Dieter und Inge aber ein Angebot: wenn beide sie, die ältere, jedesmal mit in ihre Spiele und den abschließenden Verkehr einbezogen, sei sie bereit zu schweigen. Die Bedingung wurde angenommen, einerseits zum offenkundigen Vergnügen aller drei Beteiligten, andererseits mit schweren Schuldgefühlen, mindestens für Dieter, der nicht zufällig schon in einem seiner ersten Träume sich mit beiden Schwestern vor den Traualtar gerufen sah.
Nun berichtete er von weiteren Zusammenhängen, die er bisher verborgen hatte: Besonders vor seiner Mutter empfand er eine fast panische Angst, sie könnte ihn entdecken und überraschen, so wie er es bei der Schwester erlebt hatte. In seinen Träumen geht dann das Bild der Schwestern in das der Mutter über: Mit seiner eigenen Mutter übt er da Inzest! Gottes Strafe scheint ihm sicher. Diese Sorge durchzieht auch seine religiösen Gedanken. Auch auf sein eigenes Sexualleben wirken sie sich aus. Wenn er – inzwischen dreißig Jahre alt – einmal die Gelegenheit findet und wahrnimmt, bei einem Mädchen seine Männlichkeit zu beweisen, so versagt er: »Ich bin impotent«, lautet seine bewegte Klage, »immer sehe ich dann meine Mutter hinter mir stehen und spüre ihre Gegenwart, und dann kann ich nicht«.
»Das ist auch so ähnlich, wenn ich arbeiten will, dann denke ich immer, mein Vater steht hinter mir, und dann kann ich einfach nicht anfangen.«
Von daher entwickelt sich bei ihm eine wachsende Aggression gegen beide Eltern.
»Mit beiden Händen möchte ich jetzt schreiben« sagt er und bringt während der folgenden zwei Wochen zu jeder Stunde etwa 20 Seiten mit voller heftigster Affektäußerungen gegen die Eltern:
Zwischen der 85. und 90. Analysestunde ging nun der Patient dazu über, mit starker innerer Affektbeteiligung und Aggressionshaltung endlich einmal seinem Herzen ohne Hemmungen schriftlich Luft zu machen. Nachdem er mit den bereits berichteten Beispielen etwa 60 Seiten in klarer Sprache Kraftausdrücke niedergeschrieben hatte, entfernt sich seine skurrile Wortbildung nun immer weiter von sinnvoller sprachlicher Ausdrucksweise. In der Art des »Dadaismus« schrieb er wochenlang täglich mindestens vier DIN-A 4-Seiten voller scheinbar sinnloser Neologismen. Erst nach diesem täglichen Schreiben fühlte er sich innerlich erleichtert und zum ersten Mal seit über zehn Jahren fähig zum wissenschaftlichen Arbeiten.
Dennoch steigert die offenkundige Besserung seine Arbeitsfähigkeit nicht so nennenswert, daß er ernsthaft an die Prüfung denkt. Immer dringender werden anfangs die Ratschläge, durch systematische Tages- und Arbeitspläne sowie zahlreiche weitere Anweisungen in die Arbeitstechnik, das Lernen zu erleichtern. Die Erfolge bleiben zu begrenzt. Er weicht aus.
Ein letzter ernster Rat wird ihm erteilt: Er erhält keine Bescheinigungen mehr, die die Prüfung hinausschieben. Dem inzwischen 30jährigen »ewigen Studenten« wird eine Stelle in der pharmazeutischen Industrie vermittelt, die er auch ohne abgeschlossenes medizinisches Studium wahrnehmen kann. Er zieht es vor, weiter Studium und Arbeit hinauszuschieben. Daraufhin erhält er keine Termine.
Nun aber erwacht sein Trotz, den er schon gegen den Vater zehn Jahre lang erfolgreich durchgesetzt hatte, der von ihm die Prüfung verlangte. »Nun gerade nicht«, war die innere Einstellung Dieters. Nun waren Eltern und Arzt sich einig: Er muß das Studieren lassen und soll ein akademisches Berufsziel aufgeben. »Nun gerade nicht«, so mag er sich, vielleicht ohne es selbst zu wissen, eingestellt haben. Ein Jahr hindurch ist von ihm nichts mehr zu erfahren.
Da meldet er sich am 2. März 1971, ohne vorgemerkt zu sein. »Gestern habe ich zum Dr. med. promoviert. Auch das Staatsexamen habe ich inzwischen abgelegt! Die Einzelheiten muß ich Ihnen später noch erzählen; dazu ist heute keine Zeit. Übrigens – eine Freundin habe ich jetzt auch!«
Von den späteren Jahren ist ein wechselhaftes Befinden nachzutragen: Einerseits blieb Dieter arbeitsfähig, andererseits sind die Leistungen deutlich geringer als bei seinen Kollegen, auch sind die Kontaktschwierigkeiten zum anderen Geschlecht nicht befriedigend behoben. (K. Thomas, 1976, S. 77-92)
Dieser Mann hatte in seiner Adoleszenz die Kraft, sich durch seine Passivität gegen die Mauern des Unverständnisses seiner Eltern zur Wehr zu setzen. Sein »Unvermögen«, im Medizinstudium Leistungen zu vollbringen, war für diesen überdurchschnittlich intelligenten Menschen offenbar die einzige Oase seiner Würde. Die wenigen Auszüge aus seinen Briefen, die an dadaistische Gedichte erinnern, zeigen die unerhörte sprachliche Erfindungsgabe und -kraft dieses Mannes, die so lange hinter seiner gefälligen Anpassung ungelebt geblieben waren.
Aus seinen Aggressionsentladungen: »Alter Saukerl in seinem Saustall, ein Himmelhöllenhund mit seiner Satansziege, ultrarechtslinkes Sauscheißmistvieh, schizophrener Syphilist, verunglimpfter Arschgeier, A.-Ficker, Keimdrüsenabkneifer, Oberschleimsch …, Kindermordexperte, Kannibalismusexperte, empfängnisverhütender Frauenmörder, ausgefilztes Suppenhuhn, Schabenfresser, Karrakatischaer Laienpriester, Kirchhofsbetrüger, Idiotenspiegelzimmerer, Inzestficker, Kinderverschlinger, verfickter Zinnoberverführer, Auschwitzvertreter, Kinderverführer, Im-Keim-Ersticker, vernebelter Waldheini, Heulsusenverbrenner, Schießprügelverenger, drangsalierender Schwitzkastenhalter, Schilddrüsenzerdrücker, schemenhafter Affenarschabtrenner, zermürbender Aasgeier, schielendes Ungeheuer, zwielichtige Gestalt, Irrenhausanwärter, saftlatschiger Hühnerdreck, schweinsköpfiger Schildbürger, schwindelerregender Kuheuter, häutetragendes Mistvieh, stiertötendes Kirchenschwein, stieläugiges Braunhemd, saftlatschiger Gemüsehändler, Tierquäler, stinkendes Eselsaas, Sch.-kerliger Eierverkrüppler, lahmarschige Krücke, starrköpfiger Grimassenschneider, erfindungssüchtige Waldeule, fischäugiger Gaffer, hundsgemeiner Saftarsch, Knochenpeiniger, gerammelt voller Sch.-Pott, lauter Mist, Scheiße …«
Einzelne Abschnitte in den ersten 60 (!) Seiten eng vollgeschriebener Schimpfkanonaden (ohne Wiederholungen) beziehen sich auch auf seine Mutter:
»Kriegskuh, Schwitzzange, Schließmuskel, Wildbrunnen, grünwerdende Hexe, Teufelsbrut, Amphibienwesen, Quarkzerdrücker, Drahthündin, sittsamer Engel …
Schakalaffe, Datterratte, Dattelhacke, Katzenjammer …«
In äußerster Eile niedergeschrieben, wechseln bald verständliche Ausdrücke mit scheinbar sinnlosen Wortbildungen, »Neologismen« ab »kaleppo mamaro poente, dringilo untiki intresso, grinizzo putewi malaki, kanindon garku och nich drin … tatiwi meifei geileimairaischmeiß die Eier weg geil nein heiter dein einziger Heinrich Meierdreizehn Schweinereien nein kein einziger zeigt seine Eier Heinrich Schwein schwänzchen ein meier heißt meier deizi deizi … heck dreck weg meck eck geck zeck schmeck mal weg du geck keck den zeck mal weg keck keck so’n Gag … Ich möchte mal mit Dir, und du mit mir? Hier, hier. Vielleicht um vier? So sagen wir. Schmier, schmier! Naja, hier ist mir nicht vier. Geh’n wir! So ist’s dir und ihr? Trink’n wir hier ein Bier! … Dring in sie, sie will nicht viel …«
In der Hoffnung auf einen anderen, verstehenden Vater in der Person des Therapeuten konnte das bisher Unterdrückte zum Leben kommen, und nun wurde der neue Vater auf die Probe gestellt. Dieser bestand aber wie der frühere auf der Leistung, die die Krönung seiner therapeutischen Bemühungen sein sollte und auch schließlich wurde. Denn der junge Mann wollte diesen Vater nicht verlieren, wie er damals als Kind den seinen nicht verlieren wollte. Aber wenn meine Vermutung stimmt, daß mit dieser endlich erbrachten Leistung ein Schriftsteller begraben wurde und daß die früheste Vater- bzw. Mutterbeziehung, die auf die Person des Therapeuten übertragen wurde, ungelöst geblieben ist, dann wird sich das später in den Depressionen des Patienten zeigen müssen. Damit werden die sozialen Erfolge der Therapie von Thomas nicht angezweifelt. Was ich hier versuche, betrifft einen ganz anderen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich weiß, wieviele Menschen mit erfolgreichstem Studienabschluß und dergleichen an schweren Depressionen leiden.
Obwohl Thomas kein orthodoxer Freudianer ist und, Karin Horney bestätigend, schreibt, er hätte bei keinem seiner 5 000 Selbstmordgefährdeten den »Todestrieb« gefunden, bleibt er doch vom Freudschen Triebkonzept nicht unbeeinflußt. An einem andern Beispiel aus seinen Therapien kann man sehen, wie sehr dieses Konzept das Vertrauen zum Patienten behindern und dessen Artikulierung des frühen Traumas erschweren bzw. blockieren kann:
Beispiel für eine Selbstanalyse voller Affekte und Ambivalenzen
Beschwerden und Befunde: Eine 25jährige Kunststudentin meldet sich nach einem Selbstmordversuch auf eine Fernsehsendung hin. Zunächst berichtet sie nur von ihren Studienschwierigkeiten: »Ich kann einfach nichts behalten«. Bald aber auch von erheblichen neurotischen Beschwerden: »Ich leide unter einem Zählzwang, – meist muß ich aber nur bis zwei zählen, z. B. beim Laufen, beim Saubermachen usw. fast militärisch ›eins-zwei, eins-zwei, eins-zwei‹.« Ihre Onychophagie, ihr Nägelknabbern, hat extreme Formen angenommen: alle Fingernägel sind seit ihrer Kindheit bis zu teilweise verschorften Stümpfen abgekaut. »Selbst im Zimmer muß ich meist Handschuhe tragen, und selbst an denen kaue ich noch oft die Spitzen ab«, ein nur allzu beredtes Zeichen ihrer heftigen Aggressionen. Mit dieser Form der Selbstverstümmelung erhalten auch ihre in der Kindheit verwurzelten Minderwertigkeitsgefühle ständig neue Nahrung. Obwohl sie weit überdurchschnittlich hübsch und attraktiv aussieht, klagt sie unablässig über ihre Häßlichkeit. Als früheste Kindheitserinnerungen schreibt sie darum in der Selbstanalyse auf: »Ich habe ständig abends und nachts gebetet: Lieber Gott, laß mich hübsch werden!«
Diagnose: Aus diesen und vielen anderen Symptomen ergibt sich als erste Diagnose das eindeutige Bild einer Kernneurose mit sekundärer, gehemmter, mittelschwerer Depression, mit vielfältigen anankastisch-phobischen Zuständen (Zwangs- und Angsterscheinungen) mitLiebes- und Familienkonflikten sowie mit erheblichen Nikotinabusus (sie raucht über 50 Zigaretten täglich).
Therapieplan: In enger Verbindung mit dem für die Studenten zuständigen Universitätspsychiater, der eine volle Psychoanalyse ebenfalls für erforderlich, aber aus äußeren Gründen für undurchführbar hält, beginnen wir zunächst mit der Selbstanalyse sowie unterstützend mit pharmakopsychiatrischer Behandlung.