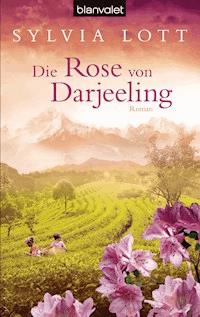10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kleine Villa auf Borkum, duftende Wicken und zwei Liebesgeschichten in bewegten Zeiten …
England 1911: Ein Wettbewerb der Daily Mail um den schönsten Wickenstrauß euphorisiert das Land. Auch die junge Anni nimmt teil und träumt davon, mit dem Preisgeld die Welt zu bereisen. Lord John Ramsgate, verlobt mit der Tochter ihres Arbeitgebers, berichtet über den Contest. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege … Borkum 2024: Marieke ist nun geschieden und in ein Insulanerhäuschen gezogen. Am Giebel prangt in altmodischer Schrift »Villa Cupani«. Von Nachbarin Alwine erfährt sie, was es damit auf sich hat – einst lebte hier eine Frau namens Anni, die in England ihre Liebe zu Duftwicken entdeckte …
Sie mögen großartig recherchierte Sagas mit schönem Setting?
Dann lesen Sie auch die anderen Romane von SPIEGEL-Bestsellerautorin Sylvia Lott!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
England 1911: Ein Wettbewerb der Daily Mail um den schönsten Wickenstrauß euphorisiert das Land. Auch die junge Anni nimmt teil und träumt davon, mit dem Preisgeld die Welt zu bereisen. Lord John Ramsgate, verlobt mit der Tochter ihres Arbeitgebers, berichtet über den Contest. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege …
Borkum 2024: Marieke ist nun geschieden und in ein Insulanerhäuschen gezogen. Am Giebel prangt in altmodischer Schrift »Villa Cupani«. Von Nachbarin Alwine erfährt sie, was es damit auf sich hat – einst lebte hier eine Frau namens Anni, die in England ihre Liebe zu Duftwicken entdeckte …
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg und im Ammerland. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane, die regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Die Autorin liebt es, auf ihren Lesungen, die immer etwas ganz Besonderes sind, mit ihren Leser*innen in Kontakt zu treten. Nach der Erfolgsreihe rund um den »Inselsalon« legt sie nun mit »Duftwickensommer« ihren neuen Stand-alone vor.
SYLVIA LOTT
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Adobe Stock (Benno Hoff, Pixel62, MrGraphics1990, ЕленаНечипоренко, lamax, arxichtu4ki)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
LH· Herstellung: DiMo
ISBN 978-3-641-32694-4V003
www.blanvalet.de
Man sollte sich darauf einstellen, sein Leben unzählige Male ganz von vorn zu beginnen.
Credo der Komponistin und Frauenrechtlerin Ethel Smyth (1858–1944)
Borkum, Juli 2024
Das Fenster schlug mit einem heftigen Knall zu, und Marieke blickte von ihrem Laptop hoch. Offenbar hatte sie die Auflockerung der Wolkenberge zu optimistisch gedeutet. Es goss ja auch seit Tagen ununterbrochen – die stürmischen Böen flauten nicht ab, nur weil mal ab und zu kurz die Sonne durchkam.
Sie schloss das Fenster der ehemaligen Frühstücksveranda, jetzt eine Mischung aus Arbeits- und Esszimmer. Dabei registrierte sie, dass am Gartenzaun ein Mann stand und interessiert das Rankzeug betrachtete, das sich um den verwitterten Holzzaun schlang, der ihren verwilderten Vorgarten begrenzte. Er passte zum Stil des Hauses, wirkte schön nostalgisch, doch einige Latten wackelten. Ich hab nicht mehr alle Latten am Zaun, dachte sie und musste kurz auflachen. So sieht’s aus, ist doch irgendwie auch romantisch. Aber ihr Bedarf an Romantik war gedeckt, ein für alle Mal.
Feststellhaken Fenster Veranda notierte sie unten auf einer schon ziemlich vollgeschriebenen Karteikarte mit Stichpunkten für Reparaturen an der Villa Cupani. Seit Monaten arbeitete sie die To-do-Liste ab, strich durch, übertrug Woche für Woche Unerledigtes auf eine neue Karte. Trotzdem wurde die Liste nicht kürzer. Es war schwierig, Handwerker zu bekommen. Aufseufzend fügte sie hinzu: Zaunlatten befestigen und streichen!
Die Nachrichten, die gerade im Radio verlesen wurden, waren alles andere als aufmunternd. Schon wieder trieben regenschwangere Wolken vor die Sonne. Warum zum Teufel hatte sie sich von ihrer Abfindung nach der Scheidung nicht eine moderne, pflegeleichte Wohnung auf Mallorca oder Ibiza gekauft? Warum ein Insulanerhäuschen mit Reparaturstau ausgerechnet im rauen Nordseeklima auf Borkum? Weil du hier am glücklichsten gewesen bist als Kind in den Ferien bei Oma und Opa, gab sie sich tonlos zur Antwort. Weil du dich damals so wunderbar frei gefühlt hast und dieses Gefühl zurückhaben willst.
Der Mann draußen – sie schätzte ihn auf Anfang bis Mitte vierzig – ging jetzt in die Knie, um das Grünzeug näher zu betrachten. Er fotografierte es sogar. Komischer Vogel.
Gedankenverloren wandte sie sich wieder ihrem Laptop zu. Vor einer Stunde hatten sie und die Zwillinge sich per Facetime zu einer kleinen Familienkonferenz zusammengeschaltet und viel gelacht. Ihre Tochter Neele studierte in Münster Kunstgeschichte, hübsch hatte sie ausgesehen, etwas rundlicher als sonst, was ihr stand. Ihr Sohn Jonas, der ein Jahr lang als Backpacker durch Australien zog, hatte sehr witzig von seinem letzten Farmstay mit Schafen erzählt. Beiden ging es gut. Das war das Wichtigste. Alles andere würde sich finden. Ihre Erschöpfung würde vergehen, genau wie ihre Traurigkeit. Und dass sie sich isolierte, obwohl sie jetzt manchmal eine nie gekannte Einsamkeit verspürte, mit schmerzhafter, geradezu metallischer Kälte, auch das würde vergehen. Irgendwann würde sich das Gefühl von Freiheit schon einstellen.
Wenigstens war sie jetzt nicht mehr eingesperrt – und nicht mehr abhängig von Gisbert Kröner, Bauunternehmer in Oldenburg. Aus rosaroten Träumen erwacht, hatte sie spät, aber nicht zu spät, nach einem zermürbenden Ehefinale ihr Leben selbst in die Hand genommen. Sie ließ sich nicht mehr einlullen, einschüchtern und betrügen.
Marieke öffnete per App ihr Aktiendepot. Beruhigend – grüne Zahlen überwogen, das bedeutete Gewinn. Alles in allem konnte sie doch wirklich zufrieden sein mit der Entwicklung. Den Rest ihrer Abfindung hatte sie bei einem Neobroker in Wertpapieren angelegt. Und in Gold. Früher hatte sie gern historische Romane gelesen, deshalb war sie überzeugt gewesen, dass sich in Krisenzeiten stets Gold als Währung behaupten würde. Der Experte ihrer Hausbank hatte ihr zuvor jedoch dringend von Gold abgeraten und stattdessen Fonds seiner Bank angepriesen. Gold wirft doch keine Rendite ab, hatte er verächtlich gesagt. Seine Hochnäsigkeit und die Höhe der verlangten Provisionen hatten sie so geärgert, dass sie ihm abgesagt und sich selbst schlaugemacht hatte, auch mithilfe einer Gruppe gleichgesinnter, an Finanzthemen interessierter Frauen, mit denen sie schon während ihrer Ehe online verbunden gewesen war. Sie hatte viel gelesen über Aktien, ETFs und Anlagemöglichkeiten und bald begriffen, dass solche Geldgeschäfte kein Hexenwerk waren.
Mittlerweile war der Goldkurs deutlich gestiegen. Das wiederum bedeutete, dass sie nicht gezwungen war, sofort Geld zu verdienen. Sie konnte sich überlegen, ob sie weiter als schlecht entlohnte Ratgeberautorin für ein Internetportal arbeiten oder vielleicht im Häuschen ein oder zwei Appartements herrichten wollte, um sie an Feriengäste zu vermieten. Aktuell hatte sie weder zum einen noch zum anderen Lust. Sie klappte ihren Laptop zu und schaute wieder zum Fenster. Kurz sah sie ihre eigene Spiegelung. Eine Frau von Anfang vierzig, weder dick noch dünn, mit schulterlangen dunkelblonden Haaren, vollen Lippen, blauen Augen und einem leichten Silberblick, der wirklich nur manchmal ein bisschen auffiel und von freundlichen Menschen als sexy beschrieben wurde.
Aus dem Radio dudelte ein alter Song – »No Doubt About It!« Wie herrlich schwelgerisch, losgelöst von Zweifeln und Niedergedrücktheit das klang, so ein Gefühl hätte sie gern mal wieder, doch davon war sie Lichtjahre entfernt. Seit dem Umzug litt sie an Rückenschmerzen und Energiemangel. In der ersten Woche nach ihrer Ankunft auf der Insel war sie so erschöpft gewesen, dass sie eine vom Teller halb unters Sofa gerollte Cocktailtomate nicht hatte aufheben können. Eine Woche lang hatte sie zugesehen, wie sie Tag für Tag weiter zusammenschrumpelte. Dann erst war es ihr gelungen, sich hinunterzubeugen, um sie endlich zu entsorgen. So was durfte man keinem Menschen erzählen.
Marieke strich sich das Haar zurück und sah erneut nach draußen. Der Mann stand noch immer am Zaun, sein Blick wechselte vom Handy zur Pflanze und zurück. Was mochte ihn so faszinieren?
Neugierig trat sie hinaus. »Moin«, sagte sie lächelnd mit einem leicht ironischen Unterton, als sie die Stufen vom überdachten Eingangsbereich hinunter in den Vorgarten ging. »Was gibt’s denn da Spannendes?«
»Wissen Sie, was Sie hier für Schätzchen haben?«, fragte der Unbekannte, ohne ihren Gruß zu erwidern, und zeigte begeistert auf einige lilafarbene Blüten, die ein bisschen aussahen wie kleine Schmetterlinge.
Marieke hob die Augenbrauen. »Sind das Wicken?«
»Ja. Allerdings keine gewöhnlichen«, antwortete er. Groß, gute Figur, registrierte sie. Rotblondes Haar, sympathische Gesichtszüge, aber rote Haare, nee, sie stand auf dunkelhaarige Typen. Wie seltsam, dass dieses »Kommt er als Partner infrage?«-Abcheckprogramm noch immer blitzschnell in ihrem Hinterkopf ablief, obwohl sie weiß Gott kein Interesse daran hatte, eine neue Beziehung einzugehen. Vermutlich war das genetisch, und man konnte nichts dagegen tun. Der Fremde wäre ja auch überhaupt nicht ihr Fall. Bei rothaarigen Menschen stellte sie sich immer vor, dass sich ihre Haut kühl und leicht feucht anfühlte. Beinahe hätte sie sich geschüttelt. Woher kam diese Assoziation? Vermutlich hing sie mit der Erinnerung an eine rothaarige Mitschülerin zusammen. Deren Haut, die weiß und glatt wie Marmor schien, hatte sie einmal unabsichtlich nach dem Sport berührt – schweißbedeckt und kühl war sie gewesen. Der kurze Kontakt hatte sie erschaudern lassen. »Das ist eine historische viktorianische Duftwicke«, sagte der Mann strahlend, als hätte er soeben einen Preis gewonnen.
»Aha«, erwiderte sie etwas ratlos.
Er ging erneut in die Hocke. »Die Blüten sind kleiner, duften aber viel intensiver als die üblichen Sorten. Riechen Sie mal!«, forderte er sie auf und schnupperte dann selbst verzückt mit geschlossenen Augen an einer Blüte.
Marieke musste auf die andere Seite des Zauns wechseln. Sie beugte sich neben ihm hinunter, sog den Duft ein. Ja, doch … sehr angenehm. Lieblich, süß, blumig-duftig, vornehm, intensiv, ohne aufdringlich zu wirken. Feminin. Ein wenig altmodisch und … schwer in Worte zu fassen … wie ein schwebendes Versprechen …
»Wirklich etwas Besonderes«, gab sie ihm recht. »Ich konnte ja nicht ahnen, dass so eine Rarität in meinem Garten wächst.«
Dann fiel ihr ein, dass Neele im Frühjahr ein paar aus Schreibmaschinenpapier gefaltete Tüten voller Samen im Gartenhäuschen aufgestöbert und ausgesät hatte. Vermutlich stammten die Wicken daher. Dass sich bereits erste Knospen geöffnet hatten, war ihr völlig entgangen.
»Blühen sie denn das erste Mal bei Ihnen?«, wollte der Mann wissen, während er sich wieder aufrichtete.
»Keine Ahnung.« Sie erhob sich ebenfalls. Er überragte sie um einen halben Kopf. »Ich bin erst Anfang des Jahres hier eingezogen und noch nicht dazu gekommen, mich richtig mit dem Garten zu beschäftigen.«
Die dominierenden Hortensienbüsche stellten keine Ansprüche und gediehen in herrlichen Farbnuancen von Blau über Lila bis hin zu Rosa. Bei ihrem Anblick musste sie immer an Rilkes Sonett Blaue Hortensie denken.
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau,
hinter den Blütendolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln.
Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist Gelb in ihnen, Violett und Grau.
Nachdenklich blickte sie auf das rankende Erbsengrün. »Aber selbst wenn«, fügte sie hinzu, »hätte ich wohl kaum erkannt, dass hier eine Besonderheit blüht. Wie heißt sie noch?«
»Das ist eine historische viktorianische Duftwicke, Lathyrus odoratus.«
Oje, ein Fachidiot, dachte sie. Allerdings war nicht zu übersehen, dass unter seiner dünnen Windjacke ein trainierter Körper steckte.
»Woher wissen Sie das?«
»Ich bin Biologe und auf der Insel, weil eine Urlauberin uns … Also, ich bin unter anderem für den Nationalpark Wattenmeer tätig und erforsche den aktuellen Bestand seltener Wildpflanzen, und eine aufmerksame Borkum-Besucherin hat uns eine Strand-Platterbse gemeldet. Lathyrus japonicus maritimus. Meint sie jedenfalls.«
»Oh«, bemerkte Marieke belustigt, »noch ein Lathyrus.«
»Ja. Doch ich bezweifle, dass es sich wirklich um den Lathyrus japonicus maritimus handelt. Die Dame hat leider kein Foto gemacht. Wahrscheinlich ist es nur ein Lathyrus sylvestris, die Wald-Platterbse.«
»Wald ist doch hier auf der Insel eher selten«, wandte sie ein.
»Trotzdem«, beharrte er. »Die Wald-Platterbse gilt als ungefährdet.«
»Sie sind also Lathyrus-Experte.« Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Was es doch für seltsame Interessen gab! »Haben Sie die gemeldete Sichtung denn noch nicht überprüft?«
»Bin erst gestern angekommen.«
Sie nickte verständnisvoll. »Das Wetter war ja nicht allzu gut. Hoffentlich bleibt Ihnen noch genügend Zeit vor dem nächsten Wolkenbruch.«
»Ich verbinde diesmal Recherche mit Urlaub.«
»Wie schön. Ich nehme an, dass es sich dann bei der Strand-Platterbse … Wie hieß sie noch gleich? Lathyrus …«
»… japonicusmaritimus …«
»… um die wertvollere oder seltenere Sorte handelt?«
»Spezies beziehungsweise Subspezies oder Varietät …«
»Ach, Entschuldigung. Sagen wir einfach Spezies.«
Jetzt musste er lächeln. »Richtig. Sie ist gefährdet und muss deshalb besonders geschützt werden. Registriert haben wir sie bislang nur weiter westlich, auf Wangerooge, aber nicht auf Borkum.« Sein Blick fiel auf die Fassade ihres Hauses, wanderte zum Giebel in der Mitte mit dem altmodischen Schriftzug Villa Cupani, der sich im geschliffenen Glas der Eingangstür wiederholte. Sein Lächeln vertiefte sich. »Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die viktorianischen Duftwicken schon länger zu Ihrem Haus gehören.«
»Wieso das?«, wollte sie wissen.
In diesem Moment bewegte sich etwas auf dem angrenzenden Grundstück, der weiße Schopf ihrer Nachbarin Alwine lugte zwischen üppigen, blau blühenden Hortensien hervor.
»Moin!«, rief Marieke ihr zu.
»Moin, woar geiht? Ist ein gutes Jahr für Hortensien, nicht? Und die blauen sind dies Jahr besonders blau, finde ich.«
»Danke, ja, aber wir entdecken gerade ganz andere, seltene Blümchen.«
Alwine, Mitte siebzig, Urinsulanerin, kam näher. Ihr verstorbener Mann hatte einen Klempnereibetrieb besessen. Sie war für die Buchhaltung zuständig gewesen, obwohl sie eigentlich lieber als Lehrerin gearbeitet hätte. Doch sie hatte ihr Studium nicht beendet. Alwine war nett und hilfsbereit, aber Marieke mied sie, weil sie gerne weitschweifig von früher erzählte. Und weil sie eine von diesen vielseitig interessierten älteren Frauen war, die einen, bei jeder Antwort schamlos nachhakend, in null Komma nix ausquetschen konnten. Sie hatte nicht vor, ihr Details über ihre gescheiterte Ehe anzuvertrauen, und ging deshalb normalerweise auf Distanz. Außerdem besaß ihre Nachbarin eine recht freigeistig erzogene, kläfffreudige Promenadenmischung – halb Schnauzer, halb Windhund – namens Lucky, die ihr suspekt war.
»Also … die Duftwicken müssten schon länger zu Ihrem Haus gehören, weil ›Villa Cupani‹ dran steht«, erklärte der Mann unbeeindruckt von der Unterbrechung.
»Das kann ich nicht ganz nachvollziehen«, sagte Marieke. »Was hat denn der Name damit zu tun?«
Ihre Vermutung war, dass irgendein Vorbesitzer, wahrscheinlich der Erbauer, Cupani geheißen hatte. Schriftzug am Giebel ersetzen lautete denn auch einer der To-do-Punkte, die sie regelmäßig auf ihre Karteikarten übertrug. Da ihr die Gravur im Glas der Originaleingangstür aber sehr gut gefiel, hatte sie den Punkt noch nicht in Angriff genommen, denn es war etwas unlogisch, den Namen oben zu verändern und ihn unten stehen zu lassen. Außerdem gab’s Wichtigeres.
Sie überlegte. Der Name des alten Ehepaars, das ihr das Haus nur verkauft hatte, weil sie auch selbst darin wohnen wollte, war Akkermann. Sie hatten ihr den Zuschlag vor einem Investor gegeben, der vorgehabt hatte, das Haus komplett in Ferienwohnungen umzuwandeln.
»Seltene Blümchen? Ach, die Wicken!«, rief Alwine schwärmerisch dazwischen. Ihre auffälligen Ohrringe, handgefertigte kleine Wale, baumelten heftig hin und her. »Früher blühten die in tollen Farben am Zaun oder an Spalieren vorm Haus, den ganzen Sommer über … Und wie das immer geduftet hat!«
»Moin«, grüßte nun auch der Fremde. »Cupani«, erklärte er, »hieß der sizilianische Mönch, der um 1700 herum als Erster wild wachsende Duftwicken botanisch erfasst und ihre Samen an Fachleute nach England geschickt hat. Das scheint mir kein Zufall zu sein. Diese Sorte sieht aus wie die nach dem Mönch benannte.«
»Ach«, Marieke staunte, »das klingt ja interessant.« Kulturgeschichte faszinierte sie weit mehr als Biologie.
»Natürlich, das sind Annis Wicken«, erklärte Alwine, die sich neben sie stellte, mit größter Selbstverständlichkeit. Sie trug neuerdings einen Undercut. Unter dem längeren Deckhaar war ihr weißes Haar raspelkurz geschnitten. Sehr gewagt. »Anni lebte hier, bevor die Akkermanns eingezogen sind. Sie ist über neunzig geworden. Ich hab als junge Frau oft für sie eingekauft, als sie stockelig wurde, und sie hat mir immer von damals erzählt, von vor dem Ersten Weltkrieg. Da war sie als Vorleserin bei einer Teegroßhändlerfamilie in England gewesen. Die Leute drüben lieben ja Wicken. Früher jedenfalls war das so.« Als käme jetzt erst der Clou, holte sie tief Luft, bevor sie weitersprach. »Anni hat ihren Tick für Wicken aus England mitgebracht, nach der Geschichte mit diesem Wahnsinnswettbewerb. Die ganze Nation hat damals verrücktgespielt, sagte Anni.«
»Wettbewerb? Was für ein Wettbewerb war das?«, fragte Marieke.
»Ich hab noch alte Zeitungsausschnitte«, verriet Alwine. Ihre blauen Äuglein blitzten. »Und ein kleines Buch, in London gedruckt. Bloß … mein Englisch ist nicht so doll …«
»Dürfte ich die Artikel und das Buch mal sehen?«, bat der Fremde. »Mein Name ist übrigens Tammen, Dr. Tibo Tammen, ich bin Dozent an der Uni Oldenburg.«
»Ja, sicher«, antwortete Alwine verschmitzt. »Wenn ihr Zeit habt, dann kommt mal eben mit. Wir setzen uns in die Gartenlaube. Heut regnet’s nicht mehr. Ich mach uns einen schönen Tee, und dann gucke ich, wo ich die Sachen finde.« Lucky kläffte, als sie rüberkamen. »Das muss er machen«, erklärte Alwine zufrieden, »das ist sein Job als Wachhund. Gut gemacht, Lucky. Die sind in Ordnung.«
Er beschnupperte die Eindringlinge, akzeptierte sie offenbar als Besucher und damit war seine Begrüßung beendet.
Eine halbe Stunde später knisterte der Kandis in kleinen, mit Ostfriesenrosen bemalten Tassen, und Alwine wischte den Staub von einer Schatulle aus brüchigem Kunstleder, bevor sie sie öffnete. Lucky lag friedlich zu ihren Füßen.
»Entschuldigung. Aber die stand jahrelang hinten im Schrank.« Ein muffiger Geruch nach altem Papier stieg ihnen in die Nase. Obenauf lag ein getrocknetes Sträußchen mit Seidenschleife. »Dünenveilchen«, kommentierte Alwine. Ihnen entströmte noch ein Hauch von strohiger Süße. Vorsichtig entnahm sie der Schatulle ein Büchlein und reichte es Dr. Tammen.
»How to Grow Sweet Peas«, las er vor, schlug es andächtig auf und blätterte etwas darin. »Das ist ein Ratgeber, wie man Wicken zieht. Aus dem Jahr 1909.«
»Sweet Peas?«, wiederholte Marieke. »Süße Erbsen?«
»Ja, so heißen sie auf Englisch.«
»Nicht Lathyrus?« Sie wollte Dr. Tammen ein bisschen aufziehen.
»Das ist Lateinisch«, erwiderte er trocken.
Alwine förderte unterdessen die Zeitungsartikel zutage. Sie stammten aus dem Jahr 1911.
»Womit geht’s los?«, murmelte sie mehr zu sich selbst, sichtete die Erscheinungsdaten und ordnete die Berichte chronologisch. »Ich mein’, ich hätte noch ein paar. Aber wo?« Es handelte sich ausschließlich um vergilbte Ausschnitte aus der Tageszeitung Daily Mail.
Marieke lehnte sich zurück und genoss den heißen Ostfriesentee. Kurz dachte sie daran, dass sie sich gegen sieben für ein Telefonat mit Gardon verabredet hatte. Das wollte sie nicht versäumen. Gardon, ihr bester Kumpel seit der Einschulung, lebte als Orthopäde und Familienvater in Hamburg. Er war der einzige Mensch, der von ihr das wusste, was sie so für sich als ihr dunkles kleines Geheimnis bezeichnete. Die Gespräche mit ihm halfen ihr, besser damit klarzukommen. Sie schaute auf ihr Handy – bis sieben Uhr waren es noch fast zwei Stunden.
»Ich glaub, jetzt hab ich’s«, verkündete Alwine. »Das Ganze dauerte von Februar bis Juli 1911, langsam erinnere ich mich wieder. Und es begann mit diesem Zeitungsaufruf.«
Willow Hill, Februar 1911
Es roch nach Rühreiern mit Schnittlauch, Toast und etwas nach angesengtem Löschpapier. Anni war gerade noch pünktlich. Das übrige Personal wartete schon darauf, am großen Frühstückstisch Platz zu nehmen. Unauffällig versuchte sie, eine Strähne, die sich aus ihrem doppelt verschlungenen Haarknoten im Nacken gelöst hatte, wieder festzustecken. Die hagere Haushälterin Mrs. Pennymore musterte sie streng, die Köchin Mrs. Tufts dagegen lächelte wie ein Glücksferkel. Anni hatte die Treppenstufen hinunter in den Aufenthaltsraum der Dienstboten wie immer recht sportlich genommen. Ihr glänzendes kastanienbraunes Haar war aber auch zu schwer zu bändigen, da geriet jede Frisur leicht in Unordnung. Rasch prüfte sie mit der Linken den Sitz der Haartolle, die sie über der Stirn und an den Schläfen hochgesteckt hatte.
Mit dem Frühstücken mussten sie allerdings warten, was ungewöhnlich war, denn der Butler Mr. Jones fehlte noch. Er stand am Bügelbrett und hatte, wie stets um diese Zeit, bereits die Times für Mr. Moss gebügelt. Etwas, worüber Anni jeden Morgen innerlich schmunzelte, seit sie anderthalb Jahre zuvor aus Deutschland nach England gekommen war, um als Vorleserin für die alte Mrs. Moss tätig zu sein. Wie sie inzwischen gelernt hatte, glättete Mr. Jones die Tageszeitung nicht etwa, weil er seinem Herrn kein zerknittertes Papier zumuten mochte, sondern weil er damit die Reste von Druckerschwärze austrocknete, die sonst möglicherweise die Kleidung der Lesenden hätten verschmutzen können. An diesem Morgen bearbeitete der Butler allerdings noch eine weitere Tageszeitung, die Daily Mail. Und zwar mit sehr spitzen Fingern und einer Miene, die keinen Zweifel daran ließ, was er von diesem Boulevardblatt hielt.
Mr. Jones war vornehmer als sein Arbeitgeber. Der Teegroßhändler Charles Moss junior galt als sehr vermögender Mann, aber er gehörte nicht zum Adel. Sein Großvater hatte es als Emporkömmling durch den Import von Assam- und Ceylon-Tees zu Wohlstand gebracht, das hatte Anni verschiedenen Gesprächen entnommen. Dem Enkelsohn war es dann gelungen, den Teehandel zu einem Imperium auszubauen, doch fehlte ihm der Schliff einer seit Jahrhunderten regierenden nobilitierten Oberschicht. Deshalb leistete er sich wenigstens einen Butler, der in ersten Häusern der Peerage gedient hatte.
»Ach«, entfuhr es Mr. Jones. Offensichtlich fasziniert las er den Aufmacher des Massenblatts. »Tausend Pfund!«
Der Geruch nach erhitztem Papier wurde stärker. Alle blickten erwartungsvoll zu ihm hinüber, aber schon verschloss sich seine Miene wieder. Er nahm rasch das Eisen hoch und legte die Zeitung ordentlich zusammen. Anni konnte gerade noch erkennen, dass der Artikel etwas mit einer Wettbewerbsausschreibung für jedermann zu tun hatte. Während des Frühstücks schnitt Mr. Jones das Thema bedauerlicherweise nicht an, und obwohl sie vor Neugier beinahe platzte, hielt sie sich mit Fragen zurück. Es wäre ungehörig gewesen, ihn auf den Artikel anzusprechen.
Den ganzen Vormittag über hörte Anni es hier und dort tuscheln, sie schnappte allerlei Andeutungen auf. Offenbar hatte auch der künftige Schwiegersohn, Lord John Ramsgate, etwas mit dem Wettbewerb zu tun. Er war mit Mr. Moss’ einziger Tochter, der attraktiven Rosabel, verlobt. Sie war ein Jahr älter als Anni. Lord Ramsgate und der Verleger Lord Northcliffe, dem sowohl die Times als auch die Daily Mail gehörten, wurden am Abend zum Essen erwartet. Aber was genau es mit dieser Ausschreibung auf sich hatte, konnte sie nicht in Erfahrung bringen.
Rosabel ließ sich drei verschiedene Abendkleider vorlegen. Die Entscheidung fiel ihr schwer. »Was meinen Sie, Duncan?«
Aber wie immer konnte die Zofe ihr natürlich keine echte Hilfe sein. Was sollte das altjüngferliche Wesen auch wissen von den Feinheiten der Koketterie? Rosabel freute sich auf John. Sie war verliebt in ihren Verlobten, wie sie noch nie in einen Mann verliebt gewesen war. Er sah fantastisch aus, und ihm stand eine blendende Karriere bevor. Außerdem betete er sie an. Schöner konnte das Leben kaum sein.
Rosabel hielt sich ein weiß-rosa gestreiftes Taftkleid mit mittelgroßem Dekolleté vor. Sie liebte die Kombination von Rosa und Weiß. Wenn man schon Rosabel hieß, verpflichtete das geradezu. Ihr Schlafzimmer und der angrenzende Salon waren fast vollständig in diesen Farben gehalten. Mit einer Rose in den goldblonden Locken würde das gestreifte Kleid ihr den Liebreiz einer anmutig errötenden Jungfrau verleihen, allerdings würde sie den ganzen Abend bissige Bemerkungen herunterschlucken müssen, weil die nicht zur romantischen Aufmachung gepasst hätten. Doch John schätzte auch bei Frauen hier und da einen pointierten Kommentar.
Unschlüssig warf sie das Kleid aufs Bett und griff nach der zweiten Möglichkeit. Dunkelgrüne Seide mit Raffungen, die schmeichelnd ihre Rundungen betonten. Sie hob das helle Grün ihrer Augenfarbe hervor. Erst neulich hatte sie diese Robe für eine Opernpremiere anfertigen lassen. Darin wirkte sie reifer.
»Vielleicht doch etwas zu theatralisch für ein Dinner?«, überlegte sie laut.
Duncan nahm ihr das Kleid ab. Blieb noch das hellblaue aus perlenbesticktem Seidensatin mit überschnittenen Ärmeln und V-Ausschnitt. Spielerisch hielt Rosabel sich das Gewand vor. Je nachdem, wie weit sie sich vorbeugte, konnte sie scheinbar beiläufig tiefere Einblicke gewähren. Und der Seitenschlitz erlaubte es, ihre schlanken Fesseln zu zeigen. Sie wusste, wie sie John – und andere Männer – konfus machen konnte. Ob sich an diesem Abend die Gelegenheit für ein paar Minuten zu zweit finden würde? Kribbelig wiegte sie sich mit dem vorgehaltenen Kleid vorm Spiegel hin und her.
»Erstaunlich, dass Ihre Augenfarbe sich zu verändern scheint, Miss Rosabel«, sagte Duncan bewundernd. »Jetzt ist sie plötzlich hellblau.«
»Suchen Sie mir bitte hierzu den passenden Schmuck und Schuhe heraus«, bat Rosabel.
Das hatte sie bereits gelernt. Eine wahre Lady, und sie würde eines nicht so fernen Tages eine echte Lady sein, war immer so höflich, dass sogar die Dienstboten untereinander ihre liebenswürdige Art rühmten. Bald würden auch endlich die alten Schreckschrauben aus dem hohen Adel, die darüber entschieden, wer dazugehörte, sie nicht länger nur mit dem Vornamen anreden und ihr zur Begrüßung statt zwei Fingern drei hinhalten.
Im Kamin knackte es behaglich, Katherine Moss spürte das weiche Leder ihrer Armlehnen unter den Fingerspitzen und auf den Knien die Wärme, die ihnen das Kaschmirplaid schenkte. Ganz entspannt, mit geschlossenen Augen, lauschte sie dem Klang von Annis Stimme. Einer Stimme, die man vom ersten Satz an ernst nahm. Angenehm klar, warm, dunkel, sicher, geradezu furchtlos und, erstaunlich für eine so junge Frau, von großer Modulationsbreite. Auch ihr Anblick war angenehm, sie wirkte sauber und adrett, ihre wachen bernsteinfarbenen Augen schauten meist freundlich. Sie hatte wirklich Glück gehabt mit diesem Fräulein aus Deutschland.
Katherine Moss liebte es, die deutschen Klassiker im Original zu hören. Seit einigen Wochen arbeiteten sie sich nun durch das Werk des Schriftstellers E. T. A. Hoffmann. Es brauchte Verstand und Sinn für Humor, um dessen Ironie zu vermitteln. Anni gelang es. Gerade trug sie die Stelle aus den Lebensansichten des Katers Murr vor, an der sich der selbstzufriedene dicke Kater darüber beklagte, dass ihm kein Redakteur oder Verleger zutraue, ein Buch zu schreiben, nur weil er eben ein Kater sei.
»O Vorurteil, himmelschreiendes Vorurteil, wie befängst du doch die Menschen, und vorzüglich diejenigen, die da heißen Verleger!« Ein Giggeln entwich ihrer Vorleserin.
Erstaunt öffnete Katherine die Augen. Anni lächelte schuldbewusst. Normalerweise enthielt sie sich, wie es ihre Aufgabe war, aller kommentierenden Äußerungen.
»Nun?«, forderte sie die junge Frau auf. »Was erheitert dich? Nur der eingebildete Kater oder steckt mehr dahinter?«
»Na ja …«
»Frei heraus!«
»Ist es nicht heute noch so?« Anni ließ das Buch in den Schoß sinken. »Das Buch ist vor fast hundert Jahren erschienen. Jetzt mal abgesehen davon, dass hier ein Tier als Schriftsteller auftritt, haben nicht einmal alle Menschen bis heute die gleichen Chancen, ein Buch zu veröffentlichen.«
»Wie meinst du das?«, fragte Katherine und hoffte, dass die Kleine jetzt nicht anfing, ein naives Plädoyer für die Arbeiterklasse zu halten.
»Die meisten Bücher stammen doch aus der Feder von Männern«, stellte Anni fest. »Und wenn Frauen mal einen natürlich männlichen Verleger überzeugt haben, ihr Werk zu veröffentlichen, dann wählen sie auch noch ein männliches Pseudonym, weil es heißt, sie müssten ihre Familie schützen.«
Bemerkenswert, dachte Katherine. Aber sie sagte: »So solltest du besser nicht allzu laut reden.« Anni nickte verlegen. »Du würdest wohl gern selbst schreiben, was?« Sie zwinkerte ihr zu.
Das Mädchen hätte das Zeug dazu. Auch wenn es Anni noch an Lebenserfahrung fehlte, waren ihre Schilderungen von Ausflügen plastisch und humorvoll – sie vermochte Menschen mit einem einzigen Satz zu charakterisieren.
Katherine wünschte sich, ihre Enkelin Rosabel hätte mehr vom Bildungshunger der jungen Deutschen und würde, statt nur von einem Ball bis zur nächsten Kleideranprobe zu denken, auch einmal tiefer sinnieren. Aber immer, wenn sie vorschlug, mit ihr zusammen Schiller oder Goethe zu lauschen, fand ihre Enkelin eine Ausrede. Vielleicht war sie selbst nicht ganz unschuldig an Rosabels oberflächlicher Art. Ihre Schwiegertochter, Rosabels Mutter, war früh gestorben, ihr Sohn, den sie erst im hohen Alter bekommen hatte, hatte nicht wieder geheiratet und für seine Tochter kaum Zeit gehabt. Seine ganze Leidenschaft galt der Firma, er gründete neue Filialen, entwickelte Teemischungen, suchte noch bessere Lieferanten. Den Rest seiner Begeisterungsfähigkeit widmete er Automobilen.
Einst waren sie und ihr verstorbener Mann die Hälfte des Jahres gemeinsam durch Indien gereist, von einem Teegarten zum nächsten. Sie kannte Darjeeling, Ceylon, Assam, den Duft von trocknenden Teeblättern, die Betriebsamkeit und Schwüle auf den Teeauktionen in Kalkutta. Herrliche freie Zeiten waren das gewesen, voller Anstrengungen, exotischer Eindrücke und menschlich bereichernder Begegnungen. Allerdings hatte sie ein übles Andenken mitgebracht – unberechenbare Malariaschübe, die sie manchmal tagelang außer Gefecht setzten. Und so hatte sie es versäumt, sich mehr um die Erziehung ihrer Enkeltochter zu kümmern. Als Einzelkind fehlte ihr auch das Regulativ der Geschwister.
Anni dagegen, Älteste von sieben Kindern, hatte früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Sie stammte aus einem Künstlerhaushalt. Die Eltern waren angeblich Freigeister, der Vater Maler in einem Dorf in der Lüneburger Heide nahe Hamburg. Annis Mutter, einst Pianistin, musste Klavierstunden geben, um die Familie über die Runden zu bringen. Man hatte ihr zugetragen, dass in diesem Heidedorf und drumherum Sommervillen reicher Hamburger standen. Deren geistiger Einfluss auf die Künstlerfamilie – und umgekehrt – sei nicht unbeträchtlich. Anni war ihr von einer deutschen Gouvernante als aufgeweckt, willig und formbar beschrieben worden. Eigentlich hatte sie unbedingt eine Vorleserin aus Hannover haben wollen, weil man dort bekanntlich das reinste Hochdeutsch sprach. Doch der Charakter des Menschen, der ihr täglich mehrere Stunden nahe sein würde, war letztlich wichtiger gewesen als eine akzentfreie Aussprache.
Vielleicht, überlegte sie weiter, hätte es gar nicht viel gebracht, wenn sie sich mehr um Rosabels Bildung bemüht hätte. Eine Veranlagung, kulturelles Interesse, war nun einmal da oder eben nicht. Aber dumm konnte man ihre Enkeltochter keineswegs nennen, sie war gewandt im gesellschaftlichen Umgang und noch dazu recht hübsch. Katherine durfte sich nicht beklagen.
»Ja«, gestand Anni nun ungewohnt schüchtern. »Ich würde gerne schreiben. Natürlich kein richtiges Buch. Noch nicht jedenfalls. Aber kleine Geschichten …« Sie schlug eine Hand vor den Mund und errötete, als hätte sie ein lange gehütetes Geheimnis preisgegeben.
»Schreiben kannst du ja. Zumindest für die Schublade«, antwortete Mrs. Moss mit milder Strenge. »Das übt.«
Annis Röte vertiefte sich. Aha, gewiss lagen dort schon einige Seiten. Natürlich wusste das Kind, dass eine Veröffentlichung unmöglich war.
»Bau deine Geschichten in die Briefe ein, die du nach Hause schickst«, schlug Katherine ihr vor. Verhalten lächelnd ließ sie den Blick durch die hohen, von goldfarbenen Damastvorhängen gerahmten Fenster hinaus zur Auffahrt schweifen. Der Park mit diversen Gartenräumen ging malerisch in eine sanft geschwungene Weidelandschaft über. Entlaubte Bäume reckten ihre Äste in einen blassblauen Himmel.
»Bitte lies …« Weiter kam sie nicht. Denn in diesem Augenblick sah sie einen Radfahrer, der sich die leichte Steigung auf dem Kiesweg direkt auf das Anwesen zukämpfte. Nein, es war überhaupt kein Mann! »Ach du meine Güte«, rief sie aus. »Ethel kommt zu Besuch! Wir müssen unsere Lektüre unterbrechen, meine Liebe. Geh nach unten, und bring du uns den Tee. Dann brauche ich nicht danach zu klingeln.«
Sie mochte Ethel, keine Frage. Aber die Gute war immer so anstrengend. Intensiv. Alles, was sie machte, artete ins Radikale aus. Schon als junges Mädchen hatte sie so lange getrotzt, bis ihr Vater ihr erlaubt hatte, in Deutschland Musik zu studieren. Das musste man sich mal vorstellen! Musik studieren. Als Frau. Und dann noch im Ausland.
Aber es hatte sich gelohnt. Ethel Smyth hatte sich einen Namen als Komponistin gemacht. Ihre Hymne für die Frauenbewegung war kürzlich beim Marsch der Suffragetten durch London auf der Pall Mall erstmals gesungen und bejubelt worden. Während ihres letzten Besuchs hatte Ethel ihr anvertraut, dass sie die Anführerin des radikalen Zweigs der Suffragetten, Emmeline Pankhurst, ab sofort zwei Jahre lang nach Kräften unterstützen wollte. Als Vollzeitunterstützerin sozusagen. Sie plante, ihre musikalische Karriere so lange ruhen zu lassen. Zweifelsohne betrieb Ethel gerade wieder Agitation für die Frauenbewegung. Und sie konnte grässlich hartnäckig werden beim Spendensammeln. Ich muss versuchen, sie abzulenken, überlegte Katherine. Am besten frage ich sie nach der skandalösen Postimpressionisten-Ausstellung, die gerade in London gelaufen ist. Bestimmt verkündet sie dazu eine pointierte Meinung.
Katherine seufzte. Sie hätte Ethels Mutter sein können. Eine eigenartige freundschaftliche Beziehung hatte sich zwischen ihnen entwickelt.
Sie war selbstverständlich dafür, dass Frauen mehr Rechte erhielten. Aber doch bitte gemäßigt. Ein paarmal hatte sie, wie viele Damen der Oberschicht, schon mit Geldspenden geholfen. Nun wurde sie die Geister nicht wieder los. Andererseits kannte Ethel wirklich Gott und die Welt. Es wurde nie langweilig mit ihr. Vielleicht konnten ihre exzellenten Kontakte ihnen ja nützlich sein, um ihrem Sohn zur Nobilitierung zu verhelfen.
Anni freute sich, dass sie den Tee und frisch gebackenes Shortbread bringen durfte. Denn Mrs. Smyth unterhielt sich immer mit ihr, wie sie sagte, um ihre Deutschkenntnisse wachzuhalten. Sie sprach mit sächsischem Akzent, was sich putzig anhörte. Die Besucherin hatte bereits in einem der Chesterfield-Sessel Platz genommen. Ihr Hut saß wie immer schief auf dem nachlässig frisierten Kopf, sie trug eine weiße Bluse mit Schlips zu einem Kostüm aus dickem Tweed.
»Ach, meine liebe Anni«, wurde sie denn auch lebhaft auf Deutsch begrüßt, als sie vorsichtig das Tablett abstellte. »Hab ich Ihnen schon erzählt, wie Brahms mich damals in Leipzig nannte?«
Mrs. Moss bedeutete Anni mit einem Blick, auf dem lila bezogenen Besuchersofa Platz zu nehmen, und griff nach der silbernen Teekanne. »Ich schenke selbst ein.«
Anni konzentrierte sich auf das Gesicht der Besucherin, die sogar einen Ehrendoktortitel erhalten hatte. Ein wenig glupschäugig, Anfang fünfzig, kleiner Mund mit schön geschwungener Oberlippe, energisches Kinn, stumpfe Nase, notierte sie innerlich, denn sie berichtete ihrer Familie von jeder Begegnung mit der berühmten Komponistin. Sie strahlt etwas Gradliniges aus, dachte Anni. Man merkt ihr an, dass sie ebenso bereit ist, verschmitzt zu lächeln wie sich unerschrocken jedem Streit zu stellen.
»Nein, Madam, das haben Sie noch nicht«, antwortete sie gespannt.
»Er sagte doch tatsächlich: Da kommt die Schmeißfliege!« Sie lachte dröhnend. »Ist das nicht ungeheuerlich? Eine Frechheit, oder? Ich … eine Schmeißfliege!« Es amüsierte sie nach all den Jahren immer noch. Anni vermutete, sie erzählte die Geschichte von der Wortspielerei, die entstand, weil ihr Name auf Deutsch »Smeiß« ausgesprochen wurde, vor allem, um elegant überzuleiten zu anderen musikalischen Größen, die sie ebenfalls kennengelernt hatte. Und tatsächlich plauderten sie nun noch eine kleine Weile angeregt über Tschaikowski, Grieg, Dvořák und Clara Schumann. »In den 1870ern war Leipzig die lebendigste Musikstadt Deutschlands«, schwärmte Mrs. Smyth. »Und es macht mir immer noch viel Freude, Deutsch zu sprechen. Ich hatte übrigens stets deutsche Gouvernanten. Genau wie Queen Victoria.«
Für die inzwischen verstorbene Königin, so leitete sie zur nächsten Erinnerung über, habe sie einst in privatem Rahmen, bei einem Besuch mit ihrer Förderin Kaiserin Eugénie von Frankreich, mehrere Lieder zum Vortrag bringen dürfen.
Ein Blick von Mrs. Moss machte Anni deutlich, dass es Zeit war, sich zurückzuziehen. »Du kannst jetzt die Lektüre für morgen vorbereiten.« Anni nickte und erhob sich.
Mrs. Smyth lächelte sie aufmunternd an. »Sie sind noch jung. Ihnen werden hoffentlich mehr Türen offenstehen als meiner Generation.« Sie reichte ihr die Hand und drückte sie fest.
»Bring sie nicht auf Gedanken, Ethel!«, scherzte Mrs. Moss. »Mach sie mir nicht abspenstig.«
»Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden«, erwiderte die Komponistin ernst. »Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen.«
Annis Herz klopfte schneller. »Danke, Mrs. Smyth. Ich glaube, ich mag die Frauenbewegung.«
Als sie zur Tür ging, sprach die Besucherin an Mrs. Moss gerichtet auf Englisch weiter, aber laut genug, dass sie sie verstehen konnte.
»Am 23. März wird der March of the Women in der Royal Albert Hall präsentiert, das wird die offizielle Uraufführung. Emmeline und ich, wir werden in einer Prozession einmarschieren. Ich möchte dich herzlich einladen, liebe Katherine, du musst dir unser Kampflied dort anhören!«
»Das klingt aufregend.«
»Bestimmt. Und natürlich ist das Ganze verbunden mit einer Spendensammlung. Wir brauchen mehr Geld für die gute Sache, denn für das Frühjahr sind jede Menge Protestaktionen in Vorbereitung.«
Leise schloss Anni die Tür. Ja, das klang aufregend – nicht dauernd an der Küste herumlungern, sondern in See stechen!
Beflügelt lief sie hoch auf ihr Zimmer. Es lag, obwohl sie als eine Art Haustochter eine gewisse Sonderstellung hatte, im Bedienstetentrakt unterm Dach zwischen dem von Rosabels Zofe Daisy Duncan und Mrs. Moss’ Zofe Harriet Brown. Anni ging der Haushälterin Mrs. Pennymore gern ab und zu zur Hand, übernahm auch mal Botengänge ins Dorf, aber sie war ihr nicht direkt unterstellt wie das andere weibliche Personal. Wenn sie sicher war, dass Mrs. Moss sie nicht brauchte, konnte sie sich eine freie Stunde nehmen, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Schnell zog sie ihren abgetragenen braunen Wollmantel über und lief vorbei an den Stallungen zum Kutscherhaus, das am Ende der Gärten lag. Von hier aus sah Willow Hill besonders imposant aus.
Das Landhaus in der Grafschaft Kent erhob sich auf einem sanft geschwungenen Hügel, gut eine Meile vom Dorf Higher Frithim entfernt. Ein efeubewachsenes dreistöckiges und mehrgiebeliges Gebäude aus gelbgrauem Sandstein. Die Eingangshalle mit steinernen Pfostenfenstern und Steinsäulen am Aufgang hatte sie am Anfang sehr beeindruckt. Die Tonnengewölbedecke, ein Werk der Arts-and-Crafts-Bewegung, der Quaderkamin und die Eichentreppen machten ordentlich was her. Aber man gewöhnte sich an alles.
Im alten Kutscherhäuschen lebte ihre Freundin Meg Hopkins, die wie sie zweiundzwanzig Jahre alt war, zusammen mit ihrem Großvater, dem Chauffeur von Mr. Moss. Mr. Hopkins kümmerte sich auch um alles Technische auf dem Anwesen. Ein Zaun umgrenzte ihren kleinen Cottagegarten, der, hinterm Haus durch eine hohe Lebensbaumhecke geschützt, nun Winterschlaf hielt. In der Nähe befanden sich die Garage und eine Werkstatt.
Sie klopfte an die niedrige türkisfarbene Tür.
»Herein«, tönte Mr. Hopkins’ sonore Stimme.
Sie trat direkt in die gemütliche Wohnküche ein, wo er mit einer Zeitung im Schaukelstuhl vorm offenen Feuer saß. Meg, die wie immer eine Blüte im haselnussbraunen Haar trug, bereitete Brotteig vor.
»Hallo, Anni, schön dich zu sehen! Nimm Platz. Tee?«
»Wenn gerade einer fertig ist.« Sie setzte sich an den Küchentisch.
»Hast du schon gehört? Der Wettbewerb der Daily Mail. Ist das nicht irre?«
»Nein«, gab sie zurück. Durch den Besuch von Ethel Smyth hatte sie das Thema ganz vergessen. »Jetzt klär mich doch endlich mal jemand auf. Seit heute Morgen hört man es raunen.«
»Die Zeitung hat eine Belohnung ausgeschrieben für den schönsten selbst gezogenen Wickenstrauß«, mischte sich Mr. Hopkins ein, während Meg ihr Tee einschenkte. Och, wie langweilig, dachte Anni. Sie hatte etwas Sensationelles erwartet. »Jeder Amateurgärtner, der nicht mehr als einen Mann als Hilfe beschäftigt, kann teilnehmen«, erklärte Megs Großvater.
Sein dunkles Haar war ebenso wie der mächtige Schnauzbart von grauen Strähnen durchzogen. Aus den Brauen ragten vorwitzig ein paar helle längere Härchen, die beim Reden zitterten, was ihm in Annis Augen das Aussehen eines Oberkaters verlieh. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er ihr ordentlich Respekt eingeflößt, denn er hatte sich gerade über einen Motordefekt geärgert und geflucht: »Mögest du an einem freien Tag vergessen, den Wecker abzustellen! Der Mechaniker soll hundert Jahre alt werden, und zwar sofort!«
Mittlerweile war sie daran gewöhnt, denn Mr. Hopkins hatte ihr erklärt, dass, verdammt noch mal, fast alle Schotten Flüche einfach nur als Satzzeichen verwendeten. Und in Gegenwart seiner Enkeltochter versuchte er auch, sich mit derartigen Kommas, Punkten und Ausrufezeichen zurückzuhalten. Anni nippte an ihrem nach Bergamotte duftenden Tee.
»Grandpa, das Wichtigste ist doch der Preis«, fiel ihm Meg ins Wort. »Im Sommer wird der schönste Wickenstrauß mit tausend Pfund prämiert. Hörst du, ein-tau-send Pfund! Ein Vermögen!«
Anni verschluckte sich. »Oh, das ist wirklich, also …« Sie pfiff anerkennend.
»Der zweite Preis sind einhundert Pfund«, fuhr Mr. Hopkins fort. »Dafür muss ein Arbeiter ein ganzes Jahr lang schuften. Und als dritter Preis winken immer noch fünfzig Pfund.«
»Bei der Blumenschau im Juli verteilen sie außerdem hundert silberne und neunhundert bronzene Medaillen. Echte!«
»Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und jeder darf mitmachen?«
»Nee, die Reichen nicht.« Grinsend nahm Mr. Hopkins die Zeitung wieder hoch, er hob die buschigen Brauen. »Nur das normale Volk.«
»Ist das nicht großartig?«, rief Meg begeistert.
»Jeder darf nur einen Strauß einsenden, aber jedes Familienmitglied darf einen schicken«, las Mr. Hopkins die Regeln vor. »Jeder Strauß soll aus zwölf Pflanzenstängeln und nicht weniger als drei verschiedenen Wickensorten bestehen. Man muss keinen Eintritt oder Ähnliches zahlen, steht hier. Du brauchst noch nicht mal die Daily Mail abonniert zu haben.«
Megs zartes Gesicht hatte vor Aufregung rötliche Flecken bekommen. »Grandpa und ich, wir machen auf jeden Fall mit. Bei uns blühen doch schon seit Jahren jeden Sommer Wicken am Zaun.«
»Vor allem Spencer-Wicken«, ergänzte der alte Mann. Anni erinnerte sich. Ihr hatten die großen Blüten und ihr rankendes Grün sehr gefallen. Die perfekte Zierde für einen Cottagezaun. Sweet Peas, so viel wusste sie, begeisterten traditionell den englischen Landadel. Man verschenkte Sträußchen davon als Symbol der Freundschaft.
»Was ist mit dir?«, fragte Meg.
»Mit mir?« Verwundert sah Anni sie an. Blümchen züchten? Das war nicht das, was sie sich vorstellte – sie wollte doch richtig in See stechen. Was genau das allerdings sein mochte, konnte sie noch nicht sagen. Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaub, das ist nichts für mich. Ich hab keinen grünen Daumen. Und einen Garten auch nicht.«
»Aber denk doch mal, was du dir leisten könntest, wenn du gewinnen würdest!« Megs grüngraue Augen blickten verträumt.
»Du könntest eine Reihe bei uns hinterm Haus anlegen«, schlug Mr. Hopkins vor, »zwischen Komposthaufen und Teppichstange, bei der alten Schaukel, vor der hohen Hecke, da wär’ noch Platz.«
Anni überlegte kurz. Was hatte sie zu verlieren? »Aber wenn ich Mrs. Moss wieder ins Stadthaus nach London begleiten muss?« Erst vergangene Woche waren sie einige Tage dort gewesen. »Dann könnte ich zum Beispiel nicht gießen.«
»Das übernehme ich für dich. Und für Grandpa, wenn er chauffieren muss«, bot Meg an. »Mensch, Anni, allein, dass wir uns jetzt ein halbes Jahr lang ausmalen können, was wir mit eintausend Pfund anstellen würden …«
»Ich würde uns ein Häuschen kaufen«, brummte Mr. Hopkins, »als Altersruhesitz für mich und als Absicherung für Meggy. Das wär’ ’ne feine Sache.«
»Aber es reicht doch sicher nicht, nur so ein paar Samen in die Erde zu stecken«, wandte Anni ein. »Ich hab wirklich keine Ahnung. Man braucht bestimmt irgendeine Ausrüstung …«
»Grandpa kennt sich aus, und außerdem wird uns sicher Jim helfen.«
Jim Harrison, Sohn eines Gärtners, war bis zum vergangenen Sommer die rechte Hand von Mr. Hopkins gewesen. Er hatte sich mit seinem Erspartem und geliehenem Geld selbstständig gemacht mit einem Betrieb für Saaten und Gartenzubehör.
»Wie läuft’s eigentlich?«, wollte Anni wissen.
»Im Moment ein bisschen mau«, wusste Meg. »Aber wir haben Februar, das ist nicht gerade Hochsaison.«
»Der Junge wird schon seinen Weg machen«, sagte Mr. Hopkins.
»Was möchtest du am liebsten tun, Anni?«, fragte Meg. »Wenn alles möglich wäre?«
»Ich würde …«, sie überlegte nur kurz, »ich würde die ganze Welt bereisen!«
»Frauen reisen nicht allein durch die Weltgeschichte«, entgegnete Meg. »Und solange du keinen Ehemann hast …«
»Aber wenn ich genügend Geld besäße, könnte ich in Begleitung einer seriösen jungen Dame reisen.« Anni lächelte. »Mit einer Freundin. Mit dir, Meg.« Und ich könnte über meine Reiseeindrücke schreiben, setzte sie in Gedanken hinzu. »Das wäre ein Traum!«
»Einverstanden«, versprach Meg augenzwinkernd, »ich würde mitkommen. Einer muss ja aufpassen, dass du deinen guten Ruf nicht ruinierst. Grandpa, was meinst du?«
Megs Großvater hielt seiner Enkeltochter und Anni je eine Hand hin. »Großartig, zur Hölle, die Wette steht, Mädels!«
Borkum, Juli 2024
»Was verdient denn heute ein Arbeiter durchschnittlich im Jahr?«, fragte Marieke. Dr. Tammen zückte sein Handy und gab eine entsprechende Suchanfrage ein.
»Je nachdem, wo man in Deutschland lebt«, fasste er kurz darauf das Ergebnis zusammen, »in welcher Branche man arbeitet und ob man ein Mann ist oder eine Frau …« An dieser Stelle unterbrach ihn ein Aufstöhnen von Marieke und Alwine – ohne Absprache, sodass sie trotz des Altersunterschieds ein schwesterliches Lächeln tauschten. »Also, es schwankt, der mittlere Wert liegt bei knapp achtunddreißigtausend Euro.«
»Wahnsinn!«, sagte Marieke ungläubig. »Und das mal zehn als erster Preis. Das würde bedeuten, heute gäbe es als ersten Preis dreihundertachtzigtausend Euro! Für so’n paar Blumen!«
»Na, da hätte ich bestimmt auch mein Glück versucht«, gestand Alwine ein, »obwohl ich Gartenarbeit nicht besonders mag.«
»Damals muss es den Zeitungshäusern deutlich besser gegangen sein als heute«, bemerkte der Biologe. Erst jetzt betrachtete Marieke sein Gesicht aufmerksamer. Dunkelbraune Augen, dichte Brauen, hohe Stirn, das rötlich blonde Haar verwuschelt, Dreitagebart.
Ihr Handy klingelte. »Hallo, Gardon! Oje, ist es schon so spät? Tut mir leid, ich hab völlig die Zeit vergessen. Bin noch im Gespräch bei meiner Nachbarin. Aber ich melde mich später wieder. Wann passt es dir?«
Gardon rief sie oft aus dem Auto an, auf seinem halbstündigen Heimweg aus seiner Praxis, die in der Hamburger City lag. Wenn er in dem Elbvorort Nienstedten angekommen war, gab’s erst Abendessen. Dann wollte er sich eine Weile mit den Kindern beschäftigen und musste natürlich mit Pia, seiner Frau, bereden, was der Tag ihnen beschert hatte. Im Sommer nutzte er die Zeit zwischen Arbeit und Familie auch öfter, um mit seinem Freund Alex zu segeln. Sie waren ehrgeizige und recht erfolgreiche Hobbyschnellsegler.
»Ich versuch’s noch mal gegen neun«, erwiderte er.
»Okay, bis dahin.« Mit einem entschuldigenden Lächeln beendete sie das Gespräch.
»Ja, ist spät geworden«, bestätigte Dr. Tammen. »Ich würde aber natürlich gerne erfahren, wie die Geschichte weitergegangen ist.«
Alwine schien es auch Freude zu bereiten, sich mit der Vergangenheit und den Zeitungsausschnitten zu beschäftigen. Zwischendurch hatten sie einige englische Textstellen gemeinsam übersetzt, was bei ihr Erinnerungen mobilisierte. Marieke zeigte ihr, wie sie im Internet ganz schnell Englisch-Deutsch-Übersetzungen googeln konnte, was bei Alwine Erstaunen und Freude auslöste.
»Kommt doch morgen wieder zu mir«, schlug die Nachbarin vor. »Vielleicht schon am Vormittag?«
»Nein«, antwortete Marieke schnell. »Morgen Vormittag geht’s bei mir nicht.«
»Dann übermorgen Vormittag?«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein, vormittags kann ich nie.«
Alwine sah sie merkwürdig an, verkniff sich aber die Frage nach dem Warum. »Na, dann morgen wieder zur gleichen Zeit wie heute, um fünf Uhr?«
»Für mich wäre das okay«, sagte Dr. Tammen.
»Ja, für mich auch«, stimmte Marieke zu. »Wir können uns auch bei mir treffen.« Sie wollte nicht, dass Alwine als Gastgeberin die ganze Arbeit hatte.
»Och, nee, kommt ihr mal lieber zu mir«, winkte ihre Nachbarin ab. »Sonst muss ich all die Unterlagen rübertragen, und am Ende geht noch was verloren oder so. Mir bereitet das keine Umstände.«
»Dann bring ich Kuchen mit.«
»Rosinenstuten wäre schön«, sagte Alwine und sah den Biologen an. »Mögen Sie den?«
»Klar. Am liebsten den von Nabrotzky.«
»Ich finde den von Müller besser«, erwiderte Marieke.
»Tja, die einen sagen so, die anderen so«, frotzelte Alwine. »Denn bis dann.«
»Wollen wir vielleicht noch unsere Handynummern austauschen?«, fragte Dr. Tammen. »Falls einem von uns was dazwischenkommt? Ich will morgen raus, wenn’s nicht wieder schüttet, um nach den Platterbsen Ausschau zu halten. Kann immer mal was …«
»Ja, besser is’«, meinte Alwine.
Flugs richtete Marieke eine WhatsApp-Gruppe ein, die sie Annis Wicken nannte. »Tschüss, Alwine, vielen Dank und bis morgen.«
Die paar Meter auf dem Weg zur Villa Cupani unterhielten sie und Dr. Tammen sich weiter.
»Hätten Sie Lust, mich morgen zu begleiten?«, fragte er am Gartentor. »Sie könnten Ihr botanisches Wissen direkt in der Natur vertiefen.«
»Richtig, Sie sind ja Lathyrus-Experte«, antwortete Marieke mit sanftem Spott. »Die sind sicher ebenso selten wie Strandplatterbsen.«
Er lachte. »Gut, dass Sie’s erkannt haben.«
»Was genau würde ich da lernen?«
»So viel, wie Sie begreifen können«, antwortete er im gleichen Tonfall. »Lathyrus, also Platterbsen, nennt man eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Faboideae, zu Deutsch: Schmetterlingsblütler, innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler, der Fabaceae, veraltet auch Leguminosen genannt.«
»Ah, ja. Die alten Leguminosen, die haben mich schon immer rasend interessiert.«
»Die wiederum gehören übrigens zur Ordnung der Schmetterlingsblütenartigen, Fabales, und gelten als eine der artenreichsten Pflanzenfamilien überhaupt.«
»Klingt wahnsinnig aufregend. Aber ich glaub eher nicht. Ich muss ja auch noch den Rosinenstuten besorgen.«
»Einen von Nabrotzky und einen von Müller?«
»Gute Idee.« Sie lächelte. »Dann machen wir einen Vergleichstest.«
»Schade. Ich meine, dass Sie sich die Chance entgehen lassen, Ihre neue Heimat besser kennenzulernen.« Er deutete zum Abschied eine leichte Verbeugung an. »Dann also morgen um fünf bei Alwine.«
»Ich bin gespannt. Tschüss!«
Als er schon ein paar Schritte gegangen war, drehte er sich um. »Falls Sie es sich anders überlegen, ich könnte Ihnen auch herrliche Strandwinden zeigen. Schicken Sie einfach eine WhatsApp.«
Sie winkte ihm nur zu.
Eigentlich hat er es ganz charmant gesagt, dachte sie, als sie sich hinunterbeugte, um noch einmal an einer lilafarbenen Wickenblüte zu riechen, immerhin mit einer Spur Selbstironie. Fast tat es ihr leid, dass sie abgelehnt hatte. Aber bestimmt würde er am Vormittag aufbrechen wollen.
Am Abend Punkt neun Uhr rief Gardon wieder an. Sie hatte es sich gerade auf dem Sofa bequem gemacht. Mildes Abendlicht fiel ins Wohnzimmer, das durch eine Doppelschiebetür von der einstigen Frühstücksveranda abgetrennt war. Sanfte Hellblau- und Cremetöne dominierten.
»Wie geht’s dir heute?«, erkundigte er sich mitfühlend. »Wie war’s am Morgen?«
»Ach«, seufzte sie, und Tränen schossen ihr in die Augen. »Wie immer. Lass uns nicht drüber reden. Es ist wie es ist. Ich tick eben nicht ganz sauber.«
»Quatsch, Mieke.« Manchmal benutzte er noch ihren Spitznamen aus Kindertagen. »Das wird wieder. Du musst einfach mehr unter Leute.«
Marieke atmete tief durch. Sie wollte es nicht wieder und wieder durchkauen. »Danke für das lustige Kaninchenvideo, das du mir geschickt hast.« Es half natürlich kein bisschen, sie aufzumuntern, aber die Geste rührte sie.
»Sind die nicht süß?«, rief er begeistert. »Am liebsten hätte ich einen großen Auslauf für mehrere Kaninchen im Garten. Hab neulich wieder versucht, meinen Anhang zu überzeugen. Die Kinder stehen voll hinter mir, Pia weigert sich standhaft. Sie meint, die ganze Arbeit würde an ihr hängenbleiben.«
»Womit sie vermutlich recht hat.« Marieke konnte Pia verstehen. »Und wie geht’s euch sonst so?«
»Och, nichts als Ärger und Freude«, antwortete er ausweichend. »Viel Arbeit in der Praxis. Noch mehr bescheuerte Abrechnungsbürokratie. Aber nichts Erwähnenswertes.«
»Wolltet ihr nicht Urlaub machen?«
»Ist erst mal verschoben. Die Kids sind demnächst in einem Feriencamp. Vielleicht komme ich für ein paar Tage allein auf die Insel. Mal gucken, ob ich dir ein bisschen beim Abarbeiten deiner To-do-Liste helfen kann.«
»Keine Drohungen!« Sie musste lachen. Gardon war bekannt dafür, dass er keinen Nagel gerade in die Wand schlagen konnte. »Und Pia?«
»Plant was mit Wellness und ihren Mädels.«
»Könnten sie hier auf Borkum haben.«
»Nee, die möchten lieber was Mondänes.«
»Tja dann …« Sie berichtete ihm von der Begegnung mit dem Biologen und ihrer Teestunde bei Alwine.
»Das klingt interessant. Wenn man die Historie seines Hauses kennt, wirkt sich das sicherlich aufs Lebensgefühl aus. Halt mich unbedingt auf dem Laufenden.«
»Du bist der einzige Erwachsene, den ich detailliert über mein abenteuerliches Leben informiere. Das weißt du doch.«
»Wehe, wenn nicht! Einen gemütlichen Abend noch, Mieke.«
»Danke, dir auch.« Sie zögerte. »Hab ich es richtig gemacht, Gardon?«, fragte sie plötzlich von Zweifeln erfasst.
Sie war nicht glücklicher seit ihrer Scheidung. Es entwickelte sich überhaupt nicht so, wie sie es sich erträumt hatte.
»Das hast du«, antwortete er mit fester Stimme. »Gib dir etwas Zeit. Die Hauptsache ist, dass du dich auch innerlich von Gisbert löst. Lass dich nicht mehr von ihm manipulieren.«
»Tu ich doch schon lange nicht mehr.«
»Naa …« Gardon klang nicht überzeugt. »Er versucht immer noch, dich emotional auf Stand-by zu halten.«
»Quatsch. Wir haben seit Monaten keinen Kontakt mehr.«
»Ich hab ihn von Anfang an nicht gemocht.«
Sie lachte auf. »Du warst eifersüchtig damals. Ihr wart alle noch kleine Bubis …«
»… und er der große Zampano mit Charme, Beschützerinstinkt und Kohle, der jede Frau rumkriegte.«
»Ich halte nicht viel davon, wenn man seinen Ex als Arschloch tituliert, weißt du? Damit würde ich all die Jahre entwerten. Immerhin hab ich ihn mal sehr geliebt. Und es wäre nicht gut für die Kinder.«
»Ommm …« Gardon übertrieb sein Meditationsgebrumm, um kundzutun, dass er sich beherrschen musste, ihr nicht zu widersprechen.
»Okay«, gab sie zu, »nur so unter uns: Er kann echt ein Arschloch sein!«
»Sehr gut. Geht doch.«
»Es liegt aber doch inzwischen allein an mir. Wieso krieg ich es nicht hin?«
»Sei nicht so streng mit dir«, bat Gardon. »Und igel dich nicht ein. Geh unter Leute. Du müsstest mal wieder einen lüpfen und dich richtig amüsieren.«
Das war das Letzte, worauf sie Lust verspürte. Aber er begriff es einfach nicht. »Mal sehen«, erwiderte sie zurückhaltend. »Euch auch noch einen schönen Abend!«
Am nächsten Morgen war es wie immer seit mindestens einem Jahr. Sie wachte auf und dachte »Sch…! Aufstehen. Ein neuer Tag. Es ist alles zu viel.«
Und dann schaffte sie es nicht, unter der Bettdecke hervorzukriechen. Sie versuchte es ein Stück, sank zurück und hasste sich dafür. Ihr war übel, der Rücken schmerzte, jeden Morgen. Ans Frühstück durfte sie nicht mal denken. Danach setzten oft Bauchkrämpfe ein, und sie kam nicht von der Toilette herunter. In diesen Stunden fühlte sie sich zutiefst unglücklich, schwach, überfordert und musste weinen. Woraus speiste sich diese Quelle nicht aufhören wollender Tränen? Jeden Morgen das Gleiche. Als wäre sie nicht normal.
Es war doch auch nicht normal. Manchmal erwachte sie sehr früh und musste sich laut schluchzend ausheulen. Gelegentlich träumte sie von ihrem Ex-Mann, schwebte wieder in dem wohlig warmen Gefühl von einst, als er noch ihr Held und Beschützer gewesen war. Rundum geliebt, beliebt, versorgt, schönste Gegenwart und Zukunftsaussichten.
Wie hatten sie alle beneidet! Mit neunzehn hatte sie sich den begehrtesten Junggesellen der Region geangelt. Gisbert »Gisi« Kröner – der ewige Playboy, Bauunternehmer, ein blonder Hüne, reich und verdammt gut aussehend – hatte ausgerechnet sie gebeten, ihn zu heiraten.
Wie romantisch er sie umworben hatte! Mit Schmuck und roten Rosen überhäuft, eine Liebeserklärung von einem Sportflugzeug in die Lüfte malen lassen, Überraschungswochenenden in Salzburg und Paris, Hochzeitsreise nach Bora-Bora. Schnell war sie mit den Zwillingen schwanger geworden. Erst großes Glück, dann Familienalltag. Nachdem die Kinder eingeschult worden waren, hatte sie in einem auf Ratgeber spezialisierten Verlag volontiert. Doch als sie anschließend als Redakteurin hatte arbeiten wollen, war es Gisbert überhaupt nicht recht gewesen. Er wollte eben eine allzeit verfüg- und vorzeigbare Gattin in einem gepflegten Haus. Um des lieben Friedens willen hatte sie sich gefügt und nur ab und zu freiberuflich Texte für Ratgeber geschrieben.
Je erwachsener sie geworden war, desto kritischer hatte sie die Welterklärungen ihres Mannes betrachtet. Seine politische Meinung gefiel ihr immer weniger.
Und dann der fünfzehnte Geburtstag ihrer Kinder. Bei dieser Feier hatte sie zum ersten Mal bewusst registriert, dass er weiterhin für junge Mädchen schwärmte. Und mehr als das. Sie wurde älter, immer unverhohlener zeigte er seine Neigung zu »knackigen jungen Hühnern«. Sie schliefen seltener miteinander, irgendwann gar nicht mehr. Schließlich flirtete er bei Restaurantbesuchen ungeniert in ihrer Gegenwart jede Serviererin unter fünfundzwanzig an.
Und dann entdeckte sie Beweise seiner Untreue. Er leugnete nicht. »Ich steh nun mal auf junge Frauen. Ab Mitte zwanzig regen sie mich nicht mehr an. Soll ich dich etwa anlügen? Nein, ich bin nicht wie andere Ehemänner, die ihre Frauen heimlich betrügen. Ich bin ehrlich.«
Sie hatte versucht, sich damit zu arrangieren, wenigstens so lange, bis die Kinder das Abitur hatten und aus dem Haus waren. Die Scheidung war in einen zermürbenden Rosenkrieg ausgeartet. Endlich hatte ihre Anwältin eine akzeptable Abfindung für sie herausgehandelt und seine Zusage, die Ausbildung der Zwillinge zu finanzieren. Klar, dass sie erschöpft war. Aber sooo lange?
Was sollte sie denn noch tun? Sie hatte auch nach anderen Gründen gesucht, sich von verschiedenen Ärzten durchchecken lassen – auf Anzeichen vorzeitiger Menopause, Post-COVID und den Verdacht, sie sei vielleicht müdegeimpft worden durch die Corona-Spritzen –, doch alle hatten gesagt, sie sei gesund, ihr niedriger Blutdruck auf jeden Fall besser als ein zu hoher. Gegen die Verdauungsbeschwerden würden gesunde Ernährung und mehr Bewegung helfen. Gegen die Rückenschmerzen Schlickpackungen und Massagen. Sie nahm Vitamin D zusätzlich ein, versuchte, regelmäßig auf einer Yogamatte Rückenübungen zu machen. Sofern sie die Energie dazu aufbrachte. Also öfter nicht. Zuweilen dachte sie, es wäre nicht schlimm, jetzt zu sterben. Dann wär’s endlich vorbei.
Sie hatte so gehofft, dass Borkum sie wieder aufrichten würde. Aber es machte ihr nicht mal Spaß, jetzt endlich die Sachen zu tragen, die Gisbert nicht an ihr gemocht hatte. Ihr kam die Frage in den Sinn, die Meg ihrer Freundin Anni gestellt hatte: Was wünschst du dir wirklich? Abgesehen von Gesundheit, Weltfrieden und dass es ihren Kindern gut ging – sie wollte in sich ruhen, mit Schönheit, Natur und anderen Menschen im Einklang leben. Es sollte nicht mehr alles so schwer sein. Sie träumte von Freiheit und Verbundenheit. Ein Widerspruch? Offenbar. Jedenfalls war sie noch weit entfernt davon. Sie fühlte sich oft beklemmt, schwankend zwischen Trauer und Wut. Es gelang ihr nicht, die rechte Aufmerksamkeit aufzubringen für das Schöne, das sie ja wohl doch auf dieser Insel umgab. Einmal hatte sie versucht, mit ihrer Mutter über alles zu sprechen. Deren knapper Rat: »Nun steigere dich da mal nicht so rein.« Seitdem verschwieg sie ihren Zustand und deutete nur Gardon als einzigem Menschen gegenüber ab und zu an, wie es ihr wirklich ging. Zwei Monate zuvor hatte sie sich von einem Heilpraktiker etliche Mittel verschreiben lassen, darunter eines, das die Serotoninaufnahme verbessern sollte. Die nahm sie auch brav ein. Aber bislang merkte sie nichts.
Sie schlief noch mal ein. Danach stand sie auf. Doch nach dem späten Frühstück überkam sie eine bleierne Müdigkeit, und sie sank aufs Sofa, verfiel in einen komaähnlichen Schlaf. Erst ab der Mittagszeit ging es ihr besser. Als hätte ihr Körper inzwischen eine Substanz produziert, die vormittags im Organismus Mangelware war. Eine Ärztin hatte mal angeboten, ihr Antidepressiva zu verschreiben. Doch als sie sich über die Nebenwirkungen informiert und erfahren hatte, dass es mindestens sechs Wochen dauerte, bis das Mittel wirkte, wenn überhaupt, hatte sie verzichtet. In sechs Wochen, so hatte sie gedacht, ist es bestimmt von allein wieder gut.
Und ab mittags fühlte sie sich ja normal. Abends konnte sie sich kaum vorstellen, dass das heulende Elend sie am nächsten Morgen wieder überwältigen würde. »Es kommt mir vor wie eine Halbtagsdepression«, hatte sie Gardon einmal gestanden. »Steht darüber was in deinen Lehrbüchern?« Er war schließlich Arzt, allerdings kein Psychologe. Doch sein Rat lautete stets gleich, dass sie sich nicht unter Druck setzen, Geduld haben und mehr unter Leute gehen sollte.
Auch an diesem Tag, es nieselte nur, lichtete sich der Grauschleier über ihrer Seele zur üblichen Zeit. Sie dachte an die Geschichte von Anni und war neugierig auf die Fortsetzung. Mittagessen ließ sie ausfallen. Sie radelte ins Dorf, kaufte ein, darunter die Rosinenstuten und Butter.
Als sie zu Hause alles eingeräumt hatte, brach die Sonne durch. Sonne! Kurz entschlossen griff sie nach ihrem Handy und schrieb in die Annis-Wicken-WhatsApp-Gruppe: Könnte ich heute noch zu Ihrer Expedition stoßen, Dr. Tammen?
Umgehend poppte seine Antwort auf. Klar. Passt es in einer halben Stunde vorm Strandhotel Hohenzollern?
Sie mailte einen erhobenen Daumen plus Smiley zurück und zog sich schnell um. Jeans, Sneakers, weißes T-Shirt, Hoodie, Regenjacke für alle Fälle, nur etwas Lippenstift, dann noch einen leichten Rucksack für Geld und Handy. Das Haar band sie zum Pferdeschwanz zusammen. Auf Augen-Make-up verzichtete sie. Beim Facetime-Anruf mit den Kindern war sie geschminkt gewesen, damit die zwei sich keine Sorgen um sie machten. Aber zum einen verwischte Mascara bei Regen oder nahe der Gischt, und zum anderen sollte der Lathyrus-Typ nicht auf falsche Gedanken kommen. Sie nutzte sein Angebot nur aus therapeutischen Gründen.