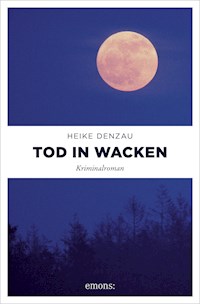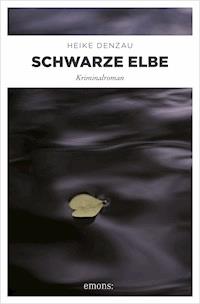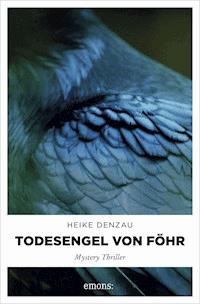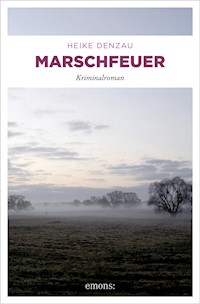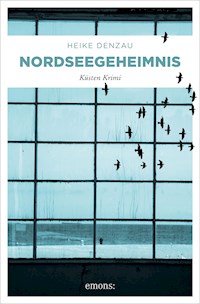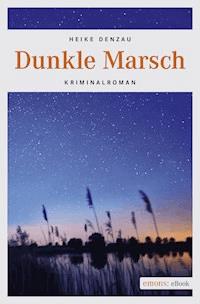
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lyn Harms
- Sprache: Deutsch
Journalist Gero Schlüter recherchiert für eine Reportage auf dem Gut der einflussreichen Itzehoer Familie Wenckenberg – kurze Zeit später wird er vergiftet. Hatte ein Familienmitglied Grund, ihn zu töten? Welche Rolle spielt Anette, die junge Frau mit dem Down-Syndrom? Lyn Harms bringt nicht nur wohlgehütete dunkle Geheimnisse, sondern weitere ungeheuerliche Verbrechen ans Licht...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Denzau, Jahrgang 1963, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Bei der Vergabe des KrimiNordica Awards 2015 erlangte sie den zweiten Platz in der Kategorie »Story«. Ihr Kriminalroman »Die Tote am Deich« war für den Friedrich-Glauser-Preis 2012 in der Sparte »Debüt« nominiert. www.heike-denzau.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.de/matlen Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-089-8 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Kristina
In Dankbarkeit dafür, dass du sein darfst, wie du bist.
Denn genau so lieben wir dich, Krissi.
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind.
Wir sehen sie so, wie wir sind.
Anaïs Nin
EINS
Unwillig griff Gero nach dem Smartphone, als der Klingelton ihn aus der Beschäftigung riss. »Schlüter«, murmelte er hinein und klemmte sich das Handy zwischen Schulter und Wange, um weiterhin beide Hände frei zu haben. Der Inhalt der alten Hutschachtel war zu interessant, um mit dem Durchwühlen aufzuhören. Geruch muffiger Vergangenheit streifte seine Nase, als er nach einem Stapel Schwarz-Weiß-Fotografien griff.
Als er endlich wahrnahm, wer da am anderen Ende mit hoher Stimme auf ihn einsprach, legte er die Fotos mit den gezackten Rändern vor sich auf den Schreibtisch und nahm das Telefon in die rechte Hand. »Ja, Frau Hartmann, guten Tag. Was… was kann ich für Sie tun?« Seine Linke schob ein Foto nach dem anderen zur Seite, während er lauschte. »Die Schachtel?« Er hielt in der Bewegung inne. »Ja, die hat Ihr Bruder mir gegeben. Er meinte, ich könne mir die passenden Bilder für die Reportage selbst heraussuch…« Er brach ab und hielt das Telefon ein Stück vom Ohr entfernt, weil ihre Stimme sich noch weiter in die Höhe schraubte.
»Sie rühren die Hutschachtel nicht an, verstanden!«, drang es schrill zu ihm durch. »Das sind höchst private Aufnahmen unserer Mutter und von ihr über Jahre gesammelte Artikel unsere Familie betreffend. Es ist unglaublich, dass Amon sie Ihnen herausgegeben hat. Unsere Mutter würde einen zweiten Schlaganfall erleiden, wüsste sie, dass ein Fremder, noch dazu ein Journalist, sie in Händen hält. Wenn auch nur ein einziges von uns nicht genehmigtes Foto in Ihrer Reportage auftaucht, verklagen wir Sie, bis Sie nur noch in Unterwäsche dastehen. Das kann ich Ihnen versichern, Herr Schlüter!«
Gero lehnte sich mit zusammengezogenen Augenbrauen in seinem wackligen Schreibtischstuhl zurück. »Liebe Frau Hartmann, ich versteh Ihre Aufregung gar nicht. Selbstverständlich werde ich für jedes Foto aus Ihrem Privatbesitz eine Genehmigung von Ihnen einholen, bevor ich es veröffentliche und–«
»Ich bin nicht Ihre liebe Frau Hartmann! Nur weil mein Bruder distanzlos ist, ist das noch lange kein Freifahrtschein für Sie, die übrige Familie Wenckenberg mit plumper Vertraulichkeit zu behandeln.«
Gero öffnete den Mund zu einem lautlosen »Bla, bla, bla«, während er mit der linken Hand weitere Fotografien aus der Schachtel griff und auf der Schreibtischplatte auseinanderschob. »Ich suche nur zwei, drei Fotos, auf denen Rosmarie zu sehen ist. Gern eines, auf dem sie allein abgebildet ist, und ein weiteres gemeinsam mit Ihrer Mutter, Frau Hartmann.«
»Ich suche sie Ihnen heraus.« Die Stimme am anderen Ende des Telefons wurde ruhiger. »Ein Angestellter ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Bitte geben Sie Herrn Boldt die Schachtel, wenn er da ist.«
»Natürlich, Frau Hartmann. Einen schönen Tag noch für Sie.«
»Danke, gleichfalls.« Es klickte. Weg war sie.
»Blöde Zicke.«
Die einundsiebzigjährige Inger Hartmann war ihm von Anfang an unsympathisch gewesen. Dagegen war ihre Zwillingsschwester Ebba Goste-Wenckenberg die Nettigkeit in Person, obwohl auch sie ihm nur mit Skepsis Informationen über die Familie hatte zukommen lassen.
Gero warf das Telefon auf einen Stapel Pappordner und griff nach der Zigarettenschachtel. Er fummelte eine der filterlosen Zigaretten heraus, steckte sie an und inhalierte den Rauch tief. Mit der Zigarette im Mundwinkel kippte er den Inhalt der ledernen Hutschachtel auf dem Schreibtisch aus. Bevor Boldt kam, wollte er zumindest alle Fotos angeguckt haben. Für die Artikel blieb keine Zeit, aber das war eher unwichtig. Schnee von gestern. Er hatte sich im Archiv bereits durch eine Vielzahl von Artikeln über die Familie Wenckenberg hindurchgelesen.
Der in acht Monaten bevorstehende neunzigste Geburtstag von Klara Wenckenberg, der Matriarchin des Itzehoer Wenckenberg-Clans, war der Anlass für die groß angelegte Reportage über das Leben der Wohltäterin der Stadt, die er für eine Frauenzeitschrift schreiben sollte. Klara Wenckenberg selbst hatte er erst ein einziges Mal –vor ihrem Schlaganfall– sprechen können, weil ihre Stieftöchter wie Habichte über sie wachten, obwohl die Folgen ihres Schlaganfalls nicht gravierend waren– laut Aussage ihres Sohnes Amon Wenckenberg.
Der hatte glücklicherweise keine Probleme damit, ihm Haus und Werkhallen zu öffnen, damit er sich ein Bild vom Leben und der Arbeit der Wenckenbergs machen konnte. Aus einer kleinen Tischlerei hatte Klara Wenckenbergs Ehemann Ludwig in der Nachkriegszeit eine florierende Möbelfabrik geschaffen. Das Label LuWe bürgte seit Jahrzehnten für gediegene und qualitativ hochwertige Designermöbel.
Amon… Gero schüttelte in Erinnerung an das letzte Zusammentreffen mit ihm den Kopf. Der Mann war ein Phänomen. Kreativ, neugierig, großzügig. Letzteres nicht nur im finanziellen, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Sie hatten sofort eine Antenne zueinander gehabt, als er Amon Wenckenberg in dessen Büro das erste Mal getroffen hatte, um ihm die Reportage über das Leben seiner Mutter schmackhaft zu machen. Das zweite Treffen hatte in den späten Abendstunden geendet, nach dem Genuss einer Kanne von Amons Lieblingstee und einiger edler Whiskys. Etliche weitere Tea-time-Gespräche waren gefolgt. Mit und ohne Whisky.
Das Material für die Reportage war quasi komplett, nur ein paar Fotos fehlten noch. Die Leser liebten private Aufnahmen.
Gero nahm einen letzten tiefen Zug und drückte den Stummel der Zigarette in dem übervollen Aschenbecher aus. Die Asche, die dabei an seinen Fingerkuppen haften blieb, wischte er an der Jeans ab.
Gestern hatte Amon Wenckenberg ihm das Angebot unterbreitet, seine Memoiren zu schreiben. Hatte er das wirklich ernst gemeint? Mit einer Biografie über den Zweiundfünfzigjährigen würde er so viel Geld machen wie nie zuvor. Amon würde großzügig sein, das stand fest. Aber er hatte das Angebot gemacht, als sie beide betrunken gewesen waren. Nun, er würde noch mal nachhaken. Amon war auf jeden Fall ein Mann, der auf Außenwirkung zielte. Im Guten wie im Schlechten, das war ihm egal. Er lebte sein Leben, wie es ihm passte. Seine Bisexualität füllte die Klatschpresse seit Jahrzehnten. Daran änderte auch die vor fünf Jahren geschlossene Ehe nichts. Sobald Amon Wenckenberg mit einem Mann auch nur den Kopf zusammensteckte, dichtete man ihm sofort wieder ein Verhältnis an.
»Rosmarie, da bist du ja.« Gero nahm die Schwarz-Weiß-Fotografie, die er freigeschaufelt hatte, in die Hand und betrachtete das lachende Mädchen darauf. Sie stand unter einem knorrigen Apfelbaum, dessen Blüten eine reiche Ernte versprachen. Das Haus mit dem windschiefen Dach im Hintergrund musste das Elternhaus im niedersächsischen Cuxhaven sein. Elf, vielleicht zwölf Jahre alt mochte Rosmarie gewesen sein, als die Aufnahme entstand. 1940 oder 1941, so schätzte Gero, war das Foto gemacht worden. Amon hatte erzählt, dass es später keine Fotos mehr von Rosmarie gegeben hatte. Er drehte das Bild um, aber es war keine Jahreszahl vermerkt.
Gero schossen unvermittelt Tränen in die Augen, während sein Finger über das Bild des kleinen pummeligen Mädchens in dem viel zu weiten Kleid glitt. Es war Leons Lachen, das ihm entgegenstrahlte. So herzlich, so arglos, voller Liebe für das Leben. Und es waren Leons Augen, die ihn ansahen.
Es war ein perfektes Foto für die Reportage. Hoffentlich suchte die Hartmann genau dieses für ihn heraus. Flink fegten seine Hände durch die Bilderflut. Die Hutschachtel würde jeden Moment abgeholt werden.
Er griff nach einem weiteren Foto, auf dem die kleine Rosmarie eingerahmt war von zweien ihrer Geschwister. Das etwa vierzehnjährige Mädchen an ihrer linken Seite musste Klara Wenckenberg sein, obwohl kaum eine Ähnlichkeit mit der heute Neunundachtzigjährigen zu erkennen war. Die Zeit hatte die vielen Jahrzehnte genutzt, um sich in Klaras Gesicht auszutoben.
Der kleine Junge rechter Hand –in kurzer Trägerhose mit Pullunder und Kniestrümpfen– war vermutlich Peter, der jüngere Bruder der Mädchen. Die beiden Fotos waren mit Sicherheit am selben Tag entstanden, denn Rosmarie trug auf beiden das dunkle Blümchenkleid und hatte das Haar zu langen Zöpfen geflochten, genau wie Klara.
Gero legte die beiden Fotografien zur Seite. Er würde sie ganz oben deponieren, wenn er die Schachtel wieder einräumte, damit Inger Hartmann sie sofort in die Hände bekam, wenn sie ihm Fotos heraussuchte.
»Mist!«, fluchte er, als es unten an der Haustür klingelte. Boldt war schon da.
Unwillig griff Gero nach dem Packen Zeitungsartikel, die ganz unten in der Hutschachtel gelegen hatten. Als er in die Schachtel blickte, um die Artikel wieder hineinzulegen, sah er, dass sich die mit buntem Papier bezogene Pappeinlage leicht gelöst und schräg an der Schachtelwand verkeilt hatte. Das musste beim Auskippen des Inhalts passiert sein. Er drückte die Einlage aus fester Pappe mit der linken Hand herunter. Als er sie rundherum festdrücken wollte, stutzte er.
Gero legte die Artikel zurück auf den Tisch. Er tastete die Pappfläche ab. Darunter lag etwas. Deutlich spürte er die Umrisse eines Vierecks unter seinen Fingerkuppen. Ein Buch?
»Boldt, leck mich«, murmelte er, als es erneut an der Tür klingelte, während er fahrig versuchte, die festgedrückte Pappe wieder vom Boden zu lösen. Als es endlich gelang und er die Einlage hochzog, klingelte es ein drittes Mal.
Gero ignorierte es. Er starrte auf das rote Büchlein, das er freigelegt hatte. Aufgeregt nahm er es in die Hand. Ein Poesiealbum aus alter Zeit? Die Stockflecken auf dem leicht geriffelten Einband ließen jedenfalls darauf schließen, dass es schon sehr alt war.
»Ja doch«, schrie er, als es wieder klingelte, »ich komm ja schon.« Ohne zu überlegen, warf er die Zeitungsartikel in die Hutschachtel, dann sämtliche Fotos und schloss den Deckel. Sein Herz klopfte, als er die obere Schreibtischschublade aufzog, deren Inhalt aus ungeöffneten Zigarettenschachteln und Bürokrimskrams bestand. Er zögerte noch einmal kurz, dann legte er das rote Büchlein in die Schublade und schob sie zu.
Bereits auf dem Weg zur Tür verflüchtigte sich das schlechte Gewissen. Er war Journalist, und Neugier war der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht stieß er beim Durchblättern des Poesiealbums auf ein paar interessante Namen aus Klaras Vergangenheit. Er würde Amon das Büchlein beim morgigen Treffen zurückgeben. Mit der Behauptung, es unter seinem Schreibtisch gefunden zu haben. Es müsse wohl aus der Hutschachtel herausgefallen sein, als er den Inhalt ausgekippt hatte.
Gero drückte auf den elektrischen Türöffner, ohne die Sprechanlage zu nutzen. Er lächelte den Mittfünfziger an, der wenig später vor der Wohnungstür stand. »Herr Boldt?«
Der nickte. »Entschuldigen Sie meine Hartnäckigkeit, aber Frau Hartmann sagte mir eben am Telefon, dass Sie zu Hause seien und–«
»Kein Problem.« Gero hielt dem Mann die Hutschachtel hin. »Sagen Sie Frau Hartmann bitte einen herzlichen Gruß.«
Noch während er die Tür schloss, blickte er auf die Armbanduhr. Es war Viertel nach zwölf. Karens Mittagspause endete um dreizehn Uhr. Wenn er in fünfzehn Minuten losging, konnte er sie sehen, bevor sie im Bürogebäude verschwand. Es war also noch ein wenig Zeit, um schon mal einen Blick in das rote Büchlein zu werfen.
Er war noch auf dem Flur, als es erneut klingelte. Kam Boldt noch mal zurück?
Gero drückte den Öffner und zog die Wohnungstür einen Spalt auf. Die Stimmen im Treppenhaus verrieten andere Besucher. Mit einem Lächeln trat Gero vor die Tür. Noch bevor er sein »Hallo, wer kommt denn da?« zu Ende gesprochen hatte, presste sich ein Kinderkopf auf seinen Bauch. Zwei Ärmchen umschlangen ihn.
»Ge’o, Ge’o, Mama hat Waffeln gekauft. Eine fü’ mich und eine fü’ dich und eine fü’ Mama. Mit Pudelzuckel.«
Gero lachte und hob den Jungen mit einem Stöhnen auf seine Arme. »Meine Güte, Leon, du wirst jeden Tag größer und schwerer. Bald kann ich dich gar nicht mehr hochheben. Vielleicht sollte deine Mama dich nicht immer mit Puderzuckerwaffeln füttern.« Mit dem Jungen auf dem Arm beugte er sich vor und küsste seine Schwester auf die Wange. »Hallo, Julchen.«
»Dann kriegst du aber auch keine mehr, Brüderchen«, sagte Juliane Buck und ließ den mit drei Waffeln bestückten Pappteller in ihrer Hand dicht an seiner Nase vorbeiziehen, als sie sich an den beiden vorbeidrängte.
»Lecker.« Gero sog den Duft genießerisch ein, während er seiner Schwester hinterhersah. Ob es anderen Menschen auffiel, dass sie ihr linkes Bein leicht nachzog?
Er stellte den Jungen auf seine Beine und gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf den Po. »Dann ab aufs Sofa, Kumpel. Bevor Mama ihre Drohung wahr macht und wir beide keine Leckerei mehr kriegen.«
Juliane stellte den Pappteller auf einem Stapel Zeitungen ab, der mitten auf dem schäbigen Couchtisch lag. »Oh Mann«, stöhnte sie und schob zwei benutzte Teller zusammen, auf denen Krümel verrieten, dass von einem Teller Pizza und von dem anderen Brot gegessen worden war. Auf die Teller stellte sie einen benutzten Kaffeebecher und ein Wasserglas, das aussah, als hätte es seit Wochen keinen Geschirrspüler von innen gesehen.
»Kochst du dir eigentlich auch mal was Vernünftiges?«, fragte sie, während sie das dreckige Geschirr in die winzige Küche brachte und auf der Spüle abstellte, die einigermaßen aufgeräumt wirkte. Aus einem Schrank nahm sie drei Kuchenteller und griff nach der Küchenrolle, die neben dem Herd stand.
Gero nahm ein sauberes Glas und füllte es mit Mineralwasser. »Klar. Vorgestern gab’s Königsberger Klopse.« Er stellte das Glas vor Leon ab, der es ignorierte, weil er auf eine riesige Plüschrobbe einbrabbelte, die er von Geros Sofa auf seinen Schoß gezogen hatte.
Juliane folgte ihrem Bruder ins Wohnzimmer, das gleichzeitig sein Arbeitszimmer war. »Ich rede von selbst gekochtem Essen. Nicht von Fertiggerichten.«
Gero verteilte die Waffeln auf die drei Teller. »He, immerhin hatte ich mir Kartoffeln dazu gekocht.« Er setzte sich neben seinen Neffen auf das Sofa, teilte ein Dreieck von der runden Waffel ab und hielt es Leon vor die Nase. Der griff mit seiner Linken danach –die Rechte umfasste das Plüschtier– und pfropfte sich das ganze Stück in den Mund.
»He, Kumpel«, Gero stupste an die kleine Nase, »du sollst nicht immer so stopfen. Dir nimmt keiner was weg.«
Leon hielt die Hand auf. »Noch meh’«, brabbelte er mit vollem Mund.
»Noch mehr gibt es, wenn der Mund leer ist«, sagte Juliane und legte zwei Blatt von der Küchenrolle auf die Robbe, um sie vor dem herabrieselnden Puderzucker zu schützen, aber Leon riss das Papier unwillig weg und presste sein Gesicht in den Plüsch.
»Patsch aufmachen«, sagte er, als er sein Gesicht wieder hob. Er schob die Robbe zu seinem Onkel hinüber.
»Du kannst Patsch auch selbst aufmachen«, sagte Gero und drehte die Robbe um. Er deutete auf den Reißverschluss an der Unterseite des Plüschtiers. »Du hast es doch schon einmal geschafft. Sieh mal…« Gero zog den Reißverschluss ein kleines Stückchen auf. »Du nimmst den Nupsi zwischen deine Finger, und dann ziehst du daran.«
Leon schüttelte wild seinen Kopf. »Ge’o, mach du auf. Ge’o, aufmachen«, schrie er dabei.
»Nun mach das Viech schon auf, Gero«, stieß Juliane aus. Sie presste die Hände an die Schläfen. »Ich ertrag sein Geschrei heute nicht. Ich hab sowieso schon wahnsinnige Kopfschmerzen… Hoffentlich sind die Ferien bald zu Ende.«
Gero widersprach nicht. Juliane sah blass aus. Und viel älter als die achtunddreißig Jahre, die sie war. Sein Blick verharrte einen Moment auf ihrer linken Hand, an der der kleine Finger und der Ringfinger fehlten. Die Narben, die sich den gesamten Unterarm hinaufzogen, verschwanden unter einem Langarmshirt.
Das Mitleid mit ihr überwältigte ihn wieder einmal. Sein Brustkorb zog sich zusammen. Was hatte sie nur verbrochen, dass das Schicksal ihr so viel Leid zumutete?
Um das Quengeln des Jungen zu beenden, zog er den Reißverschluss auf und legte die Robbe zurück auf Leons Schoß.
Der war sofort ruhig. Mit einem breiten Grinsen fummelte er aus der Öffnung drei kleine pastellfarbene Robbenbabys heraus. »Wieder hein«, murmelte er und stopfte sie in die Plüschtiermama zurück. Dann begann das Spiel von Neuem. »Wieder haus.«
»Wieder raus«, korrigierte Gero seinen Neffen. »Rrrrrr, Leon, rrrrrr. Versuch doch mal das Rrrr. Rrrraus und rrrrein und–«
»Gero!« Julianes Stimme klang mehr als gereizt. »Hör bitte endlich damit auf, ihn zu verbessern. Akzeptiere einfach, dass mehr nicht geht.«
Geros Hand fuhr durch Leons dunkelblonden Schopf mit dem Wirbel am Hinterkopf. »Aber vielleicht könntest du den Logopäden noch mal wechseln. Leon wird nächsten Monat zehn. Da muss doch noch mehr drin sein. Ein neuer Ansatz könnte vielleicht–«
»Hör auf, Gero. Ich kann es nicht mehr hören.« Juliane schob ihren Teller mit der nicht angerührten Waffel von sich. Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. »Seit sieben Jahren renne ich jede Woche mit ihm zur Logopädie, zur Krankengymnastik… Wir haben schon so viel geschafft. Man kann ihn gut verstehen.«
Geros Blick verharrte auf Leons Gesicht, das ihn jetzt anstrahlte. Wie die kleine Rosmarie auf dem alten Foto: das herzliche Lachen, das die Freude am Leben so intensiv ausdrückte. Die leicht schräg stehenden Augen, die durch eine mattblaue Brille so herrlich neugierig in die Welt blickten und sie als besser betrachteten, als sie war. Geros Hand glitt zart über die Wange des Kindes. Unverkennbar gehörten Leon und Rosmarie einer gemeinsamen Familie an. Der großen Familie der Down-Syndrom-Menschen. Mit dem Unterschied, dass Rosmarie lange tot war.
»Entschuldige, ich bin ein Idiot.« So fühlte er sich wirklich. Anstatt seine Schwester aufzubauen, machte er ihr auch noch Vorwürfe. »Leon hätte keine bessere Mutter haben können als dich, Julchen. Manchmal fehlt mir einfach noch deine Einsicht, dass er einige Grenzen einfach nicht überschreiten kann.«
Beide schwiegen einen Moment und betrachteten Leon, der nicht aufhörte, die kleinen Robben in den Bauch des riesigen Plüschtiers hineinzustopfen, um sie sofort wieder herauszufischen. »Wieder hein… wieder haus.«
»Allerdings gibt es eine tolle Neuigkeit.« Gero war sich bewusst, dass er den Bogen vielleicht überspannte, aber er musste es noch loswerden. »Wir haben doch schon so oft über diese Delphin-Therapie gesprochen, Julchen. Ich hab tausend Euro dafür klargemacht.«
Juliane schloss die Augen. Müde lächelnd sagte sie: »Na toll, dann ist ja schon mal ein Flug bezahlt. Warte…« Sie öffnete die Augen und tat, als müsste sie angestrengt überlegen. »Ja, dann fehlen ja nur noch die übrigen vierzehntausend Euro für die Therapie, die Unterbringung, den Lebensunterhalt in den USA und den zweiten Flug.«
»Zweitausend kann ich beisteuern. Das hab ich dir schon so oft gesagt.«
»Und ich habe dir genauso oft gesagt, dass ich keinen Cent von dir annehmen werde. Du hast doch selbst nichts in die Suppe zu bröseln. Da werde ich garantiert nicht dein sauer Erspartes annehmen. Allerdings würde mich interessieren, woher du die tausend Euro zauberst.«
Gero warf einen versteckten Blick auf seine Armbanduhr. Er würde Karen verpassen, wenn Juliane und Leon nicht bald gingen. »Ich schreibe doch diese Reportage über die Wenckenbergs. Ich hatte dir davon erzählt.«
Juliane nickte. »Und?«
»Du weißt, wie stark das Engagement dieser Familie für behinderte Menschen ist.«
»Ja, klar. Sie sind beispiellos.«
»Eben. Ich habe Amon Wenckenberg von Leon erzählt, und er hat mir, ohne zu überlegen, das Geld angeboten. Vielleicht kann ich sogar noch einen Tausender bei ihm lockermachen. Die Wenckenbergs haben Stiftungen ins Leben gerufen, und da gibt es Töpfe, aus denen sie gern verteilen. Außerdem soll ich vielleicht seine Biografie schreiben. Dann kommt jede Menge Geld rein, und du kannst auch von mir ohne schlechtes Gewissen einen Teil davon annehmen.«
Juliane stand auf. »Ich weiß, dass die Wenckenbergs gern geben. Auch ich und Leon haben schon davon profitiert, so wie jede Itzehoer Familie mit behinderten Familienmitgliedern. Es ist dann Geld, das an Institutionen fließt. Schulen, Kindergärten, Betreuung für Freizeiten, was weiß ich. Aber untersteh dich, für Leon und mich persönlich zu betteln.«
Sie ging um den Couchtisch herum, klappte Leons restliches Waffelstück zusammen und drückte es ihm in die Hand. Er ließ die Robbe los, und Juliane nahm sie und warf sie auf den Sessel. »Wir müssen los, Leon. Unser Bus fährt gleich.«
»Patsch mitnehmen?« Er schmatzte, während seine puderzuckerverschmierte Hand auf das Plüschtier deutete.
»Nein, du weißt, dass sie hierbleibt, mein Schatz«, sagte Juliane, küsste ihn auf den Scheitel und zog ihn an der freien Hand hoch. »Für das Riesenviech haben wir keinen Platz. Und außerdem freust du dich doch viel mehr, wenn du Gero besuchst und Patsch hier auf dich wartet.«
»Die Wenckenbergs suchen übrigens nach einer Haushaltshilfe. Ganztägig, auf Lohnsteuerkarte«, sagte Gero. »Ich habe überlegt, ob das nicht was für dich wäre? Jedenfalls so als Überbrückung, bis du wieder was in der Pflege gefunden hast.«
»Reichen Leuten den Dreck wegputzen? Nee, danke. Ich will mich um Menschen kümmern, nicht um Möbel. Und in die Pampa fährt doch auch kaum ein Bus, oder? Ein Auto kann ich mir nicht leisten.« Sie überlegte noch kurz, dann sagte sie: »Sorry, Gero, aber das ist einfach nichts für mich. Und außerdem hab ich nächste Woche ein Vorstellungsgespräch bei einem ambulanten Pflegedienst. Ich werde schon schnell was finden.«
Er nickte. »Hab ich mir schon gedacht. Darum hab ich auch nichts gesagt, als Amon mit seiner Schwester über die Stelle sprach.«
»Wir müssen dann«, sagte Juliane und schob Leon aus der Tür. »Sonst verpassen wir den Bus.«
Gero war nicht undankbar, dass seine Schwester jetzt ging. Ein weiterer Blick auf die Uhr verriet, dass er es vielleicht gerade noch schaffen könnte, Karen zu sehen. Er rief Leon, der schon durchs Treppenhaus tobte, »See you!« hinterher.
»Zi ju!«, hallte es zurück.
Dieses Mal war sein Blick auf die Uhr allerdings nicht unbemerkt geblieben. Juliane sah ebenfalls auf ihre Uhr. Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen, als sie Gero wieder ansah. »Du hältst dich hoffentlich von Karen fern? Du… du beobachtest sie doch hoffentlich nicht mehr?«
Gero winkte ab. Allerdings wirkte sein Lachen künstlich, wie er selbst bemerkte. Da nützte auch das verbale Abwehren nichts mehr. »Natürlich nicht. Ich–«
»Wenn du damit nicht aufhörst, wird sie eine richterliche Anordnung erwirken, Gero. Du… du bist doch kein Krimineller! Hör auf, sie zu belästigen. Bitte!«
»Ich bin kriminell?« Wut brachte seinen Herzschlag in Fahrt. »Dieser… dieser kroatische Wichser, den sie sich angelacht hat, der ist kriminell! Sie muss vor sich selbst geschützt werden. Sie ist diesem Typen verfallen.«
Julianes Blick wurde unerbittlich. »Akzeptiere endlich, dass Schluss ist. Niemand hat Karen gezwungen, mit dem Kroaten zusammen zu sein. Sie lieben sich.« Sie nahm die Hand ihres Bruders in ihre. »Menschen trennen sich, Gero. Das ist etwas völlig Normales. Ihr… ihr wart einfach nicht füreinander bestimmt.« Sie deutete auf den Hausflur hinaus. »Irgendwo da draußen wartet auch deine neue Liebe. Du musst Karen endlich loslassen.«
Geros Gesicht versteinerte. »Glaub mir, Josip Markovic ist ein Schwein. Ein Krimineller. Meine Recherchen haben ergeben, dass er Verbindungen zum Kiez hat. Ich sag dir, ich finde raus, in welche dreckigen Geschäfte er verwickelt ist. Und dann wird Karen zu mir zurückkommen.«
»Wenn du dich nur hören könntest.« Juliane ließ Geros Hand abrupt los. »Wenn du damit nicht aufhörst, wird noch ein Unglück geschehen.«
***
Lyn Harms parkte ihren roten Beetle in der Itzehoer Schillerstraße vor dem Grundstück des Nachbarn ihres Vaters, weil die Plätze vor Henning Harms’ Haus besetzt waren.
»Hallo, Herr Petschack«, grüßte sie den Nachbarn freundlich, der ein akkurates Beet von Unkrautwinzlingen befreite.
Er sah auf. »Ach, hallo, Lyn.«
»Was macht die Gicht?«
Er hob den Daumen. »Momentan ist alles im grünen Bereich… Ach, bitte, sag deinem Vater, dass der junge Mann, mit dem er das Haus angeguckt hat, sich vorhin gemeldet hat. Er will es kaufen.«
Lyn sah den alten Mann irritiert an. »Sie wollen verkaufen, Herr Petschack?«
Er nickte. »Was soll ich hier noch allein in dem großen Haus? Den Garten krieg ich nur noch in den Griff, wenn ich mal keinen Gichtanfall hab. Als Hilde noch lebte, war es uns schon zu viel, und jetzt, wo ich allein bin… Ab August wohne ich im Cläre-Schmidt-Senioren-Centrum. Ich krieg mein Haus hier gut verkauft, dann kann ich mir das leisten.«
Lyn nickte. »Eine kluge Entscheidung, Herr Petschack… Sie sagten, mein Vater hat Ihr Haus angeguckt. Mit einem jungen Mann?«
»Jaja. Ich komme grad nicht auf den Namen des Mannes, aber sag deinem Vater schon mal meinen Dank für die Vermittlung.«
»Ich richte es aus. Machen Sie’s gut, Herr Petschack.« Sie ging die paar Schritte zum Grundstück ihres Vaters, von dem Sophies Stimme herüberschallte.
»Hallo, Krümel!« Lyn winkte ihrer Tochter zu, die auf dem Rasen stand und Befehle in Form von »Weiter links!– Oder hinter dem komischen Busch.– Versuch noch mal weiter links!« in Richtung Beet gab. Zu sehen war allerdings niemand.
»Was treibst du da?« Lyn öffnete die schmiedeeiserne Gartenpforte, die ein hässliches Quietschen von sich gab. Jetzt konnte sie den Garten besser einsehen. Hinter einem Ranunkelstrauch kam ein Mädchen hervorgekrabbelt, in dessen langem braunen Haar sich einige Blätter verfangen hatten. »Hallo, Lisa«, begrüßte Lyn die Freundin ihrer Tochter.
»Wir werfen Stöckchen für Barny«, klärte Sophie ihre Mutter auf. »Aber mein letzter Wurf war zu weit. Das Stöckchen ist im Beet gelandet.«
Die schlaksige Lisa strich sich beim Aufrichten über die Hosenbeine und sandte ein gelangweiltes »Hi, Frau Harms« in Lyns Richtung.
»Super, Barny«, rief Sophie in diesem Augenblick. »Du hast ihn gefunden.«
Der Boxer kam hinter einer riesigen Konifere zum Vorschein. In seinem Maul schleifte er einen Stock hinter sich her, der eine Verniedlichung eindeutig nicht verdient hatte.
»Das ist kein Stöckchen, das ist ein Totschläger«, sagte Lyn. »Krass, dass du das Teil überhaupt so weit werfen konntest, Krümel.«
»Erzähl’s nicht Opa«, sagte Sophie, als Lyn neben sie trat und ihr einen Kuss auf die heiße Wange schmatzte. »Das ist nämlich wirklich sein Totschläger. Den hat er im Schlafzimmer neben dem Nachttisch stehen. Falls Einbrecher kommen. Barny findet den besser als die langweiligen Stöckchen.«
»Opa guckt eindeutig zu viel AktenzeichenXY«, sagte Lyn. »Genau wie du… Ist er drinnen?«
Sophie nickte. »Er badet im Wohnzimmer seinen Fuß. Der ist fett angeschwollen, weil er letzte Nacht über Barny gestolpert und umgeknickt ist.«
»Hatte er seine Brille mal wieder nicht auf?«
»Die hätte ihm auch nichts genützt. Er hat kein Licht angemacht, als er in der Küche was trinken wollte. Er wollte Barny nicht aufwecken. Aber Barny hat gar nicht geschlafen. Wenn er in seinem Korb gelegen hätte, wäre Opa ja nicht über ihn gestolpert.«
»Oh Mann«, murmelte Lyn genervt, »können wir nicht mal wie ’ne normale Familie sein?«
Sophie lachte auf. »Das sagen die Freeses auch immer.«
»Die Freeses?« Lyn hob die Schultern. »Muss ich die kennen? Aus der Schule?«
»Mensch, Mama, ich mein die Freeses von NDR2. Comedy. Kommt jeden Morgen im Radio. Und bei Facebook hab ich die auch. Spiel ich dir mal vor. Ist dein Humor.«
Lyn grinste. »Haben deine Freeses auch so einen bekloppten Opa wie wir?«
Sophie winkte ab. »Nee, die haben Oma Rosi. Gegen die ist Opa harmlos.«
»Na dann…« Lyn ging Richtung Haustür, blieb aber nach zwei Metern wieder stehen. »Lisa, du stellst dich hinter Sophie, wenn sie die Keule wirft«, rief sie dem Mädchen zu, das sich auf den Rasen gehockt hatte und flink auf einem Smartphone herumtippte. »Wenn du den Mörderknüppel an den Kopf kriegst, ist nämlich Schluss mit Chatten und Facebook.« Lyn deutete Richtung Himmel. »Da oben gibt es kein Internet.«
Lisa sah Lyn von unten herauf an, während sich ihre Oberlippe an einer Seite genervt hochzog. »Chillen Sie mal, Frau Harms. Gott twittert da oben bestimmt, was das Zeug hält. Mit coolen Hashtags. Der hat doch einen Sohn, der übers Wasser laufen kann.«
Lyn öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Dann setzte sie ihre Ich-dulde-keine-Widerworte-Miene auf. »Hashtag: Lisa sofort raus aus Wurfzone. Hashtag: Sonst Arsch voll.«
Mit einem gelangweilten »Ja, ist ja gut« bequemte Lisa sich schließlich aus der Gefahrenzone.
Sophie zerrte bereits wieder an dem Knüppel in Barnys Maul, den der nur widerwillig herzugeben schien. Lyn war dankbar, dass der Hund beschäftigt war. So sprang er sie wenigstens nicht an.
Im Haus ging sie schnurstracks Richtung Wohnzimmer. Ihr »Hallo, Papa, ich…« erstarb, als ihr Blick auf den Behälter fiel, in dem Henning Harms seinen nackten Fuß in einer milchigen Lauge badete. Die olivgrüne Cordhose hatte er bis zum Knie aufgekrempelt.
Entsetzt sah sie ihn an. »Du… du badest deinen Fuß im…?« Sie schüttelte sich. »Sag, dass das nicht der Bräter ist, in dem du an Weihnachten die Ente brätst. Sag, dass es ein altes Ding ist. Bitte, bitte.«
»Stell dich nicht so an, Lyn. Ich wasche ihn doch gründlich ab. Außerdem hätte ich es nicht gemacht, wenn es in diesem Haus eine Plastikschüssel geben würde, in die meine Riesenfüße hineinpassen. Der Bräter war die einzige Möglichkeit.«
Lyn ließ sich auf den Sessel fallen. »Ich hätte Weihnachten gern einen Salatteller.«
»Papperlapapp. Außerdem wird sich deine Laune gleich bessern. Vera wird jeden Moment hier sein.«
Lyn hätte beinahe erneut das Gesicht verzogen. Wieso glaubte ihr Vater, seine Freundin könne ihre Laune bessern? Das Gegenteil war eigentlich immer der Fall. Die blondierte Zweiundsechzigjährige hatte etwas an sich, mit dem Lyn nicht warm werden konnte. Ohne genau benennen zu können, was es war. Die Chemie stimmte einfach nicht.
Lyn beugte sich vor und stierte in den ovalen Bräter. »Wie geht es deinem Fuß? Krümel hat mir berichtet, dass du bei nächtlicher Dunkelheit durch dein Haus latschst, weil du Sabbermauls Schlaf nicht mit Licht stören willst?«
»Er heißt Barny.«
»Und er ist ein Sabbermaul, Papa.«
Ihr Vater lächelte sie nach diesem Satz liebevoll an. Seine nächsten Worte erklärten, warum: »Es ist schön, dass du wieder Papa sagst, Lyn.«
Lyn wusste sofort, worauf seine Bemerkung abzielte. Laut seiner Aussage hatte sie ihn in den vergangenen Jahren immer Vater genannt. Sie hatte das zwar abgestritten, aber es stimmte wohl, dass sie nach dem Tod der Mutter vor vielen Jahren unbewusst auf Distanz gegangen war. Aber sie hatten sich wiedergefunden. Zur Gänze. Er war für sie da gewesen, als ihr Leben vor einigen Monaten kurzzeitig aus den Fugen geraten war.
»Wenn du deine Füße weiter in Kochutensilien badest, sage ich wieder Vater«, drohte sie ihm. »Aber nun sag endlich, warum Vera meine Laune verbessern kann.«
»Weil ich ja lädiert bin«, er hob kurz seinen am Knöchel dick angeschwollenen Fuß aus dem Kochtopf, »darfst du Vera zu dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres begleiten.«
Lyn starrte ihn an. »Ihr wollt zum Wiener Opernball?«
»Unsinn. Ich meine natürlich das Itzehoer Gesellschaftsereignis des Jahres… Na?« Er hob auffordernd die Hände.
Lyn überlegte, was er wohl von ihr hören wollte, da ihr absolut nichts einfiel, was Itzehoe an gesellschaftlichen Großereignissen zu bieten hatte. Von der Wenckenberg-Charity-Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfand, einmal abgesehen. Aber zu der High-Society-Spendengala, die auf Gut Wenckenberg stattfand, hatten die Itzehoer Otto Normalverbraucher kaum Zugang. Eine Eintrittskarte kostete um die tausend Euro. Geld, das die Wenckenbergs für wohltätige Zwecke stifteten. Einrichtungen in ganz Schleswig-Holstein profitierten davon.
»Irgendeine Veranstaltung im Theater Itzehoe? Wird Goethes Faust gezeigt?« Das würde die Begeisterung ihres Vaters erklären.
»Hallöchen, mein Tristan«, flötete es auf dem Flur. Eine leichte Röte bildete sich auf Henning Harms’ Gesicht.
Mein Tristan! Die in drei Monaten stattfindenden Wagner-Festspiele, zu denen ihr Vater Vera eingeladen hatte, warfen anscheinend ihre Schatten voraus. Lyn wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie entschied sich für ein süffisantes Grinsen. »Soll ich raten, wie du sie nennst?«
»Oh, Besuch«, sagte Vera Büchner, als sie das Wohnzimmer betrat. »Hallo, meine Liebe.«
Fünf Worte, und Lyns Reizschwelle war schon überschritten. »Komisch«, sie lächelte Vera an, ohne dass das Lächeln ihre Augen erreichte, »ich habe mich in meinem Elternhaus nie als Besuch betrachtet, auch wenn ich schon vor über zwanzig Jahren ausgezogen bin.« Dass sie es außerdem hasste, wenn Vera sie »meine Liebe« nannte, schluckte sie herunter.
Vera ging nicht auf Lyns Bemerkung ein. Sie beugte sich zu Henning Harms hinab und küsste ihn ausgiebig, bevor sie ihn fragte: »Und? Hast du ihr schon gesagt, wohin sie mich begleiten darf?«
Begleiten darf? Lyn verbat sich eine entsprechende Reaktion. Was bildete die Frau sich ein? Es gab in ihrer Phantasie nichts, was ihre Lust, die Freundin ihres Vaters zu begleiten, wecken könnte. Was auch immer jetzt kam, sie würde dankend ablehnen. Um eines allerdings beneidete sie Vera. Die Qualität ihres Lippenstifts war hervorragend. Nicht eine Spur davon haftete an den intensiv geknutschten Lippen ihres Vaters.
Vera ließ ihr perfektes weißes Gebiss blitzen, als sie sich Lyn zuwandte. »Ich habe zwei Karten für den Ball auf Gut Wenckenberg morgen. Das Charity-Event in Schleswig-Holstein, meine Liebe. Und da dein Vater nicht mobil ist, würde ich dich einladen. Wenn du magst.«
Lyn presste schnell die Lippen zusammen, auf denen das Nein bereits tänzelte. Der Wenckenberg-Ball! Vielleicht wäre ein Nein doch übereilt. Schließlich berichtete sogar die Bunte über das Itzehoer Ereignis und präsentierte den Leserinnen die eleganten Ballkleider der Gäste. Und es waren immer einige deutsche Schauspieler unter der Gästeschar. Gab es nicht auch im Vorwege ein exklusives Galadinner eines Starkochs?
»Das… äh… klingt verlockend«, gab Lyn zu, »aber –entschuldige, dass ich frage– wie kommst du zu zwei Eintrittskarten?« Lyn war sich sicher, dass Vera ihr die Frage nicht übelnahm. Vera war Friseurmeisterin. Aber obwohl sie ein florierendes Geschäft in der Itzehoer Innenstadt betrieb, würde sie kaum zweitausend Euro für die Karten berappt haben.
»Nun«, Vera lachte auf, »ich habe keinen Pfennig dazubezahlt. Die Karten sind ein Geschenk. Klara Wenckenberg ist seit mehr als drei Jahrzehnten Kundin in meinem Salon. Sie lässt sich nur von mir frisieren. Ich lasse mich ja nur noch sporadisch im Salon blicken, schließlich habe ich fähige Angestellte, aber die beiden Wenckenberg-Damen frisiere ich immer selbst.«
»Die beiden?«
»Ebba Goste-Wenckenberg ist eine der Stieftöchter der alten Klara. Auch sie ist Stammkundin.« Beim nächsten Satz verzogen sich ihre Lippen missbilligend. »Ebbas Zwillingsschwester Inger Hartmann zieht es eher nach Hamburg zu Oppermann. Eine Itzehoer Meisterin ist ihr anscheinend zu provinziell. Obwohl ich es mit jedem Starfriseur aufnehme.« Ihr Blick glitt dabei über Lyns Kopf. »Hol dir auch gern einen Termin in meinem Salon, bevor wir zur Gala gehen. Ich sag Vivien Bescheid, dass sie dich morgen irgendwo dazwischenquetschen muss, wenn alle Termine vergeben sind.«
Ehe Lyn es verhindern konnte, trat Vera vor sie und fuhr mit beiden Händen in ihr Haar. »Der Schnitt ist gar nicht übel. Da würde ich nicht viel verändern. Vielleicht einen Hauch kürzen. Aber die Farbe können wir etwas intensivieren. Und mehr Volumen werden wir für den Abend hineinfönen. Ein Abendkleid hast du ja bestimmt im Schrank?… Hach, wir werden uns einen wunderschönen Abend machen, meine Liebe.«
Sie setzte sich zu Henning Harms auf die Sofalehne und küsste seinen Scheitel. »Für dich tut es mir leid, aber deine wunderhübsche Tochter wird dich würdig vertreten. Wir werden etliche der Damen ausstechen, was das Aussehen betrifft.«
Lyn war sprachlos. Das Kompliment aus Veras Mund kam überraschend. »Ja, dann… ich freu mich«, stammelte sie und erntete einen dankbaren Blick von ihrem Vater.
Als sie sich verabschiedete, fiel ihr ein: »Ach, ich soll dir von Herrn Petschack vielen Dank sagen. Für die Vermittlung des jungen Mannes, mit dem du das Haus angeguckt hast. Er will es kaufen.« Sie sah ihren Vater an. »Wer ist denn der junge Mann? Wieso guckst du mit dem das Haus an?«
ZWEI
Gero Schlüter drückte sich noch fester in den Hauseingang des Mehrfamilienhauses in der Itzehoer Geschwister-Scholl-Allee, als sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Haustür öffnete. Er hielt den Atem an, als er sah, dass es Karen war. Er hatte gehofft, dass sie heute Abend zur Fitness gehen würde, nachdem er sie heute Mittag vor dem Büro in der Innenstadt knapp verpasst hatte.
Er entspannte sich, als er sah, dass sie allein war. Der Kroate war nicht zu sehen. Er löste sich aus dem Eingang und überquerte die Straße. Karens Schritt stockte, als sie ihn auf dem kurzen Stück Weg zu ihrem am Straßenrand geparkten Auto wahrnahm.
»Karen!« Gero verfiel in Laufschritte.
Einen Moment lang sah es aus, als wolle sie auf dem Absatz umdrehen, aber sie blieb stocksteif stehen, als er vor ihr stand und sagte: »Häschen, ich… ich muss kurz mit dir reden.«
Unwillig entriss sie ihm ihren Arm, über den seine Hand zart glitt. »Verschwinde, Gero! Josip kommt jeden Moment raus. Wenn er dich hier sieht, garantiere ich für nichts.«
»Du spinnst doch. Der Wichser kommt nicht. Du gehst zum Bauch-Beine-Po-Training.« Gero lächelte. »Ich kenn doch alle deine Termine, Häschen. Ich kenne dich.«
Seine Hand zuckte vor und packte Karens Unterarm, als sie die Flucht antreten wollte. Dieses Mal gelang es ihr nicht, seine Hand zu lösen. »Lass mich endlich in Ruhe!« Ihre Stimme wurde schrill und lauter. »Wir haben nichts mehr zu bereden.«
Gero riss Karen an sich heran. Seine Lippen streiften ihre, als er flüsterte: »Der Wichser ist in Drogengeschäfte verwickelt. Er… er zieht dich da mit rein. Das kann ich nicht zulassen. Er…«
Karens erlöstes »Josip!« kam für Gero zeitgleich mit dem Schmerz, als sich stählerne Finger von hinten um seinen Hals krallten und ihn von ihr zurückzogen. Gero kam nicht dazu, auch nur einen Laut von sich zu geben, bevor ein viel intensiverer Schmerz in seinem Bauch ihn in die Knie gehen ließ.
»Du… verdammter… Pisser!« Die Worte kamen mit Pausen aus dem Mund von Josip Markovic, während er Gero wieder auf die Beine zog. Zwischen den Worten rammte er seine Faust in Geros Magen. Abschließend traf Gero eine harte Rechte am linken Auge. Mit einem Aufschrei fiel er zu Boden.
»Josip, hör auf, es reicht!«, hörte Gero dumpf Karens Stimme, in der Erwartung, gleich noch einen Tritt in den Magen zu bekommen. Aber es kamen keine weiteren Schläge.
Mit Schmerztränen in den Augen rappelte Gero sich auf. Er nahm wahr, dass sich ein Ehepaar, das mit einem Hund auf dem Gehweg lief, umdrehte und schnellen Schrittes davoneilte. Von der anderen Straßenseite wurde ihnen allerdings Aufmerksamkeit zuteil.
»Brauchen Sie Hilfe?«, rief ein junger Mann, der seinen Wagen gestoppt und die Seitenscheibe heruntergelassen hatte, Gero zu. »Soll ich die Polizei rufen?«
Josip Markovic lief auf die Straße, blieb aber zwei Meter vor dem Auto stehen. »Ja, Arschloch, ruf die Polizei! Weil ein Scheiß-Ausländer mal wieder einen von euch sauberen Deutschen vermöbelt hat. Das ist doch alles, was ihr seht! Aber dass der Wichser ’nScheiß-Stalker ist, das interessiert euch nicht.«
»Josip«, Karen zerrte am Arm ihres Freundes, »hör jetzt auf, bitte! Lass uns raufgehen.«
Dem Autofahrer seinen Mittelfinger zeigend, ließ Josip sich schließlich von der Straße ziehen. Gero rief er zu: »Und dich mach ich kalt, Arschloch, wenn du ihr noch mal zu nah kommst. Richtig kalt!«
Zu Hause öffnete Gero umgehend das Eisfach seines Kühlschranks, in dem außer zwei Pizzapackungen ein noch bis zur Hälfte befüllter Eiswürfelbeutel lag. Er nahm den Beutel und presste ihn auf sein pochendes Auge. Schmerzerfüllt nahm er ihn sofort wieder herunter.
»Wichser! Scheiß-Kroate«, fluchte er, während er vom Heizkörper das Geschirrhandtuch riss, das dort zum Trocknen hing. Er wickelte den Beutel hinein und drückte ihn wieder auf das Auge. Jetzt war es auszuhalten. Er trat vor den Flurspiegel und nahm die kühlende Packung kurz herunter.
»Fuck.« Die Verfärbung trat bereits ein. Das würde ein schönes Veilchen geben. Und das ausgerechnet vor dem Ball bei den Wenckenbergs. Er presste die Eiswürfel wieder auf die schmerzende Stelle, ging ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen. Doch er sprang gleich wieder auf. Der Gedanke an die Wenckenbergs hatte ihm etwas in Erinnerung gerufen. Er ging zum Schreibtisch, setzte sich auf den Drehstuhl und zog mit der freien rechten Hand die Schublade auf.
»Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da haben«, murmelte er und griff nach dem roten Büchlein aus der Hutschachtel von Klara Wenckenberg. Als er es aufschlug und die Beschriftung auf dem inneren Buchdeckel las, vergaß er einen Moment sein pochendes Auge.
Es war kein Poesiealbum. In feiner Handschrift stand dort mit Tinte geschrieben:
Besondere Tage von Klara Michels
Ab 4.Februar 1941
Auffällig war, dass das Wort »Besondere« durchgestrichen und ersetzt worden war durch das darüber geschriebene Wort »Böse«. Die Korrektur war definitiv zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt worden, denn die wilden Striche und das Wort »Böse« stammten von einem anderen Stift.
Ein Tagebuch! Klara hatte es zweifellos zu ihrem fünfzehnten Geburtstag bekommen, denn in acht Monaten jährte er sich zum neunzigsten Mal.
Gero schlug die erste Seite auf und las. Klara hatte sie tatsächlich an ihrem fünfzehnten Geburtstag beschrieben. Sie erwähnte ihre Freude über das Buch und den Willen, die Seiten nicht an tägliche Nebensächlichkeiten zu verschwenden, sondern nur besonders erwähnenswerte Ereignisse aufzuschreiben. Außer dem Buch hatte sie eigene –das wurde ausdrücklich erwähnt–, von der Mutter gebackene Kekse bekommen und eine neue Bluse. Endlich eine neue Bluse.Die alten Blusen spannen über dem blöden Busen. Ich hasse meinen Busen. Die Jungs starren darauf.
Gero lächelte. Pubertäre Befindlichkeiten. Die waren wohl zu allen Zeiten gleich. Auch heute gab es bestimmt Mädchen, die mit ihren körperlichen Veränderungen haderten, wenn sie begannen.
Er las zwei weitere Seiten. Anscheinend hatte Klara ihrer Schwester Rosmarie ein neues Lied beigebracht, dessen Melodie die drei Jahre Jüngere sofort behalten hatte. Zwei Blümchen mit lachenden Gesichtern hatte sie dahinter gezeichnet.
Gero schluckte, als er den nächsten Absatz las, in dem es ebenfalls um die behinderte Schwester ging. Er war zwei Wochen nach dem ersten Eintrag datiert.
Heute bin ich mit Rosmarie zum Schlachter gegangen. Da haben wir Frau Siebke getroffen. Die war mit ihrer Tochter Lene da. Die kriegt ein Kind. Frau Siebke hat sich erschrocken, als sie Rosmarie gesehen hat, und hat ihrer Tochter etwas ins Ohr geflüstert. Aber ich habe es trotzdem verstanden. »Dreh dich nicht um, Lene, die Michels Klara steht hinter uns. Mit ihrer verhexten Schwester. Guck die nicht an, hörst du! Du darfst die auf keinen Fall angucken. Du hast ein Kind im Bauch.«
Auf dem Heimweg hab ich geweint. Weil ich so traurig war und auch vor Wut auf die alte Siebke. Rosmarie ist nicht verhext! Ich hoffe, sie kriegen auch ein Idiotenkind. Dann sehen die mal, wie das ist.
Gero atmete tief durch. Das war starker Tobak. Klara hatte diese Frau für das, was sie über die geliebte Schwester gesagt hatte, gehasst. Und doch nannte sie selbst Rosmarie ein Idiotenkind.
Das spiegelte wohl eindrücklich wider, wie damals über Behinderte gedacht wurde. »Idiot« war eine gängige Bezeichnung für Menschen mit geistiger Behinderung gewesen, wie Gero wusste. Auch in Lehr- und medizinischen Fachbüchern war der Begriff Idiotie gebraucht worden.
Bei seinen Recherchen zu Rosmarie war ihm so manches Mal eine Gänsehaut über die Arme gelaufen. Schon vor 1920 war die Saat gelegt worden, die die Nationalsozialisten Jahre später zu ungeheuerlichen Auswüchsen getrieben hatten. Die geistig Behinderten waren für lebensunwert, zu Ballastexistenzen erklärt worden. Eine Gesellschaft der Elite hatten die Anhänger der Eugenik schaffen wollen. Ärzte und Biologen hatten gehofft, Einfluss auf die Fortpflanzung der Menschen nehmen zu können. Die Kranken und Behinderten, die »rassisch Minderwertigen«, sollten ausgemerzt werden, während die »Hochwertigen« viele Kinder bekommen sollten.
Mit Tränen in den Augen hatte Gero damals das Recherchebuch zugeklappt. Leon, sein geliebter, fröhlicher Leon, sollte ein unwertes Leben haben? Sollte ein Parasit sein? Gero betete nicht oft. Eigentlich nie. Aber nach der Recherche hatte er Gott ausdrücklich dafür gedankt, dass Leon in der heutigen Zeit aufwachsen durfte.
Die andere Hand weiterhin auf das schmerzende Auge gepresst, sah er aus dem Fenster in den langsam dunkler werdenden Himmel. Klara war nicht immer die wohlhabende Wenckenberg-Matriarchin gewesen, sondern ein junges Mädchen aus einem weiß Gott nicht vermögenden Elternhaus in Cuxhaven. Ein Mädchen, das damals nicht gewusst hatte, wie ihre Zukunft aussah. Ein Mädchen mit den Sorgen und Problemen aller Jugendlicher ihrer Zeit. Ein Mädchen mit Wünschen und Träumen.
Gero knipste die Schreibtischlampe an, um weiterzulesen. Eine Seite war einer Erkrankung der Mutter gewidmet. Das schien Klara belastet zu haben. Und doch, da war sich Gero sicher, spiegelte dieser kurze Eintrag kaum wider, was sich wirklich in Klara abgespielt hatte. Sie hatte ihren eigenen Gefühlen wenig Raum in diesem Buch gegeben.
1941
»Zisch ab, du Blödmann«, schrie Klara und trat nach dem schlaksigen Jungen, der gemeinsam mit zwei weiteren Jungen den Singsang fortsetzte, den sie begonnen hatten, als sie Klara entdeckten, die mit ihrer Schwester Rosmarie an der Hand die Cuxhavener Delftstraße entlanglief.
»Rosmarie, Rosmarie, macht in ihre Hose Pipi. Rosmarie, Rosmarie, macht in ihre Hose Pipi. Rosmarie…«
»Das sag ich Eckart«, rief die fünfzehnjährige Klara, die lachende Rosmarie hinter sich herziehend, »dann verdrischt er euch, dass ihr grün und blau ausseht.«
»Bis dein großer Bruder hier ist, sind wir über alle Berge«, sagte der Schlaksige und stellte sich grinsend vor Klara.
Klaras Wut steigerte sich ins Unermessliche, als sie merkte, dass sein Blick auf ihrem Busen verweilte, der den Stoff ihres Kleides spannte. Tränen der Scham traten in ihre Augen, als er sang: »Klaralein, Klaralein, hat Hügel im Kleidchen fein. Klaralein, Klaralein, hat Hügel im– Aua! Spinnst du?«
Das Gelächter der anderen beiden Jungs begleitete seinen Schmerzensschrei. Dieses Mal hatte Klara sein Schienbein mit voller Wucht getroffen. Nachdem er einmal heftig an ihrem langen Zopf gezogen hatte, trollte er sich schließlich mit seinen Kumpanen.
»Rosmarie, Rosmarie…«, sang Rosmarie fröhlich nuschelnd ihren Namen, die Melodie der Jungs imitierend.
»Halt die Klappe«, rügte Klara ihre Schwester. »Das ist nicht lustig, was die singen.«
Doch Rosmarie nuschelte und summte vergnügt weiter vor sich hin, während sie einen leeren Blecheimer schwang. Die beiden Mädchen waren nach dem Mittagessen aufgebrochen und hatten im Eimer Dahlienknollen zu einer Freundin der Mutter gebracht. Klara war froh, dass die Jungen ihnen nicht folgten, als sie die Autowerkstatt in der Westerreihe passierten.
Die Werkstatt war bis vor zwei Jahren eine jüdische Synagoge gewesen. Jetzt gab es in Cuxhaven keine Juden mehr. Und das war auch gut so. Klara konnte sich an die wenigen Juden, die in Cuxhaven gelebt hatten, nicht erinnern, doch es mussten schlechte Menschen gewesen sein. Ihr sechzehnjähriger Bruder Eckart hatte mit seiner Kameradschaft der Hitlerjugend einen Film gesehen, in dem die wahre Natur der Juden gezeigt worden war. Dreckig und krankheitsbringend wie Ratten, so hatte er berichtet, fielen sie aus Osteuropa ein. Einige tarnten sich geschickt als Geschäftsleute. Bei dem, was Eckart ihr erzählt hatte, war es Klara kalt den Rücken hinuntergelaufen.
Die Mutter hatte den Film im Kino sehen wollen, aber der Vater nicht. Die Eltern hatten sich deswegen sogar gestritten. Klara war es egal. Was gingen sie die grässlichen Juden an? Sie hatte genug Kummer mit den Jungs aus ihrer Klasse. Sie ärgerten sie, was das Zeug hielt. Wenn sie die Jungen schon von Weitem sah, grauste es Klara. Und wenn sie dann noch Rosmarie im Schlepptau hatte, war es doppelt schlimm. Aber sie traute sich nicht, der Mutter zu sagen, dass sie ihre Schwester nicht mitnehmen wollte. Und sie schämte sich auch dafür. Schließlich genoss Rosmarie jeden Spaziergang.
»Komm, Sternchen, wir jagen die Gack-Gacks«, sagte Klara, als sie zu Hause ankamen, und küsste ihre Schwester auf die Wange, nachdem sie den schmalen Durchgang zwischen dem Eltern- und dem Nachbarhaus passiert und den kleinen Hinterhof erreicht hatten, auf dem fünf Hühner im Dreck scharrten. Sie ließ Rosmarie los und rannte mit einem »Ksch-ksch« durch die Tiere hindurch, dass sie gackernd flohen. Rosmarie lachte herzhaft und machte es Klara nach. Nur dass ihre Gangart plumper war.
»Hört auf, die Hühner zu jagen«, erklang Eckarts gereizte Stimme. Den siebenjährigen Bruder Peter im Schlepptau, war er aus dem Haus gekommen. »Dann legen die keine Eier mehr.«
Klara tippte sich an die Stirn. »Blödsinn.«
Peter lachte. Eckart verpasste ihm einen Tritt in den Hintern. »Los, komm, wir marschieren.«
Im Gleichschritt liefen die beiden Jungen –der Kleine hinter dem Großen– im Karree auf dem Hof. »Uns’re Fahne flattert uns voran… In die Zukunft zieh’n wir Mann für Mann«, sang Eckart aus Leibeskräften. Er trug seine Hitlerjugend-Uniform, weil er nachher mit der Sammelbüchse losgehen würde, um für die tapferen Soldaten an der Front zu sammeln. Peter klang ein wenig schwächer, aber auch er war textsicher. Eckart liebte es, ihn zu drillen. Und Peter konnte es nicht erwarten, endlich bei den Pimpfen mitmarschieren zu dürfen. »Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot…«
Klara mochte die Melodie des Liedes, aber sie hörte es zu oft. »Lass uns reingehen«, sagte sie darum zu Rosmarie.
Es machte Mühe, die aufgedrehte Schwester von den Hühnern fortzuholen. Sie schob sie zur Hintertür hinein in die Küche, wo die Mutter gerade den Auszug mit den Emailschüsseln in den Küchentisch zurückschob. Klara freute sich. Der Abwasch war glücklicherweise beendet.
»Wie läufst du denn nur wieder rum, Klara?« Alma Michels schüttelte missbilligend den Kopf, während sie Rosmarie den leeren Eimer aus der Hand nahm, den die gegen den Küchenhocker schlug, wobei sie das dumpfe Geräusch fortwährend mit »Bum… Bum… Bum…« begleitete.
Schuldbewusst tasteten Klaras Hände nach ihren Zöpfen. Aus dem linken hatte sich eine Strähne gelöst. Sie zog das Haarband heraus, löste die einzelnen Strähnen bis zur Hälfte des Zopfes, um sie dann flink wieder zusammenzuflechten. »Der Willi, der Blödmann, hat dran gerissen«, sagte sie dabei. »Ich hasse Jungs.« Den Blick hielt sie starr zu Boden gerichtet. Wenn die Mutter so betrübt und kränklich dreinblickte, mochte sie sie nicht anschauen.
Ein schwerer Husten plagte die Mutter seit Wochen. Sie hatte keinen Appetit und wurde immer dünner. Doch mit ihrer Äußerung entlockte Klara der Mutter ein zartes Lachen. »Glaub mir, mein Kind, das wird sich noch ändern. In ein, zwei Jahren wirst du Jungs durchaus nett finden.«
»Niemals«, beharrte Klara.
Für Alma Michels war das Thema beendet. Sie wies auf das kleine Küchenbüfett. »Nimm den Branntwein, Klara, und reib dem Vater den Stumpen ein. Er hat Schmerzen. Ich muss in den Schuppen zurück und die Kochwäsche aus dem Bottich holen. Und du…«, sie griff nach Rosmaries Hand, »kommst mit mir.« Hustend nahm sie von einem Haken an der Küchentür eine grobe, verdreckte Schürze und band sie Rosmarie um.
»Aber soll ich nicht erst dir helfen, Mutti?« Klara sah ihre hustende Mutter besorgt an. »Die nasse Wäsche ist doch so schwer.«
Alma Michels kamen die Tränen vom Husten, doch sie winkte ab. Mit erstickter Stimme sagte sie: »Lass nur. Deine Brüder sind ja draußen. Eckart kann mir helfen.«
Klara sah ihrer behinderten Schwester hinterher, als sie mit der Mutter nach draußen ging. Sie hätte jetzt gern mit ihr getauscht. Um Rosmarie zu beschäftigen, würde ihre Mutter ihr wie gewohnt zwei Kohleeimer hinstellen, in die Rosmarie die Kohle Stück für Stück von dem großen Haufen, der in einem hölzernen Verschlag im Schuppen lagerte, hineinlegen würde. Sie würde dabei zählen. Das hatte Klara ihr beigebracht. Bis fünf schaffte Rosmarie es fehlerfrei, dann kamen jedes Mal die Sieben und die Neun. Aber Klara war sich sicher, dass sie das auch noch hinkriegen würde. Rosmarie war nicht so dumm, wie die Leute glaubten.
Klara seufzte. Oder doch? Schließlich war Rosmarie schon elf Jahre alt und konnte gerade einmal bis fünf zählen. Schreiben konnte sie gar nicht. Was nicht nur daran lag, dass sie nicht zur Schule ging. Der Vater hatte versucht, ihr das Lesen und Schreiben beizubringen, war aber kläglich gescheitert. Bis auf ihren Namen, den sie in Großbuchstaben nachzeichnen konnte, wenn man ihn ihr vorschrieb, gelang es ihr nicht, Buchstaben zu Wörtern zu verbinden. Als Lehrer schmerzte es den Vater wohl besonders, mutmaßte Klara. Jahr für Jahr nahm er wieder Anlauf, doch Rosmarie verstand einfach nicht, was er von ihr wollte. Singen dagegen konnte Rosmarie wunderbar. Sie kannte jede Melodie der Lieder, die Klara ihr vorsang. Nur der Text war manchmal kaum zu verstehen, weil Rosmarie so nuschelte.
Widerwillig ging Klara zu dem kleinen Küchenbüfett. Bevor sie nach der Flasche mit dem Franzbranntwein griff, zog sie den gläsernen Schieber mit dem Zucker aus seiner Vorrichtung, leckte den Zeigefinger an und bohrte ihn hinein. Dann steckte sie den Finger in den Mund und ließ den Zucker genüsslich auf der Zunge zergehen. Mit der Flasche ging sie schließlich in die gute Stube, wo der Vater auf einer grauen Decke auf dem Sofa seine tägliche Mittagspause verbrachte.
»Ach gut, Klärchen«, begrüßte er sie mit einem Nicken. »Das Wetter schlägt um. Heute tut es höllisch weh.«
Klara schob den Holztisch mit den dünnen Beinchen, auf dem ein Stapel Diktathefte lag, zur Seite und ging vor dem Sofa auf die Knie. Während Hermann Michels sein Bein mit einem Stöhnen anhob, nahm Klara ein verschlissenes, mehrfach zusammengefaltetes Laken von der Lehne des Sofas und breitete es unter dem Oberschenkel des Vaters aus. Der Vater legte das Bein ab, und sie öffnete die Flasche mit dem Branntwein. Sie musste aufpassen, dass sie nichts verschwendete. Das Geld war knapp.
Mit bloßen Händen begann sie, die streng riechende Flüssigkeit vom Oberschenkel abwärts in die Haut einzumassieren. Viel Haut gab es nicht einzureiben, denn das Bein des Vaters endete oberhalb der Stelle, wo einmal das Knie gewesen war.
Ihr Blick suchte die Prothese, die an einen der drei Stühle im Raum gelehnt war. Sie wurde mit einer Ledermanschette am Stumpen befestigt, aber ihr Vater trug sie nicht immer, weil der Stumpen an vielen Tagen stark schmerzte und die Prothese den Schmerz verschlimmerte. Im Haus benutzte der Vater zumeist seine Krücken.
Klara hasste es, die wulstigen Narben unter ihren Fingerkuppen zu erspüren, aber eher würde sie sich die Zunge abbeißen, als ein Wort darüber zu verlieren, denn der Vater liebte die Massagen. Um sich abzulenken, begann sie, das Lied zu summen, das sie heute in der Schule gesungen hatten. Freudig bemerkte sie, dass es dem Vater gefiel, anstelle eines Schlagers ein Volkslied zu hören.
Nach kurzem Lauschen begleitete er ihr Summen mit seiner dunklen Stimme: »…schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. Die Bäume stehen voller–«
Er brach ab, weil Klaras Bruder Eckart in die Stube stürzte. »Vater! Die Mutter… schnell! Du musst kommen. Sie liegt im Schuppen und rührt sich nicht.«
»Gib mir die Krücken!«, wies Hermann Michels seinen Sohn an, während er schon auf seinem gesunden Bein stand.
Klara rannte bereits über den kleinen Flur zur Hintertür. »Mutti!«, rief sie dabei weinend. Als sie den Schuppen erreichte, standen der kleine Peter und Rosmarie um die Mutter herum, die –zu Klaras immenser Erleichterung– auf dem nackten gepflasterten Boden hockte und hustete.
»Es geht schon wieder«, kam es über Alma Michels’ Lippen, als Hermann und Eckart schließlich dazukamen. Sie versuchte, sich aufzurichten. »Was für ein Aufstand«, murmelte sie. »Wegen mir. Ich… mir ist schwindlig geworden. Jetzt… jetzt geht es wieder.«
Mit Hilfe von Eckart stand sie auf und putzte sich den Dreck von Kleid und Schürze. »Du kannst zurück in die Mittagsstunde gehen, Hermann«, sagte sie, ihren Mann anblickend. »Wir kommen hier klar.« Sie musste sich vornüberbeugen, als ein erneuter Hustenanfall sie nach der Hand des Sohnes greifen ließ und ihre Worte Lügen strafte.
»Führ sie ins Haus«, wies Hermann Michels seinen Sohn scharf an, »und du gehst zu Dr.Schink, Klara. Er soll kommen, sobald er kann. Sag, dass es der Mutter sehr schlecht geht.«
»Aber–«, wandte Alma ein, doch sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn Hermann Michels fiel seiner Frau ins Wort.
»Nichts aber. Jetzt wird getan, was ich sage.« Er stieß den kleinen Peter an. »Nimm Rosmarie und bring sie ins Haus. Und dann spielst du mit ihr, hast du verstanden?«
Klara brauchte im Dauerlauf zehn Minuten bis zur Praxis des alten Dr.Schink, der versprach, noch am Nachmittag vorbeizukommen. Seine Antwort gab sie umgehend weiter, als sie wieder zu Hause war. Ihre Eltern waren im Schlafzimmer. Die Mutter lag im Bett, der Vater saß auf der Bettkante.
»Das ist gut«, sagte Alma zu ihrem Mann. »Mit Medizin wird es mir schnell besser gehen. Rosmarie kann also hierbleiben.«
»Ich will keine Widerrede mehr hören, Alma«, sagte Hermann Michels, ohne sich weiter um Klara zu kümmern, die in der Schlafzimmertür stehen geblieben war. »Wir geben die Rosi doch nur so lange weg, bis du wieder ganz gesund bist. Der Doktor kennt bestimmt ein Heim, das nicht so weit weg ist. Ehe du dich versiehst, ist sie schon wieder da.«
Klara sah von einem zum andern. Der Vater hatte schon einmal davon gesprochen, Rosmarie in ein Pflegeheim zu geben. Im letzten Jahr, als die Mutter die erste schwere Bronchitis hatte. Aber sie hatte sich strikt geweigert, ihr Kind fortzubringen.
»Aber der Klaus Bethel«, wiederholte sie jetzt ihre Ängste des vergangenen Jahres, »das weißt du genau, Hermann, der ist in dem Heim gestorben, in das die Bethels ihn gegeben haben. An einer Lungenentzündung. Soll unserem Rosmariechen das Gleiche passieren? Man… man hat doch gar keine Kontrolle, ob die Menschen dort auch vernünftig versorgt werden. Wir lassen Rosmarie hier, ja?«
Der Ausdruck in den Augen der Mutter war bettelnd, aber jetzt, wo es ihr noch schlechter ging als im vergangenen Jahr, ließ der Vater sich nicht erweichen.
»Nein, Alma, jetzt ist Schluss. Der Klaus Bethel war bestimmt schwächlich, sonst wäre er nicht an der Lungenentzündung gestorben. Aber unsere Rosmarie ist doch gesund und kräftig. Und wir holen sie uns schnell wieder, wenn du gesund bist.« Mit einer gewissen Strenge sagte er: »Also sieh zu, dass du schnell auf die Beine kommst. Umso eher hast du sie wieder hier.«
Klara nickte ihrer Mutter aufmunternd zu. In so einem Heim gab es bestimmt viele Kinder wie Rosmarie. Die Ärzte und Schwestern kannten sich also aus. Sie würden sich gut um Rosmarie kümmern.
Gero schluckte.
Klaras letzter Satz zur Krankheit ihrer Mutter lautete: Rosmarie wird in eine Pflegeanstalt in Lüneburg gehen, bis Mutti wieder auf dem Damm ist. Der Doktor meldet sie dort an. Ich beneide Rosmarie um die schöne Reise.
Geros Finger strich über die blasse Tinte. Klara hatte es nicht besser gewusst. Hatte nicht geahnt, inwiefern dies Rosmaries Schicksal einmal besiegeln würde.
Er vergaß den pochenden Schmerz in seinem Gesicht, während er weiterlas. Die in säuberlicher Jungmädchenschrift beschriebenen Seiten brachten ihm Klara Wenckenberg näher, als es all die Zeitungsartikel und Berichte über sie jemals möglich gemacht hätten. Er musste Klara unbedingt noch einmal sprechen. Also sollte er morgen auf dem Ball einen guten Eindruck bei ihr hinterlassen, damit sie ihm ein Interview gewährte.
Gero stutzte, als er bei den letzten eng beschriebenen Seiten anlangte– die folgenden Blätter waren weiß. Klara hatte das Schreiben eingestellt, bevor das Buch vollgeschrieben gewesen war. Die Eintragungen stammten aus den Jahren 1943 und 1944.
»Holla!«, stieß er begierig umblätternd aus. »Wer hätte das gedacht.« Es konnte keine Rede mehr davon sein, dass Klara mit ihren Gefühlen hinter dem Berg gehalten hatte.
Erschüttert las er schließlich die letzten Einträge, die nicht mehr fein säuberlich, sondern in fahriger Handschrift die Seiten füllten. Ein Blatt war anscheinend herausgerissen worden.
»Mein Gott.«
Er blätterte zurück und begann noch einmal zu lesen, um sich zu vergewissern, dass er alles richtig verstanden hatte. Kein Wunder, dass Klara auf der ersten Seite die »Besonderen Tage« in »Böse Tage« umgewandelt hatte.
Lange starrte er aus dem Fenster. Ob die Stieftöchter und Amon von diesem Buch wussten? Mit Sicherheit nicht, denn dann hätte Amon ihm die Hutschachtel nicht überlassen, und Inger Hartmann hätte nicht den Bediensteten Boldt geschickt, sondern wäre persönlich angerauscht gekommen, um ihm die Schachtel zu entreißen.
Er befeuchtete die trockenen Lippen. Sollte er das Wissen, das er jetzt hatte, für sich behalten? Ja, flüsterte eine Stimme in seinem Inneren, die Moral gebietet es.
Er ging zum Kühlschrank und nahm ein kaltes Astra heraus. Auf dem Weg zurück zum Schreibtisch fiel sein Blick auf das Sofa. Die dunkel glänzenden Knopfaugen von Patsch, der Plüschrobbe, schienen ihn anzusehen. Er nahm einen tiefen Schluck aus der Bierflasche und stellte sie auf dem Schreibtisch ab, während er grübelte.
Moral. Wurde sie nicht überbewertet? Und überhaupt…