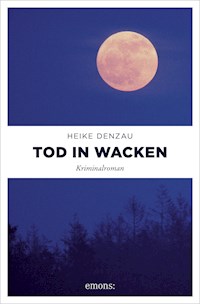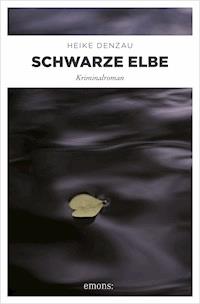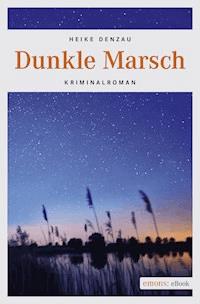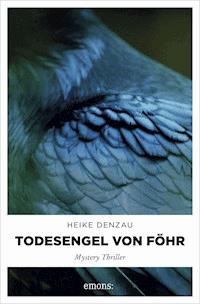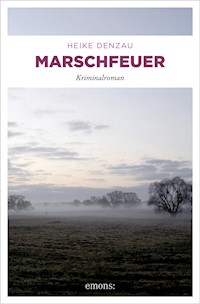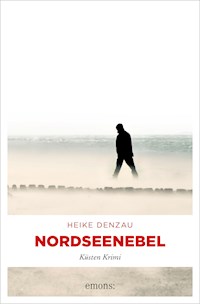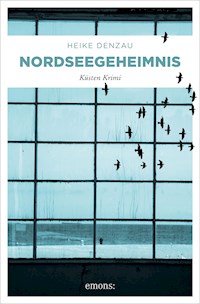Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lyn Harms
- Sprache: Deutsch
Die Hölle im Herrenmoor Wer ist Freund, wer ist Feind? Fragen, die im Fall der Entführung des elfjährigen Theo nicht nur Hauptkommissarin Lyn Harms umtreiben. Auch die Kidnapper selbst wissen nicht mehr, wem sie noch trauen können. Dabei hatte alles so einfach gehen sollen: Das Versteck im Moor war perfekt ausgesucht, der Coup sorgfältig geplant. Doch mit dem unvorhergesehenen Auftauchen zweier Ausreißerinnen eskaliert die Situation für alle Beteiligten, und nicht nur der Polizei läuft die Zeit davon ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Heike Denzau, Jahrgang 1963, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Beim KrimiNordica-Award 2015 erlangte sie den zweiten Platz in der Kategorie »Story«. Ihr Kriminalroman »Die Tote am Deich« war nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis 2012 in der Sparte »Debüt«. Es folgten zahlreiche Kriminalromane. Heike Denzau veröffentlicht außerdem humorvolle Liebesromane.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Silas Manhood/Arcangel Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-600-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Tief atmet er auf, zum Moor zurück.Noch immer wirft er den scheuen Blick:Ja, im Geröhre war’s fürchterlich,O schaurig war’s in der Heide!
Aus »Der Knabe im Moor«von Annette von Droste-Hülshoff
EINS
Kathrin Pinkert setzte den Rollstuhl in Bewegung. Ihr enges Shirt war unter den Armen feucht vom Schweiß. Auch Stirn und Schläfen waren benetzt. Kraftvoll schob sie mit den Händen die metallenen Greifreifen an, um den Rolli in Fahrt zu bringen. Sie sah sich um, während sie sich fortbewegte. Das stillgelegte Firmengelände der Dosenfabrik lag menschenleer vor ihr. Außer dem dunklen »Krah-Krah«, das die Krähen in den blauen Aprilhimmel schrien, herrschte Ruhe. Nur ihr Atem war zu hören. Verärgert drehte sie den Kopf. Wo blieben die Jungs?
In diesem Moment sprang hinter dem ehemaligen Bürogebäude ein Motor an.
»Na endlich«, grummelte sie, weiter vorwärtsrollend. Sie spürte die Anstrengung in den Oberarmen, doch die Muskeln schmerzten nicht. Durch die vielen Sportstunden, die sie im Fitness-Club gab, war sie trainiert.
Das Motorengeräusch schwoll an. Ein Mercedes Sprinter überholte sie und blieb mit quietschenden Reifen drei Meter vor ihr stehen. Die Fahrertür wurde geöffnet. Sie schaffte es gerade noch, einen spitzen Schrei auszustoßen, bevor ein Mann mit schwarzer Sturmhaube über dem Kopf bei ihr war und ihr grob ein Tuch auf Nase und Mund presste. Sie zappelte, zerrte an den Armen des Mannes und versuchte erneut zu schreien. Sie hörte, wie die hintere Tür des Sprinters geöffnet wurde. Dann erschlaffte ihr Körper in den Armen des Mannes. Er ließ von ihr ab.
Ihr Kopf hing über der Rückenlehne, leblos wie ihr übriger Körper, während der Mann hinter den Rollstuhl stürmte und ihn mit der reglosen Last vorwärtsschob – zur offenen Hecktür des Sprinters, in dem ein weiterer maskierter Mann auf den Knien hockte und fluchte.
»Verdammt!« Er riss sich die Sturmhaube vom Kopf und pfefferte sie in die Ecke des Wagens. »Das ist doch zum Kotzen!«
Kathrin Pinkert fuhr hoch. Sie sprang aus dem Rollstuhl. »Sag mal, wie dämlich bist du eigentlich?«, schrie sie. »So blöd kann man doch gar nicht sein!«
Mit einem Satz war sie im Laderaum des Sprinters und schlug mit der rechten Faust auf Arm und Oberkörper des Mannes ein, der schnell aufgestanden war. »Wie kann man es nicht schaffen, in einer Minute diese blöde Platte«, sie stampfte stakkatoartig mit dem Fuß auf der eisernen Platte auf, »aus dem Wagen zu kippen? Wie soll Nick den Rollstuhl in den Sprinter schieben, wenn die Platte nicht draußen ist? Wir haben das jetzt so oft geübt, und nicht ein einziges Mal sind wir in der Zeit geblieben, die wir uns gesetzt haben.«
Sie kam nicht dazu, dem Mann die Ohrfeige zu verpassen, die sie ihm zugedacht hatte. Ihre Hand wurde in der Luft von dem Maskierten abgefangen, der nach ihr in den Sprinter gestiegen war. Grob drehte er ihren Arm nach hinten.
»Au!«, schrie sie. »Lass mich gefälligst los, Nick … Diese Flasche wird uns alles vermasseln!«
»Lass ihn in Ruhe, Kat«, schnauzte Nick Mattow sie an und zog sie vom Wagen. Er gab ihr einen Stoß Richtung Rollstuhl und sprang in den Sprinter zurück. Dort riss er sich die Maske vom Kopf und strich sich die feuchten Haarsträhnen aus der Stirn.
»Leon, komm, das kriegen wir hin.« Er legte dem anderen den Arm um die Schulter. »Hör nicht auf sie.« Er ruckte mit dem Kopf zu Kathrin, die mit ihrer Stiefelette auf den Rollstuhl eintrat. An sie gewandt rief er: »Lass das! Wir brauchen das Ding noch zum Üben.«
»Üb lieber mit der Flasche da, die Platte zu kippen«, stieß sie aus, ein wenig ruhiger. »Und du musst auch noch schneller werden. Ich hatte Zeit für einen kurzen Schrei. Das darf nicht passieren.« Sie ging ein paar Schritte in die entgegengesetzte Richtung und fummelte eine zerknitterte Zigarettenpackung aus der Jeans.
»Sie hat recht, Nick«, sagte Leon Jahn. »Ich bin schuld, dass wir zu langsam sind. Aber mit den Handschuhen hab ich nicht das richtige Gefühl in den Fingern. Ich hab die Platte nicht richtig zu fassen gekriegt.«
»Ist doch kein Ding.« Nick Mattow blieb ruhig. »Wir schweißen dir noch einen kleinen Griff dran. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt ab nach Hause. Für heute reicht’s. Wir können alle eine Dusche gebrauchen. Komm, Leon.« Er knuffte den Jüngeren spielerisch in die Seite. »Wir kriegen das hin. Echt, mach dir keinen Kopf. Das läuft doch schon alles super. Und mit dem Griff wird das ein Kinderspiel.«
Leon Jahn sah zu Kathrin. Die Kippe hing in ihrem Mundwinkel, während sie mit den Fingern eine Pistole formte und auf den Krähenbaum zielte, aus dem das Gekrächze der Vögel immer lauter herüberdrang. Er nickte in Kathrins Richtung. »Das sagst du, Nick, aber Kat …«
»Kat ist einfach nervös. Sie meint das alles nicht so. Wenn wir erst mit den Scheinchen um uns werfen, wird sie auch wieder normal.«
»Ja, klar«, sagte Leon, klang aber nicht überzeugt. Er hob die Sturmhaube auf und klopfte sie auf seinem Bein aus, um den Staub abzuschütteln.
»Noch mal?«, rief Kathrin und schnippte die glühende Kippe weg.
Nick schüttelte den Kopf und sprang vom Wagen. »Feierabend. Ich schweiß nachher einen Griff an die Platte, dann üben wir morgen und übermorgen noch mal.« Er hob den Rollstuhl in den Sprinter. Leon schob ihn in die Ecke und stellte die Bremse fest.
»Vielleicht sollten wir noch mal zum Haus fahren?«, schlug Leon vor, der die ganze Zeit aus dem Fenster starrte, während Kathrins Finger an Nick rumfummelten, der den Sprinter über die A 23 Richtung Elmshorn fuhr.
Nick fegte ihre Hand weg, als sie über seinen Schritt strich. »Spinnst du?« Er sah zu Leon, doch der schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein.
»Pff!« Kathrin zog die Hand zurück, öffnete das Handschuhfach und nahm eine Zigarettenschachtel heraus.
»Beim Haus ist doch alles klar«, sagte Nick und beugte sich vor, um mit seinem Freund Augenkontakt aufzunehmen.
»Aber vielleicht haben wir noch was vergessen.«
»Was denn?«, fauchte Kathrin Leon an, bevor sie die Zigarette anzündete und den Rauch tief inhalierte.
»Wir bringen morgen die Lebensmittel zum Haus«, sagte Nick. »Dann kannst du die Räume noch mal durchchecken, okay?«
»Na gut.« Leon gab sich zufrieden.
Sie ließen ihn an der Köllner Chaussee in Elmshorn raus, wo er in einer Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete wohnte. Sie studierten oder arbeiteten alle drei in Hamburg, doch die dortigen Mietpreise hatten sie ins Umland gezwungen.
Nick und Kathrin fuhren zu ihrer Wohnung in der Elmshorner Meteorstraße. Als sie den Block betraten und Nick zum Fahrstuhl gehen wollte, hielt Kathrin ihn am Arm zurück. »Wir nehmen doch wohl die Treppe? Es schadet nicht, wenn du an deiner Kondition arbeitest.«
Kathrins Atmung war im dritten Stock ruhiger, als es Nicks im zweiten Stock gewesen war. »Wie kann man nur so ätzend fit sein«, sagte er.
Als er den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür steckte, öffnete sich die Tür der Nachbarwohnung, und eine alte Frau steckte ihren Kopf heraus. Das schüttere weiße Haar hing ihr strähnig über die Ohren.
»Ich wollte nur mal schauen, wer es ist«, sagte sie. »Ich –«
»So wie immer«, fuhr Kathrin ihr über den Mund. »Stehen Sie eigentlich den ganzen Tag hinter der Tür? Versuchen Sie es doch mal mit Stricken oder Kreuzworträtseln.«
»Kat!«, warnte Nick sie leise. Zu der alten Frau sagte er: »Hallo, Frau Kankowski. Einen schönen Tag für Sie.« Dann zog er Kathrin in die Wohnung und schloss die Tür.
»Neugierige Alte«, murmelte Kathrin und stieg aus den Stiefeln.
»Sei nicht immer so unfreundlich zu ihr. Wenn du mal so alt bist und so allein …«
»… und so hässlich«, führte Kathrin seinen Satz zu Ende. »Aber das wird mir nicht passieren. Ich bring mich um, wenn der Östrogenmangel bei mir einsetzt und alles schlaff und faltig wird, das weiß ich.«
»Du bist doch nicht ganz dicht.« Er zog seine Jacke aus und warf sie auf den Schuhschrank.
»Hast du dir die Haut von alten Leuten mal genau angeguckt? Es sind ja nicht nur die Falten und die Runzeln. Altersflecken, geplatzte Äderchen, dicke weiße Barthaare … Bah!« Sie zog ihr Shirt über den Kopf und schälte sich aus der hautengen schwarzen Jeans. »Ich geh duschen. Den Rolli zu fahren ist anstrengender, als ich dachte.«
Sie blickte ihn ernst an. »Die kleine Kröte wird eine gute Armmuskulatur haben. Bist du sicher, dass du es ohne meine Hilfe schaffst, ihn zu sedieren?«
Irritiert von der Sprunghaftigkeit ihrer Gedanken, musste er erst einmal überlegen, bevor er antwortete.
»Du bleibst auf jeden Fall im Wagen. Dass wir schnellstens wegkommen, ist die halbe Miete. Und ich werde ja wohl mit einem Elfjährigen fertigwerden.« Er ließ seine Armmuskulatur unter dem eng sitzenden Shirt spielen, sodass der auf den Oberarm tätowierte Star-Wars-Roboter sich zu bewegen schien. »Er wird panisch sein und so heftig atmen, dass er in Nullkommanix abseilt.«
Kathrin ging in die Küche, nahm zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und öffnete sie mit dem Laryngoskop-Öffner, den Nick ihr zum Geburtstag geschenkt hatte – seinerzeit hatte sie ihr Medizinstudium noch nicht abgebrochen. »Ich bin noch nicht überzeugt«, rief sie. »Warum fährt Leon nicht den Wagen, und ich gehe hinten rein?«
»Lass es uns nicht immer wieder durchkauen.« Er war ihr gefolgt und nahm das Bier, das sie ihm reichte. »Leon ist hinten einfach besser aufgehoben. Je weniger er sieht, desto weniger kann er in Panik ausbrechen.«
»Pff!« Kathrin stellte ihre Flasche so hart auf dem Küchentisch ab, dass Schaum aus der Öffnung trat. »Schlimm genug, dass wir den Panikfritzen dabei haben. Wenn er es vermasselt, dann –«
»Er wäre bestimmt ruhiger, wenn du ihn nicht immer so anschreien würdest«, fuhr Nick ihr über den Mund. Er wechselte die Bierflasche von der Rechten in die Linke und zog Kathrin an ihrem dunkelblauen BH zu sich heran. »Er macht das schon. Wenn er muss, funktioniert er.«
Kathrin löste sich aus seinem Griff und ging ins Wohnzimmer. »Immer nimmst du ihn in Schutz. Immer.« Vor einer metallenen Stange, die zwischen Zimmerdecke und Boden installiert war, blieb sie stehen. Sie legte beide Hände um die Stange und schwang sich langsam darum. Sie spreizte ein Bein ab, schwang weiter und wickelte sich in aufreizender Stellung um das kalte Metall. Die Muskeln an ihrem durchtrainierten, grazilen Körper zeichneten sich ab, während sie verschiedene Poledance-Figuren ausführte. Nick ging zur Musikanlage.
Als harte Beats erklangen, grinste sie ihn an. »Ah, da kommt also jemand in Stimmung. Soll ich für dich tanzen?« Sie schlang ein Knie um die Stange und brachte ihren Körper in die Waagerechte, während sie mit den Armen federleichte Bewegungen zur Musik machte.
Nick zog sein Shirt über den Kopf und ließ es fallen. Seine vom Bier kühlen Lippen pressten sich auf ihr Dekolleté, als er sich über sie beugte. »Du schmeckst salzig«, sagte er an ihrer Haut und leckte noch einmal darüber. Als er seine Arme um sie schlang, löste sie ihr Knie von der Stange.
Ihre Finger schienen das Roboterherz, das auf seine Brust tätowiert war, herunterkratzen zu wollen, als er sie zum Bett trug. »Setz die Maske noch mal auf«, flüsterte sie an seinem Ohr.
***
Vivien Fahrenkrug hatte ihre Mitspieler fest im Blick. Theo starrte auf das Kartenblatt in seiner Hand. Dann sah er seinen großen Bruder Sören an, der ihn beobachtete.
Theo holte tief Luft. »Ich erhöhe auf sechs.« Er schob von seinen Smarties sechs Stück zur Tischmitte, wo sich bereits ein buntes Häuflein angesammelt hatte. »Gehst du mit, Noa?«, fragte er das schwarzhaarige Au-pair an seiner linken Seite aufgeregt.
»Nein.« Noa warf ihre Karten auf den Tisch. »Ich habe schon so viele Bonbons verloren.« Sie sprach stark akzentuiertes, aber perfektes Deutsch.
»Das sind keine Bonbons«, sagte Theo. »Das sind Smarties. Und Smarties sind … Smarties.«
»Ich kenne Smarties«, sagte Noa entrüstet. »Es gibt sie auch in Spanien.«
»Das ist kein Schnackspiel«, ging Sören dazwischen. »Ich will sehen.« Er schob von seinem Schoko-Haufen sechs Smarties zur Mitte und sah Vivien an.
»Verrate das bloß deinem Vater nicht«, sagte Vivien Fahrenkrug zu Theo, der sie mit vor Aufregung roten Wangen beobachtete. »Magnus bringt mich um, wenn er herausfindet, dass ich euch das Pokern nicht verboten habe.«
»Und sogar noch mitspielst.« Sören grinste seine Stiefmutter breit an.
»Pst!«, wehrte sie mit gespielter Aufregung ab, »ich muss mich konzentrieren.« Sie musterte die Gesichter ihrer Mitspieler. Theo hatte offensichtlich ein Bombenblatt, das verriet sein zartes Jungengesicht. Sörens Miene hingegen ließ keine Schlüsse zu. »Ich denke, ich lasse es und steige aus.« Sie legte ihre Karten verdeckt auf den Tisch und steckte sich einen ihrer Smarties in den Mund.
»Die darfst du nicht essen, Vivi! Das sind doch unsere Dollar!«, rief Theo empört. Noa und Vivien lachten.
»Wo er recht hat, hat er recht«, sagte Sören, zog eine imaginäre Pistole aus der Hüfte und erschoss Vivien mit einem »Peng!«.
»He«, sagte sie und sah ihn an, »ich hab nicht falsch gespielt.«
»Stimmt.« Er grinste, dann veränderte sich seine Miene. »Im Ernstfall hätte ich eine so schöne Frau sowieso nicht erschossen.«
Vivien löste ihren Blick hastig. »Also«, sie sah zu ihrem elfjährigen Stiefsohn, »jetzt bin ich gespannt, Theo. Deinem Gesicht nach zu urteilen, hast du einen Royal Flush.«
»Ha, hab ich gar nicht.« Er legte sein Blatt auf den Tisch.
»Zwei Pärchen?«, rief Noa. »Das ist schlecht!«
Theo freute sich. »Ich wollte euch anschmieren, damit ihr alle aussteigt. Und das hat fast geklappt. Nur Sören ist nicht auf mich reingefallen.«
»Da hast du mich wirklich reingelegt«, sagte Vivien in Gedanken an ihre drei Bauern.
Sören warf seine Karten aufgedeckt auf den Tisch und schaufelte den Smarties-Haufen aus der Mitte zu sich. »Danke, Theo, dass du so schlechte Karten hattest.«
Theo blickte auf Sörens Karten. Auch er hatte nur zwei Pärchen, allerdings mit zwei Assen. »Du bist auch ein Zocker, Sören, genau wie ich«, strahlte er seinen Bruder an. »Du hast aber mehr Glück gehabt.«
»Nicht immer, Kleiner, nicht immer«, sagte Sören ernst und stand auf. »Will noch jemand einen Kaffee?«
»Ich«, sagte Theo, während die beiden Frauen verneinten.
»Träum weiter«, rief Sören ihm auf dem Weg in die Küche zu.
»Wollen wir an die Au gehen, Theo?«, schlug Noa vor. Sie sah aus dem Fenster, vor dem eine der Linden stand, die das Haus umgaben. Zartes Grün hatte sich schon gebildet. »Es ist wieder trocken. Ich möchte noch ein bisschen frische Luft atmen.«
»Oh ja!« Theo rollte seinen Rollstuhl vom Tisch weg. »Wir nehmen die Angeln mit und gehen zum Steg. Vielleicht fangen wir heute einen Hecht.«
»Nein, das lohnt den Aufwand jetzt nicht mehr«, sagte Vivien und tippte auf die Armbanduhr an ihrem Handgelenk. »Bis ihr das Angelgedöns zusammengesucht habt, ist es dunkel.«
»Oh Mann«, maulte Theo. »Noa ist doch nur noch ein paar Tage hier. Und sie will so gern vorher noch einen Hecht angeln. Oder?« Er grinste Noa an.
»Ja, unbedingt«, log sie und lachte.
»Bitte, Vivi!«, bettelte Theo. »Mit Taschenlampen macht Angeln total viel Spaß.«
Sie sah ihn an. Die hellblauen Augen, die Theo von seinem Vater hatte, schienen von innen her zu leuchten. Das rotblonde Haar stand struppig vom Kopf ab, weil er es beim Kartenspielen immer wieder gerauft hatte. Viviens Blick blieb schließlich an seinen dünnen Beinen im Rollstuhl hängen. Die Beine, die nie wieder laufen, springen oder hüpfen würden. Nie Rad und Hoverboard fahren würden, nie tanzen.
»Also gut«, gab sie nach. »Wir verschieben das Abendessen um eine Stunde, damit es sich für euch lohnt. Um Punkt halb acht seid ihr aber drinnen, verstanden?«
»Du bist die Beste, Vivi!« Freudig rollte Theo aus dem Esszimmer.
»Und zieh deine Schwimmweste über«, rief sie ihm hinterher.
Er stöhnte auf. »Ja-ha.«
Vivien hielt Noa, die Theo folgen wollte, an der Hand fest. »Pass gut auf ihn auf, ja?«
»Natürlich.« Noa strich über Viviens Hand auf ihrer. »Tue ich doch immer.«
»Ich weiß«, sagte Vivien und streichelte kurz über Noas Wange.
Die junge Spanierin folgte Theo hinaus. Vivien sah ihr hinterher. »Ich werde sie furchtbar vermissen. Sie ist ein tolles Mädchen«, sagte sie zu Sören, der mit einer Tasse dampfenden Kaffees ins Wohnzimmer zurückkam. Ihr Stiefsohn war mit seinen sechsundzwanzig nur vier Jahre jünger als sie selbst.
Sören stellte die Tasse auf dem würfelartigen Massivholztischchen ab und ließ sich auf die cremefarbene Ledercouch fallen.
Sie sah ihn an und er sie.
»Und, Stiefmami? Was machen wir beiden Hübschen jetzt?«
***
»Wann fängt der Schreihals eigentlich mal zu laufen an?« Sophie hockte im Schneidersitz auf der Couch und blickte mit gerunzelter Stirn zu Lyn herüber, die auf dem Sessel saß und gerade einen zärtlichen Kuss auf das Köpfchen an ihrer Brust drückte. Emil war in ihren Armen eingeschlafen. Er hatte gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert, aber es sah nicht danach aus, als würde er bald laufen.
Lyn strich zart über die warme, rosige Wange ihres Sohns. »Jungs sind eindeutig fauler. Du und Lotte habt mit zwölf Monaten die ersten Schritte gemacht. Unser Krabbelmeister wird sich wohl mehr Zeit lassen«, sagte sie mit Wehmut in der Stimme. Am morgigen Montag würde sie nach Mutterschutz und zehn Monaten Elternzeit wieder arbeiten gehen, und vielleicht würde sie bei seinen ersten Schritten gar nicht dabei sein.
Sie sah Sophie an. »Magst du mir deinen Bruder abnehmen, Krümel? Dann kann ich mich ums Abendessen kümmern.«
»Er ist nicht mein Bruder, sondern mein –«
»Wenn ich von dir noch einmal das Wort ›Halbbruder‹ höre«, fuhr Lyn ihrer Tochter über den Mund, »schreie ich.« Der Blick, der Sophie traf, war wenig freundlich.
»Ist doch die Wahrheit«, maulte Sophie und stand auf. »Leg ihn einfach in seine Wiege. Ich muss Vokabeln pauken.« Ohne Lyn oder dem Kleinen noch einen Blick zu gönnen, ging sie aus dem Wohnzimmer. Es war zu hören, dass sie in der Küche den Kühlschrank öffnete und eine Flasche herausnahm.
»Alte Zicke«, murmelte Lyn und schwang sich mit dem Bündel auf dem Arm aus dem Sessel. Emil hatte gut zugelegt. Sein Geburtsgewicht von dreitausendfünfhundert Gramm hatte er fast verdreifacht.
»Hat die Halbschwester mal wieder schlechte Laune?«, erklang Hendriks belustigte Stimme an der Tür. Er war vor einer halben Stunde von der Arbeit gekommen – unwillkommener Sonntagsdienst – und hatte geduscht. Der Geruch seines herben Duschgels drang angenehm in Lyns Nase, während er ihr Emil abnahm und einen Kuss auf dessen Stirn hauchte.
»Langsam nervt es«, sagte Lyn. »Mit fünfzehn kann man doch unmöglich eifersüchtig auf ein Baby sein, oder?«
Hendrik legte seinen Sohn in der Wiege ab, die noch neben dem Sofa stand, obwohl Emil aus ihr herausgewachsen war. Momentan wurde sie überwiegend von der Katze genutzt. Die Wiege war ein Familienerbstück der Wolffs, schon Hendriks Mutter hatte darin geschlafen. Entsprechend stolz war er gewesen, als sein Sohn darin lag. »Sophie ist mit allem spät dran«, sagte Hendrik. »Sie pubertiert halt.«
»Erzähl doch noch mehr blöden Scheiß, Hendrik Wolff«, ertönte es von der Treppe. Sophie stand mit einem Glas Cola in der Hand am Geländer. Ihr Blick war giftig wie eine Aspisviper.
»Schon deine Ausdrucksweise zeigt, dass Hendrik recht hat«, sagte Lyn und versuchte ruhig zu bleiben.
»Ihr könnt mich alle mal!« Sophie begann zu weinen – lautstark – und rannte die Treppe hinauf.
»Respekt«, rief Lyn ihr mit Blick auf die Stufen hinterher. »Du hast keine Cola verschüttet. Sonst hättest du nämlich jetzt wischen dürfen.«
Sophies Antwort war ein heftiges Türknallen.
»Damit dürften unsere Nachbarn jetzt auch wach sein«, sagte Hendrik trocken und nickte Richtung Haustür, hinter der der Wewelsflether Friedhof lag. Er folgte Lyn in die Küche.
»Wie weit seid ihr im Grünberg-Fall?«, fragte sie, während sie das Kartoffelnetz auf der Spüle aufschnitt. »Hat der Nachbar gestanden?«
Hendrik nahm einen Topf aus dem Schrank. »Ja, hat er. Thilo Steenbuck und Hendrik Wolff«, er warf sich in die Brust, »haben die Wahrheit aus ihm herausgekitzelt.«
»Ihr habt also mal wieder versucht, ›Guter Bulle, böser Bulle‹ zu spielen«, kommentierte Lyn spöttisch.
»He«, er boxte ihr spielerisch gegen den Oberarm. »Ich war ein perfekter Bad Cop.«
»Was denn, Thilo hat den Good Cop gegeben? Das kann er doch gar nicht.«
Hendrik lachte und öffnete ein Glas mit Rotkohl und schaufelte ihn mit einer Gabel in den Topf. »Nächste Woche darfst du das dann übernehmen.« Weil Lyn schwieg, sah er sie an. »Alles gut, Frau Hauptkommissarin?«
»Ja, schon.«
»Aber?« Hendrik stellte das Glas ab.
Lyn legte das Schälmesser aus der Hand, ging zu Hendrik und schlang die Arme um seinen Bauch. »Haben wir das wirklich richtig entschieden? Ich fühl mich heute richtig elend bei dem Gedanken, dass ich morgen zur Arbeit gehen soll, als wäre nichts geschehen.«
Hendrik streichelte ihr Haar. »Nun, geschehen ist in der Tat etwas, seit du zuletzt im K1 warst. Du hast unser Baby bekommen. Das niedlichste Baby ever.«
»Ja. Und jetzt, nach einem Jahr, lasse ich es einfach zurück und gehe arbeiten.«
Hendrik hielt sie fest in seinen Armen. »Liebling, du setzt es ja nicht in einem Binsenkörbchen auf der Elbe aus, sondern lässt es bei seinem ihn über alles liebenden Vater.«
Lyn löste ihren Kopf und sah Hendrik mit einem schiefen Lächeln an. »Das weiß ich doch, Liebling.« Sie küsste ihn zärtlich. »Du bist ein wundervoller Vater«, murmelte sie an seinen Lippen. »Ich weiß ja, dass es Emil an nichts fehlen wird, und dennoch …« Sie seufzte leise.
»Es war dein Wunsch, Lyn, dass wir es so machen.«
»Ja … Ich hab nicht gewusst, dass es sich so anfühlt, wenn es so weit ist.«
Hendrik drückte sie wieder an sich. »Nur dreißig Wochenstunden, Liebling. Und wenn es dir nicht gefällt, reduzierst du weiter. In einem halben Jahr gehe ich wieder arbeiten, und du könntest noch mehr reduzieren oder sogar eine Zeit lang aufhören zu arbeiten.«
Lyn löste sich aus seinen Armen. »Das nun auch wieder nicht. Ich würde durchdrehen. Ich bin ja kaum in der Lage, die anderthalb Stunden in der Krabbelgruppe durchzuhalten. Die jungen Mütter mit ihren Gesprächen über Biokarottenbrei und Tragetuchbindetechniken … Das fand ich auch alles megawichtig, als Lotte und Krümel klein waren, aber jetzt …«
Sie sah Hendrik an. »Ich freue mich auf die Arbeit, auf die Kollegen, sogar auf Birgit und ihren furchtbaren Kaffee. Und weil ich mich freue, habe ich ein schlechtes Gewissen.« Ein weiterer dicker Seufzer folgte. »Vielleicht sind alte Mütter ja keine so guten Mütter?«
»Oh bitte, jetzt nicht diese Leier.« Hendrik trat einen Schritt zurück. »Du tust immer so, als wärst du Methusalem. Heutzutage ist es doch völlig normal, mit zweiundvierzig ein Kind zu kriegen.«
»Na, normal wohl nicht gerade. Vielleicht üblicher als früher. Und mittlerweile bin ich dreiundvierzig.« Lyn lächelte, als sie das Kartoffelschälmesser wieder aufnahm. »Ich vermisse Lotte. Hätte sie dir eben zugehört, hätte sie gesagt, dass der Vergleich mit Methusalem hinkt. Schließlich war er ein Mann. Und die können bekanntlich keine Kinder kriegen.«
Hendrik nahm die Fleischtüte vom Edeka-Markt aus dem Kühlschrank. »Aber Männer können ihre Kinder lieben und behüten. Das tue ich das nächste halbe Jahr intensiv. Und ich werde es wahnsinnig genießen. Du darfst dich ohne schlechtes Gewissen auf deinen Job freuen. Unsere lieben Kollegen freuen sich auch auf dich.«
ZWEI
Jana Roffler sah den Fahrer des Lkw an, als er in Itzehoe bei der Esso-Tankstelle am Sandberg hielt, während ihre Freundin Neele Haack bereits die Beifahrertür öffnete und heraussprang.
»Tschüs, und danke fürs Mitnehmen.« Jana nahm ihren Rucksack aus dem Fußraum und folgte Neele auf den Parkplatz.
»Goodbye, girls«, sagte der Fahrer des Lkw mit einem Winken. Osteuropäischer Akzent färbte die Worte.
Bevor Jana die schwere Tür schloss, lauschte sie kurz dem Song im Radio, der gerade anlief. »Oh, Mist, jetzt kommt ›Speechless‹. Hätten die ja mal eher spielen können.« Sie machte ein paar Moves zur Musik. »If you love me, then say you love me«, sang sie, dann schlug sie die Tür zu. Der Lkw fuhr los.
Neele ging nicht auf Janas Gesang ein. Sie streifte ihren Rucksack über und fuhr mit beiden Händen über ihre Oberarme. »Mir ist kalt … Wo gehen wir jetzt hin? Es wird ja kaum von hier aus ein Auto in das Kaff fahren?« Sie sah zu dem Parkplatz hinter der Tankstelle.
»Nee, per Anhalter kommen wir jetzt nicht weiter. Wir gehen zum Busbahnhof und fahren mit dem Bus nach Vaale. Auf geht’s!« Auch Jana schulterte ihren Rucksack und ging voran. »Wenn wir an einem Supermarkt vorbeikommen, kaufen wir noch ein.«
»Das können wir doch in dem Kaff erledigen. Oder gibt’s da keinen Supermarkt?« Neele schloss zu Jana auf.
»Keine Ahnung. Ist fünf oder sechs Jahre her, seit ich das letzte Mal bei meinem Uropa war. Da war ich acht oder neun. Das Haus liegt jedenfalls in der Pampa, nicht direkt im Dorf. Und im Dorf lassen wir uns besser auch nicht blicken. In so einem kleinen Kaff fällt doch jeder Fremde direkt auf. Wenn die vom Heim unsere Fotos in die Zeitung setzen lassen, erkennen die Dorfdödel uns sofort. Also decken wir uns hier in Itzehoe mit Proviant ein.«
»Und denk dran«, sagte Jana zu Neele, als sie den Supermarkt in der Straße Große Paaschburg betraten. »Die leichten, teuren Sachen einstecken, die schweren kommen in den Einkaufswagen. Wir geben höchstens zehn Euro aus.«
»Ja, schon klar.« Sehr glücklich sah Neele bei dem Gedanken, gleich klauen zu müssen, nicht aus.
Jana musterte sie von der Seite. Vielleicht hätte sie doch lieber allein abhauen sollen? Andererseits war Neele ganz okay. Ein bisschen zu ängstlich, aber sie begriff, worauf es ankam, und war nicht so eine Hohlbirne wie die anderen im Heim.
Janas Herz schlug schnell, als sie mit dem Einkaufswagen an der Kasse standen. Neele legte gerade einen Sixpack mit kleinen Colaflaschen auf das Laufband. Toast, Marmelade und zwei Dosen Ravioli folgten. Und ein Doppelpack Klopapier, da Jana nicht wusste, was im Haus ihres verstorbenen Uropas noch vorhanden war.
Zwei Tafeln Milka mit bunten Kakaolinsen und Camembert steckten in Neeles Jackentaschen, eine Flasche Sekt und Thunfisch-Sandwiches im Rucksack. Jana hatte Nutella und Frikadellen in ihrem Rucksack verschwinden lassen. Schinken und Salami steckten in der Bauchtasche ihres Hoodies, unter der Jeansjacke. Es war nicht schwer gewesen, die Sachen einzusacken. Wichtig war: Man durfte nicht zögern. Dann fiel man auf. Und zu zweit war es eh einfacher. Einer konnte dem anderen Deckung geben. Kritisch wurde es beim Klauen noch mal beim Verlassen des Ladens. Diese Erfahrung hatte Jana oft genug gemacht, wenn sie sich ihre Garderobe in der Kieler Innenstadt zusammengestellt hatte. Aber sie konnte gut rennen.
Dass sie im Heim gelandet war, lag nicht am Klauen, jedenfalls nicht nur. Ihrer ständig zugedröhnten Mutter war vom Jugendamt das Sorgerecht entzogen worden. Und sie musste das jetzt ausbaden! Aber nicht mit ihr. Wenn sie sie jetzt schnappten, würde sie wieder abhauen. So lange, bis sie zu ihrer Mutter zurückkonnte. Da hatte sie wenigstens ihre Ruhe und konnte ausschlafen, wann immer sie wollte. Schule war eh vertane Zeit.
Jana zog ihr Portemonnaie aus der Hosentasche und legte noch eine Plastiktüte auf das Laufband. Es war besser, die Rucksäcke nicht zu öffnen. Sie zahlte. Beim Verlassen des Ladens sprachen sie beide vor Aufregung kein Wort. Aber alles ging glatt. Niemand hatte die Schmuggelware entdeckt. Nichts piepte.
Neele atmete draußen erleichtert aus. »Das stresst mich total. Dich nicht?«
»Nee.« Dass Janas Herz schneller klopfte, musste Neele nicht wissen. »Und jetzt auf zum Busbahnhof.«
***
»Fühl mal!« Kathrin Pinkert hielt Nick ihren Arm hin. »Ich bin vor Aufregung ganz heiß. Es fühlt sich wie Fieber an.« Als Nick seine Hand auf ihren Oberarm legte, zog sie den Arm ruckartig weg. »I, du hast Schweißhände.«
»Im Gegensatz zu dir haben Leon und ich ein paar Nerven, die angespannt sind«, stieß er aus.
Kathrin musterte ihren Freund unter zusammengezogenen Augenbrauen. Großflächige rötliche Flecken hatten sich auf Nicks Hals gebildet, während sie im Sprinter warteten. Sein Blick glitt immer wieder die Bürgersteige entlang. Es war eindeutig, dass er fürchtete, von Passanten wahrgenommen zu werden. Gut, dass kaum jemand zu Fuß unterwegs war.
Nicks übrige Gedanken galten mit Sicherheit Leon, der im hinteren Teil des Lieferwagens hockte und auf seinen Einsatz wartete – wahrscheinlich schweißgebadet unter der Schimpansen-Latexmaske. Kathrin sah auf die Zeitanzeige ihres Handys. Es war Montag, frühabends, und der Coup stand unmittelbar bevor.
»In einer Minute fahren wir los«, sagte sie, ohne Nick anzusehen. »Zeitlich müsste der Kleine jetzt schon auf dem Bischofer Weg sein.« Der zigfach gegoogelte Stadtplan von Wilster hatte sich ihr ins Hirn gebrannt.
»Und wenn der Junge doch noch im Stadtgebiet ist? Vielleicht hat er jemanden getroffen und noch geschnackt.«
»Dann halte ich eben kurz an, wenn er vor uns auftaucht, bevor wir am geplanten Punkt sind.« Sie sah wieder auf die Uhr. Der Junge war vor genau zwölf Minuten in Wilster von der Auffahrt des Hauses am Bischofer Deich gerollt, wo sein bester Freund wohnte. Bis zum Haus seines Vaters an der Wilster Au in Kasenort waren es knapp zwei Kilometer.
»Aber bei jedem Stopp könnten uns Leute sehen. Irgendwie«, Nick stockte kurz, »erscheint mir die Idee jetzt gar nicht mehr so brillant, wie du immer gesagt hast.« Er packte ihren Unterarm. »Wenn uns einer sieht … und die Kripo dann ein Phantombild erstellt …«
»Wirst du jetzt weich, oder was?« Sie riss ihren Arm erneut weg. »Wir tragen doch Perücken. Und an der Au stülpen wir die Masken über. Außerdem spielt uns das Wetter in die Karten.« Nach einem sonnigen Nachmittag war das Wetter umgeschlagen. Es regnete zwar nicht, aber der Aprilhimmel verwandelte sich in eine einzige graue Masse. »Was soll denn schiefgehen? Sogar Leon hat bei der letzten Probe alles richtig gemacht.«
Nick starrte ohne ein Wort aus der Frontscheibe.
Sie sah, wie angespannt seine Wangenmuskulatur war, und strich ihm über das Bein. »Es wird alles laufen wie geplant «, sagte sie mit ruhigerer Stimme. »Stell dir einfach vor, wir üben wieder. Stell dir vor, ich sitze im Rollstuhl und nicht die kleine Kröte.«
Er sah sie an. »Wie kannst du nur so ruhig sein?«
»Wenn man exakt plant, kann man doch entspannt sein. Planung ist alles, das haben wir nun oft genug gehört.« Nach einem erneuten Blick auf ihr Handy legte sie es auf den freien Mittelplatz neben sich und startete den Wagen. »Auf geht’s.«
Sie bog in die Allee ab und fuhr am Friedhof vorbei in den Bischofer Weg und aus Wilster heraus zur Schleuse Kasenort, wo die Wilster Au in die Stör mündete. Sie ließen ein paar Häuser hinter sich und fuhren unter der Überführung der B 5 hindurch. Dann wurde es einsamer. Rechts floss die Au, links lag ein reetgedeckter Bauernhof. Es folgten wenige weitere Häuser und Weideland.
Theo Fahrenkrug hatte eindeutig niemanden getroffen, der ihn in ein Gespräch verwickelt hatte, stellte Kathrin aufatmend fest, als sie den weißen Sprinter um eine leichte Kurve lenkte.
Mini-Fahrenkrug rollte vor ihnen auf der Straße. Er hatte noch einen Kilometer vor sich. Sein Elternhaus lag zwischen zwei reetgedeckten Höfen. Der Rollstuhl war mehr als gut beleuchtet. Darauf hatten seine Eltern bestimmt bestanden. Schließlich gab es hier keinen Bürgersteig.
Kathrin stoppte den Wagen. Sie riss die schwarze Perücke vom Kopf und nahm die Trump-Maske, die Nick ihr reichte. Er nahm seine schwarze Kurzhaarperücke ab und zog eine Shrek-Maske über den Kopf. Dann stopfte er die beiden Perücken in die Tüte und deponierte sie im Fußraum.
»Kein Auto in Sicht«, stieß er erleichtert aus.
»Und auch sonst niemand«, sagte Kathrin. Die Wahrscheinlichkeit, auf der schmalen Straße entlang der Wilster Au auf ein Auto zu treffen, war wesentlich geringer, als einem Radfahrer oder Jogger zu begegnen.
Kathrin fuhr an und drückte auf das Gaspedal. Der Junge hörte sie kommen, denn er lenkte seinen Rolli auf der Straße ganz nach rechts. Er beherrschte den Rollstuhl. Nur wenige Zentimeter trennten ihn von der Bankette.
»Bereit?« Eine rhetorische Frage, denn Kathrin sah Nick weder an, noch nahm sie seine gepressten Worte wahr. Ihr Fokus lag einzig und allein auf dem wie ein Christbaum leuchtenden Rollstuhl. Während sie Gas wegnahm, hämmerte Nick an die Rückseite der Innenkabine – das Zeichen für Leon, sich bereit zu machen.
Als Nick die Gefriertüte nahm, die er auf dem Mittelplatz deponiert hatte, ließ Kathrin die Seitenscheibe herunter. Auch Nick öffnete seine Scheibe, bevor er mit behandschuhten Händen den Verschluss der Gefriertüte öffnete und den mit Äther getränkten Waschlappen herausnahm. Sofort erfüllte der strenge Geruch die Kabine des Lieferwagens. Kathrin hielt automatisch die Luft an, während sie den Jungen überholte und bremste.
Noch bevor sie standen, riss Nick die Beifahrertür auf und sprang aus dem Wagen.
Kathrin hörte ein Scheppern. Es war das Geräusch, das die Metallplatte machte, wenn Leon sie vom Wagen aus auf die Straße fallen ließ. Sie rückte auf den Beifahrersitz und sah im Außenspiegel, dass Nick schon bei dem Jungen war und ihm den Lappen auf das Gesicht presste. Theo Fahrenkrug wehrte sich, wie erwartet. Seine Schreie unter dem Lappen klangen gedämpft. Er schlug desorientiert um sich, dann griffen seine Hände nach Nicks Hand, die dieser auf das Jungengesicht presste. Kathrin überlief es heiß und kalt zugleich. Es würde noch ein wenig dauern, bis der Junge sediert war. Gegen Nicks Kraft würde er letztendlich keine Chance haben.
Als der Jungenkörper erschlaffte, atmete Kathrin auf. Es lief.
Sie wollte auf den Fahrersitz zurückrutschen, aber ein lautes »Nein!« ließ sie erstarren. Eine Frauenstimme.
»Lassen Sie ihn! Hilfe!«, tönte es in die Fahrerkabine hinein. »Hilfeee!«
Kathrin stieß die Beifahrertür auf und blickte auf das Szenario, das sich hinter dem Wagen abspielte. Eine junge schwarzhaarige Frau in Jeans und senfgelber Jacke hatte Nick am Arm gepackt und zerrte daran. Sie schrie unaufhörlich in die einsetzende Dämmerung der ruhig daliegenden Marschlandschaft. »Hilfe, Hilfe!«
Und dann riss sie Nick die Maske vom Kopf.
Leon war aus dem Wagen getreten, stand aber da wie eine Marmorstatue, nicht fähig, sich zu rühren. »Oh Gott«, klang es dumpf durch das Gummi seiner Schimpansenmaske. »Oh Gott!«
Kathrin überlegte nicht lange. Sie zog ihr Messer aus der Hosentasche und ließ es aufspringen. Mit wenigen schnellen Schritten war sie bei Nick und der jungen Frau. Nick hatte sie gerade erfolgreich abgewehrt und in das feuchte Gras der Bankette gestoßen, von wo aus sie weiterschrie und sich jetzt aufrappelte.
Kathrin zögerte nicht. Sie schob sich zwischen Nick und die Frau, hob den Arm und stach zu, aus voller Kraft in die Brust. Der Schrei erstickte der jungen Frau gurgelnd im Hals. Als ihr Blick brach, zog Kathrin das Messer heraus. Dann drehte sie sich um und sammelte Nicks Maske auf. Er stand keuchend da, mit weit aufgerissenen Augen.
»Mach hinne«, schrie sie und stülpte ihm die Maske über. Das löste seine Starre.
»Bist … bist du irre?« Das freundliche Shrek-Grinsen der Maske stand in krassem Widerspruch zu seiner Stimmlage. Er starrte auf die junge Frau, die wie eine Marionette, der man die Fäden durchtrennt hatte, wieder zu Boden gefallen war. Ihre dünne Steppjacke verfärbte sich in Brusthöhe rot. »Was hast du getan?«, schrie er Kathrin an, stürzte aber zu seinem Kumpel, der weinend in die Knie gegangen war.
»Steh auf, du Memme!«, schrie Kathrin, eilte zu den Männern und zerrte an Leons Arm. »Wir müssen hier weg!« Dann überließ sie es Nick, seinen zitternden Kumpel hochzuziehen.
»Verfrachte ihn auf den Beifahrersitz. Du fährst«, rief sie Nick zu. »Ich bleibe hinten bei dem Jungen.« Diese Planänderung schien angebracht. »Wer weiß, was Leon hier hinten sonst anstellt.«
Hektisch begann sie die Taschen des bewusstlosen Jungen nach seinem Handy abzusuchen. Sie fand es in der Jacke. Mit Schwung warf sie das Smartphone in die Au. Dann schob sie den Rollstuhl mit dem Jungen die Platte hinauf in den Lieferwagen. Es kostete Kraft, zumal sie in der Rechten noch das Messer hielt. Sie sicherte die Bremsen des Rollstuhls, nachdem sie ihn in die rechte hintere Ecke des Wagens geschoben hatte, sprang aus dem Lieferwagen und klappte die Platte ein. Dabei warf sie einen letzten Blick auf die junge Frau am Wegesrand. Deren dunkle Augen blickten starr in die Dämmerung.
Kathrin sprang in den Laderaum zurück. Bevor sie die Türen schloss, sah sie zwei Radfahrer näher kommen. Sie hämmerte gegen die Wand, und Nick fuhr umgehend los.
Die Beine lang ausgestreckt, setzte sie sich mit dem Rücken an der Wagenwand neben den ohnmächtigen Jungen im Rollstuhl. Noch immer hielt sie das blutverschmierte Messer in der rechten Hand. Wo war diese Bitch hergekommen? Sie hatte alles vermasselt.
Kathrin registrierte das Zittern ihrer Beine, das jetzt einsetzte. Sie legte den Kopf zurück, schloss die Augen und spürte dem Gewicht des Messers in ihrer Hand nach.
Sie hatte einen Menschen erstochen.
Eigenartig.
Es fühlte sich nicht schlimm an. Im Gegenteil. Dieses Gefühl, als sie die Klinge durch die Jacke hindurch in das Fleisch gebohrt hatte …
***
»Wie weit denn noch?«, fragte Neele genervt. »Sind wir vielleicht irgendwann mal da?«
»Gleich«, gab Jana zurück.
»Ich kann nicht mehr laufen. Und ich frier mir den Hintern ab.«
Sie waren vom Itzehoer ZOB mit dem Bus nach Vaale gefahren und hatten das Dorf dann Richtung Vaalermoor verlassen. Dass das Haus allerdings so weit entfernt lag, hatte sie nicht mehr in Erinnerung gehabt. Es war eine Stunde vergangen, seit sie an der Vaaler Sparkasse aus dem Bus gestiegen waren, Vaalermoor hatten sie längst hinter sich gelassen. Um sie herum war Einsamkeit pur. Linker Hand verlief ein schmaler, zu beiden Seiten mit Gräsern bewachsener Wasserkanal am Hochmoor entlang. Die Armee von Birken, die diesen Teil des Moors vereinnahmte, wirkte fast unheimlich. Wie die Weißen Wanderer aus »Game of Thrones«. Aber das würde sie Neele lieber nicht sagen. Die war schon mies genug drauf.
»Das Moor arbeitet pausenlos.« Diese Worte ihres Uropas fielen Jana jetzt ein. Opa hatte ganz viel über das Moor gewusst und erzählt, aber das Einzige, was sie behalten hatte, war, dass es über siebentausend Jahre alt war und pro Jahr einen Millimeter wuchs. Voll wenig. Darum dauerte es wohl so lange, bis ein Meter Moor entstand.
Die Straße wurde immer schmaler. Und miserabler. Absackungen, Schlaglöcher und gebrochener Teer … Straße konnte man das gar nicht mehr nennen. Hier konnte ein Auto nur im Schritttempo fahren, wenn man es nicht schrotten wollte. Darum fuhr hier wahrscheinlich auch niemand.
»Das Haus muss gleich auftauchen«, sagte Jana mit Blick auf die riesige baumfreie Fläche rechter Hand.
»Das dahinten?«, fragte Neele hoffnungsvoll, als sie an eine Einfahrt kamen, an der unter einem Verschlag mehrere Briefkästen angebracht waren. Das Gehöft lag so weit zurück, dass es kaum zu sehen war.
»Nein, ein Stückchen weiter.« Jana wusste nicht genau, wie lange sie noch gehen mussten. Uropas Haus lag jedenfalls auch so weit zurück wie dieses, und das würde Neele nicht gefallen. Um der Freundin und sich selbst Mut zuzusprechen, sagte sie: »Gleich können wir uns aufwärmen. Opa hatte so einen tollen Ofen. Voll gemütlich, mit Holz reinlegen und so.« Sie freute sich darauf, denn ihre Füße in den Sneakers waren eiskalt.
»Warum sind wir nicht einfach nach Hamburg oder Berlin gefahren?«, maulte Neele weiter. »Da hätten wir im Bahnhof pennen können. Und tagsüber hätten wir Action in der Stadt gehabt.«
»Das machen wir auch noch. Aber erst mal müssen wir unterkriechen. Die Bullen nehmen uns sofort hops, wenn die uns sehen. Unsere Fotos landen doch ganz frisch bei denen.«
»Hm«, grummelte Neele. »Hier, du bist wieder dran mit Tragen.« Sie hielt Jana die Tüte mit dem Einkauf hin.
Obwohl Neele die Tüte gerade mal seit fünf Minuten trug, nahm Jana sie. Im gleichen Moment schrie Neele auf.
Aber es war nur ein Reh, das sie aus dem Dickicht am Wasserlauf aufgescheucht hatten. Blitzschnell war der weiße Püschel des Hinterteils im Birkenwald aus ihrem Blick verschwunden.
»Da vorn!«, rief Jana nach weiteren zähen Minuten des Laufens erleichtert. Sie deutete auf eine von Gras und Unkraut überwucherte Spurbahn voller Schlaglöcher, die nach rechts abging. Aber erst nach weiteren Hunderten von Metern war die Backsteinkate gut zu erkennen. »Das ist es.«
Jana blickte auf das alte Haus, dessen bröckelndes Gemäuer sich unter dem griesen, mit Moos bewachsenen Reetdach wegduckte, als wollte es sich verschämt verstecken. Sie hatte es größer in Erinnerung, und etwas, das sie nicht benennen konnte, fehlte, aber es war trotzdem ein schöner Anblick. Schade, dass es drinnen nicht nach frisch gebackenem Brot riechen würde. Opas Brot, zusammen mit dem selbst geimkerten Honig auf einer dicken Schicht Butter … Selbst aus der Erinnerung heraus lief ihr das Wasser im Mund zusammen.
»Alter, ernsthaft?«, stieß Neele aus, als sie näher kamen. Sie blickte Jana mit offenem Mund an. »Die Bude fällt ja zusammen, wenn wir da reingehen.«
»Quatsch.«
»Boah, ich will hier wieder weg. Ich frier und hab Hunger!« Tränen klangen durch ihre Stimme.
»Jetzt lass uns doch erst mal reingehen.« Jana bedauerte erneut, Neele mitgenommen zu haben. Sah sie denn nicht die Gemütlichkeit, die dieses Haus ausstrahlte? »Wir machen den Ofen an, dann essen wir was und trinken den Sekt. Wir lassen es uns richtig gut gehen.«
Und in diesem Moment schoss Jana durch den Kopf, was fehlte. Das Rauchen des Schornsteins. Aus Opas Schornstein hatte es immer gequalmt, wenn sie mit ihrer Mutter hier gewesen war.
Ihr wurde heiß. Dass er jetzt nicht qualmte, war klar. Ihr Uropa war schließlich längst tot. Aber wenn sie jetzt den Ofen anheizten, würde es wieder Rauch geben. Rauch, der kilometerweit zu sehen war. Würden die Dorfdödel sich nicht wundern, wenn es aus Opas Kate qualmte? Bestimmt würde einer hier auftauchen, um das zu checken.
Sie sah Neele von der Seite an. Wenn sie der Freundin jetzt sagte, dass sie den Ofen besser auslassen sollten, würde die bestimmt ausrasten. Und Jana musste vor sich selbst zugeben, dass die Aussicht, in der Kälte zu hocken, verdammt ätzend war.
Rund um das Haus, um den großen, von Unkraut überwucherten Hof und den schäbigen Schuppen gab es ein paar Bäume, deren Geäst von der einsetzenden Dunkelheit geschluckt wurde. Der hintere Garten war nicht zu sehen. Hoffentlich war der Strom nicht abgestellt, dachte Jana. Das Licht konnten sie ruhig einschalten, in der Nähe wohnte schließlich niemand. Sie fasste ein wenig Zuversicht und wurde auf den letzten Metern schneller. Sie würden sich einfach in Opas altes Bett verkriechen, das es hoffentlich noch gab, und sich unter der dicken Decke aufwärmen und dabei Sekt trinken und die Schoki futtern. Die Sandwiches hatten sie im Bus schon aufgegessen.
»Und welches Fenster wollen wir einschlagen?«, fragte Neele, als sie vor dem Haus standen.
Dass sie anders nicht hineinkommen würden, stand fest. Jana hatte keinen Schlüssel. Ihre Mutter auch nicht mehr, soweit Jana wusste. Seit dem Tod des Uropas waren sie nie mehr hier gewesen, denn den Opa um Geld zu erleichtern war der einzige Grund gewesen, warum ihre Mutter hierher in die Provinz gefahren war. Er hatte Mutti immer ein paar große Scheine zugesteckt.
»Hinten«, beantwortete Jana Neeles Frage nach dem Fenster. »Da ist so ’ne kleine Abstellkammer.« Sie linste dabei durch ein verdrecktes Fenster neben der Eingangstür. Jana wusste, dass es das Küchenfenster war. Aber es war zu dunkel. Es war nichts zu erkennen.
Gerade als sie um das Haus herumgegangen waren und Jana sich nach etwas umsah, mit dem sie die Scheibe einwerfen konnte, erklang Motorengeräusch. Schnell näher kommendes Motorengeräusch. Jana linste um die Hausecke. Die Lichter eines großen Wagens waren zu erkennen. Sie hielten Kurs auf das Haus. »Scheiße!«, stieß sie aus.
»Ist das die Polizei?«, fragte Neele ängstlich. Sie traute sich nicht, um die Ecke zu gucken, sondern zerrte an Janas Jackenärmel. »Komm da weg, die sehen dich sonst.«
Jana überlegte nicht lange. »Wir verstecken uns im Schuppen. Schnell!«
DREI
Als ihr Diensttelefon klingelte, sah Lyn auf dem Display, dass der Anruf von zu Hause kam. Bestimmt wollte Hendrik wissen, wann sie Feierabend machte.
»KHK Harms bei der Arbeit«, meldete sie sich gut gelaunt.
»Hausmann Wolff, voller Sehnsucht nach seiner Frau.«
Lyn lachte. »Das klingt gut. Ich habe auch Sehnsucht nach euch. Wie geht’s meinem Mini-Wölfchen?«
»Das Baby?«, stieß Hendrik aus. »Oh Gott, stimmt, da war doch was. Ich ruf dich gleich wieder an. Ich muss ihn erst mal suchen. Ich glaube, ich hab den Kinderwagen im Dörpsladen stehen lassen.«
»Witzig.«
»Emil und ich haben eine schöne Mittagsstunde gemacht, anschließend haben wir uns vom Deich aus die ›Peking‹ in der Werft angeguckt und sind noch mal durchs Neubaugebiet geschoben. Zu Hause haben wir dann die tote Maus bewundert, die Mieze in der Wiege abgelegt hatte.«
»Echt?«
»Echt. Die Wiege steht jetzt bei mir im Wagen. Ich bring sie morgen zu meinen Eltern zurück. Mieze ist beleidigt, weil sie sich einen neuen Schlafplatz suchen muss, und Emil sitzt im Knast, damit ich in Ruhe das Abendessen vorbereiten kann, da meine Frau gleich hungrig von der Arbeit kommt.«
Nachfragen musste Lyn nicht. Knast war ihr Synonym für das Laufgitter. »Was gibt’s Schönes?«
»Hühnersuppe mit extra viel Fleischklößchen.«
»Na, da muss ich ja nicht fragen, wer sich das gewünscht hat.« Sophie liebte Hühnersuppe. Und Fleischklößchen. Lyn sah auf die Uhr. »Ich fahre hier in fünfzehn Minuten los. Bis gleich, Liebling.«
Sie legte auf und sah sich um. Lächelnd nahm sie das Cellophantütchen mit dem Gebäck in die Hand, das mit einer schwarzen Schleife zugebunden und mit einem Welcome-back-Schildchen versehen war. Von welchem Kollegen die Tüte stammte, war ihr gleich klar gewesen, denn es waren Kekse in Form von Bullenschädeln, überzogen mit Schokolade. Eine nette Geste von Wacken-Fan Thilo.
Lyn wusste, dass sie auch Blumen zur Begrüßung bekommen hätte, wäre ihre Kollegin Karin Schäfer hier gewesen, aber die Hauptkommissarin war im Urlaub. Und noch ein Kollege hatte heute gefehlt. Thomas Martens war mit Magen-Darm-Grippe zu Hause geblieben. So hatte das Wiedereinstiegs-Kaffeetrinken mit leckerer Itzehoer Torte der Konditorei Ramm im kleinen Kreis stattgefunden. Die Kollegen hatten sie heute noch verschont. Sie durfte erst mal wieder ankommen.
»Lyn?« Wilfried Knebel, Chef der Itzehoer Mordkommission, klopfte an den Türrahmen ihres Büros, da Lyn die Tür immer offen stehen ließ. »Du hast hoffentlich an deinem ersten Tag nicht vor, pünktlich Feierabend zu machen?« Er verzog die Lippen zu einem schiefen Lächeln. Sein Haar war im letzten Jahr noch schütterer geworden.
Lyn sah den gemütlichen Abend schwinden. »Was ist passiert?«
»Die Leitstelle sprach von einer Toten an der Wilster Au. Der Name Fahrenkrug fiel. Könnte der Küchenmogul sein, der wohnt doch in Wilster. Ich fahre selbst hin. Jochen kommt mit. Und du bitte auch.«
»Alles klar. Ich nehme meinen eigenen Wagen. Vielleicht kann ich ja von dort direkt nach Hause fahren.«
Wilfried nickte, dann war er auch schon weg.
Lyn stand auf, griff ihre Tasche und öffnete den Schrank, der zur Hälfte als Garderobe und zur anderen Hälfte als Aktenschrank diente. Sie schlüpfte in die Jacke und warf noch einen Blick in den kleinen Spiegel.
Auf dem Weg zum Parkplatz rief Lyn zu Hause an. Sophie war dran. »Hi, Krümel, gibst du mir bitte mal Hendrik? Bei mir wird’s heute später.«
»Wer wurde ermordet? Und wie?« Sophie klang gewohnt gespannt bei diesen Fragen. Im Gegensatz zu ihrer großen Schwester hatte sie einen mächtigen Hang zum Morbiden.
»Weiß ich noch nicht. Bin auf dem Weg zum Leichenfundort. Und jetzt gib mir bitte Hendrik.«
Sie hörte, wie Sophie beim Weiterreichen des Hörers sagte: »Mama hat eine Leiche. Dein Kind musst du also selbst zu Bett bringen.«
Lyn klärte Hendrik auf und verabschiedete sich: »Ich liebe dich. Knuddel unser Baby und sag ihm, dass seine schreckliche Mama ihn lieb hat und die Überstunden abbummeln wird, um die Zeit mit ihm nachzuholen.«
»Mach dir keinen Kopf, Liebling. Bis später.« Hendrik schmatzte einen Kuss hinterher und legte auf.
***
Kathrin stand schon, als Nick die Türen des Sprinters aufzog. »Danke auch, dass ihr auf der Schotterpiste so schnell gefahren seid«, fuhr sie ihn an. »Jetzt tut mir der Hintern weh.«
Nick sah sie entgeistert an. »Das ist dein Problem, Kat? Dein Scheißarsch?« Er sprang zu ihr in den Wagen. »Du hast gerade ein Mädchen abgestochen!«
Kathrin war mit zwei Schritten bei ihm. »Weil du zugelassen hast, dass sie dir die Maske abreißt! Ich hab das für dich getan!«
»Ja, danke!«, schrie Nick. »Danke, dass wir jetzt Mörder sind! Du … du …«
Kathrin packte ihn am Sweater. »Ja? Ja? Spuck es doch aus!«
»Hört auf!« Leon stand draußen an der Wagentür. Seine Stimme zitterte. »Ihr seid ja bis ins Dorf zu hören.«
»Nichts sind wir«, fauchte Kathrin, allerdings deutlich leiser. Sie löste die Hand aus Nicks Shirt. »Hier gibt’s nur Karnickel und Rehe. Hier hört uns kein Mensch.«
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Leon. Er klang weinerlich.
»Genau das, was geplant ist. Daran hat sich nichts geändert.« Kathrin trat an den Rollstuhl, löste die Bremse und schob den Rolli ein Stück zurück, bevor sie ihn umdrehte. Der Junge stöhnte und versuchte seinen Kopf zu heben.
»Verabreiche ihm noch eine Ladung von dem Äther«, sagte sie zu Nick. »Ich muss mich erst mal selbst sortieren, bevor ich dem Jungen klarmachen kann, was er zu tun und zu lassen hat.«
Sie ließ den Rollstuhl los und sprang vom Wagen. »Ich schließ auf«, sagte sie zu Nick. »Dann könnt ihr den Jungen hochtragen. Den Rolli könnt ihr ins Wohnzimmer stellen.«
Sie blickte in die Dunkelheit. Das Haus lag ruhig da. Rechter Hand stach der Schatten des verfallenen Schuppens leicht hervor. Kein Geräusch störte die vollkommene Ruhe der Landschaft.
Die schäbige Haustür quietschte in den Angeln, als sie sie öffnete. Muffgeruch schlug ihr entgegen. Eklig, aber ein paar Tage musste sie es ertragen. Sie ignorierte die Taschenlampe, die auf dem Boden bereitstand, denn noch reichte das schwindende Tageslicht aus, um sich umzusehen.
Alles war vorbereitet. In der Küche zu ihrer Rechten befanden sich ausreichend Vorräte. Im Wohnzimmer links standen Tisch und Stühle. Das meiste Zeug war zwar aus dem alten Haus herausgeräumt worden, aber einige Möbel waren zurückgeblieben. Wohl weil sie alt und schwer waren und niemand sie haben wollte. Drei dünne Matratzen, die sie hierhergebracht hatten, lagerten an der Seite.
Sie trat in die Küche, als die Männer mit dem Jungen kamen. Da der Flur schmal war, brauchten sie den gesamten Platz.
»Legt ihm eine von den Windeln um«, rief sie ihnen hinterher. »Ich komm gleich nach.«
In der Küche säuberte sie unter dem dünnen Strahl des Wasserhahns das Messer. Es musste ganz rein sein, wieder frisch und glänzend. Für das nächste Mal. Zärtlich strichen ihre Finger über die Klinge. Dann öffnete sie die ans Stromnetz angeschlossene Kühltasche und nahm eine Flasche Bier heraus. Sie hebelte den Bierdeckel mit dem Messer auf, trank und ließ den kühlen Schluck mit einem genüsslichen »Ahh« durch die Kehle laufen.
Bis hierher hatte alles geklappt. Jedenfalls fast alles. Das Mädchen an der Au war nicht eingeplant gewesen. Wo war sie nur so plötzlich hergekommen?
Egal. Sie nahm einen weiteren Schluck, und weil sie sich vor der Windel ekelte, wartete sie noch ein paar Minuten, bevor sie den Männern nach oben folgte.
Dort gab es nur ein ausgebautes Zimmer. Ein riesiger Holzkleiderschrank stand darin, außerdem eine alte Kommode, ein schäbiger Sessel mit einem abgewetzten Fußschemel davor, ein altes Holzbett und ein Nachtschränkchen. Neben der Tür hing noch ein Regal, auf dem ein paar vergilbte Bücher vor sich hin staubten.
Die Männer hatten den Jungen auf der Matratze abgelegt. Ein Laken gab es nicht, aber ein Kissen. Da Nick ordentlich schnaufte, schien es kein leichtes Unterfangen gewesen zu sein, den bewusstlosen Jungen in die Windel und dann wieder in die Jeans zu kriegen.
Leon griff nach der Decke auf der Kommode.
»Willst du ihm auch noch eine Gutenachtgeschichte erzählen?«, sagte Kathrin. »Der trägt Jacke und Schal und wird schon nicht erfrieren.«
Leon hatte zwar in der Bewegung innegehalten, doch dann deckte er den Jungen zu. »Es ist saukalt hier oben. Und es soll ihm gut gehen, oder? Das war doch die Ansage?« Herausfordernd sah er sie an.
»Hm«, grunzte Kathrin unter zusammengezogenen Augenbrauen. »Hast ja recht.« Sie ließ sich auf den Sessel fallen und legte die Füße auf dem Schemel ab. »Ich bleibe hier, bis er wach ist.«
»Das kann ich doch machen«, bot Leon sich an.
Kathrin schüttelte den Kopf. »Nein, geht ihr mal schön unten chillen.« Sie zog das Messer aus der Jeans und ließ es aufspringen. »Ich will der kleinen Kröte persönlich klarmachen, was mit ihm passiert, wenn er auch nur einen falschen Mucks von sich gibt.«
***
»Hast du das gesehen?«, flüsterte Jana ihrer Freundin zu, die zitternd neben ihr auf dem Boden des Schuppens hockte. »War das ein Mensch, was die da ins Haus geschleppt haben?« Sie selbst zitterte ebenfalls, aber nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung.
»Ich hab Angst«, wimmerte Neele. »Was sind das für Leute?« Sie hatte gar nichts gesehen, weil sie sich nicht getraut hatte, durch die alte Schuppentür zu schauen, dort, wo ein Stück einer Holzlatte splittrig herausgebrochen war.
Jana kroch ein Stück zurück und hockte sich auf einen der beiden Strohballen, die in einer Ecke lagerten. Sie mussten noch vom Uropa stammen, der Kaninchen gezüchtet hatte. Entsprechend alt und muffig roch das Stroh.
»Lass uns abhauen«, flüsterte Neele. »Das ist voll unheimlich.«
Jana zog ihr Handy aus der Hosentasche. »Nee, wir bleiben hier. Es ist schon so spät.«
»Hier?« Neele klang entsetzt.
»Ja, hier. Wir nehmen das Stroh, breiten es aus, und mit dem Stroh von dem anderen Ballen decken wir uns zu. Stroh ist total warm.«
»Aber ich will hier weg!«
»Dann musst du allein gehen. Ich bleib hier. Bis zum Dorf ist das ewig weit, und ich hab keinen Bock, das ganze Ende wieder zurückzulatschen. Außerdem fährt so spät kein Bus mehr. Wo sollen wir also im Dorf unterkriechen, ohne dass wir auffallen? Ich hab nicht vor, mich gleich wieder hopsnehmen zu lassen.«
Neele begann leise vor sich hin zu weinen.
Genervt durchtrennte Jana mit einem Kartoffelmesser, das sie aus der Heimküche hatte mitgehen lassen, den Strick eines Strohballens und verteilte das Stroh auf dem Boden. Hauptsache, die Typen kamen nicht in den Schuppen. Was sollten die hier auch schon wollen?
Sie leuchtete mit der Handy-Taschenlampe durch den Raum. Hier gab es nichts außer altem Gartengerät und ein paar rostigen Werkzeugen. An einer Wand hing Opas alter vergilbter Kopfschutz, den er getragen hatte, wenn er zu seinem Bienenstock ging. Jetzt hausten die Spinnen darauf.
»Mach das Licht aus!«, zischte Neele.
Schnell tat Jana, was die Freundin gesagt hatte. War sie blöd? Licht war ja nun wirklich verräterisch. »Die hauen bestimmt gleich wieder ab«, sagte sie zu Neele. »Und wenn nicht, verschwinden wir morgen ganz früh. Bevor die Typen wach sind.«
Statt Sekt, nach dem ihnen beiden nicht mehr der Sinn stand, tranken sie Cola, und weil der Appetit sich auch verabschiedet hatte, aßen sie nur die Schokolade.
»Ich muss so dringend«, sagte Neele. »Aber ich trau mich nicht, rauszugehen.«
Jana zeigte auf einen rostigen Eimer bei den Gartengeräten. »Da kannst du reinpinkeln.«
»Ernsthaft?« Neele schossen wieder einmal Wuttränen in die Augen.
»Ist doch sogar besser, als hinterm Schuppen ins Gras zu pinkeln. Da sind bestimmt Zecken und so ’n Zeug.«
»Witzig«, fauchte Neele. Sie zog die Klopapierpackung aus der Tüte, öffnete sie und warf Jana eine der beiden Rollen zu. Mit der anderen ging sie in die Werkzeugecke.
Jana hörte Neele leise weinen, als der Urinstrahl hart das Blech des Eimers traf. Sie verdrehte die Augen. Die war aber auch empfindlich!
Nachdem auch Jana den Eimer genutzt hatte, lagen sie schließlich schweigend nebeneinander im Stroh, zitternd, weil es nicht genug Stroh war, um durchzuwärmen. Und all die Geräusche draußen … Jana lauschte angestrengt. Überall knackte und raschelte es, und irgendetwas flatterte immer wieder am Schuppen vorbei. Hauptsache, es gab hier drinnen keine Ratten oder Mäuse.
Von den Typen hatte sich keiner mehr draußen blicken lassen. Wer waren die? Die Besitzer? Das konnte eigentlich nicht sein. Mutti hatte doch gesagt, dass irgendeine Naturschutzstiftung Uropas Haus gekauft hatte, weil es nicht wieder bewohnt werden sollte. Weil es am Moor lag, das unter Naturschutz stand.
Eigenartig. Und unheimlich. War das wirklich ein Mensch gewesen, den die da reingetragen hatten? Vielleicht doch eher ein Tier.
»Neele, das sind Wilderer«, flüsterte sie aufgeregt. »Ja, bestimmt. Opas alte Kate ist doch ein super Versteck für so was.«
Es kam keine Antwort. Neele war also entgegen ihrer Ansage, sie würde hier keine Sekunde pennen, eingeschlafen.
Und dann erklangen Stimmen, dunkle Männerstimmen. Jana schoss hoch. Sie ging zur Tür und lugte durch das Loch nach draußen in die Dunkelheit. Sie hörte zwei Wagentüren zuschlagen, dann den Motor. Die Lichtkegel der Scheinwerfer erhellten kurz das Haus, dann wendete der Fahrer den Wagen auf dem Hof und fuhr davon.
Zwei Autotüren … War die andere Person noch im Haus, die Frau? Jana war sich sicher, dass die dritte Person eine Frau gewesen war.
Sie sah zu der alten Backsteinkate. Da! Da war ein Licht. Unstet, wie von einer Taschenlampe. Dann war es dunkel. Traute die Frau sich nicht, das Licht anzumachen? Vielleicht wollte sie nicht, dass jemand sah, dass sie im Haus war. Jana beobachtete das Haus noch einen Moment, aber es tat sich nichts mehr. Sie kroch zurück unter das muffige Stroh und starrte in die Düsternis der Scheune. Obwohl sie hundemüde war, wollte und konnte ihr Kopf nicht abschalten.
Was ging hier vor sich? Warum wurde im Haus das Licht ausgeknipst?
Gänsehaut bildete sich auf Janas Körper. Nicht nur vor Kälte.
***
Die Spurensicherung war bereits vor Ort, als Lyn in Kasenort ihren roten Beetle am Straßenrand parkte, unweit des rot-weißen Flatterbandes, das ein Kollege gerade weitflächig um den Leichenfundort zog. Das Scheinwerferlicht des Beetle reichte nicht bis dort heran.
Erst als Lyn ausstieg und ein paar Schritte gegangen war, sah sie die Tote im feuchten Gras der Bankette liegen, keine zwei Meter von der Wilster Au entfernt. Sie erkannte im Licht der Lampen, die die Kollegen aufgestellt hatten, schlanke Beine in Bluejeans und eine senffarbene Jacke. Der Kopf der Toten wurde durch die weiße Schutzanzüge tragenden Kollegen verdeckt.
Die Szenerie wurde von verschiedenen Lichtern in der Dunkelheit beleuchtet. Vom Blaulicht der Polizeiwagen und des Rettungswagens, von den Scheinwerfern der Spurensicherung und vom Licht der Häuser in der Ferne. Etliche Schaulustige hatten sich auch schon eingefunden. Sie standen hinter dem Flatterband und diskutierten. Ein Streifenpolizist, der bei ihnen stand, wurde gerade laut. Wahrscheinlich hatte wieder ein asozialer Gaffer versucht, ein Handyfoto zu schießen.
Kollege Jochen Berthold stand bei einem Mann und einer Frau und befragte sie. Zwei Räder lagen im Gras. Vielleicht hatten die Radfahrer das Mädchen gefunden? Oder aber die hysterisch schluchzende Frau, die von einem Sanitäter betreut wurde? Wilfried stand neben ihr und redete auf sie ein.
Lyn stieg in die weißen Überschuhe, die ihr eine Kollegin der Spurensicherung reichte, streifte Einweghandschuhe über und sah wieder zu der Leiche, die ein weiterer Kollege gerade fotografierte. Die Frau war jung, so viel war im Licht zu erkennen. Ihre Augen waren leicht geöffnet gen Himmel gerichtet. Die langen Fransen ihres bunt gestreiften Schals wehten im Wind und bedeckten zum Teil ihr dunkles Haar.
»Die Rechtsmedizin müsste auch gleich hier sein«, sagte einer der Kollegen, als Lyn und Wilfried die Erlaubnis bekamen, an die Leiche heranzutreten.
»Die Tote ist das Au-pair der Fahrenkrugs«, sagte Wilfried zu Lyn, als sie sich zu der Toten hinunterbückte und mit den Fingern eine Haarsträhne aus dem Gesicht des Mädchens strich.
Es versetzte Lyn einen schmerzhaften Stich im Oberbauch, das Mädchen so daliegen zu sehen. Dieses wunderbare junge Leben … Vor zwei Stunden hatte sie vielleicht herzhaft gelacht, mit Freunden gechattet, Musik gehört oder sich einen Rooibostee mit Vanillearoma gekocht. Den trank Lyns ältere Tochter Charlotte am liebsten. Sie mochte im gleichen Alter wie das Mädchen sein.
Lyn schluckte. Wer auch immer die Eltern dieses Mädchens waren … sie würden heute den Schmerz ihres Lebens erleiden.