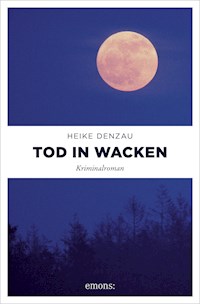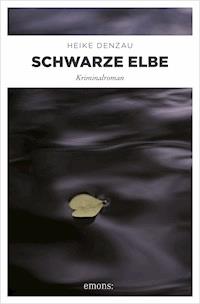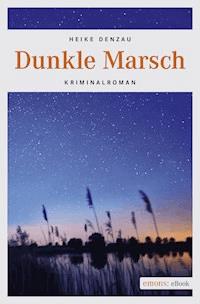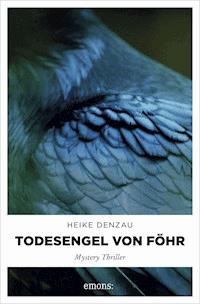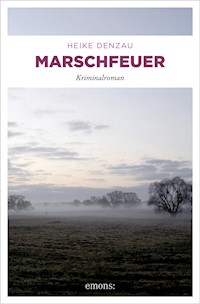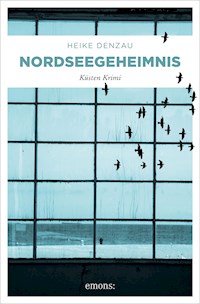Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lyn Harms
- Sprache: Deutsch
Cold Case am Nord-Ostsee-Kanal. Lyn Harms ist zurück! Vor vier Jahren verschwand die Studentin Mara Keller spurlos. Ein ungelöster Fall, in den unerwartet Bewegung kommt, als Kommissarin Lyn Harms von der Kripo Itzehoe in einer tödlichen Brandstiftung am Nord-Ostsee-Kanal ermittelt. Schnell gerät eine Unternehmerfamilie in den Fokus, in der offenbar jeder Dreck am Stecken hat – aber gleich zwei Morde? Lyn forscht im engsten Familienumfeld und kommt einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Denzau, Jahrgang 1963, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Bereits mehrfach preisgekrönt, ist sie Verfasserin zweier erfolgreicher Krimireihen und veröffentlicht außerdem bei Droemer Knaur humorvolle Liebesromane.
www.heike-denzau.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: time./photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-889-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Was hinter uns liegt und was vor uns liegt,
sind winzige Dinge im Vergleich zu dem,
was in uns liegt.
VOR VIER JAHREN …
»Ich kann dich kaum verstehen, Mama.« Mara Keller schirmte ihr Handy so gut es ging mit der linken Hand gegen den laut prasselnden Regen ab. Sie war bis auf die Unterwäsche durchnässt und bereute, an diesem Rastplatz ausgestiegen zu sein. Das WC-Häuschen bot keinen Schutz zum Unterstellen, denn es war aufgrund von Sanierungsmaßnahmen geschlossen, wie ein Schild verkündete. Aber der Typ in dem alten Fiat war ihr unheimlich geworden, und darum hatte sie ihn gebeten, bei der nächsten Gelegenheit zu halten. Die nächste Heimfahrt würde sie definitiv wieder über BlaBlaCar buchen. Bei den Mitfahrgelegenheiten dort war sie noch nie enttäuscht worden. Nur hatte es diesmal nicht geklappt, weil sie sich erst heute Morgen entschieden hatte, ihre Eltern zu besuchen.
»Falls du mich besser hörst als ich dich, Mama: Ich bin jetzt auf einer Raststätte und werde hoffentlich gleich einen Wagen finden, der mich weiter mitnimmt. Spätestens in zwei Stunden bin ich zu Hause. Ich freu mich auf deine Frikadellen. Hab dich lieb.«
Sie stopfte das Handy in den Rucksack und sah zu den mobilen Toiletten, die als Ersatz für das WC-Häuschen aufgestellt worden waren. Mit einem Naserümpfen wandte sie sich wieder ab. Lieber nass, als in einer dieser engen, stinkigen Kabinen zu stehen. Und dann gab es auch schon Hoffnung. Erwartungsvoll sah sie den beiden Wagen entgegen, die zeitgleich den Rastplatz ansteuerten und hintereinander hielten.
Sie eilte auf den ersten Wagen zu, als der Motor abgestellt wurde. Es war ein schwarzer Kombi. Ein dicker Mann saß darin, wie das Innenlicht zu erkennen gab, das er gerade einschaltete. Er stellte eine Brotdose auf das Armaturenbrett und sah zu ihr, während er die Lasche von einer Dose Red Bull zog. Die Rückbank war mit Kartons und Kisten vollgestellt, ebenso der Kofferraum.
Mara blickte zu dem anderen Wagen, einem roten Polo. Das Licht eines Handys, das die Person darin zur Hand nahm, zeigte, dass es eine Frau war. Das war gut. Sie hatte zwar grundsätzlich keine Angst, bei Männern einzusteigen, aber Frauen waren nun mal die sicherere Schiene.
Sie ging die paar Schritte und klopfte an die Beifahrertür des Polos. Doch das erhoffte Runterfahren der Scheibe blieb aus. Das war das Problem bei alleinfahrenden Frauen. Die hatten Schiss vor Trampern, und diese hier hatte gerade die Tür verriegelt.
Mara versuchte dennoch ihr Glück. Sie zog die Kapuze vom Kopf, damit die Frau ihr Gesicht besser sehen konnte. »Würden Sie mich ein Stück mitnehmen?«, schrie sie gegen die geschlossene Scheibe.
Doch die Frau wedelte mit der Hand, als wäre Mara ein lästiges Insekt.
Mist. Mara hastete zurück und klopfte an die Scheibe des Kombis.
Kauend signalisierte ihr der Fahrer mit der Hand, die Tür zu öffnen.
»Hallo, ich suche eine Mitfahrgelegenheit.« Mara musterte ihn. Er war nicht dick, er war fett. Wohl ein Geschäftsmann. Er trug ein weißes Hemd und eine edle dunkle Jeans und sah gepflegt aus. Und, das war die Hauptsache, er wirkte vertrauenswürdig.
»Ich fahre bis Itzehoe«, sagte er und biss erneut in das Sandwich.
»Echt? Super«, freute sich Mara, »genau da will ich hin. Meine Eltern wohnen da.«
Er musterte sie noch einmal kurz, dann nickte er. »Na gut, weil es so gießt. Normalerweise nehme ich keine Anhalter mit.« Er griff nach der Lederjacke, die auf dem Beifahrersitz lag, und hielt sie ihr hin. »Ich muss ja nicht auch noch nass werden. Leg die hinten auf eine der Kisten im Kofferraum. Und pass auf, dass sie nicht so nass wird, die ist neu.«
Mara nahm sie und eilte damit um den Wagen herum. Sie öffnete den Kofferraum und schüttelte die Jacke unter der schützenden Kofferraumklappe noch einmal aus, um sie von den Regentropfen zu befreien, die sich auf dem kurzen Stück Weg daraufgesetzt hatten. Dann legte sie sie auf eine der geschlossenen Stapelkisten. Durch das milchige Plastik der Behälter war zu erkennen, dass darin Klamotten lagerten.
»Puh«, stieß sie aus, als sie schließlich auf dem Beifahrersitz saß und die Tür hastig ins Schloss zog. Endlich trocken.
Der Blick des Mannes glitt über sie, während er sich das letzte Stück Sandwich in den Mund stopfte. »Nasser geht’s wirklich nicht, was?«
»Allerdings.« Mara wischte die Tropfen weg, die ihr aus dem Haar über das Gesicht rannen. Dabei versuchte sie den Geruch auszublenden, der verriet, womit das Weißbrot belegt gewesen war. Ekliger Thunfisch. Noch dazu war es bullenheiß hier drin.
»So, weiter geht’s«, sagte der Mann, leckte seine Finger ab und leerte den Rest des Energy Drinks in einem Zug, bevor er die Dose nach hinten in den Fußraum warf. Er startete den Wagen. Der Polo, der hinter ihnen gestanden hatte, passierte sie, während der Mann die beschlagene Seitenscheibe freiwischte und dann auf die Autobahn fuhr.
Mara schnallte sich an und war froh, als Musik erklang. Musik war gut, dann hatte man nicht das Gefühl, immer reden zu müssen. »Ich hoffe, du magst Rock«, sagte er und drehte das Radio lauter. »Ich brauche heute was Lautes.« Nach einem Moment des Schweigens setzte er hinterher: »Lautes hilft, wenn man richtig, richtig sauer ist.«
Mara warf ihm einen schnellen Blick zu, aber es kam keine Erklärung. Er blickte stur geradeaus in den Regen, während Bon Jovi röhrte: »… standing on the dirt where they’ll dig my grave …« Sie strich mit dem Ärmel über die Scheibe an ihrer Seite. Sie fühlte sich unwohl. Erwartete er, dass sie nachhakte? Als Vieltramperin hatte sie dieses Phänomen schon oft erlebt: Wildfremde Menschen gaben Persönliches preis – wohl weil sie davon ausgingen, dass man sich nie wieder begegnete.
Okay, dann würde sie mal die Therapeutin geben. Zeit genug hatten sie ja. »Warum sind Sie denn so sauer?«
»Weil es verdammte Scheißfrauen gibt.«
Fuck, jetzt durfte sie sich irgendwelche Beziehungsprobleme anhören. Sie blies sich mit der Unterlippe Luft an die Stirn, weil die Luft nicht nur schlecht, sondern vor allem so unangenehm warm war. Wie konnte er das nur aushalten? Schwitzten Dicke nicht eigentlich noch mehr als Dünne?
Sie sah zu ihm hin, weil entgegen ihrer Erwartung keine weitere Erläuterung kam. Er schien ihren Blick zu spüren, denn er schaute sie kurz an. »Du kommst aus Itzehoe, sagtest du?«
Aha, daher wehte der Wind. Er hatte Schiss, mehr zu erzählen, weil er auch aus Itzehoe war. Dabei kannten sie doch beide nicht mal ihre Namen. »Ja, ich besuche meine Eltern übers Wochenende. Ich studiere in Hannover.«
Er nickte nur und starrte wieder geradeaus. Natürlich musste er sich bei dem Starkregen auf den Verkehr konzentrieren, aber irgendwie wirkte er eher, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders, während sie schweigend Kilometer um Kilometer zurücklegten. Sie beobachtete aus dem Augenwinkel, wie sich seine Hände in Abständen immer wieder so stark um das Lenkrad verkrampften, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. Wer auch immer die »Scheißfrau« war, sie musste mächtig was verbockt haben.
Nach einer Viertelstunde hielt Mara es nicht mehr aus. Sie musste aus dem klatschnassen Hoodie raus. Sie schnallte sich ab und fuhr sich beim Ausziehen noch einmal über die immer noch nassen Haare. Dann stopfte sie den Hoodie einfach zwischen ihre Füße und entwirrte ihre feuchten Strähnen. »Ganz schön warm hier«, sagte sie in der Hoffnung, dass er die Heizung drosseln würde, und sah ihn an.
Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sein Blick bereits auf ihr ruhte. Allerdings nicht auf ihrem Gesicht. Er korrigierte den Blick zwar schnell, aber er war eindeutig gewesen.
Mara blickte an sich herunter und hielt vor Schreck kurz den Atem an. Der Regen hatte nicht nur ihren Hoodie durchnässt, sondern auch das weiße Shirt und den Baumwoll-BH darunter. Deutlich zeichneten sich ihre Brüste durch den feuchten Stoff hindurch ab. Fuck! Kein Wunder, dass er so geglotzt hatte. Hastig verschränkte sie die Arme vor der Brust.
Das Schweigen wurde belastend, insbesondere, weil sein Atmen hörbar wurde. Es wurde hastiger. Seine Finger begannen, das Lenkrad zu kneten. Ein kurzer Seitenblick verriet, dass ihm Schweiß auf der Stirn stand.
»Können wir die Heizung ein bisschen drosseln?«, bat sie. Es war eklig und beunruhigend zugleich zu sehen, wie sich Schweißtropfen von seiner Schläfe lösten und er immer kurzatmiger wurde.
Er sagte kein Wort, drehte aber die Temperatur runter, und nicht nur ein wenig. Er stellte die Klimaanlage an und drückte den Regler, bis die Anzeige achtzehn Grad anzeigte. Was zuerst erleichternd wirkte, wandte sich schnell ins Gegenteil. Die klammen Klamotten und die niedrige Temperatur ließen Mara frieren.
Sie warf ihm erneut einen Seitenblick zu. Was für eine Kacke. Sie konnte doch jetzt nicht sagen, dass es zu kalt war. Vor allem, da er es selbst nicht so zu empfinden schien. Er hatte keine Gänsehaut. Im Gegenteil. Sein Gesicht wirkte erhitzt.
Kurz entschlossen griff sie wieder nach dem Hoodie und schnallte sich ab. Die feuchte Baumwolle machte ein schnelles Hineinschlüpfen allerdings unmöglich. Es war kein schönes Gefühl, die Arme heben zu müssen, um in die Ärmel zu kommen. Sie glaubte, seinen Blick auf ihren Brüsten zu spüren. Sie zog und zerrte, um den Kopf durch die klamme Öffnung zu kriegen, als seine Stimme erklang. »Brauchst du Hilfe?«
Dann streiften heiße Finger eine ihrer vor Kälte harten Brustwarzen, während er am Hoodie zog. Mara schrie auf.
»Oh, Entschuldigung«, sagte er, als sie endlich den Kopf durch die Öffnung des Hoodies bekommen hatte. »Keine Absicht.«
Mara kamen die Tränen. Er log. Die Berührung war nicht zufällig gewesen. Er hatte ihren Busen eindeutig absichtlich berührt. Ihre Stimme zitterte, als sie sagte: »Ich möchte aussteigen. Sofort.«
»Du kannst hier nicht aussteigen«, sagte er, ohne sie anzusehen. »Nicht mitten auf der Autobahn.«
»Dann bei der Raststätte«, sagte Mara und deutete auf das Schild, das gerade in Sicht kam. Sie versuchte, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben.
»Okay.«
Doch als die Raststätte nahte, ging er nicht vom Gas.
»Ich will hier raus!«, schrie sie und schlug gegen die Scheibe.
»Beruhig dich«, sagte er schwer atmend. Er löste eine Hand vom Lenkrad und wischte sie an der Hose ab. »Bei der nächsten Abfahrt fahren wir raus. Ich muss sowieso noch tanken.«
Maras Herz raste. Sie starrte auf die Tankanzeige. Drei viertel voll.
Sie begann zu weinen. »Bitte, lassen Sie mich raus! Bitte!«
EINS
»Krümel, wir sind spät dran!«, rief Lyn aus der Küche Richtung Flur, in der Hoffnung, dass es oben im Bad ankam, wo Sophie sich ungewohnt lange aufhielt. Es war der zweite Schultag nach den Sommerferien, und alle mussten sich erst wieder an den Alltagsrhythmus gewöhnen.
Sie trank den restlichen Kaffee aus dem Becher in zwei kleinen Schlucken, um sich nicht wieder zu bekleckern wie am Vortag, als sie den Rest hinuntergestürzt hatte. Zufrieden sah sie auf ihre ärmellose weiße Bluse, die sie zu einer blau-weiß gestreiften Palazzo-Hose trug. Alles sauber.
»Ich brauch mal einen Waschlappen«, sagte Hendrik mit Blick auf Emil, der mit honigverschmiertem Mund auf seinem Hochstuhl saß und endlich herunterwollte, wie das Quengeln und die erhobenen Arme verrieten.
»Emi will hunter, Emi will hunter!«, rief er unentwegt.
»Ja, gleich, Mäuserich«, antwortete Hendrik, der immer die Ruhe bewahrte, worum Lyn ihn beneidete.
Sie nahm den Putzlappen aus der Spüle und drückte ihn Hendrik in die Hand.
»Dein Ernst?« Hendrik hielt den Lappen mit zwei Fingern, als hätte sich die Pestilenz persönlich damit den Schweiß von der Stirn gewischt.
»In der Sandkiste futtert er doch auch Dreck.« Sie verdrehte die Augen, als Hendrik den Lappen in die Spüle zurückwarf und ein Geschirrhandtuch unter dem Wasserhahn befeuchtete. »Meine Mutter hat mir früher den Mund immer mit dem Küchenlappen abgewischt«, fuhr sie fort. »Oder mit einem Taschentuch mit ihrer Spucke. Das ist eklig.«
»Ich zitiere mal meine Oma: Früher hatten wir auch einen Kaiser.« Hendrik hob seinen Sohn vom Stuhl, als der kleine Mund sauber war.
Die Katze sprang vom Hocker, als Emil mit ausgestreckten Händen auf sie zudackelte, und verschwand auf den Flur. Emil tappte hinterher. »Gafiel, wate!« Die Katze wurde von jedem Familienmitglied anders genannt: Lyn rief sie »Mieze«, Charlotte hatte sie »Krummbein« getauft. Sophie nannte sie »Garfield« und freute sich darüber, dass Emil sich auf ihre Seite geschlagen hatte, genau wie Hendrik.
»Bleib hier, mein Schatz«, sagte Lyn, während sie den klebrigen Hochstuhl mit dem Putzlappen abwischte. »Papa bringt dich gleich in den Kindergarten.« Da Hendrik noch eine weitere Woche krankgeschrieben war – ein Unfall bei seinem heiß geliebten Polizeidienstsport –, übernahm er es weiterhin, das Kind zur Kita zu bringen. Den kurzen Weg vom Wewelsflether Friedhof, an den ihr Häuschen direkt grenzte, über die Schulstraße und den Ho-Chi-Minh-Pfad zum Kindergarten schaffte er auch humpelnd.
Als das Telefon klingelte, sah sie zur Küchenuhr. Sieben Uhr zehn. Das konnte nur ihr Vater sein. Niemand sonst rief morgens so früh an.
»Du musst das Gespräch im Wohnzimmer annehmen«, sagte Hendrik und deutete auf die leere Ladestation, während er die Butter in den Kühlschrank stellte.
Lyn schnappte sich auf dem Weg zum Wohnzimmer Emil, der auf dem Flur an der Schublade der Kommode zerrte, in der Handschuhe, Tücher und Schals lagerten. Gut, dass sie klemmte. »Verdammt!«, stieß sie aus, als der Blick auf die zweite Station verriet, dass alle drei Mobilteile oben waren.
Dann hörte sie Sophie auch schon mit einem fröhlichen »Hi, Lotte!« rangehen. Einen Moment lang herrschte Stille, dann nahm Sophies Stimme einen beunruhigenden Unterton an: »Was ist los?«
Lyn setzte Emil an der Küchentür ab, stieg über das Schutzgitter und hetzte die Treppe hinauf.
Sophie sah Lyn mit großen Augen entgegen, während sie ihrer Schwester lauschte. Deutlich war Schluchzen zu hören. »Lotte weint ganz doll«, sagte Sophie, als Lyn ihr schon das Telefon aus der Hand riss.
»Lotte, was ist?« Lyns Herz raste.
»Mama …« Charlotte schluchzte bitterlich. »Mama, es ist Schluss. Markus und ich … Wir haben uns getrennt.«
»Ach, Schatz!«, rief Lyn aus – für den Moment einfach nur erleichtert. Niemand war verunfallt oder tot. Aber das half natürlich Charlotte nicht. »Lotte, Schatz, beruhig dich erst mal«, setzte sie nach und hielt kurz den Hörer zu, um Sophie aufzuklären, die an ihrem Arm zerrte und immer wieder fragte, was los sei. »Lotte und Markus haben sich anscheinend getrennt«, flüsterte sie.
»Waaas?«
Hendrik stand unten an der Treppe und fragte besorgt: »Ist was passiert?«
»Markus hat mit Lotte Schluss gemacht«, rief Sophie ihm ihre eigene Version zu. Ihre Schlussfolgerung schien allerdings so falsch nicht zu sein, denn Charlottes lautes Aufweinen verriet, dass sie es gehört hatte.
»Ach, Schatz, mein Schätzchen.« Lyn lief das Herz über.
Weil Sophie mit ihrem Ohr fast am Telefon klebte und ständig »Was sagt sie?« fragte, stellte Lyn auf Lautsprecher.
»Er hat … mich betrogen«, stammelte Charlotte. »Mit Greta. Das … ist so …« Ihre Stimme brach weg.
»Wer ist Greta?«, hakte Lyn nach, weil sie den Namen nicht einordnen konnte, obwohl er ihr vage bekannt vorkam.
»Unsere Nach…barin«, schluchzte Charlotte erbarmungswürdig. »Von ge…genüber.«
»Die Blonde mit dem Riesenbusen?«, rief Sophie in den Hörer, was zur Folge hatte, dass Charlotte erneut heftig aufweinte.
Lyn stellte den Lautsprecher wieder aus und zischte Sophie zu: »Sehr hilfreich. Danke.« Dann sagte sie zu Charlotte: »Schatz, komm zu uns.«
Die Antwort kam stockend. »Aber ich … hab doch Vorlesung.«
Lyn seufzte. Charlotte, die Vorbildliche. Sie war mit Sicherheit die einzige Studentin der Flensburger Universität, die noch nie geschwänzt hatte. »Du bist in der Lage, jetzt in die Uni zu gehen?«, fragte Lyn mit ein wenig Strenge in der Stimme.
Eine Weile war nur das bittere Weinen zu hören, dann kam ein leises »Nein«.
»Dann sammle dich jetzt ein bisschen und komm nach Hause, mein Schatz. Morgen ist doch auch schon Freitag. Du verpasst also nicht viel. Und ich möchte, dass du den Zug nimmst, verstanden? Zum Autofahren bist du viel zu aufgeregt. Du schreibst mir, wann du am Bahnhof bist, dann hole ich dich ab. Okay?«
Charlotte erklärte sich einverstanden. Ihr Abschiedsgruß ging noch mal in flammendem Weinen auf, weil Sophie ins Telefon schrie: »Markus ist ein blödes Arschloch!«
Lyn verdrehte die Augen und legte Sophie die Hand an die Wange, nachdem sie aufgelegt hatte. »Krümel, solche Aussagen sind jetzt wirklich nicht dienlich, selbst wenn es stimmt. Wenn Lotte sagt, er ist ein Arschloch, dann dürfen wir ihr zustimmen, aber wenn du es so raushaust, tut es ihr weh … Wie siehst du eigentlich aus?« Lyn betrachtete ihre siebzehnjährige Tochter mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Hast du dich geschminkt?«
»Du sagst das, als hätte gerade ein Einhorn einen Regenbogen gekackt«, fauchte Sophie und wischte Lyns Hand weg.
»Ehrlich gesagt hätte mich das kackende Einhorn nicht so überrascht«, erwiderte Lyn wahrheitsgemäß. Sophie hatte sich noch nie geschminkt. »Nordisch by Nature« lautete ihre Devise.
»Sieht es denn gut aus?«, fragte Sophie.
Ihr Gesichtsausdruck riet dazu, nicht die Wahrheit zu sagen. Also verkniff Lyn sich das »Erheblich weniger wäre erheblich mehr gewesen« und sagte: »Es ist einfach so ungewohnt, Krümelchen.«
Doch Sophie konnte durchaus zwischen den Zeilen hören. »Sag doch einfach, dass du mich hässlich findest!« Sie stürmte in ihr Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
»Lyn?«, kam von unten Hendriks Stimme. »Hab ich das richtig verstanden: Lotte kommt nach Hause, weil Markus Schluss gemacht hat?«
Lyn liebte ihn für seinen Gesichtsausdruck. Er würde Charlotte von vorn bis hinten verwöhnen, wenn sie hier war. Die beiden verstanden sich wunderbar, und es war deutlich, dass er mit ihr mitfühlte, auch wenn er nicht Lottes und Sophies Vater war. »Ja«, seufzte sie und ging die Treppe hinunter. »Darum werde ich heute früher Feierabend machen und Lotte an der Bahn abholen.«
Hendrik setzte Emil ab und nahm sie in die Arme. »Die arme Maus. Er hat sie betrogen?«
»Ja. Mit der vollbusigen Blondine von gegenüber.«
»Fuck.« Und dann schleuderte er ein weiteres »Fuck!« heraus. Diesmal lauter. Hastig löste er sich von Lyn und ging vor dem Katzenklo in die Knie, das unter der Treppe stand. Emil saß darin. Und die Knetmasse in seinen Händen war definitiv nicht von Play-Doh.
»Och nee«, stöhnte Lyn auf, eilte in die Küche und nahm den Putzlappen. Diesmal hatte Hendrik nichts dagegen, als sie Emil damit über den Mund fuhr, den der Kleine offensichtlich mit seinen Händen berührt hatte. Als Emils beschmierte Finger sich dabei in ihre Bluse krallten, war Lyn kurz vorm Heulen. »Ich ruf jetzt im Büro an und sage, dass ich später komme.«
Sie ging in die Küche, pfefferte den Lappen in den Mülleimer und zog die Bluse aus. »Und dich liebe ich sehr«, rief sie Hendrik zu, der sich den stinkenden Nachwuchs schnappte und mit ihm Richtung Dusche humpelte.
Sie stellte den Kaffeevollautomaten wieder an, blickte dabei aus dem Fenster und fand sich Auge in Auge mit der alten Doro wieder, die auf dem Friedhofsweg stehen geblieben war und ins Küchenfenster starrte. Wie immer hatte die kleine Frau mit dem grauen zerfransten Haar ihren mit allem Möglichen voll beladenen Einkaufswagen bei sich, der ihr vor Jahren von den Besitzern des Edeka-Marktes geschenkt worden war. Wenn die Fenster offen standen, konnte man Doro kommen hören, denn die Räder quietschten entsetzlich. Und Doro kam oft vorbei, denn der Friedhofsweg verband die Schulstraße mit der Wewelsflether City, die aus Nahkauf-Markt, Bäcker und Schuster bestand.
Dorothea Kruse, so hieß sie mit vollem Namen, hatte immer diesen Blick. Ein Blick, der ihr bei den Ewiggestrigen im Dorf eine Art Hexenstatus gesichert hatte. Was natürlich auch daran lag, dass Doro gern behauptete, sie könne Engel und Geister sehen. Firlefanz. Doro hatte einfach ein sehr schlichtes Gemüt und viel Phantasie, aber …
Lyn trat ans Fenster und zog das taubenblaue Plissee vor die Scheibe. Es war einfach kein angenehmes Gefühl, dass Doro sehen konnte, dass sie nur im BH hier stand. Sekunden später zeugten ein Quietschen und Rumpeln davon, dass die alte Frau weiterzog, und Lyn ärgerte sich ein wenig über sich selbst. Wieso sollte sie vor Doro verbergen, was sie in ihrem eigenen Haus trieb?
Sie trank ihren Kaffee in Ruhe und stellte auch für Hendrik noch einen Becher unter den Automatenhahn, denn aus dem Bad erklang seine genervte Stimme: »Och nee! Emil, du musst doch Bescheid sagen, wenn ein Dutt kommt. Jetzt brauchen wir noch eine Windel.«
»Es gibt ja nicht viele Tage im Jahr, an denen ich das Büro meinem Zuhause vorziehe«, flüsterte Lyn Karin Schäfer zu, als sie sich im Besprechungsraum des K1 neben sie setzte. »Aber heute ist so ein Tag.«
Die Frühbesprechung hatte bereits begonnen. Lyn zog sich einen Becher aus der Tischmitte heran und füllte ihn. Wilfried Knebel, Chef der Mordkommission Itzehoe, berichtete gerade über den Stand der Dinge zur Neubesetzung seines Postens. Dass er in Pension ging, war für Lyn immer noch undenkbar. Wilfried gehörte hierher.
»Wir müssen unbedingt wieder einen Chef mit schütterem Haar finden«, flüsterte sie Karin zu. »Ich brauche einfach diese Geste, wie er sich mit den Händen hindurchfährt, um das Wenige zu ordnen.«
Karin lächelte. »Was wirst du denn bei mir am meisten vermissen?«
Lyn starrte sie an. Wirst? Hatte Karin gerade wirklich »wirst« gesagt und nicht »würdest«?
Karin strich ihr über den Arm. »Ich habe es gerade verkündet.«
»Nein.« Lyn kamen die Tränen. Was für ein Scheißtag. Karin hatte bereits im vergangenen Monat gesagt, dass sie überlege, ein Jahr vor ihrem eigentlichen Rentenbeginn zu gehen, aber dass es nun Wirklichkeit werden sollte, kam doch überraschend.
»Entschuldigt, Lyn und Karin«, erklang Wilfrieds Stimme. »Soll ich kurz warten, bis ihr euer Gespräch beendet habt?«
Lyn sah ihn an und plinkerte noch heftiger. Der gute Wilfried. Solche Sachen sagte er ohne Ironie. »Nein, natürlich nicht«, antwortete sie ihm mit einem verzerrten Lächeln. »Sorry.«
Sie fing einen amüsierten Blick von Kriminalhauptkommissar Thomas Martens auf. Thilo Steenbuck hingegen, der Kollege, der eigentlich immer gut gelaunt war, starrte düster vor sich hin. Lyn hätte Karin gern gefragt, welche Laus ihm über die Leber getrippelt war, wollte Wilfrieds Gutmütigkeit aber nicht überstrapazieren.
Doch als ihr Chef mit seinem Statement fortfuhr, bekam sie die Erklärung für Thilos miese Laune. Es gab einen weiteren Bewerber für Wilfrieds Posten: Thomas Martens. Und das kam bei Thilo, der sich ebenfalls darum beworben hatte, offensichtlich nicht gut an. Lyn hoffte, dass die Hauptkommissarin aus Lübeck, die die Dritte im Bunde war, das Rennen machen würde, damit keine Unruhe im Team entstand. Denn eines stand fest: Thilo würde es definitiv nicht werden. In Mitarbeiterführung stünde er auf einer Vier minus, wohlwollend betrachtet.
Nach der Frühbesprechung ging Lyn direkt in ihr Büro. Sie saß kaum, als Kommissariatssekretärin Birgit an die offen stehende Tür klopfte. »Lyn, vor zehn Minuten hat der Pförtner angerufen. Unten wartet eine Frau Bünz. Er sagt, sie möchte eine Aussage zum Fall Mara Keller machen.«
»Aha?« Lyn musste nicht eine Sekunde überlegen, wer Mara Keller war. Der Fall lag zwar fast vier Jahre zurück, aber der Name der verschwundenen Studentin hatte sich ihr ins Hirn gebrannt. Ungelöste Fälle gab es in Lyns Laufbahn nur wenige. Einer war der von Mara Keller.
Sie stand auf. »Du musst nicht zurückrufen, Birgit. Ich hole sie direkt unten ab.«
Während sie mit dem Fahrstuhl vom zehnten Stock des Polizeihochhauses in der Großen Paaschburg ins Erdgeschoss fuhr, waren ihre Gedanken bei der jungen Studentin Mara, die zuletzt auf einer Raststätte in der Lüneburger Heide lebend gesehen worden war. Danach verlor sich ihre Spur. Bis heute. Lyn und ihre Kollegen hatten damals alles versucht. Aber Aufrufe nach Zeugen in Presse und sozialen Medien und sogar bei »Aktenzeichen XY … ungelöst« hatten keine Erkenntnisse darüber geliefert, wer der Unbekannte war, zu dem sie in den Wagen gestiegen war. Auch die Schnüffelnasen der Mantrailer hatten nichts gefunden. Zu stark war der Regen an dem Septemberabend gewesen.
Der Pförtner deutete zu den Besucherstühlen, als er Lyn kommen sah.
»Frau Bünz?«, begrüßte Lyn die mollige Mittzwanzigerin. »Guten Tag, ich bin Lyn Harms vom K1. Der Pförtner sagt, Sie möchten eine Aussage zum Fall Mara Keller machen?«
Die junge Frau stand auf. »Kristin Bünz, hallo, ja, das möchte ich.« Sie öffnete ihren Rucksack und zog eine knittrige Zeitungsseite heraus. »Ich habe gestern diesen Artikel gelesen. Er ist vier Jahre alt.« Erfolglos versuchte sie, die Seite zu glätten. »Darin wird eine Jacke erwähnt.«
Lyn nickte. »Ja genau. Können Sie etwas dazu sagen?«
»Vielleicht.« Kristin Bünz hob die Schultern. »Ich weiß es ja nicht sicher, aber vielleicht habe ich die Jacke damals gefunden. Also, ohne zu wissen, dass es diese Jacke ist.«
Lyns Herzschlag beschleunigte sich ein wenig. Die Zeugin, die Mara Keller zuletzt lebend gesehen hatte, hatte in einem Wagen gesessen, der hinter dem Kombi gestanden hatte. Unglücklicherweise hatte sie nichts zum Nummernschild sagen können. Zu dicht hatte sie hinter ihm gehalten, und sie war vor ihm vom Rastplatz Wolfsgrund Ost gefahren. Aber sie hatte ausgesagt, dass Mara ein großes Kleidungsstück ausgeschüttelt und in den Kofferraum gelegt hatte. Vermutlich eine dunkle Jacke oder einen Kurzmantel.
»Kommen Sie bitte mit mir, Frau Bünz«, sagte Lyn und deutete zum Fahrstuhl.
Oben führte sie sie in den Vernehmungsraum. »Möchten Sie ein Wasser oder einen Kaffee?«
»Ein Wasser nehme ich gern.«
Die junge Frau wohnte in Pinneberg und studierte in Hamburg BWL.
»Bitte, erzählen Sie«, bat Lyn, nachdem sie sie belehrt und das Diktiergerät angestellt hatte.
»Ich habe vor vier Jahren eine schwarze Jacke gefunden. In einem Abfalleimer am Rastplatz Forst Rantzau an der A23.« Zu ihrem vor Aufregung fleckigen Hals gesellten sich rote Wangen. »Also, ich wühle normalerweise natürlich nicht in Müll rum, aber das Leder stach sofort ins Auge. Ich habe es rausgezogen, und es entpuppte sich als eine Lederjacke. Eine richtig tolle, aus ganz weichem Leder. Ich hab geguckt, ob sie kaputt ist, weil sie ja weggeworfen wurde, aber die war in Ordnung. Feucht vom Regen, aber heil. Da hab ich sie mitgenommen, weil sie so cool war und vor allem, weil sie so groß war, dass sie mir passte. Eigentlich war sie mir sogar zu groß, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm.«
»War es eine Damenjacke?«
»Nein, eher nicht. Die war schon für Herren.«
»Haben Sie die Jacke dabei?«, fragte Lyn mit Blick auf den Rucksack, den die Studentin auf dem Stuhl neben sich abgestellt hatte.
Kristin Bünz stellte das Glas zurück, nachdem sie einen Schluck getrunken hatte, und schüttelte den Kopf. »Nein. Die ist in Neuseeland geblieben.«
»Neuseeland«, wiederholte Lyn überrascht.
»Ja, ich bin in der Woche nach dem Fund für ein Jahr als Au-pair nach Auckland gestartet. Letztendlich wurden fast anderthalb daraus. Ich bin noch zur Südinsel und nach Australien gereist.«
»Und den Zeitungsartikel haben Sie jetzt erst gelesen?«
»Ja. Meine Oma hatte damals ein paar alte Sachen für mich aussortiert, Gläser, Tassen und so ’n Zeugs, und hatte das in Zeitungspapier eingewickelt. Den Karton mit den Sachen habe ich gestern erst vom Dachboden meiner Eltern geholt. Und beim Auspacken ist mir der Artikel mit der verschwundenen Studentin ins Auge gesprungen. Ich hab ihn gelesen, und …«, sie schluckte, »als das mit der Jacke erwähnt wurde, habe ich überlegt, wann ich die Lederjacke gefunden hatte. Es passt zeitlich.«
»Haben Sie ein Foto von der Jacke? Sie haben sie doch sicherlich in Neuseeland getragen?«
Kristin Bünz verzog die Lippen. »Ich bin nicht sicher. Ich müsste dann alle Bilder aus der Anfangszeit durchgucken. Die Jahreszeiten in Neuseeland sind ja genau andersrum. Die Jacke war dann schnell zu warm, und später passte sie nicht mehr. Darum habe ich sie dort für eine Kleidersammlung gespendet.«
Lyn musste nicht nachhaken. Die junge Frau sprach schon weiter. »Das war mein Ziel, als ich nach Neuseeland abgereist bin: ganz viel abzunehmen. Ich wollte meine Leute zu Hause überraschen. Die meisten Mädchen, die ein Jahr Au-pair oder Work and Travel machen, nehmen zu. Ich wollte es andersherum und hab es auch durchgezogen. Ich bin fünfundzwanzig Kilo leichter wieder nach Hause gekommen. Und ich hab das Gewicht bis jetzt gehalten«, fügte sie stolz hinzu.
Lyns Hirn ratterte. Die junge Frau war immer noch mollig. Wenn man fünfundzwanzig Kilo dazuzählte … Und sie hatte gesagt, die Jacke sei ihr sogar noch zu groß gewesen. »Es gab doch bestimmt einen Markenaufnäher. Welche Größe hatte die Lederjacke, und von welchem Hersteller war sie?«
Kristin Bünz hob die Schultern. »Ich hab geguckt, weil ich ja auch wissen wollte, welche Größe es war, aber da war kein Schildchen. Muss derjenige rausgeschnitten haben.«
Das war ungewöhnlich. Lyn notierte es in ihrem Heftchen, das sie immer zusätzlich zur Tonaufnahme führte. »Können Sie die Größe schätzen?«, fragte sie.
Kristin musste nicht lange überlegen. »Ich hab früher, als ich so dick war, oft Männersachen getragen. Fand ich cool. Größe 62 war es mindestens, aber eher 64.«
»Super, danke«, antwortete Lyn. »Es wäre von allergrößtem Interesse, dass Sie ein Foto von der Jacke finden. Bitte suchen Sie danach, Frau Bünz, so schnell wie möglich. Und dann senden Sie mir die entsprechenden Fotos bitte per Mail. Ich gebe Ihnen gleich ein Kärtchen, auf dem meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse stehen.«
»Ja klar, mach ich sofort, wenn ich zu Hause bin. Ich habe die Neuseelandfotos alle gespeichert.«
»Parkten damals weitere Wagen auf dem Parkplatz, wo Sie die Jacke fanden?«
»Ich glaube nicht.« Kristin Bünz überlegte. »Eigentlich bin ich mir sogar sicher, dass da keiner war. Dann hätte ich mich nämlich bestimmt nicht getraut, was aus dem Müll zu nehmen.« Sie zog die Nase kraus. »Ist ja schon peinlich.«
»Sind Ihnen noch mehr Dinge in dem Raststättenabfalleimer aufgefallen, aus dem Sie die Jacke genommen haben?«
»Nein, ich hab extra geguckt, ob da noch was Brauchbares drin ist. Aber da war nichts. Außer richtigem Müll.«
Lyn machte eine weitere Notiz. »Was genau war es für Müll? Können Sie sich an Details erinnern?«
Kristin Bünz machte große Augen. »Puh keine Ahnung! Das weiß ich echt nicht mehr. Halt Plastikflaschen und Papier und so was.«
»Danke. Gehen Sie zu Hause bitte noch mal in sich. Vielleicht fällt Ihnen noch die Marke der Plastikflaschen ein. Oder ein Aufdruck auf Papier oder Tüten, die vielleicht darin lagen. Oder Zigarettenschachteln.«
Die junge Frau starrte sie an, als hätte Lyn sie gebeten, den Ententanz aufzuführen. »Da brauche ich nicht in mich zu gehen. Keine Ahnung, was da genau drin war. Das ist vier Jahre her.«
»Das verstehe ich natürlich«, sagte Lyn mit einem Lächeln. »Aber es könnte ja durchaus sein, dass in Ihrer Erinnerung noch etwas haften geblieben ist, gerade weil Sie so intensiv nach weiteren Dingen Ausschau gehalten haben. Für uns sind Details, auch wenn sie noch so nichtig erscheinen mögen, durchaus wichtig. Eine zerknüllte Zigarettenschachtel zum Beispiel könnte vom Täter stammen.«
Lyn begleitete die junge Frau hinaus und steuerte dann direkt das Büro von Wilfried Knebel an, um ihm die Neuigkeiten zum Fall Mara Keller zu berichten. Auch er maß dem Jackenfund große Bedeutung bei.
Eine Stunde später erreichte sie eine Mail von Kristin Bünz. Ein einziges Foto war als Anlage beigefügt. Und das war quasi nicht zu gebrauchen. Kristin stand darauf hinter mehreren Personen und hatte die Arme auf deren Schultern gelegt. So waren nur Teile der unteren Ärmel und unter dem langen Haar ein Stück Kragen zu erkennen.
Lyn schrieb ihr zurück und fragte, ob Kristin bereit sei, mit dem Phantombildzeichner eine möglichst detailgetreue Zeichnung der Jacke anzufertigen.
Die Antwort kam umgehend. »Ja klar.«
Lyn rief direkt beim LKA in Kiel an. Phantombildzeichner waren Raritäten in Schleswig-Holstein und brauchten sich über zu wenig Arbeit nicht zu beschweren, aber der zuständige Beamte erklärte sich bereit, Kristin Bünz am nächsten Tag zu empfangen.
Lyn informierte Kristin, dass ein Polizeiwagen sie abholen und nach Kiel bringen würde. Dann rief sie die Akte »Mara Keller« am PC auf und betrachtete das Foto der jungen dunkelblonden Frau mit den blauen Augen. Mara war schlank und zierlich gewesen, einen Meter zweiundsechzig groß und hatte langes glattes Haar, das ihr bis über die Schultern fiel. Ein ganz normales, ein wenig unscheinbares Mädchen.
»Ich habe deiner Mutter damals vorlaut versprochen, dass wir dich finden, Mara«, murmelte Lyn dem Foto zu. Es war furchtbar gewesen, das Versprechen nicht halten zu können. Mara lebend zu finden, von dieser Vorstellung hatte Lyn sich verabschiedet, je mehr Zeit verging. Aber sie hätte den Eltern gern die quälende Ungewissheit genommen, ob ihr Kind irgendwo verscharrt lag oder in einem Verlies festgehalten wurde.
Lyn konnte dem Impuls nicht widerstehen und strich über das Gesicht auf dem Bildschirm. »Ich wünsche deinen Eltern so sehr, dass sie ihren Frieden finden können.«
ZWEI
Wer wohl Kim war? Lyn wunderte sich, dass sie sich diese Frage noch nie gestellt hatte. Dabei prangte der gesprayte Name mit dem i-Punkt-Herzchen schon ewig in riesigen Buchstaben an der Überführung, unter der sie jeden Arbeitstag hindurch Richtung Itzehoe fuhr. Sie war mal wieder spät dran, weil Emil lautstark darauf bestanden hatte, dass sie mit ihm noch die Duplo-Feuerwehr aufbaute. Sie hatte seinem Blick, den er eindeutig von seinem Vater hatte, nicht widerstehen können und nicht eingeplante fünfzehn Minuten mit ihm gespielt. Die Baustelle auf der B5 hatte dann für weitere Verspätung gesorgt.
Wenigstens hatte Charlotte noch geschlafen, als sie gefahren war. Es war schrecklich gewesen zu hören, wie sie sich in den Schlaf geweint hatte, nachdem sie sich einigermaßen tapfer über den gestrigen Abend gerettet hatte. Gut, dass sie erst einmal zu Hause in Wewelsfleth war. Sie würden sie am Wochenende auf andere Gedanken bringen, vor allem Emil mit seiner süßen Unschuld und dem nie stillstehenden Plappermäulchen.
Der Arbeitstag verging schnell. Lyn führte Befragungen zu einem Tötungsdelikt in Brunsbüttel durch, bei dem der in U-Haft befindliche Täter geständig war. Kurz vor ihrem Feierabend um fünfzehn Uhr kam vom LKA das Phantombild der Lederjacke. Die breite Jacke war etwas länger geschnitten und eher edel als lässig. Sie hatte keinen Reißverschluss, sondern eine Knopfleiste, an der die Knöpfe mit Ornamenten ein Hingucker waren.
»Klasse, Kristin«, murmelte Lyn erfreut. Details waren wichtig. Sie druckte das Bild aus und ging damit zu Wilfried.
»Sehr gut«, sagte ihr Chef, »ab damit zu Lurchi.« Er blickte auf die Uhr. »Vielleicht kriegt die ›sh:z‹ es noch in den morgigen Ausgaben unter.«
Lyn ging in ihr Büro und sandte die Datei mit dem Phantombild direkt an Pressesprecher Lukas Salamand, der von allen nur Lurchi genannt wurde. Die Details würde sie persönlich mit ihm durchgehen, daher eilte sie die Treppe hinunter in den vierten Stock. Lurchi war jahrelang Mitglied des K1 gewesen. Ein Einsatz, bei dem auch Lyn beteiligt gewesen und schwer verletzt worden war, hatte ihn aus der Bahn geworfen. Als der Job des Pressesprechers neu besetzt werden musste, hatte er es als Wink des Schicksals empfunden.
Nachdem sie sich gegenseitig kurz auf den neuesten Stand ihrer Privatleben gebracht hatten, betrachteten sie gemeinsam das Foto und gingen die Aussage von Kristin Bünz durch.
»Da war kein Schildchen in der Jacke?« Lukas Salamands Stirn kräuselte sich. »Ungewöhnlich.«
»Ja, finde ich auch merkwürdig«, sagte Lyn. »Wenn derjenige, der sie entsorgt hat, nicht wollte, dass die Jacke anhand eines Markenaufnähers näher identifiziert werden kann, müsste er ziemlich dämlich sein, wenn er sie dann so offensichtlich in einen Mülleimer stopft und damit rechnen muss, dass sie gefunden wird. Mit seiner DNA.«
»Er könnte das Schild aus anderen Gründen entfernt haben«, sagte Lukas. »Vielleicht sollte die Jacke wie ein Haute-Couture-Teil wirken? Die haben keine Aufnäher oder Schildchen.«
»Lurchi, das stimmt.« Lyn sah ihn überrascht an. Sie knuffte ihn auf den Arm. »Du Lagerfeld.«
Er lachte. »Ich und Mode, davon träumt mein liebes Eheweib.«
Doch Lyn war mit ihren Gedanken schon weiter. »Vielleicht war diese Jacke ja sogar Haute Couture? Dann hatte sie nie ein Schild.«
»Wenn du mich nicht länger aufhältst, werden wir es vielleicht erfahren. Online wird das Bild heute schon erscheinen.« Er blickte zur Uhr. »Für die Printausgabe der Samstagszeitung ist es wahrscheinlich zu spät. Die Presse wird sich bis Montag Zeit lassen. Es ist kein aktueller Fall.«
Lyn nickte. Höchste Eile war bei einem vier Jahre zurückliegenden Fall nicht mehr geboten. »Danke, Lurchi. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Mara Kellers Eltern, um sie vorzuwarnen.«
Christine und Sönke Keller wohnten im Stadtteil Wellenkamp, aber Lyn wusste, dass sie sie dort nicht antreffen würde. Sie waren beide Friseure und betrieben ihren eigenen Salon in der Itzehoer Feldschmiede. Als Lyn das Geschäft betrat, wandte Christine Keller, die bei einer Seniorin gerade Dauerwellwickler im Haar befestigte, sich um und sagte freundlich: »Hallo.«
»Hallo, Frau Keller«, antwortete Lyn mit einem Lächeln. Im selben Moment verlor sich Christine Kellers freundliche Miene, und Lyn wusste, dass die Frau sie erst jetzt erkannt hatte.
Schrecken zeichnete sich auf Christine Kellers Gesicht ab. Sie ließ einen Lockenwickler fallen, trat von der Kundin weg und machte zwei Schritte auf Lyn zu. »Mara?«, fragte sie atemlos. »Ist …? Haben Sie …?«
Lyn schüttelte schnell den Kopf. »Es gibt keine neuen Erkenntnisse zu Mara, Frau Keller, aber einen Hinweis zu der Jacke.«
Christine Keller starrte sie an. »Was ist mit der Jacke?«
Lyn berichtete, was sie erfahren hatte. »Wir werden das Phantombild der Jacke zusammen mit Maras Foto und einem Bericht in den Medien zeigen, Frau Keller«, endete sie. »Es war uns wichtig, dass Sie und Ihr Mann es vorher erfahren, damit Sie keinen Schreck bekommen, wenn Sie die Zeitung aufschlagen.«
Christine Keller war unter der Sommerbräune blass geworden. »Ja … Ja, danke. Bitte melden Sie sich sofort, wenn Sie etwas hören.«
»Natürlich.«
»Gott«, Maras Mutter fasste sich an den Hals, »jetzt ist mir ganz schlecht.« Sie ging zu einem freien Friseurstuhl und setzte sich darauf.
Die Dauerwellenkundin sah irritiert zu ihnen herüber, aber Christine Keller nahm es gar nicht wahr. »Mein Mann ist nicht da«, murmelte sie. »Er ist zur Reha. Er hat ein neues Knie. Ich … Ich muss ihn gleich anrufen.«
Lyn strich ihr über den Arm. »Alles Gute für Sie beide … Und bleiben Sie stark.«
Lyn wusste, dass das leichter gesagt als getan war. Christine Keller saß immer noch auf dem Stuhl und starrte vor sich hin, als sie den Salon verließ. Jetzt wurde bei den Kellers wieder alles aufgewühlt. Der Täter hatte nicht nur Maras Leben zerstört. Lyn fühlte tiefes Mitleid mit den beiden.
Wenn diese Jacke, was sie von Herzen hoffte, tatsächlich dem Täter gehörte, würde ihm der Arsch hoffentlich auf Grundeis gehen, wenn er in der kommenden Woche die Zeitung aufschlug.
***
»Was für ein herrlicher Tag.« Annie Göblin griff nach dem Weißweinglas und prostete ihrem Gegenüber zu. »Auf die Montage! Ich habe nie verstanden, warum einige Leute den Montag nicht mögen.«
Er erwiderte den Trinkspruch mit seinem Wasserglas.
Annie winkte dem Kellner des Restaurants »himmel + erde« zu, wo sie an einem der Außentische in der Augustsonne saßen. Sie liebte es, auf dem Platz vor dem ehemaligen Itzehoer Katasteramt in der Mittagspause eine Kleinigkeit zu essen. Ein Glas Wein gehörte immer dazu. Bisher hatte sich noch keine ihrer Kundinnen über eine Alkoholfahne beschwert. Im Gegenteil, manchmal schenkte sie auch in ihrem Laden einen Prosecco aus. Einfach so, weil das Leben schön war und genossen werden sollte.
Als der Kellner kam und die leeren Teller abräumte, orderte sie zwei Espresso. Dann zog sie die zusammengerollte Norddeutsche Rundschau aus der Basttasche neben dem Stuhl und schlug sie auf. »Stört dich doch nicht, Sweety? Ich habe es heute Morgen nicht mehr geschafft.«
Er lächelte. »Hast du wieder mal zu lange am Kissen gehorcht, Schlafmütze?«
Das Gegenteil war der Fall. Sie war früh wach geworden. Doch er musste nicht wissen, dass langes Grübeln sie im Bett festgehalten hatte. Darum sagte sie nur: »Yes.«
Er streckte die Hand nach der Zeitung aus. »Wenn du mir den Sportteil gibst, verzeih ich dir, dass du die Rundschau meinem anscheinend nicht sehr interessanten Geplauder vorziehst.«
Mit einem Luftschmatzer reichte sie ihm die entsprechenden Seiten. Sie überflog die Schlagzeile, dann die Artikelankündigungen auf der Titelseite. »Der Dithmarscher Feuerteufel hat schon wieder zugeschlagen«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Diesmal hat er einen Schuppen in Averlak abgefackelt.«
»Ist bestimmt ein Feuerwehrmann«, orakelte er. »Hat man doch schon oft gehört. Solche Idioten wollen sich dann beim Löschen profilieren.«
Annie hatte schon weitergeblättert. Auf der Itzehoer Seite fiel ein Artikel direkt ins Auge. Das Foto einer jungen Frau gehörte dazu, ebenso das Abbild einer Jacke. Annie las den Artikel und wusste dann, wieso ihr das Mädchen bekannt vorgekommen war. Es war die Itzehoer Studentin, die vor ein paar Jahren verschwunden war. Anscheinend hatte man sie bisher nicht gefunden.
Sie betrachtete das Bild mit der Jacke, dann noch einmal das Foto von Mara Keller. Ein schrecklicher Fall. Und die Tatsache, dass man von einem Tag auf den anderen einfach weg sein konnte, spurlos, war furchterregend.
Annie blätterte um und wollte sich gerade in einen Artikel versenken, in dem es um einen Bürgerentscheid zum kontrovers geführten Thema Störschleife ging, als sie noch einmal zurückblätterte. Zum Jackenbild. Irgendetwas war gerade in ihrem Hirn aktiviert worden. Sie musterte die Jacke erneut, dann sah sie auf. »Sweety, das musst du dir angucken.« Sie drehte die Zeitungsseite, als sie seine Aufmerksamkeit hatte. »Sieht diese Jacke nicht genauso aus wie die, die du dir vor ein paar Jahren in Italien gekauft hast? Die, die dir gestohlen wurde?«
Er stellte das Glas, aus dem er gerade getrunken hatte, ab und starrte auf die Zeitung, bevor er sie nahm.
»Stimmt doch, oder?«, hakte Annie nach, während sein Gesicht hinter der Zeitung verschwand. Anscheinend las er den dazugehörigen Artikel.
Schließlich ließ er die Seite sinken. »Ja, die Knöpfe sahen tatsächlich ähnlich aus, aber der Kragen war bei meiner Jacke anders.«
Annie schnappte ihm die Zeitung wieder weg. »Ich könnte schwören, die sah genauso aus. Es ist auf jeden Fall der gleiche Schnitt.«
»Du hast doch damals nur das Foto gesehen.«
Sie nickte. Er hatte die Jacke seinerzeit auf der Modemesse in Rom gekauft und ihr ein Foto geschickt, um zu fragen, wie sie ihm stand und ob er sie nehmen sollte. Sie hatte ihm den Daumen-hoch-Smiley geschickt. Von dem Kauf hatte er jedoch nicht viel gehabt. Auf der Rückfahrt nach Deutschland war sie ihm an einer Tankstelle geklaut worden.
Als sie wieder aufsah, fiel ihr auf, wie rot sein Gesicht war. »Alles klar bei dir? Hast du deine Blutdrucktablette genommen?«
»Ja, ja. Ich reg mich nur gerade innerlich wieder über diesen Typen auf, der mich damals bestohlen hat. Das war echt ärgerlich. Die Jacke war nicht billig.«
»Darum hat er sie ja bestimmt haben wollen.« Annie lachte. »Wie lange ist das jetzt her?« Sie suchte im Artikel das Datum heraus, an dem Mara Keller verschwunden war. »Vier Jahre? Dann würde es genau hinkommen. Die Studentin ist 2017 zuletzt lebend gesehen worden.«
»Nein, das mit der Jacke ist länger her. Mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs Jahre.«
»Was? Nie im Leben.«
»Doch, klar. Du weißt doch, wie schnell die Zeit vergeht. Du hast letzte Woche auch behauptet, Lena Meyer-Landrut habe vor fünf Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen. Dabei war es 2010 … Und vor vier Jahren lag ich mit Grippe krank im Bett. Da war ich nicht mit zur Messe.« Er nahm den Sportteil wieder auf und verschwand dahinter.
»Du hast recht. Die Zeit fliegt nur so dahin. Darum müssen wir sie auch genießen.« Annie hob ihr Weinglas und nahm genüsslich einen Schluck. »Außerdem, Sweety«, sie stellte das Glas wieder ab, »traue ich dir ja einiges zu, aber als Highway-Ripper sehe ich dich nun wirklich nicht.«
Es kam keine Erwiderung. Sie lächelte. Männer und die Sportseite.
***
Das Schicksal war ein verdammtes Arschloch. Warum wollte es ihn unbedingt einholen? Warum? Er hatte alles so sehr bereut! Er bereute noch. Tag für Tag. Und er machte doch auch wieder gut: Er spendete Unmengen an Geld für Flüchtlinge, für hungernde Kinder in Afrika, für die Itzehoer Tafel.
Konnte das Schicksal ihn nicht einfach davonkommen lassen? Es war ja doch nicht mehr zu ändern. Die Studentin blieb tot.
Mara Keller … Jetzt war der Name wieder präsent. Und er wollte doch nicht an ihren Namen denken. Hätte Annie gestern nicht einfach die Klappe halten können? Den Artikel übersehen können?
Mara … Maraaa! Es war ein unheimliches Flüstern. Ein ekliger Wurm, der sich durch sein Hirn fraß. Kein Auge hatte er letzte Nacht zugemacht.
Seine Finger zitterten, während er ein Papierschildchen handschriftlich mit einem Preis versah und es anschließend mit einem Band durch die Gürtellasche einer Jeans zog, die auf einem kleinen Stapel vor ihm auf dem Verkaufstresen lag. Neue Ware. Er liebte Kleidung. Sie von Hand zu etikettieren, an den Stoffen zu schnuppern, sie auf Bügeln zu arrangieren und großzügig auf Ständern und Tischen zu präsentieren, nicht als Massen-, sondern als Wohlfühlware – all das gehörte dazu, um ein schönes Stück an die Kunden zu bringen und sie damit glücklich zu machen. Das konnte doch nicht einfach enden. Er war doch kein schlechter Kerl! Er hatte einen furchtbaren Fehler gemacht, ja, aber doch nicht geplant. Es war einfach geschehen.
Hoffentlich bohrte Annie nicht weiter. Natürlich hatte sie recht gehabt. Die Abbildung der Jacke in der gestrigen Zeitung war perfekt getroffen. Vier lange Jahre war er froh über die Entscheidung gewesen, sie vorsorglich in dem Abfalleimer entsorgt zu haben, denn es war eingetreten, was er befürchtet hatte: Die Frau im Wagen hinter ihm hatte die Jacke gesehen, als das Mädchen sie in den Kofferraum gelegt hatte. Doch anstatt längst auf einer Halde zu verrotten, war die verdammte Jacke aus dem Müll herausgefischt worden. Das war doch scheiße!
Unbewusst wimmerte er auf und lauschte erschrocken nach hinten. Diana könnte ihn hören. Sie war dabei, Ware einer Lieferung aus Skandinavien auszupacken.
Eine Frau hatte seine Jacke im Müll entdeckt und an sich genommen, so hatte es im Artikel gestanden. Einziger Pluspunkt: Sie schien die Jacke nicht mehr zu besitzen, denn dann wäre statt der Zeichnung ein Foto abgebildet gewesen. Also hatte die Polizei auch nicht seine DNA.
Er atmete tief ein und aus. Solange die Leiche nicht gefunden wurde, war er DNA-mäßig sowieso gut raus. Er war schließlich nicht erfasst bei der Polizei. Er war ein Vorzeigebürger. Bis auf diese Sache.
Der Aufruf in dem Artikel, dass sich Zeugen melden sollten, denen auf der Raststätte Forst Rantzau, wo er die Jacke entsorgt hatte, sonst etwas aufgefallen war, bereitete ihm auch keine Sorge. Er war allein auf dem Parkplatz gewesen. Darauf hatte er natürlich geachtet. Und selbst wenn … Kein Mensch erinnerte sich an so etwas, wenn es so lange zurücklag.
Er schrak zusammen, als die Ladenglocke ertönte. Annie liebte diese Kleinigkeiten: kein elektronischer Gong, sondern ein feines Glöckchenbimmeln. Er setzte ein geschäftsmäßig freundliches Lächeln auf, als die Kundin ihn ansah, und sagte: »Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen, oder möchten Sie ein wenig schauen?«
»Erst mal schauen, danke.« Sie steuerte den Ständer mit den Flatterkleidern an. Italienische Ware.
Italien … Die Messe. Schon waren seine Gedanken wieder bei dem Septemberabend vor vier Jahren. Er hörte das Prasseln des Regens wieder, sein eigenes Keuchen, ihr Wimmern und Schluchzen.
»Welche Größe ist das hier?«
»Wie?« Er starrte die Kundin an. Reiß dich zusammen, Mensch! Sich sammelnd nahm er das Kleid entgegen, das sie ihm hinhielt. Ohne auf das Etikett zu schauen, sagte er: »Das ist ein One-Size-Modell für die Größen 52 bis 56. Es sollte Ihnen also auf jeden Fall passen. Sie brauchen 54, richtig?«
»Perfekt.« Anerkennend schürzte sie die Lippen. »Man merkt, dass Sie einen Kennerblick haben. Obwohl ich manchmal auch in eine 52 passe. Aber eher selten«, fügte sie hinzu. »Ich probier’s mal an.« Sie streckte die Hand nach dem Bügel aus, aber er trat damit hinter dem kleinen Tresen hervor. »Ich hänge es Ihnen in die Kabine.«
»Vielen Dank, dann gucke ich mich weiter um.«
Er hängte den Bügel an den Haken in der cremefarben gestrichenen Kabine. »Carpe diem« prangte in verschnörkelten brombeerfarbenen Buchstaben über dem großen Spiegel mit dem verspielten goldfarbenen Rahmen.
»Möchten Sie einen Kaffee trinken, während Sie stöbern?«, fragte er und erntete ein erfreutes Lächeln.
»Das ist ja ein toller Service. Sehr gern, danke.«
Er ging zum Tresen zurück und rief durch die schmale Tür dahinter: »Diana, bringst du bitte einen Kaffee?« Perfekter Service und Wohlfühlatmosphäre, das war das Geschäftsmotto von »Göblin & Gark«. Hier fühlten die Kundinnen sich noch wie Königinnen. Gleich darauf nahm er den Kaffee von Diana entgegen und stellte ihn auf dem kleinen Tischchen hinter dem Paravent mit toskanischem Dorfmotiv ab. In einem terrakottafarbenen Schälchen und einem Kännchen standen Zucker und Kaffeesahne bereit, dazu ein Teller mit Annies selbst gebackenen Cantuccini.
»Herzlichen Dank.« Die Kundin strahlte. Als sie einen Schubs Sahne in ihren Kaffee gab, sagte sie: »Sonst schmeckt er mir nicht.«
Er wusste, Annie hätte jetzt mit den Augen gerollt. Sie hasste es, wenn Frauen sich dafür entschuldigten, dass sie Sahne und Zucker nahmen.
Aber das waren Kinkerlitzchen gemessen an den Problemen, die er jetzt hatte. Schon als er zum Tresen zurückging, fraß der Wurm weiter. Mara … Maraa … Maraaa!
***
»Ich freue mich schon auf die nächste Lesung«, sagte Henning Harms mit Blick zum Alfred-Döblin-Haus in der Wewelsflether Dorfstraße. »Die Diversität unter den Autorinnen und Autoren macht es immer zu einem Vergnügen.« Er zog leicht an der Hundeleine in seiner rechten Hand. »Komm, Barny, nicht trödeln.«
Schwerfällig setzte der altersschwache Boxer sich wieder in Bewegung, nachdem er sein Bein an der Sitzbank des Schusters gehoben hatte, was Henning zu einem hastigen Rundumblick veranlasste. Lyn verdrehte nur die Augen.
»Es muss bald wieder so weit sein«, sagte sie und hakte sich in den linken Arm ihres Vaters. Die kuschligen Lesungen der Berliner Stipendiaten fanden im vierteljährlichen Turnus statt. Die alte Küche im ehemaligen Wohnhaus von Günter Grass war urgemütlich und lockte immer viele Zuhörer an. Dicht an dicht saßen sie dann an dem betagten Holztisch und auf der schmalen Treppe, aßen selbst gebackenen Blechkuchen und tranken Wein, während sie den schriftstellerischen Ergüssen lauschten.
Lyn genoss den Spaziergang durch Wewelsfleth, insbesondere, weil ihr Vater ohne Vera zu Besuch gekommen war. Lyn bemühte sich, aber so richtig warm geworden war sie mit der Freundin ihres Vaters immer noch nicht.
Charlotte lief neben Emil her, der auf seinem Laufrad schnell unterwegs war. Lyn, Henning und Barny folgten ihnen. Dass der Abstand immer größer wurde, lag nicht nur an Barny, was Lyn leichtes Unbehagen bereitete. Die körperliche Vitalität ihres Vaters hatte in letzter Zeit erheblich abgenommen. Doch die Hauptsache war, dass er geistig fit blieb.
Sie schlenderten die von Linden gesäumte Deichreihe entlang, die dem Ort mit seinem Kopfsteinpflaster dörflich-nostalgischen Charme verlieh.
»Gibt es schon Ergebnisse zu eurem Aufruf in der Zeitung?«, fragte Henning Harms, als sie beim Bistro »Moby Dick« die Straße überquerten und den Weg durch die Stöpe zum ehemaligen Fähranleger einschlugen. »In dem Fall mit der Studentin?«
»Zur Jacke beziehungsweise zu gleichen Modellen gab es einige Anrufe. Da recherchieren wir jetzt.« Mehr zu verraten wagte Lyn nicht, da sie nicht sicher war, ob ihr Vater es für sich behielt. Wenn Vera in ihrem Friseursalon Polizeiinterna ausquatschte … Lyn wurde allein bei dem Gedanken heiß.
Es gab durchaus Ergebnisse. Zwar hatte sich bisher niemand gemeldet, der vor vier Jahren Beobachtungen zur Entsorgung der Lederjacke gemacht hatte, aber zur Jacke selbst existierten etliche Hinweise. Zwei Männer besaßen identische Jacken. Der eine hatte sie vor drei Jahren in Italien gekauft, der andere bei einem Herrenausstatter in Hamburg – ebenfalls vor drei Jahren. Die Jacken dieser Männer waren keine Haute Couture. Sie hatten eingenähte Herstellerschildchen. Es war italienische Ware. Kollege Jochen war damit beschäftigt, herauszufinden, wann das Modell hergestellt und wo es überall verkauft worden war.
»Schade, dass die ›Peking‹ nicht mehr da ist«, sagte Henning und blickte nach rechts zum Dock der Peters Werft, wo das historische Segelschiff über fast drei Jahre hinweg aufwendig restauriert worden war. »Ich habe sie gern in der Stör gesehen.«
Lyn war dankbar, dass ihr Vater zum Fall Mara Keller nicht weiter nachbohrte. Er hatte dieses Feingefühl, das ihm zeigte, wenn sie nichts weiter zu einer Sache sagen wollte.
»Mama, Opa!«, rief Charlotte von der Anlegestelle des Hafens herüber. Sie stand mit Emil, dessen Laufrad am Deich lag, auf der Dampferbrücke. »Darf ich mit Emil auf die Schlengel? Ich halte ihn auch fest an der Hand.«
Lyn wartete mit der Antwort, weil in diesem Moment die Werftsirene zum Feierabend heulte. »Warte, wir kommen!«, rief sie, als der Ton, der seit Jahrzehnten zum Dorf gehörte, verklang.
Da es ein Wochentag war, lagen viele Motorboote auf ihren Plätzen.
»Heiß der Schiff?«, fragte Emil an Charlottes Hand und deutete auf eines der Boote, während sie alle vier den Schlengel entlanggingen und die Namen studierten.
»Das Schiff heißt ›Tyrion‹«, kam es umgehend von Oberstudienrat a.D. Harms.
»Falsch«, sagte Charlotte. »Das Boot heißt ›Tyrion‹.«
»Eins zu null für dich, Lottchen«, gab der Opa ihr lachend recht.
Charlotte küsste ihn auf die Wange und ließ sich dann von Emil mitziehen, der zurück zum Deich sah und rief: »Joe ist da!«
»Wer ist dieser Joe?«, fragte Henning mit Blick auf den Mann, der mit einem Labrador Gassi ging.
»Joe ist der Hund«, klärte Lyn ihren Vater auf. »Emil liebt Hunde, und mittlerweile kennt er durch unsere Spaziergänge alle Vierbeiner des Dorfes beim Namen.«
Lächelnd sahen sie zu, wie Charlotte und Emil den Hund streichelten.
»Du bist doch dankbar, dass Schluss mit den beiden ist, oder?«, bemerkte Henning einen Moment später.
»Was?« Lyn schaute ihren Vater an.
Dass es ein rhetorisches Was gewesen war, hatte ihr Vater erkannt, denn er sagte: »Du warst nie wirklich einverstanden mit dieser Beziehung. Nun, ich kann das auch verstehen, mein Kind.« Er tätschelte ihre Wange. »Welche Mutter wünscht sich schon einen Freund mit solch einer Vergangenheit für ihre Tochter?«
»Du kannst Markus nicht für die Taten seiner Familie verantwortlich machen«, nahm Lyn Charlottes Ex-Freund in Schutz, allerdings mit flammend roten Wangen, denn sie fühlte sich ertappt.
»Für seine eigene schon.«
»Er hat es nicht mit Absicht gemacht. Es war eine Rangelei, die …«, sie schluckte, »katastrophal endete.« Der Fall Jacobsen war und blieb einer der spektakulärsten ihrer Laufbahn.
»Markus hat immer nur die Kommissarin in dir gesehen«, fuhr ihr Vater fort, während sie langsam zurück zur Brücke gingen. »Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich ihn erlebt habe, war er in deiner Nähe immer verkrampft.«
Lyn schwieg, weil sie sich Charlotte und Emil näherten, die an den beiden senffarben gestrichenen hölzernen Hafenhäuschen auf sie warteten. Ihr Vater hatte recht. Sie war dankbar, dass Markus nicht mehr Teil von Charlottes Leben war. Markus’ Psyche war auch nach mehreren Therapien noch angegriffen durch das, was in der Vergangenheit geschehen war: Schreckliches, für das er nichts konnte, und Schreckliches, für das er verantwortlich war.
Charlotte hatte ihn durch Höhen und Tiefen begleitet. Aus Liebe. Und sie, Lyn, hatte sie dafür bewundert, aber auch mitgelitten, wenn Charlotte litt, weil Markus immer wieder schwierige Phasen durchmachte und Charlotte dann nicht um sich haben wollte. War es schlecht, jetzt so zu empfinden? Erleichtert zu sein?
Lyn gab sich selbst die Antwort: Sie war keine Samariterin. Sie war Mutter. Und letztlich war ihr Charlottes Seelenwohl wichtiger als das des jungen Mannes, der jede Chance auf ein gutes Leben verdient hatte, ja. Aber gern mit der blonden Nachbarin, und nicht mit ihrer Lotte.
***