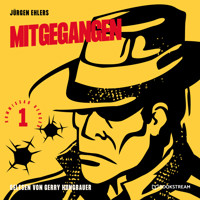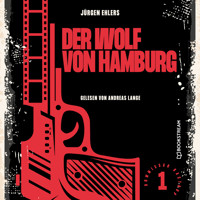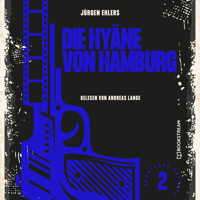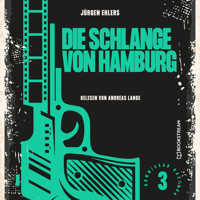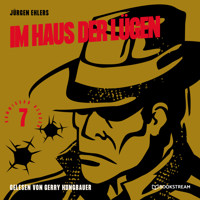Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Liebe und Verrat in den besetzten Niederlanden
- Sprache: Deutsch
Der Fallschirmagent Gerhard Prange gibt vor, für die deutsche Abwehr zu arbeiten. Aber als das Funkspiel mit England aufgegeben wird, wird auch Gerhard verhaftet. Seine Freundin Sofieke bemüht sich um seine Freilassung. Der zwielichtige Agent Christmann verspricht zu helfen, aber Sofieke vertraut ihm nicht. Zum Glück scheint jedenfalls die achtjährige Sara in Sicherheit zu sein. Aber niemand ist sicher in diesen Zeiten. Und neugierige Nachbarn gibt es überall: »Warum hängt bei euch Kinderwäsche auf der Leine?«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PERSONEN
INSTITUTIONEN
JUNI 1943
Dienstag, 15. Juni 1943
Montag, 26. Juli 1943
Hamburg, 28. Juli 1943
AUGUST 1943
Dienstag, 4.August 1943
Freitag, 6. August 1943
Donnerstag, 12. August 1943
Donnerstag, 19. August 1943
Sonntag, 22. August 1943
OKTOBER 1943
Freitag, 1. Oktober 1943
NOVENBER 1943
Mittwoch, 3. November 1943
JANUAR 1944
MÄRZ 1944
Freitag, 24. März 1944
APRIL 1944
Sonnabend, 1. April 1944
Dienstag, 3. April 1944
Donnerstag, 5. April 1944
Dienstag, 10. April 1944
MAI 1944
Mittwoch, 10. Mai 1944
Sonnabend, 13. Mai 1945
Montag, 15. Mai 1944
Sonntag, 21. Mai 1944
Montag, 22. Mai 1944
JUNI 1944
Donnerstag, 8. Juni 1944
Sonnabend, 10. Juni 1944
Mittwoch, 14. Juni 1944
Donnerstag, 15. Juni 1944
Donnerstag, 22. Juni 1944
Donnerstag, 6. Juli 1944
Freitag, 7. Juli 1944
Sonntag, 8. Juli 1944
Montag, 10. Juli 1944
Dienstag, 11. Juli 1944
Mittwoch, 12. Juli 1944
Sonntag, 16. Juli 1944
Montag, 17. Juli 1944
JULI 1944
Donnerstag, 20. Juli 1944
AUGUST 1944
Dienstag, 8. August 1944
Donnerstag, 10. August 1944
SEPTEMBER 1944
Sonntag, 3. September 1944
Dienstag, 5. September 1944
Mittwoch, 6. September 1944
Dienstag, 7. September 1944
Freitag, 8. September 1944
Dienstag, 12. September 1944
Mittwoch, 13. September
Donnerstag, 14. September
Freitag, 15. September 1944
Mittwoch, 20. September
OKTOBER 1944
Freitag, 6. Oktober 1944
NOVEMBER 1944
Mittwoch, 8. November 1944
Sonntag, 31. Dezember 1944
JANUAR 1945
Montag, 1. Januar 1945
Sonnabend, 13. Januar 1945
Donnerstag, 25. Januar 1945
FEBRUAR 1945
Dienstag, 13. Februar 1945
Dienstag, 27. Februar 1945
MÄRZ 1945
Freitag, 2. März 1945
Sonnabend, 3. März 1945
Donnerstag, 15. März 1945
Freitag, 16. März 1945
Sonnabend, 17. März 1945
Mittwoch, 28. März 1945
APRIL 1945
Montag, 2. April 1945
Sonnabend, 7. April 1945
Sonntag, 8. April 1945
Mittwoch, 11. April 1945
Donnerstag, 12. April 1945
Freitag, 13. April 1945
Sonnabend, 14. April 1945
Sonntag, 15. April 1945
Mittwoch, 18. April 1945
Montag, 30. April 1945
MAI 1945
Dienstag, 1. Mai 1945
Sonntag, 6. Mai 1945
Montag, 7. Mai 1945
NACHWORT
QUELLEN
PERSONEN
Gerhard Prange (24), Student
Eltern und ältere Schwester Ilse in Hamburg
Sofieke Plet (20), untergetauchte Jüdin
Witwe ter Laak (71), ihre Vermieterin
Sara (= Grietje) (8), ein jüdisches Mädchen
DIE FALLSCHIRMAGENTEN
Aart Alblas * (26), Deckname »Klaas«, Seeoffizier
Huub Lauwers * (29), Journalist
Hendrik „Han“ Jordaan * (26), Flugzeugmechaniker
Beatrice (Trix) Terwindt * (33), Stewardess
Jan Jacob van Rietschoten * (23), Student
Arie Cornelis van der Giessen * (28), Student
Anton Johannes Wegner * (29), Seemann
Dr. Arthur Seyß-Inquart * (52), Reichskommissar für die besetzten Niederlande
Gertrud * (52), seine Frau
Dorli * (16), ihre Tochter
Dr. Friedrich Wimmer * (47), Generalkommissar für Verwaltung und Justiz
DIE SS Heinrich Himmler * (44), Reichsführer SS und Chef der Deutschen PolizeiHanns Albin Rauter * (49), Generalkommissar für das SicherheitswesenDr. Wilhelm Harster * (40), Befehlshaber des Sicherheitsdienstes und des SDErich Naumann * (39), Obergruppenführer, Harsters Nachfolger ab September 1943
Dr. Karl Eberhard Schöngarth * (40), Brigadeführer, Naumanns Nachfolger ab 1. Juni 1944Erich Deppner * (34), Chef der Abteilung GegnerbekämpfungHans Kolitz * (34), Obersturmbannführer, Deppners Nachfolger ab 1. März 1945Joseph Schreieder * (40), Sturmbannführer, Leiter der Abteilung IV E Gegenspionage
Anton van der Waals * (32), sein holländischer Spitzel Corrie den Held * (20), seine spätere Frau
Friedrich Frank * (35), Obersturmführer
Ernst Georg May * (38),
Untersturmführer, Kriminalkommissar
Nicolay (Nico) Johannsen * (41),
Untersturmführer, Jiu-Jitsu-Experte
Johannes Bernardus Faure * (35),
niederländischer SD-Mitarbeiter
Marten Slagter * (40) und Leo Poos * (43),
holländische Polizisten
Alfred Gemmeker * (37), Obersturmführer, Leiter des Durchgangslagers WesterborkFranz Xaver Ziereis * (39), SS-Standartenführer, Kommandant des KZs Mauthausen, SS-Georg Bachmayer * (31), Hauptsturmführer, KZ MauthausenJosef Niedermayer * (24), Unterscharführer, KZ Mauthausen
DIE WEHRMACHT General der Flieger Friedrich Christiansen * (65), Wehrmachtbefehlshaber in den besetzten NiederlandenGeneral Johannes Blaskowitz * (61), sein NachfolgerGeneralmajor Karl Böttger * (53), Befehlshaber der deutschen Truppen in Nordost-Holland
Hermann Giskes * (48), Major, Leiter der Gruppe III F der Abwehr
Matthijs Adolf Ridderhof * (49),
sein holländischer Spitzel
Richard Christmann * (39),
Ex-Fremdenlegionär, freier Mitarbeiter der Abwehr
Ernst Kiesewetter * (45), Major, Giskes‘ Nachfolger
MITGLIEDER DES WIDERSTANDS
Willem (Willi) de Graaf (23), Student
Miep Blaauw (22), Studentin
Bas (23), ihr Freund
Freerk Leijstra (42) *, Schlachter aus Birdaard
Willem (Wim) van der Veer *, niederländischer Agent
DIE FRANZOSEN
Philippe Pétain (88) *,
Staatschef der französischen Regierung in Vichy
Charles de Gaulle (54) *,
General, Befehlshaber der Freien Französischen Streitkräfte
Antonin Betbèze (34) *, Leutnant und Kriegsheld
DAS KÖNIGSHAUS
Königin Wilhelmina * (64), im Exil in London
Juliana * (35), ihre Tochter
Bernhard * (33), Julianas Ehemann
Irene * (5), Tochter von Juliana und Bernhard
NIEDERLÄNDISCHE POLITIKER
Peter Sjoerds Gerbrandy * (59),
Professor, Ministerpräsident der Exilregierung
Hans Max Hirschfeld * (45),
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
Historische Personen sind durch ein * gekennzeichnet.
Altersangaben bezogen auf 1944.
INSTITUTIONEN
Die Special Operations Executive (SOE, Sondereinsatztruppe) war eine britische nachrichtendienstliche Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs.
Der Secret Intelligence Service (SIS) ist der britische Auslandsgeheimdienst. Er ist besser bekannt unter dem Namen MI6.
Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (Abkürzung SD) war ein Teil des nationalsozialistischen Machtapparates. In der Auslandsspionage konkurrierte der SD mit dem Amt Ausland/Abwehr der Wehrmacht.
Die Sicherheitspolizei (kurz SiPo) umfasste die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und die Kriminalpolizei (Kripo). Sie war Heinrich Himmler als »Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei« unterstellt.
Die Geheime Staatspolizei, auch kurz Gestapo genannt, war die politische Polizei.
Ordnungspolizei (OrPo) (Schutzpolizei, Gendarmerie, Gemeindepolizei) war der Oberbegriff für die uniformierte Polizei.
Abwehr ist die im deutschen Sprachgebrauch verbreitete Bezeichnung für den deutschen militärischen Geheimdienst der Wehrmacht.
Der Generale Staf sectie III (GS III) war der erste moderne niederländische Nachrichtendienst. Er wurde nach Einmarsch der deutschen Truppen 1940 aufgelöst.
Während die Deutsche Wehrmacht nach dem Rückschlag in Stalingrad auf neue Erfolge an der Ostfront hofft, geht das Leben in den besetzten Niederlanden seinen normalen Gang. Vom Durchgangslager Westerbork werden in zwei Zügen am 6. und 7. Juni 1266 jüdische Kinder nach Sobibór gebracht und direkt nach ihrer Ankunft vergast.
Dienstag, 15. Juni 1943
Sofieke betrat die Gaststätte »De Eikelaar« in Den Haag und sah sich suchend um. Ihr war klar, dass sie sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich ziehen würde. Eine Frau ging nicht allein in ein Café.
»Hier bin ich!« Richard Christmann stand an der Theke und hielt ein Glas Bier in der Hand. »Komm, wir setzen uns hier rüber.«
»Moffenmeid«, sagte jemand. Sofieke tat, als habe sie das nicht gehört. Sie war jetzt 21 Jahre alt und lebte seit gut zwei Jahren unter falschem Namen in Den Haag. Bis jetzt war alles gutgegangen. Sie hatte ihre Haare blond gefärbt, und ihr falscher persoonsbewijs war so gut wie echt. Niemand konnte ahnen, dass sie eine Jüdin war.
Zu dieser Tageszeit waren die meisten Tische im Lokal noch frei.
Sofieke wünschte, Gerhard wäre hier. Ihr deutscher Freund. Aber Gerhard Pranges Dienststelle war schon vor sechs Monaten nach Driebergen umgezogen, 80 km von hier entfernt, und sie saß noch immer in ihrer kleinen Mietwohnung in Den Haag.
Es gefiel ihr nicht, sich mit Richard in einem Lokal zu treffen, und mit Verwunderung registrierte sie, dass er seine Uniform trug. Sie hatte ihn noch nie in Uniform gesehen. War er wirklich Oberleutnant, oder gehörte diese Jacke gar nicht ihm?
»Schön, dich zu sehen«, sagte Christmann.
»Danke.« Sofieke freute sich nicht, den Mann zu sehen. Er arbeitete zwar genau wie Gerhard für die Abwehr, den militärischen Geheimdienst der Deutschen Wehrmacht, aber sie hatte kein Vertrauen zu ihm. Allerdings hatte er der kleinen Sara das Leben gerettet – jetzt schon zum zweiten Mal.
»Du wirkst so reserviert«, sagte Richard. »Für dich auch ein Bier?«
Nein, Sofieke wollte einen Kaffee. Richard ging zum Tresen. »Einen Kaffee für die junge Dame«, sagte er. Ein älterer Holländer, der rechts neben ihm stand, warf ihm einen finsteren Blick zu.
Sofieke gefiel es nicht, dass Richard sie so demonstrativ als seine Freundin vorführte. Sie spürte, dass sie verstohlen gemustert wurde.
Richard machte das nichts aus. Er kam mit dem Kaffee. »Na, wie fühlt man sich denn so, wenn man plötzlich vogelfrei ist?«, fragte er. Es klang ein klein wenig besorgt.
Sofieke erschrak. »Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte sie.
»Damit meine ich, dass es leicht passieren kann, dass deine Fotografie auf einem dieser famosen Flugblätter erscheint, die Anton van der Waals zum Verhängnis geworden sind. Du hast mit ihm zusammen das Nationalkomitee unterwandert.«
»Das ist nicht wahr!«, rief Sofieke erregt.
Christmann lächelte. »Das sagst du. Aber für einen Außenstehenden muss es so aussehen, als hättet ihr beide zusammen die Sozialdemokraten ans Messer geliefert. Vorrink, Van Tijen und Van Looi. Und all die anderen. Wir beide wissen natürlich, dass es nicht so gewesen ist, aber wie willst du das beweisen? Der Schein spricht gegen dich. Und was am schlimmsten ist: Du bist verhaftet und wieder freigelassen worden, und das jetzt schon zum zweiten Mal. Du musst eine Verräterin sein!«
»Nicht so laut!« Sofieke sah Richard wütend an. Sie wollte es nicht wahrhaben, dass jemand sie für eine Verräterin halten könnte. Aber ihr Verstand sagte ihr: doch, das stimmt. Es war einfach zu offensichtlich. Zweimal verhaftet, zweimal wieder freigelassen.
Richard sagte: »Du bist erpressbar geworden, mein Schatz. Du bist eine Verräterin und du bist eine Jüdin. Das ist eine ganz schlechte Kombination!«
»Wer sollte mich erpressen?«, fragte sie. Sie konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme ganz leicht zitterte. Richard Christmanns Feststellung hatte sie erschüttert.
Richard zuckte mit den Achseln. »Niemand«, sagte er leichthin. »Ich glaube nicht, dass dich jemand erpresst. Bis jetzt jedenfalls. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wer soetwas tun könnte.« Aber es war offensichtlich, dass er sich so etwas sehr wohl vorstellen konnte. Er selbst zum Beispiel könnte Sofieke erpressen. Er hatte es schon einmal versucht. Christmann war kein Freund. Er war und blieb ein gefährlicher Mann.
Sofieke war völlig aufgewühlt, als sie das Cafe verließ. Sie hatte nicht herausgefunden, was Richard von ihr gewollt hatte. Falls er sie erschrecken wollte, dann war ihm das gelungen. Sie hatte Angst vor dem niederländischen Widerstand. Und sie hatte noch mehr Angst vor Richard Christmann.
Und Anton? Brauchte sie vor dem keine Angst mehr zu haben? Wahrscheinlich nicht. Wenn Anton wirklich tot war. Aber war Anton wirklich tot? Sofieke war sich nicht sicher. Angeblich hatte der Widerstand ihn auf offener Straße erschossen, aber irgendetwas stimmte nicht an der Geschichte. Sie beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Zum Glück war der Mordanschlag in allen Einzelheiten in der Zeitung beschrieben worden, so dass sie keine Schwierigkeiten hatte, den Ort des Geschehens zu finden. Die Zestienhovenstraat lag außerhalb des Stadtzentrums von Rotterdam. Zwei- und dreigeschossige ältere Wohnhäuser auf beiden Seiten. Die Sonne schien, und jetzt am frühen Nachmittag hatte die Gegend nichts Sinisteres an sich.
Sofieke ging die Straße von einem Ende zum anderen, hin auf der linken und zurück auf der rechten Seite. Die Zestienhovenstraat war keine 200 Meter lang; wenn es hier eine Schießerei gegeben hatte, dann wusste wahrscheinlich jeder der Anwohner darüber Bescheid. Kurz enschlossen läutete Sofieke an einem der Häuser etwa in der Mitte der Straße.
»Ja, bitte?« Ein älterer Mann öffnete im ersten Stock das Fenster.
»Jutta de Vliet, ich komme von der Zeitung, vom Nieuwe Rotterdamsche Courant«, behauptete Sofieke. »Wir schreiben einen Bericht über die Schießerei, die sich hier am 27. Mai ereignet hat.«
»Jetzt noch? Das ist doch schon fast drei Wochen her!«
»Ja. Aber die Polizei hat die Täter noch nicht verhaftet, und da wollen wir den Fall noch einmal aufgreifen. Haben Sie damals mitgekriegt, was hier passiert ist?«
»Ja, natürlich. Wir alle haben das mitgekriegt. Ich habe am Fenster gesessen. Es war gegen 11 Uhr abends. Ich hatte gerade beschlossen, ins Bett zu gehen, als da plötzlich dieser Wagen anhielt. Da drüben war das. So ein großer, schwarzer Wagen.«
»Und der ist Ihnen aufgefallen?«
Der Mann nickte. »Allzu viele Autos gibt es nicht hier in der Gegend. Schon gar nicht solche großen. Und dieses Fahrzeug habe ich hier noch nie gesehen. Ich habe gleich gedacht: Das ist Gestapo.«
»Gestapo?«
»Ja, natürlich. Diese großen deutschen Wagen, das ist immer Gestapo. Fast immer. Also, der Wagen hielt und drei Männer stiegen aus. Zwei blieben beim Wagen stehen, und der dritte ging auf der anderen Straßenseite auf und ab. Das war dieser Van der Waals. Jedenfalls stand in der Zeitung, dass er so hieß. Es sah so aus, als ob er auf jemand wartete. Möglicherweise hatte er sich mit jemand aus dem Widerstand verabredet, und der sollte hier in eine Falle gelockt werden. Aber dann kam alles ganz anders. Da drüben erschienen plötzlich zwei Männer. Als dieser Van der Waals sie kommen sah, blieb er sofort stehen. Vielleicht wollte er weglaufen, aber die Männer hatten ihre Pistolen schon in der Hand und haben sofort auf ihn geschossen. Der Van der Waals stieß einen Schrei aus, versuchte wohl noch, seine eigene Waffe zu ziehen, aber es war zu spät. Er brach nach den ersten Kugeln zusammen.«
»Tot?«, fragte Sofieke.
»Nicht gleich. Die beiden von der Gestapo haben zu spät reagiert. Sie sind hinter den unbekannten Männern hergerannt und haben in vollem Lauf geschossen, aber wenn man rennt, trifft man ja nichts. »Fenster zu!«, haben sie dabei geschrien. »Hier wird geschossen! Fenster zu!« Das haben wir natürlich gemerkt, dass geschossen wurde, und alle haben trotzdem rausgeguckt. Dieser Van der Waals lag stöhnend am Boden. ›So helft mir doch!‹, hat er gerufen. Aber keiner hat ihm geholfen. Schließlich haben dann die beiden SD-Männer ihre Verfolgung abgebrochen und sind zu Van der Waals zurückgekommen. Sie haben ihn in ihr Auto verfrachtet und sind dann mit hohem Tempo davongerast. – Ein Spitzel weniger, habe ich gedacht.«
»Aber?«, fragte Sofieke. Sie war sich sicher, dass der Mann noch mehr wusste.
»Aber vielleicht hat das alles nicht gestimmt. Die Polizei hat uns zwar am nächsten Morgen alle befragt, aber, wie Sie schon sagen, dann ist gar nichts weiter passiert. Und dann gab es noch etwas Merkwürdiges: Normalerweise sollte man doch denken, wenn so viel geschossen wird, sicher an die zwanzig Schüsse, dass dann irgendwo eine Scheibe zu Bruch geht, oder dass man Spuren am Mauerwerk sieht, wo eine Kugel eingeschlagen ist. Aber da war nichts. Und da, wo der Mann gelegen hat, sozusagen genau gegenüber von unserer Haustür, da war auch nichts. Kein Blutfleck. Und wenn jemand von mehreren Kugeln getroffen wird, dann sollte es doch irgendwelche Blutspuren geben, finden Sie nicht?«
»Das ist seltsam.« Sofieke war sich jetzt fast sicher, dass der Überfall auf Anton van der Waals nur vorgetäuscht worden war. Von der Sicherheitspolizei inszeniert, damit der Mann untertauchen konnte. Wenn er tot war, konnten ihm die Widerstandskämpfer nichts mehr anhaben. »Haben Sie vielen Dank für Ihre Auskünfte«, sagte sie. »Wir werden dem Fall weiter nachgehen.«
Der nächste Schritt war bedeutend riskanter. Wenn Sofieke wirklich wissen wollte, ob Anton van der Waals noch am Leben war, musste sie direkt in die Höhle des Löwen gehen. Die Anschrift, die sie in Antons Unterlagen gefunden hatte, lautete Stationssingel 37, praktisch direkt gegenüber vom Bahnhof Rotterdam. Es war die Anschrift seiner Eltern.
Das Haus war eines der wenigen alten Häuser, die stehengeblieben waren. Um Haaresbreite dem verheerenden deutschen Luftangriff im Mai 1940 entgangen. Die Wohnung befand sich im zweiten Stock. G. und A. van der Waals stand auf dem Klingelschild. Anton und eine weitere Frau? Was sollte sie sagen, wenn Anton jetzt die Tür öffnete? Sofieke hatte für alle Fälle ihre Pistole in der Handtasche. Die Browning-Pistole, die sie damals aus Antons Wohnung in Den Haag gestohlen hatte. Aber Anton war gefährlich. Würde sie gegen ihn überhaupt zum Schuss kommen? Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Eine ältere Frau öffnete die Tür. Sofieke sagte: »Jutta de Vliet, ich komme von der Zeitung, vom Nieuwe Rotterdamsche Courant. Wir schreiben einen Bericht über den Mord an Anton van der Waals.«
»Gerard, kommst du mal bitte?«, rief die Frau in die Wohnung hinein. »Hier ist jemand von der Zeitung!«
Gerard war ganz offensichtlich Antons Vater. »Zunächst einmal möchte ich Ihnen beiden mein herzliches Beileid ausdrücken«, behauptete Sofieke. Sie war erleichtert und enttäuscht zugleich.
Gerard van der Waals schien derjenige zu sein, der hier das Wort führte. »Das war ein schwerer Schlag für uns«, sagte er. »Das kann ich Ihnen sagen. Ein ganz schwerer Schlag. Wenn der eigene Sohn so plötzlich – so plötzlich nicht mehr da ist.«
»Er hat immer gut für uns gesorgt«, ergänzte die Frau. »Diese Wohnung hier, die hätten wir uns allein niemals leisten können. Aber er hat gut verdient, und er hat seine armen Eltern nicht vergessen.«
»Das ist wirklich furchtbar, wenn man den eigenen Sohn verliert«, bestätigte Sofieke, und einen Moment lang taten ihr die beiden alten Leute leid.
»Was das Schlimmste ist«, fuhr der Mann fort, »und was Adriana und ich überhaupt nicht begreifen können, das ist, dass sie die Leiche nicht freigegeben haben. Wenigstens ein Grab wollen wir haben, einen Ort, wo wir unserem Sohn nahe sein können. Aber es gibt kein Grab. Zumindest hat man uns keines genannt. Wir haben bei der Polizei angerufen, aber die haben uns nur vertröstet. Wir würden benachrichtigt, haben sie gesagt. Jetzt ist das fast drei Wochen her, und gar nichts ist passiert. Verstehen Sie das?«
»Nein«, sagte Sofieke, »das ist unfassbar.« Aber in Wirklichkeit konnte sie sich inzwischen sehr gut vorstellen, was passiert war. Anton van der Waals war noch am Leben.
Auf dem Tischchen im Flur lag unter dem Spiegel eine Ansichtskarte. »Jedenfalls sind Sie nicht völlig allein. Sie haben wenigstens nette Menschen, die Ihnen schreiben.« Sie deutete auf die Postkarte.
»Ja«, sagte Adriana. »Da hat uns jemand aus Delfzijl geschrieben. Und wir wissen nicht einmal, wer das ist. ›Bin auf der Excelsior.‹ In Druckbuchstaben. Was soll das heißen?« Antons Mutter schüttelte den Kopf.
Sofieke wusste sehr wohl, was das heißen sollte. Anton stand im Begriff , sich ins Ausland abzusetzen.
Sofieke hatte Gerhard in seiner Dienststelle angerufen. Von der Post aus; das Telefon ihrer Vermieterin, einer freundlichen alten Dame, sollte sie nur im Notfall benutzen. Auch so konnte sie Gerhard nicht direkt erzählen, was sie vorhatte. Telefone wurden ja bekanntlich oft abgehört. Gerhard begriff dennoch sofort, um was es ging. Zum Glück konnte er sich freinehmen. Sie trafen sich auf dem Bahnsteig in Amsterdam Centraal. Sofieke erzählte ihm aufgeregt, was sie herausgefunden hatte.
»Wir können ihn nicht festnehmen lassen«, bremste Gerhard ihren Enthusiasmus. »Wir können nicht einmal den Widerstand informieren. Von den Widerstandskämpfern, die wir kennen, ist niemand mehr in Freiheit.«
»Ich will wissen, woran ich bin«, sagte Sofieke. Ihr Herz klopfte. Sie war fest entschlossen, Anton zu erschießen. Sie hatte Gerhard nichts davon erzählt. Er wusste nicht, dass sie bewaffnet war.
Gemeinsam fuhren sie mit dem Zug nach Delfzijl. Die Stadt war nicht groß, für den Weg vom Bahnhof zum Hafen brauchten sie keine zehn Minuten. Der Hafen von Delfzijl war kleiner, als Sofieke erwartet hatte. Es gab nicht einmal ein richtiges Hafenbecken, nur einen Damm gegen den Dollart hin und eine einzige Kaimauer. Gerhard sah sich suchend um. Sofieke fragte einen Mann, der auf einem Poller am Kai saß und rauchte: »Entschuldigen Sie, wir suchen den Liegeplatz der Excelsior.«
»Liegeplatz? Die Excelsior liegt nicht mehr. Die hat gerade abgelegt.« Der Mann deutete auf ein Fahrzeug, das auf die Mitte des Fahrwassers zusteuerte.
»Das ist die Excelsior?« Sofieke konnte es kaum glauben.
Der Mann nickte. »Zu spät«, sagte er. »Sie sind zu spät gekommen. Wollten Sie auch mit nach Schweden?«
»Nein, wir wollten nicht mitfahren«, sagte Gerhard, der inzwischen hinzugetreten war. Also war Anton auf dem Weg nach Schweden.
»Übrigens: wenn Sie eine Unterkunft brauchen, wo Sie bis zur nächsten Fahrt warten können, dann könnte ich vielleicht ...«
»Danke«, erwiderte Gerhard. »Wir brauchen keine Unterkunft.«
»Da!« Sofieke deutete auf die Excelsior. Ein Mann ging lässig zum Heck des Schiffes und blickte zurück in Richtung Hafen. Kein Zweifel, das war Anton van der Waals. Aber sie konnte nichts machen. Der Abstand des Schiffes von der Kaimauer war für einen sicheren Pistolenschuss zu groß.
Anton hatte Sofieke und Gerhard entdeckt. Er winkte ihnen zu. Es sah ausgesprochen fröhlich aus.
Gerhard winkte zurück. »Wir kriegen dich trotzdem«, murmelte er. »Verlass dich drauf, Anton van der Waals, wir kriegen dich!«
Sofieke hatte Tränen in den Augen vor Enttäuschung.
»Er bleibt nicht in Schweden!«, sagte Gerhard. »Ganz sicher nicht. Wir müssen nur ein paar Monate warten. Er kommt zurück nach Holland, und dann schnappen wir ihn uns.«
Montag, 26. Juli 1943
In der Nacht zum 25.7. flogen feindliche Luftwaffenverbände einen schweren Bombenangriff auf Hamburg. Gerhard erfuhr davon erst aus den Nachrichten. Er versuchte zu Hause anzurufen. Die Telefonverbindung nach Hamburg war unterbrochen. Erst am Nachmittag des nächsten Tages gelang es ihm, seine Mutter am Telefon zu erreichen. Ihm fiel ein Stein vom Herzen. Das Gespräch war nur kurz.
»Nein, hier ist alles in Ordnung«, sagte seine Mutter. »Bei uns jedenfalls. In der Innenstadt dagegen … – Oh, ich muss Schluss machen. Es gibt wieder Alarm.«
»Jetzt, bei Tag?«
»Bis bald, Gerhard!« Seine Mutter legte auf.
Weitere Luftangriffe auf Hamburg folgten. Gerhard versuchte noch viele Male, zu Hause anzurufen, aber vergeblich. Die nächste Nachricht von zu Hause, die er bekam, war ein Brief seines Vaters.
Hamburg, 28. Juli 1943
Lieber Gerhard! Ich hatte den Kontakt zu Dir abgebrochen, aber jetzt muss ich mich doch melden. Es geht nicht anders. Wir haben schwere Angriffe auf Hamburg erlebt, wie du wahrscheinlich im Wehrmachtsbericht gelesen hast. Wie schwer sie gewesen sind, kannst du dir nicht vorstellen. Mutter und ich sind wohlauf. Deine Schwester ist bei einer Freundin in Eppendorf; wir haben noch keine Nachricht von ihr.
Ich schreibe dir dies, weil ich nicht anders kann, auch wenn es verboten ist. Natürlich habe ich keine Fotos; meine Worte müssen ausreichen, obwohl mir zur Beschreibung dessen, was ich gesehen habe, die Worte fehlen. Nach dem fünften Angriff in der Nacht von gestern auf heute ist Hamburg praktisch zerstört. Die Häuser sind nur noch rauchende Ruinen. Nur die Außenmauern stehen noch. In den Hauseingängen liegen verkohlte Leichen. Menschen, die gehofft haben, dort Schutz zu finden. Ich habe mit einem Feuerwehrmann gesprochen. Die meisten sind in dem unfassbaren Feuersturm ums Leben gekommen. Ich habe Gruppen von Toten gesehen, 20 bis 30 Menschen, die hinter einem Gartenzaun Schutz gesucht hatten. Frauen und Kinder. Alle tot. Einige bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, andere vollkommen nackt, weil ihnen die Kleidung vom Leib gebrannt ist, ihre Körper praktisch unversehrt. Und der Gartenzaun ist völlig heil geblieben. Leichen überall, auf den Straßen, in den Kanälen. Und wie es in den verschütteten Luftschutzkellern aussieht, weiß noch keiner. An die Bergung der Toten dort unten ist zur Zeit nicht zu denken. Das geht erst, wenn die Trümmer abgekühlt sind.
Nach allem, was ich gesehen habe, sind bei all den Angriffen keine kriegswichtigen Ziele getroffen worden. Den Hafen haben sie verschont. Es ging den Engländern allein um den Mord an der Zivilbevölkerung. Wer bisher etwa geglaubt hat, dass in diesem Krieg die Deutschen die Bösen und ihre Gegner die Guten sind, der sollte spätestens jetzt noch einmal neu nachdenken. Du weißt, warum ich gerade Dir diese Zeilen schreibe.
Unser Fahrer fährt am späten Nachmittag nach Lübeck und nimmt diesen Brief mit. Ich hoffe, dass diese Zeilen dich trotz der Zensur erreichen. Wandsbek steht noch. Barmbek auch. Mehr weiß ich nicht. Mutter lässt Dich grüßen.
Dein Vater.
Dienstag, 4.August 1943
Gerhard hielt es nicht länger aus. Nachdem er noch immer keine Telefonverbindung zu seinen Eltern bekommen hatte, fuhr er schließlich mit dem Zug nach Hamburg. Giskes hatte ihm eine entsprechende Genehmigung ausgestellt. Offiziell sollte er den Kollegen der Abwehrstelle Hamburg im Wehrkreis X in der General-Knochenhauer-Straße geheimes Material über die tragbaren englischen S-Phones übergeben, mit denen eine Sprechfunk-Verbindung vom Boden zum Flugzeug möglich war. Aber Giskes wusste nicht, ob sein Ansprechpartner in der Abwehrstelle Hamburg überhaupt noch am Leben war. Der Zug fuhr nur bis Hamburg-Harburg; die Strecke zum Hauptbahnhof war noch nicht wieder freigegeben.
Gerhard kam am 4. August in Hamburg an. Der letzte Großangriff lag bereits anderthalb Tage zurück. Noch immer stand eine Rauchwolke über der Stadt. Der Transport vom Harburger Bahnhof bis in die Innenstadt erfolgte per Wehrmachts-LKW. Die Fahrt endete auf dem Rathausmarkt. Das Rathaus hatte die Bombardierung so gut wie unbeschadet überstanden. Der Rest der Innenstadt sah dagegen trostlos aus.
»Nach Barmbek wollen Sie? Da ist es noch schlimmer!«, sagte ein Polizist, den Gerhard nach dem Weg gefragt hatte.
»Meine Eltern wohnen da«, erwiderte Gerhard.
»Eigentlich kann ich Sie da nicht hinlassen«, sagte der Polizist. »Ihre Papiere sagen ja, dass Sie nach Harvestehude sollen, zur Knochenhauer-Straße. Aber ich hab nichts gesehen. Versuchen Sie Ihr Glück. Die großen Straßen sind wieder frei.«
Dass die Straßen frei waren, war leicht übertrieben. Aber immerhin fuhren wieder Autos. Auch hier half Gerhard seine Wehrmachtsuniform. Ein Lastwagen hielt an und nahm ihn bis nach Barmbek mit.
Er hätte sich die Fahrt sparen können. Sein Elternhaus stand nicht mehr. Gerhard stand fassungslos vor einem Haufen Trümmer.
»Bist du das, Gerhard?«, sagte plötzlich jemand.
Gerhard drehte sich um. Da stand Herr Winkelmann, einer der Nachbarn. Er trug einen Kopfverband. »Herzliches Beileid«, sagte er. »Entschuldigung, das klingt jetzt so banal, aber ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Das ist alles so furchtbar, so unvorstellbar furchtbar. Ich habe einen Stein auf den Kopf gekriegt. Ich lebe noch, aber meine Frau ...«
»Das tut mir leid«, sagte Gerhard. Auch ihm fehlten die Worte. Die Frau Winkelmann, diese liebenswerte ältere Dame, einfach ausgelöscht. Gerhard nahm allen Mut zusammen. »Und meine Eltern?«, fragte er.
Winkelmann zuckte hilflos mit den Achseln. »Du siehst ja, wie es hier aussieht. Erst Sprengbomben und Luftminen, um die Dächer abzudecken und Fenster und Türen wegzufegen, und dann Brandbomben und Phosphorkanister hinterher. So machen sie es, die Engländer. Und das hier, das war eine Luftmine. Nahtreffer. Da bleibt kein Stein auf dem anderen.«
»Und – der Luftschutzkeller?«
»Den haben sie ausgegraben, aber ich glaube nicht, dass da noch jemand gelebt hat. Das weiß ich nicht. Da war ich ja im Krankenhaus, wo ich den Verband gekriegt habe. Frag mal bei der Polizei nach, vielleicht wissen die was.«
Die Polizei konnte nur bestätigen, was Gerhard geahnt hatte. Aus dem Haus war keiner lebend herausgekommen. Im Luftschutzkeller nur Tote. Nein, sie hatten keine Ahnung, wer die Toten gewesen waren.
»Und die Trauringe? Es müsste doch Trauringe gegeben haben.«
»Ich weiß nichts von Trauringen.«
»Kann ich bitte die Toten sehen?«, fragte Gerhard. Vielleicht könnte er die Toten identifizieren. Vielleicht waren es ja gar nicht seine Eltern.
»Schon begraben«, war die Antwort. »Tut mir leid, Junge, aber bei der Hitze jetzt im August, das muss schnell gehen.«
Und Ilse? Seine Schwester war wahrscheinlich gar nicht zu Hause, als der große Angriff kam. Papa hatte geschrieben, sie sei bei einer Freundin in Eppendorf. Aber in Wirklichkeit war sie natürlich bei ihrem Freund. Gerhard wusste, wo das war. Die Straßenbahn fuhr nicht. Er ging zu Fuß. Auch dieses Haus war völlig zerstört; nur die Fassade stand noch. Überall Polizei, auch Soldaten mit Gewehren, um Plünderungen zu verhindern. Aber hier gab es nichts mehr zu plündern. Es war alles kaputt. Gerhard lieh sich einen Spaten. Er begann zu graben.
»Da ist niemand mehr im Keller«, sagte einer der Polizisten. Nein, da waren auch keine Toten im Keller gewesen. Sie hatten den Luftschutzraum ausgegraben, natürlich, die Nachbarn, die noch da waren, hatten mit angefasst. Der dicke weiße Pfeil mit den Buchstaben LSR wies den Weg. Aber da war niemand. Der Keller war leer.
»Wahrscheinlich sind sie aus der Stadt raus«, sagte der Polizist. Er versuchte halbherzig, Gerhard Mut zu machen. »Haben viele gemacht nach dem ersten Angriff , obwohl es ja eigentlich verboten war. Hat sich niemand drum gekümmert. Wir haben alle gewusst, dass dies erst der Anfang war. Werden wohl auch noch weitere Angriffe folgen.«
Gerhard nickte. Unsinn, dachte er. Er war sich sicher, dass die Menschen, die er suchte, noch unter den Trümmern lagen. Wahrscheinlich tot. Aber vielleicht auch nicht. Wie lange hielt man es ohne Wasser und Nahrung aus unter Ziegelsteinen und Beton?
»Eines kann ich dir versprechen«, sagte der Polizist, »wenn ich jemals wieder einen Engländer sehe, ganz gleich, ob das jetzt im Krieg ist oder hinterher, dann schlage ich ihn auf der Stelle tot. Diese Mörder sind es nicht wert, weiterzuleben!«
Gerhard antwortete nicht. Es war sinnlos. Es war Unsinn, was der Mann sagte, und er würde niemanden totschlagen, weder jetzt noch später. Er war einfach nur bis in die Grundfesten seiner Seele erschüttert. Gerhard grub weiter. Sie sind nicht im Keller, weil sie geflüchtet sind, dachte er. Als die ersten Bomben fielen, da haben sie gemerkt, dass es diesmal ernst ist, und da sind sie losgerannt, zum Hochbunker, aber dort sind sie niemals angekommen. Sie liegen hier unter den Trümmern. Vielleicht lebten sie noch. Das war nicht unmöglich. Vielleicht lebte Ilse noch.
Die Trümmer widersetzten sich seinem Spaten. Gerhard grub und hebelte und zerrte mit bloßen Händen Balken aus dem Schutt. Jemand lachte. Wütend drehte Gerhard sich um, aber es war nur ein verwirrter Alter, der im Nachthemd zwischen den Trümmern stand und wieherte wie ein Pferd. Gerhard schüttelte den Kopf und grub weiter. Der Alte verschwand.
Gerhard grub in panischer Hast. Bald würde er aufhören müssen, bald würde es dunkel werden. Lieber Gott, dachte er, ich flehe dich an, mach, dass Ilse noch lebt. Meine liebe, liebe Schwester! Ich werde alles tun, was du willst, ich werde nie wieder an dir zweifeln! Ich werde nie wieder behaupten, dass es dich nicht gibt!
Aber es gab keinen Gott. Oder wenn es ihn doch gab, hatte er sich einen entsetzlichen Scherz für Gerhard ausgedacht. Da waren Haare in den Trümmern, ganz eindeutig Haare! Gerhard warf den Spaten zur Seite, grub mit den Händen. Das waren Ilses Haare, kein Zweifel, die Haare seiner Schwester.
»Ilse!«, rief er, in der Hoffnung, dass sie ihn hören könnte. Sie rührte sich nicht. Er zog an den Haaren, und dann stieß er einen entsetzlichen Schrei aus.
Freitag, 6. August 1943
Gerhard wusste hinterher nicht mehr, wie er in den Zug gekommen war. Auch an die Fahrt nach Holland hatte er später keine Erinnerung. Als er in Driebergen ankam, war der erste Mensch, der ihm über den Weg lief, Richard Christmann. Richard war erschrocken, wie der Junge aussah. »Was ist passiert?«, fragte er.
Gerhard hatte sich nicht vorstellen können, dass ausgerechnet Richard einmal derjenige sein würde, dem er sich anvertrauen würde, aber der ex-Fremdenlegionär war in diesem Augenblick ohne jeden Spott. »Es war furchtbar«, sagte Gerhard.
»Deine Eltern?«, fragte Richard. »Tot?«
Gerhard schüttelte den Kopf. »Vermisst«, sagte er. »Die Polizei sagt, dass in dem Luftschutzkeller vier Tote gefunden worden sind. Nicht verbrannt, sondern erstickt. Zwei davon sind wahrscheinlich Mama und Papa.«
Richard sagte gar nichts.
Gerhard fuhr fort. »Die Polizei sagt, alles ist möglich. Nach den ersten Angriffen auf Hamburg hätten tausende von Menschen die Stadt verlassen. Hunderttausende vielleicht. Vielleicht auch meine Eltern. Aber ich glaube nicht daran. Wenn sie noch am Leben wären, hätten sie sich längst gemeldet. Es sind doch schon zehn Tage seit dem Angriff. Nein, elf Tage sogar. Entschuldige, ich bin noch immer völlig durcheinander.«
»Was ist mit deiner Schwester?«
»Ich habe in den Trümmern nach ihr gegraben. Aber was ich gefunden habe, das war nur ihr Kopf, verstehst du, Richard? Nur ihr Kopf! Irgendeine verdammte Bombe hat ihr den Kopf abgerissen!« Er weinte hemmungslos.
Richard Christmann nahm ihn in die Arme.
»Ich möchte auch tot sein«, schluchzte Gerhard.
Richard schüttelte den Kopf. »Du darfst jetzt nicht sterben«, sagte er. »Du wirst noch gebraucht. Komm mit!«
»Wohin?« Warum fragte er das? Eigentlich war es egal.
»Erstmal in unsere Dienststelle. Ich muss telefonieren. Und du – hast du überhaupt schon irgendetwas gegessen?«
Gerhard schüttelte den Kopf.
»Dann musst du jetzt erst einmal was essen. Am besten gehst du gar nicht erst zu Giskes. Das hat alles Zeit. Jetzt gehst du hier in Het Wapen van Rijsenburg und bestellst dir das beste Menü, das du kriegen kannst. Ich bezahl. Und dann komme ich gleich und hole dich ab.«
Dass er wirklich Hunger hatte, wurde Gerhard erst bewusst, als er tatsächlich sein Essen vor sich hatte. Der Ober hatte ihn zunächst mit äußerstem Mißtrauen angesehen, denn ungewaschen und in seiner verdreckten Uniform sah Gerhard in der Tat aus wie ein Landstreicher oder Deserteur, aber Richard Christmann hatte alles geregelt.
Richard hatte einen Wagen besorgt. Da sie erst Sofieke abholen mussten, wurde es schon dunkel, als sie schließlich auf dem Bauernhof in Drente ankamen, auf dem sie Sara untergebracht hatten. Sara, die jetzt Grietje hieß. Hendrika, die Bäuerin, machte ein besorgtes Gesicht, als sie das Auto mit dem Wehrmachtskennzeichen sah. »Es ist nicht gut, wenn jemand diesen Wagen hier sieht.«
Richard wischte ihre Bedenken vom Tisch. »Wir haben eine Panne«, sagte er. »Deshalb haben wir angehalten.« Er öffnete demonstrativ die Motorhaube.
Wenig später saßen Gerhard und Sofieke in dem kleinen Kinderzimmer, und Sofieke erzählte Grietje ein Märchen. »Es soll eine Prinzessin darin vorkommen!«, verlangte Grietje.
»Dann nehmen wir Prinzessin Irene«, schlug Sofieke vor. »Das ist die einzige Prinzessin, die ich persönlich kenne.«
»Du kennst eine Prinzessin?«, fragte Grietje überrascht.
»Na klar.«
Bei der Taufe war das gewesen, 1939. Bei der Fahrt zur Taufe. Sofieke hatte mitten in der jubelnden Menge gestanden, wenn auch in zu großer Entfernung, um irgendwelche Einzelheiten erkennen zu können. Sie sagte: »Heute kann ich dir nur den Anfang der Geschichte erzählen.«
»Warum nicht die ganze Geschichte?«
»Weil ich noch nicht weiß, wie sie ausgeht.«
»Schade.«
Gerhard saß auf dem Fußboden und betrachtete Sofieke und Grietje. Alle Anspannung war gewichen. Richard hat Recht, dachte er. Ich werde noch gebraucht. Ihr braucht mich und ich brauche euch.
Sofieke begann: »Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Irene. Sie war noch ein kleines Mädchen, noch viel jünger als du, aber sie hatte eine Eigenschaft, die die meisten Erwachsenen nicht mehr haben: Sie sagte immer die Wahrheit.«
»Warum sagen Erwachsene nicht die Wahrheit?«, wollte Grietje wissen.
Sofieke schüttelte den Kopf. »Sie sagen oft die Wahrheit, aber manchmal auch nicht. Das ist dumm, aber damit muss man rechnen. Sie sind nicht böse, aber sie haben einfach vergessen, dass man die Wahrheit sagen soll. – Zu dieser Prinzessin kam ein junger Mann, der hieß Hans, und der war fasziniert von ihr. Nicht von ihrer Schönheit, wie es im Märchen so oft heißt, sondern von ihrer Ehrlichkeit ...«
Gerhard hatte die Prinzessin nie zu Gesicht bekommen, die inzwischen zu einer Symbolfigur des Widerstandes geworden war. Die holländischen Soldaten, die nach England geflüchtet waren, waren im Namen dieses Kindes zu einer eigenen Einheit zusammengefasst worden, der Irene-Brigade. Aber die Prinzessin war nicht in England. Ihre Mutter war mit ihr nach Kanada ausgewichen.
Gerhard war, im Gegensatz zu den meisten seiner holländischen Kameraden, nicht einmal ihrer Großmutter vorgestellt worden, der Königin Wilhelmina. Einen Deutschen mochte man ihr wohl nicht zumuten.
Sofieke sagte: »Aber es ist nicht leicht, wenn man einer Prinzessin gefallen will. Die Prinzessin sagte: ›Wer mir gefallen soll, der muss gefährliche Dinge für mich tun. In dem Land, in dem ich zu Hause bin, herrscht jetzt ein böser Drache. Wenn du mutig bist, geh hin und kämpfe gegen ihn. Und was immer auch passieren mag: Sag stets die Wahrheit.‹«
»Der Drache heißt Hitler«, sagte Grietje.
»Der Drache hat viele Namen«, widersprach Sofieke. »Aber jedenfalls machte Hans sich auf den Weg. Den Drachen sah er nicht, aber einen bösen Mann in einer schwarzen Uniform. Der trat gerade auf ein Spielzeugauto. ›Kaputt!‹, sagte Hans erschrocken. ›Heil!‹, sagte der Mann. Hans traf den Mann wieder, als er gerade eine Stadt zerstört hatte. Die Stadt hieß Rotterdam. ›Heil!‹, sagte der Mann wieder, aber es war alles kaputt.«
»Warum tut er das?«, wollte Grietje wissen.
»›Warum tust du das?‹, fragte ihn Hans. ›Ja‹, sagte der Mann. ›Das ist doch keine Antwort!‹, empörte sich Hans. ›Ja‹, sagte der Mann wieder. Und ganz gleich, was Hans ihn fragte, die Antwort war jedesmal ja. Daraufhin erklärte Hans ihm, dass man nicht immer ja sagen müsse. Manchmal könne man auch nein sagen. Manchmal müsse man sogar nein sagen. Diese Möglichkeit hatte der Mann noch nie in Betracht gezogen. ›Aber woher soll ich wissen, wann ich nein sagen soll? Woher soll ich wissen, was richtig und was falsch ist?‹, fragte er. ›Es gibt so viele Regeln und Gesetze und Befehle ...‹ – ›Vergiss die Regeln und Gesetze und Befehle‹, erwiderte Hans. ›Man kann nein sagen. Man muss manchmal nein sagen, aber das reicht noch nicht aus. Man muss manchmal auch nein tun.‹«
»Aber woher soll er wissen ...«, setzte Grietje an.
Sofieke schüttelte den Kopf. Sie piekte dem Mädchen mit dem Zeigefinger zwischen die Rippen.
»Au!«
»Da sitzt das Herz«, sagte Sofieke. »Vergiss die Regeln und Gesetze und Befehle. Dein Herz sagt dir, was richtig ist. Die Entscheidung kann schmerzhaft sein. Aber was dir dein Herz sagt, das musst du tun.«
Später, als Grietje längst schlief, saßen Gerhard, Sofieke und Richard noch mit den Pflegeeltern zusammen im Wohnzimmer. Sie hatten über alle möglichen Dinge geredet, und schließlich waren sie auf die schlechten Zeiten zu sprechen gekommen. Der Bauer behauptete, in der Landwirtschaft könne man heute nur noch überleben, wenn man Beziehungen hätte.
»Was willst du damit sagen?«, fragte Richard.
»Ich frage mich, ob ich nicht in den NSB eintreten sollte.«
»Nein«, sagte Sofieke bestimmt.
Richard warf ihr einen amüsierten Blick zu. Zu dem Bauern sagte er: »Wenn es dir nützt, dann solltest du es tun.«
»Nein«, wiederholte Sofieke.
Richard sagte: »Ob man Mitglied im NSB ist oder nicht, das besagt gar nichts. Man kann mit den Nazis kooperieren und dennoch gegen sie sein. Frag Gerhard. Er ist jemand, der hervorragende Beziehungen zu den Nazis hat, und er ist trotzdem gegen sie.«
»Unsinn!« Gerhard war rot geworden.
»Kein Unsinn. Du bist auf ›Du‹ mit dem Reichskommissar ...«
»Na schön.« Irgendetwas musste Gerhard jetzt sagen. »Es ist kurios, aber angeblich bin ich soetwas wie der ›Neffe‹ von Arthur Seyß-Inquart. Seine Tochter und ich, wir haben zusammen in der Sandkiste gespielt. – Und außerdem kenne ich den General Christiansen. Den deutschen Militärbefehlshaber in den Niederlanden. Ob er sich allerdings noch an mich erinnert, das ist eine andere Frage.«
»Das musst du uns näher erklären!« Diese Geschichte kannte Richard noch nicht.
»Im Sommer 1932 ist das gewesen ...«
»1932? Da bist du ja gerade erst 11 Jahre alt gewesen!«, fiel ihm Richard ins Wort.
»Ja, das stimmt. Ich war noch ein Schulkind. Damals gab es dieses riesige Flugboot, das die Dornier-Werke gebaut hatten, die Do X. Und die ist nach der Amerika-Tour im Sommer 1932 nach Hamburg gekommen. Auf der Außenalster gelandet. Es war unglaublich, wie dieses riesige Wasserflugzeug auf dem kleinen See gelandet ist. Und dann durfte man es besichtigen. Und der Flugkapitän, der uns herumgeführt hat, das war Friedrich Christiansen.«
Richard überlegte. »Das könnte stimmen«, sagte er.
»Natürlich stimmt das. Fast wäre ich sogar mit der Do X geflogen, aber meine Eltern waren dagegen. Mein Freund, der hat es gemacht. Der ist am nächsten Tag mit Christiansen von Hamburg nach Travemünde geflogen.«
»Daran jedenfalls wird sich Christiansen erinnern«, vermutete Richard. »Es war mit Sicherheit nicht der Normalfall, dass irgendwelche Kinder mitgeflogen sind.«
»Nein«, sagte Gerhard. Nur sein Freund und er waren gefragt worden.
Sofieke sah Gerhard forschend an. ›Du bist solch ein wunderbarer Mensch‹, dachte sie, ›und du kennst all die falschen Leute.‹
Auf dem Heimweg kamen die Depressionen zurück. Gerhard sprach von seinen Versuchen, die Engländer über den Mord an den Juden zu unterrichten. »Ich habe nichts erreicht«, sagte er. »Es ist alles sinnlos.«
»Sie wissen es, Gerhard«, entgegnete Richard Christmann. »Das kannst du mir gern glauben, sie wissen es. Die Amerikaner und die Engländer und ihre Verbündeten. Ein SS-Offizier hat die entsprechenden Dokumente an unsere Gegner weitergegeben. Kurt Gerstein. Und er war nicht der einzige.«
»Aber warum tun sie dann nichts?«, rief Sofieke. »Mein Gott, warum tun sie dann nichts?«
Richard zuckte mit den Achseln. »Es ist nicht ihr Problem«, sagte er. »Es sind nicht ihre Juden.«
»Das ist zynisch!«, antwortete Gerhard erbost.
»Zynisch oder nicht – das ist einfach ein Fakt. Als Hitler an die Macht gekommen war, und als er sehr deutlich gesagt hat, dass er die Juden loswerden wollte, und gefragt hat, ob sie jemand haben will, da hat niemand ›hier‹ geschrien. Ein ganzes Schiff mit über 900 deutschen Juden ist kurz vor dem Krieg nach Amerika gefahren. Die St. Louis. Aber die Amerikaner haben niemanden an Land gelassen. Die Kanadier auch nicht. All diese Juden. Wer sie aufnimmt, der riskiert, nicht wiedergewählt zu werden. Und man will doch wiedergewählt werden. Wie willst du das nennen? Schieren Egoismus von Roosevelt und Konsorten? Unterlassene Hilfeleistung? Ganz gleich, wie du es bezeichnest, eines wird dabei überdeutlich: dass sie keiner haben will.«
»Richard, das kann so nicht stimmen!«, widersprach Gerhard. Das durfte so nicht stimmen.
Christmann zuckte mit den Achseln. »Vielleicht stimmt es nicht. Ihr wisst, dass ich gelegentlich übertreibe. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den ihr nicht außer Acht lassen dürft. Die Engländer und Amerikaner führen Krieg. Sie sind von uns angegriffen worden. Sie führen einen Krieg, den man inzwischen geradezu als Weltkrieg bezeichnen könnte. Und wer sich auf einen solchen Waffengang einlässt, der muss sich voll darauf konzentrieren. Mit ganzer Kraft, mit allen Mitteln. Wer nebenbei noch die Juden retten will, der verschwendet knappe Ressourcen.«
Gerhard schüttelte den Kopf. »Was du sagst, ist völlig unmoralisch.«
»Die Welt ist völlig unmoralisch. Ob die Amerikaner die indianischen Ureinwohner abmurksen oder die Deutschen die Hereros in Südwestafrika oder die Türken die Armenier, das ist dem Rest der Menschheit scheißegal.«
»Mir nicht!«, sagte Gerhard mit fester Stimme.
»Mir auch nicht!«, bekräftigte Sofieke.
Richard Christmann sah die beiden bekümmert an. »Das ist euer Problem, Kinder«, sagte er. »Genau das ist euer Problem.«
Am nächsten Morgen saß Gerhard wie gewohnt zur festgelegten Zeit hinter dem Funkgerät. Er ging auf Sendung. Die Verbindung mit London klappte diesmal fast sofort. Gerhard atmete tief durch. Er hatte sich fest vorgenommen, den Herrschaften auf der anderen Seite seine Meinung zu sagen: »Ich bin in Hamburg gewesen. Was habt ihr gemacht, ihr Schweine?« Aber das war sinnlos. Stattdessen beschränkte er sich, wie mit Schreieder abgesprochen, auf drei Buchstaben, QRU: »Ich habe keine neuen Meldungen«.
Donnerstag, 12. August 1943
»Nichts Neues?«, sagte Schreieder.
Gerhard drehte sich um. Er hatte nicht gehört, dass Schreieder hereingekommen war. »Nein«, sagte er. »London schweigt.«
Schreieder schüttelte den Kopf. Genau das war das Neue. Eine völlige Abkehr von der bisherigen Praxis. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Gerhard sah den SS-Mann fragend an. Er hatte das Gefühl, dass Schreieder misstrauisch war. Aber Gerhard hatte seit seiner Antwort auf das »HH« vor drei Monaten nichts getan, was er hätte missbilligen können. »Wahrscheinlich wollen sie nichts riskieren«, sagte Gerhard leichthin.
»Nichts riskieren?«
»Ich denke mir, dass die Invasion noch in weiter Ferne liegt, und dass London den Kontakt zur Untergrundarmee nicht durch unnötige Aufträge gefährden will.«
»Ja, vielleicht.« Die Untergrundarmee existierte nicht. Schreieder fragte sich, ob drüben wirklich noch jemand daran glaubte, dass hier in Holland Tausende von Kämpfern auf ihren Einsatz warteten. »Aber auch unsere holländischen Informanten sind nicht sehr aktiv.«
Gerhard sagte: »Der Tod von Anton van der Waals wird ein schwerer Schlag für sie gewesen sein. Davon müssen sie sich erst erholen.«
»Ja, wahrscheinlich.« Schreieder ahnte, dass Gerhard ihm auf den Zahn fühlen wollte. Der Junge wollte herausfinden, ob Anton wirklich tot war. Wir spielen Katz und Maus, dachte er.
Schreieder war sich nicht sicher, was Gerhard möglicherweise in Erfahrung gebracht hatte. Vielleicht wusste er sogar, dass Anton sich nach Schweden abgesetzt hatte. Was er aber unmöglich wissen konnte war, dass Anton inzwischen wieder in Holland war. Er hatte sich in Schweden stümperhaft angestellt. Seine Behauptung, ein Graf zu sein, hatte der Botschafter mithilfe des Adelsverzeichnisses sofort widerlegen können. Antons Abreise aus Schweden war einer Flucht gleichgekommen. Er hatte nicht auf ein Schiff nach Holland warten können. Schreieder hatte ihn aus Kiel abholen müssen.
Nun saß Schreieder wieder mit ihm an. Was sollte er mit ihm machen? Der Mann war verbrannt, zu nichts mehr zu gebrauchen. Er hätte den Kontakt zu ihm abbrechen sollen, aber er traute sich nicht. Anton wusste viel zu viel über ihn. Alle Schweinereien, die beim Schlag gegen die Vorrinck-Gruppe passiert waren, hatte Schreieder mit zu verantworten. Und Anton hatte einmal angedeutet, dass er schriftliche Aufzeichnungen hatte. Er musste den Mann ständig unter Beobachtung halten.
Zum Glück hatte Anton inzwischen begriffen, dass sein Leben bedroht war. In Rotterdam und in Den Haag war er nicht mehr sicher. Er besaß seit langem ein Hausboot in Aalsmeer; dahin hatte er sich jetzt zurückgezogen. Er wollte angeblich demnächst einen Bauernhof kaufen – unter falschem Namen natürlich – , weit weg von all den Orten, an denen er als Kollaborateur und Verräter aufgetreten war, und dann wollte er heiraten, ein naives Mädchen, das er beim Segeln kennengelernt hatte. Wenn er schlau war, würde er das tun und sich anschließend zur Ruhe setzen, und niemand würde jemals herausfinden, wo er geblieben war. Aber war Anton schlau genug?