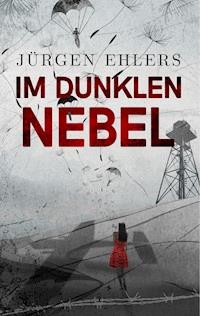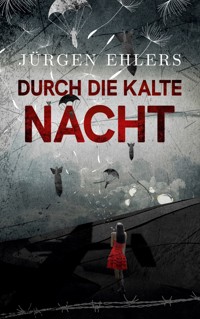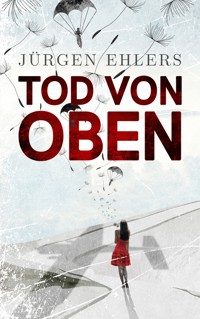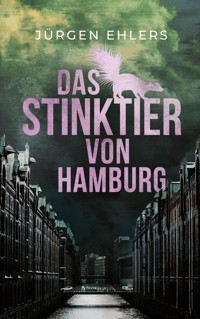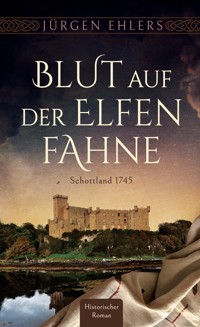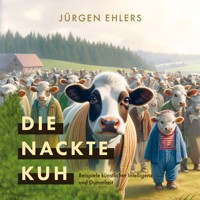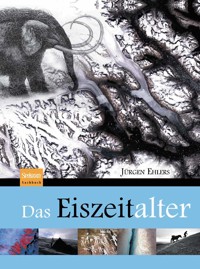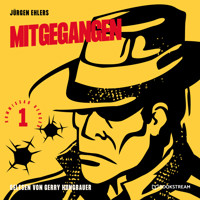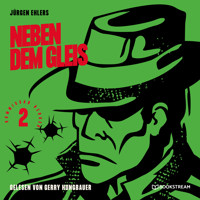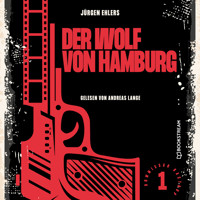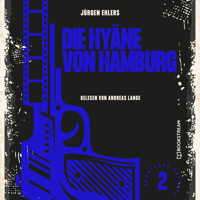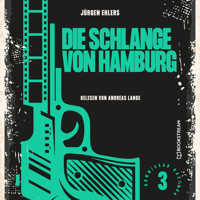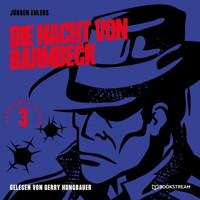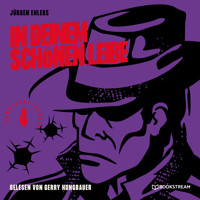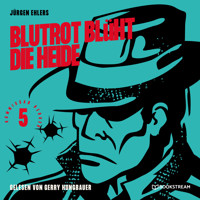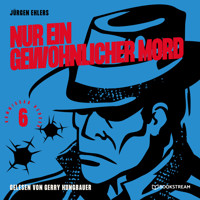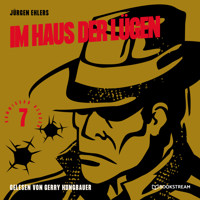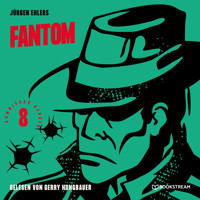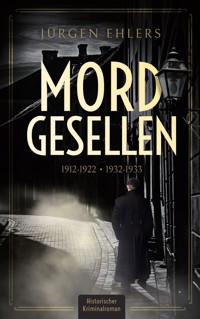
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Berger und seine Kollegen von der Hamburger Kripo sehen sich einer gut organisierten Bande von Kriminellen gegenüber. Und das sind keine Gentleman-Verbrecher, sondern Gewalttäter. Gewalt gibt es allerdings auch anderswo: Hunger-Unruhen, Kapp-Putsch - die junge deutsche Republik steckt in einer schweren Krise. Um Petersen und seiner Bande das Handwerk zu legen, geht die Polizei bis an die Grenzen des Rechtsstaats - und darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ehlers
Eiszeitforscher und Krimiautor, geboren 1948 in Hamburg. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis und Kriminalromane. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«. Er lebt mit seiner Familie in Schleswig-Holstein. Wer mehr über ihn und seine Bücher erfahren möchte, findet viele Informationen auf seiner Webseite
https://www.juergen-ehlers-krimi.de
Inhaltsverzeichnis
I. Sieg
Tod eines Wachtmeisters
Es wird geschossen!
Prügel
Sieg und Platz
Schlag auf Schlag
Zwischenspiel auf St. Pauli
II. Niederlage
Verhaftet
Petersen verhaftet
Die Meineidfalle
Der Kern
Wahnsinn
Sieger und Verlierer
III. Entscheidung
Falschgeld
Hannack ist raus!
Führungswechsel
Berufsbeamte
Ein Einbruch zu viel
Die Falle
I. Sieg
Tod eines Wachtmeisters
19. Mai 1919
Thérèse. Das ist Thérèse.« Wilhelm Berger tippt auf die sepiafarbene Fotografie. Niemand hört ihm zu. Es ist Nacht, er ist betrunken, und von Thérèse Charpentier-Deterville, deren Bild er seit einem dreiviertel Jahr mit sich herumschleppt, hat er seit jener Nacht in Huppaye nie wieder etwas gehört. »Warum schreibst du nicht?«, murmelt er. Sie hatte es ihm fest versprochen.
Unter einer Straßenlaterne hält er an, betrachtet das Bild. Das Foto ist in einem Studio aufgenommen. Der Park im Hintergrund ist nur gemalt. Und dieses hölzerne Ding, was soll das sein? Eine Bank? Vielleicht.
Ungestüm sieht sie aus, die Thérèse. Das Foto fällt ihm aus der Hand. Er bückt sich danach, gerät ins Straucheln, fängt sich wieder. Noch ein Zettel ist heruntergefallen. Die Seite, die er immer in sein Tagebuch kleben wollte, aber nie dazu gekommen ist.
Am 24. April Sturmangriff auf den Kemmel-Berg. Nachts um 3.30 Uhr Beginn des Trommelfeuers. Gasschießen. Wir setzen Masken auf, Regen. Noch vor 7 Uhr in den großen Sprengtrichter. Um 7.00 Uhr Sturm. Viel Gas und Pulverdampf, Blasen, Gefangene, Verluste, Halt. Splitter gegen Bein. Trull tot. Straße Kemmel-Ypern, Schlafen in Freien, Regen. Oft in Gefahr. Am Abend des 27. abgelöst. In unserer Kompanie 12 Tote, 30 Verwundete.
Zwölf Tote, dreißig Verwundete. Fast die Hälfte ist das gewesen.
Zum Teufel damit. »Zum Teufel mit dem Krieg!«
Hat er das wirklich laut gerufen? Und, was da knallt, sind das wirklich Schüsse? Hier, in Hamburg, mitten im Frieden? Nein, er träumt.
Undeutlich nimmt er wahr, dass Leute auf ihn zu rennen; sie sehen ihn, verschwinden nach links zwischen den Häusern. Und vor ihm, vor ihm liegt etwas auf der Kreuzung. Vielleicht sollte er ... Da scheppert es unmittelbar neben ihm. Die Männer, die eben noch in die Gärten gerannt sind, kommen zurück, klettern über ein Gitter.
»He, he! Nun mal langsam!«, ruft er.
Sie stoßen ihn zur Seite.
2.
»Jetzt haben wir es gleich geschafft!« Wernicke hält sich die Hand vor den Mund, gähnt.
»Ja«, sagt Brandt. So hat er sich den Dienst bei der Polizei nicht vorgestellt.
Die beiden Schutzleute stehen an der Ecke Peterkampsweg und Wandsbeker Chaussee in Eilbeck. Eigentlich sind sie auf Streife, aber man kann ja nicht die ganze Zeit herumlatschen, schon gar nicht mit den neuen Stiefeln. Es ist drei Uhr morgens; die Straßen sind leer.
»Ich hör auf«, sagt Brandt.
Wernicke lacht. »Das hat schon mancher gesagt.«
»Doch, ganz im Ernst. Dieser Schichtdienst, der macht einen kaputt.«
»Gleich ist er ja vorbei!« Wernicke, der ältere der beiden Schutzleute, will diese Leier nicht schon wieder hören. Auch er ist nicht begeistert davon, sich die Nächte auf diese Weise um die Ohren zu schlagen, aber er hat sich damit abgefunden. Es wird ja alles besser. Und sicherer. Die Hungerunruhen vom April – vorbei. Keine Gefahr mehr, dass der Mob die Polizeiwache stürmt. Sogar neue Stiefel hat er gekriegt inzwischen. Die drücken zwar, aber wenn er sie gut fettet, wird sich das schon geben. »Und was willst du machen, wenn du wirklich hier aufhörst?«
Darüber hat sich Brandt noch keine Gedanken gemacht. »Ich bin doch jung, ich kann überall Arbeit finden.«
»Denk dran, du hast hier ‘ne Lebensstellung ...«
»Lebenslänglich, ja, das kannst du wohl sagen. Von den 300 Piepen kann man ja nicht leben und nicht sterben. Und wenn wir jetzt heiraten, die Irmi und ich ...«
»Heiraten willst du?«
»Ja, wir wollen heiraten.« Es klingt etwas kleinlaut.
Wahrscheinlich muss er heiraten, denkt Wernicke. »Wenn ich dir mal was sagen darf, mein Lieber, dann ist es dieses: Bleib bloß in dieser Stellung und erzähl keiner Menschenseele, dass du hier weg willst. Denn wenn die da oben das erst spitz kriegen, dann kannst du sicher sein ...«
»Moment mal!«
»... dann kannst du ganz sicher sein, dass sie dir hinterher...«
»Sei doch mal still!«
»Was ist denn los?« Wernicke sieht sich um.
»Da hinten, da sind welche!«
»Wo?«
»Da, bei der Kreuzung!«
Wernicke sieht niemanden.
»Beim Roßberg muss das sein«, sagt Brandt. »Ja, das ist die Ecke Roßberg. Und da auf der anderen Seite, das ist die Maxstraße.«
Wernicke weiß, wie die Straßen heißen. »Was hast du gesehen?«, fragt er.
»Da sind zwei Männer rübergegangen!«
»Um diese Zeit?« Mist, das sind Einbrecher, denkt Wernicke.
»Das sind Einbrecher! – Komm, die schnappen wir uns!«
»Die sind bestimmt längst weg.«
»Die haben uns doch nicht gesehen! Komm, wir teilen uns auf: Ich geh hier drüben rein, Fichtestraße, und dann nach links. Du gehst hier runter und dann in die Maxstraße. Da haben wir sie in der Zange.«
»Ja, das können wir versuchen.« Wernicke ist nicht begierig darauf, jetzt kurz vor der Ablösung auf ein paar Einbrecher zu treffen. Über den Eifer des Kollegen kann er nur den Kopf schütteln. Eben wolltest du noch den Dienst an den Nagel hängen, denkt er.
Brandt eilt davon.
Wernicke geht die Wandsbeker Chaussee entlang. Nur nichts überstürzen. Da ist schon die Maxstraße. Er guckt erst einmal, was hier überhaupt los ist. Einbrecher, denkt er. Wo können die herkommen? Aus jedem der anliegenden Häuser natürlich, das ist klar. Oder hier aus dem Laden.
An der Ecke Roßberg/Wandsbeker Chaussee gibt es ein Textilgeschäft. Lehmann, Weißwaren. Die Scheiben sind unversehrt, die Tür ist geschlossen. Wernicke tritt heran, fasst an die Klinke. Die Tür lässt sich öffnen! Scheiße. Tatsächlich ein Einbruch.
Schlagartig wird Wernicke klar, dass sein Kollege in Gefahr ist. Er rennt los.
3.
Brandt läuft die Fichtestraße entlang und biegt dann in die Schellingstraße ein. Er ist gut im Training, aber er weiß natürlich, dass er sich beeilen muss. Sein Weg ist mehr als doppelt so lang wie der der beiden Männer, die er gesehen hat. Nur mit Glück kann er sie noch erwischen!
Schon hat er die Kreuzung vor sich. Alles frei, niemand zu sehen. Brandt hört auf zu rennen, fällt in einen gemächlichen Trab. In dem Augenblick kommen sie. Zwei Männer sind es, die einen Sack zwischen sich tragen. Jeder hat einen Zipfel gepackt, und gemeinsam schleppen sie die offensichtlich schwere Last über die Kreuzung. Brandt ist keine fünfzig Meter entfernt, er fängt wieder an zu rennen. Da bemerken die Männer ihn.
»Halt!«, ruft Brandt, aber da haben die beiden schon den Sack fallen gelassen und rennen in verschiedene Richtungen davon. Kein Zweifel, das sind Einbrecher! »Halt! Polizei!«
Sie hören nicht auf ihn.
Brandt will hinterher, da sieht er, dass auf der anderen Straßenseite noch jemand steht. Er bewegt sich jetzt, will sich offensichtlich davonmachen, so tun, als ob er nicht dazugehört. Aber er gehört dazu, keine Frage, was hätte er sonst zu dieser Stunde hier auf der Straße zu suchen?
Brandt packt ihn am Arm.
»He, was soll das?« Der Kerl will sich losreißen.
»Mitkommen!« Brandt lässt nicht locker. Er zerrt den Mann auf die Kreuzung, ins Licht, zu dem liegen gebliebenen Sack. Der Kerl windet sich wie ein Aal. Da bemerkt Brandt, dass der Bursche mit der freien Hand etwas aus der Tasche zieht. Eine Waffe!
Der Wachtmeister greift danach. Zu spät.
4.
Wernicke sieht die Männer vor sich auf der Kreuzung. Plötzlich kracht ein Schuss, dann noch einer. Zwei Schüsse in rascher Folge. Wernicke springt in Deckung. Er reißt seine Waffe heraus. Wo ist Brandt? Da vorne steht er!
»Schieß doch, schieß!«, ruft er.
Aber der Mann, der da vor ihm auf der Kreuzung steht, wendet sich ab und rennt. Als Wernicke hinterher will, sieht er, da steht noch jemand, nicht auf der Kreuzung, sondern weiter vorn, hinter dem Baum!
»Brandt!« schreit Wernicke.
Da blitzt es auf. Nicht Brandt! Jemand schießt auf ihn!
Wernicke zückt die Trillerpfeife. Über ihm im Haus, über dem Krämerladen, wird ein Fenster aufgerissen. »Was ist denn los hier?« Eine kräftige Männerstimme. Auch von den Fenstern auf der anderen Straßenseite werden Stimmen laut. Als Wernicke sich wieder gefasst hat, ist der Mann verschwunden.
Wernicke rennt auf die Kreuzung. Da liegt etwas groß und schlapp mitten auf der Fahrbahn. Um Himmels willen, denkt Wernicke. Aber es ist nicht der Kollege. Es ist der Sack, den die Einbrecher fallen gelassen haben.
Brandt liegt ein paar Meter weiter, auf halbem Wege zur Schellingstraße, aus der er gekommen ist, und rührt sich nicht.
»Brandt!«, schreit Wernicke. Er kniet sich neben ihn. »Mensch, Brandt, was machst du für Sachen?«
Der Kollege antwortet nicht.
»Junge, komm hoch, so – schlimm wird’s schon nicht ...« Wernicke bricht ab. Er bemerkt jetzt, dass er sich in einen Blutfleck gekniet hat.
»Sag doch was!«, bittet er.
Umsonst. Der Schutzmann Brandt ist tot.
5.
Was wollen diese Leute von ihm? »Ich will nach Hause«, sagt Berger. »Ich will einfach nur nach Hause und schlafen.«
Der Polizist schüttelt den Kopf. »Ich fürchte, so einfach geht das nicht. Hier ist ein Einbruch verübt worden, und ein Mord. Sie wurden zur Tatzeit am Tatort angetroffen und haben uns bisher keine glaubhafte Erklärung darüber abgeben können, was Sie da gemacht haben!«
»Gar nichts hab ich gemacht. Ich hab gesoffen und bin auf dem Weg nach Hause.«
»Wo haben Sie gesoffen?«
»In Hamburg. Unten am – am Hafen.«
»Und wo sind Sie zu Hause?«
»Wandsbek. – Aber was geht Sie das an?«
»Und warum irren Sie dann hier mitten in der Nacht durch Eilbeck, anstatt mit dem Zug direkt bis vor die Haustür zu fahren?«
»Fährt doch kein Zug mehr, um diese Zeit!«
»Können Sie sich ausweisen?«
»Ja, wo hab ich denn – ach, im Mantel. Wo ist denn der – ach, da drüben.«
Einer der Polizisten prüft den Inhalt der Taschen, findet nur ein vollgerotztes Taschentuch.
»Innen.«
Der Polizist zieht das Foto von Thérèse aus der Tasche. »Was ist das denn für ‘ne Schlampe?«
»Andere Tasche.«
»Ist das Ihre Freundin?« Der Polizist greift in die andere Tasche. Da steckt tatsächlich ein Dokument; er zieht es heraus. »Oh«, sagt er. »Das ist ein Dienstausweis.«
»Was denn sonst?«, lallt Berger. »Wir bei der Kripo haben alle Dienstausweise!«
6.
Die Kriminalwachtmeister Jastorf und Krohn kommen fast gleichzeitig in Eilbeck an. Wache 38. Berger liegt in der Arrestzelle und pennt.
»Ja, das ist er«, sagt Krohn. »Wie lange ist das jetzt her? Fast sechs Stunden? Gut, dann ist das Meiste wieder abgebaut, dann müssen wir ihn nur noch wach kriegen.«
»Das mache ich«, sagt Jastorf. »Man reiche mir einen Eimer Wasser!«
Zu dritt lassen sie sich berichten, was die Kripo vor Ort unternommen hat.
»Wir haben drei Dinge gemacht. Zum einen haben wir festgestellt, was es mit diesem Einbruch auf sich hat. Wir haben den Sack auf die Wache gebracht. Er enthielt Kleidung. Der Sack war in der Tat so schwer, dass man ihn mit zwei Mann tragen musste. Festgestellt wurde, dass der Inhalt des Sackes bei dem Manufakturwarenhändler Hermann Lehmann, Wandsbeker Chaussee 160, mittels Einbruch gestohlen war. Die Täter sind vom Hausflur aus in den Keller gelangt, haben die Tür zu dem Keller, welcher unter dem Laden liegt, mit zwei Brecheisen aufgebrochen ...«
»Zwei Brecheisen?«, fragt Krohn.
»Ja, das sieht man an den unterschiedlichen Spuren. Die Täter haben vorher es wohl mit einer Brustleier versucht, aber damit haben sie die Tür nicht aufbohren können. Da haben sie die Brecheisen genommen und sind so in den Laden gelangt.«
»Und dieser Lehmann – wo wohnt der?«
»Oben. Im ersten Stock. Aber der hat nichts gehört. Wir haben den Laden zunächst gesperrt und das chemische Staatslaboratorium in Kenntnis gesetzt – wegen der Fingerabdrücke.«
»Und?«
»Leider vergeblich.«
»Das waren Berufsverbrecher«, sagt Jastorf.
»Der Herr Lehmann hat uns ein Verzeichnis der gestohlenen Sachen erstellt.«
»Darf ich mal sehen?« Jastorf nimmt sich die Liste.
»Die abgehakten Teile sind in dem Sack gefunden worden«, erläutert Wernicke.
»Da fehlt also noch ein ganz erheblicher Teil?«
»Ja, mindestens die Hälfte. Sofort nach Bekanntwerden der Tat haben wir die Wohnungen der hier bekannten Verbrecher durchsucht. Nur einen davon haben wir zu Hause angetroffen: Fritz Wehner. Wir haben seine Kleidung kontrolliert ...«
»Wozu das?«, fragt Krohn.
»Die Täter haben das Diebesgut in einem Sack transportiert, in dem vorher Federn gewesen sind. Wir gehen davon aus, dass Spuren von den Federn an dem gestohlenen Zeug zu finden sein müssen.«
»Und? Haben Sie Federn gefunden?
»Nein. – Dann kam noch dieser Schmied infrage. Willi Martens heißt der. Wird wegen verschiedener Einbrüche gesucht. Aber der war nicht zu ermitteln.«
Berger zieht die Stirn kraus. So kann man doch nicht arbeiten! Auch Krohn scheint nicht überzeugt, dass die Herren Martens und Wehner für diese Tat in Betracht kommen.
»Außerdem haben natürlich unsere Leute die Zeugen vernommen. Hier sind die Aufzeichnungen.«
Warum müssen immer die Kollegen mit der größten Sauklaue das Protokoll schreiben? Die Zeilen der Sütterlinschrift fließen ineinander; Oberlängen und Unterlängen überlappen sich. Berger hat große Mühe, den Text zu entziffern.
Der Zeuge Milchhändler Wilhelm Knoor, wohnhaft Maxstr. 13, daselbst befragt:
»Am 19.5.1919 kurz vor 3½ Uhr vormittags hörte ich Laufen bei uns in der Straße. Ich sprang aus dem Bett und öffnete die Tür, um zu sehen, was los war. Ich hörte, wie jemand rief: »Schieß ihn.« Dann hörte ich mehrere Schüsse. Ich lief hinaus und sah nun den Wachtmeister Brandt erschossen Ecke Max- und Ottostraße liegen. Auf Bitten des Wachtmeisters Wernicke bin ich so lange bei der Leiche geblieben, bis die Feuerwehr kam und Brandt abholte. Die Täter habe ich nicht gesehen.«
Die Zeugin Ida Sahlmann, geborene Brügge, wohnhaft Ottostraße 33 ptr daselbst befragt:
»Ich habe in der Nacht vom 18./19.5.1919 drei Schüsse gehört. Wie ich aus dem Fenster sah, lag der uns bekannte Wachtmeister Brandt auf dem Bürgersteig. Von dem Einbrecher habe ich nichts gesehen.«
Wenn sie alle Aussagen von den Leuten aufschreiben wollen, die nichts gesehen haben, dann haben sie viel zu tun, denkt Berger.
Die ermittelte Zeugin, Ehefrau Wilhelmine Graupner geb. Warnke, wohnhaft Ottostraße 29 I, daselbst befragt:
»In der Nacht zwischen 3-3½ Uhr vom 18./19.5.1919 hörte ich zwei Schüsse fallen. Ich stand auf und sah aus dem Fenster. Ich sah nun, wie zwei Personen aus der Fabrik von Gierner Ottostr. 27 kamen und die Ottostraße nach dem Eilbecker Weg zu fortliefen. Der eine war 1,80-83 groß, und der zweite viel kleiner. Ich bin der Meinung, dass einer eine Schirmmütze trug und der andere einen weichen Hut, vermag aber nicht sicher anzugeben, wer von den beiden Hut oder Mütze aufhatte. Näher beschreiben kann ich sie nicht, da es noch zu dunkel war. Sachen hatten sie nicht bei sich.«
»Wunderbar«, sagt Jastorf. »Zwei oder drei Schüsse, zwei Männer, einer größer als der andere, was bei zwei Personen in der Regel der Fall ist, der eine hat einen Hut getragen, der andere eine Mütze, aber vielleicht war es auch umgekehrt. Und dann noch ein sturzbetrunkener Kriminalbeamter, der am Tatort herumtorkelt. – An die Presse werden wir geben: Die Polizei verfolgt bereits verschiedene konkrete Spuren. Nähere Einzelheiten können nicht bekannt gegeben werden, um den Gang der Ermittlungen nicht zu behindern.«
7.
Als sie wieder unter sich sind, sagt Jastorf: »Na, Berger, nun zeig mal, was du gelernt hast! Was haben die Kollegen in Eilbeck falsch gemacht?«
Berger überlegt. Die kalte Dusche hat ihn aufgeweckt; die nassen Haare sind inzwischen wieder getrocknet. Er ist fast wieder einsatzbereit – bis auf die Kopfschmerzen. Es ist klar, dass bei einem Mord, noch dazu einem Polizistenmord, jedem noch so unwahrscheinlichen Hinweis nachgegangen wird. Das ist kein Fehler. Auch, dass die Beschreibungen der Täter praktisch wertlos sind, kann Jastorf nicht meinen. Dafür können die Kollegen nichts.
»Der Sack«, sagt Berger schließlich. »Nur die Hälfte der Beute ist sichergestellt worden. Die Kollegen glauben, dass die Täter zu zweit waren und zweimal gegangen sind. Aber das muss nicht sein.«
»Weiter«, sagt Jastorf.
»Wenn sie zu viert gewesen sind, dann konnten sie zwei dieser Säcke gleichzeitig wegschleppen. Bleibt aber noch das Einbruchswerkzeug. Zwei Brecheisen und eine Handleier. Das wiegt einiges. Die haben sie sicher nicht zu der Wäsche in den Sack geworfen. Und da war ja auch noch der Mann, der auf Wernicke geschossen hat. Ich denke, sie werden mindestens zu fünft gewesen sein.«
»Selbst im Suff kann er noch nachdenken«, sagt Krohn. »Da sieht man, wozu so ein Abitur gut ist!«
»Große Einbrecherkolonnen sind aber selten«, sagt Jastorf. »Hier in Hamburg haben wir zur Zeit von dieser Art Gruppierung eigentlich nur die Bande des Adolf Julius Petersen.«
»Wer ist das denn?«
»Die Barmbecker Verbrechergesellschaft.«
»Wir sind hier aber in Eilbeck«, gibt Berger zu bedenken.
»Ach, das Abitur ist doch nicht mehr, was es mal war«, sagt Jastorf. »Siehst du das Wasser da drüben? Das ist der Eilbeck-Kanal, dahinter fängt Barmbeck an.«
8.
»Das ist er, der Petersen«, sagt Jastorf. Er schiebt Berger die Akte hin. »Da hat sich einiges angesammelt im Laufe der Jahre!«
Berger überfliegt die Zusammenfassung:
Julius Adolf Petersen, geboren am 17. Oktober 1882.
9.6.1896 verurteilt wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls zu 5 Tagen Gefängnis,
22.9.1897 verurteilt wegen einfachen und schweren Diebstahls zu 1 Monat Gefängnis,
18.11.1897 verurteilt wegen eines gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahls zu 1 Monat Gefängnis,
22.4.1898 verurteilt wegen eines gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahls und Raubes zu 6 Monaten Gefängnis,
14.3.1901 verurteilt wegen schweren Diebstahls und wegen Raubes zu 1 Jahr Gefängnis,
25.6.1901 verurteilt wegen schweren Diebstahls und Raubes in zwei Fällen zu 4 Jahren Gefängnis und 4 Jahren Ehrverlust,
24.4.1906 verurteilt wegen versuchter Gefangenenbefreiung zu 3 Tagen Gefängnis,
8.1.1908 verurteilt wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahls zu 3 Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverlust und Polizeiaufsicht,
8.6.1912 verurteilt wegen Hehlerei und Widerstands zu 1 Jahr 7 Monaten Gefängnis und 3 Jahren Ehrverlust sowie Polizeiaufsicht,
23.7.1919 verurteilt wegen Widerstands zu 1 Jahr Gefängnis.
»Im Krieg war er natürlich interniert«, sagt Jastorf. »Ab 1916. Das steht hier nicht drin.«
Berger weiß, dass Gewohnheitsverbrecher vorbeugend in Haft genommen worden sind, um bei der Knappheit der Polizeikräfte die Sicherheit an der »Heimatfront« zu erhöhen. Genützt hat es nicht viel.
»Wenn man sich das so anguckt«, sagt Berger, »hat man eigentlich nicht den Eindruck, dass der Mann besonders erfolgreich gewesen sein kann. Zehnmal geschnappt und verurteilt, und diese Strafen, das sind zusammen – Moment mal – 11 Jahre 2 Monate. Dann kommt noch die Internierung dazu – der Mann hat ja fast ein Drittel seines Lebens im Gefängnis gesessen.«
»Nicht lange genug«, brummt Jastorf.
»Schade, dass kein Foto dabei ist«, sagt Berger.
»Das können wir dir besorgen, aber das hilft auch nicht viel. Er bezeichnet sich als Kaufmann, und so sieht er auch aus, als ob er vielleicht einen Kolonialwarenladen betreiben würde. Völlig unauffällig. Aber wie er aussieht, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir ihn kriegen.«
Krohn sieht Berger an: »Du wunderst dich vielleicht, dass wir so viel über ihn wissen und ihn dennoch nicht festsetzen können? – Das liegt daran, dass diese Burschen so eng zusammenhalten. Ganze Verbrecherfamilien sind das. Nimm zum Beispiel die Petersens. Vier Geschwister. Da ist nicht nur der Adolf Petersen, sondern auch noch sein Bruder Arnold – ebenfalls mehrfach vorbestraft. Der zweite Bruder Karl, der lebt in Amerika. Was er da macht, weiß ich nicht, aber vermutlich auch nichts Gutes. Die Schwester Martha – eine obstinate Person. Und die Eltern – beides Galgenvögel, wenn du mich fragst. Der Vater ist ja inzwischen tot – im Gefängnis gestorben. Die Mutter hat natürlich gleich wieder geheiratet, einen Mohnsen. Den kennen wir noch nicht, aber der wird schon zum Rest der Familie passen.«
»Das vererbt sich«, sagt Jastorf. »Das ist doch ganz offensichtlich: Das Verbrechertum vererbt sich.«
»Ich weiß nicht, ob die Vererbung wirklich so einfach funktioniert.« Berger denkt: Wenn das stimmen würde, dann wäre ich ja genau wie mein Vater!
»Wie dem auch sei. – Die Amerikaner sagen: Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Das lässt sich auch auf Gewohnheitsverbrecher anwenden. Nur ein toter Einbrecher ist ein guter Einbrecher.«
»Das geht mir zu weit.«
»Tot oder lebenslänglich weggesperrt, damit er keinen Schaden mehr anrichten kann. Alles andere ist verlorene Liebesmüh.«
Berger schüttelt den Kopf. Aber er weiß, dass Jastorf nicht der einzige Polizist ist, der in äußerster Härte das einzige Mittel gegen die wachsende Kriminalität sieht.
9.
»Wie geht’s deinem Sohn?«, fragt Schacht.
»Danke der Nachfrage.«
Hjalmar Schacht sieht Friedrich Berger fragend an.
»Du weißt ja, wie es ist«, erläutert Berger. »Er hat bei der Polizei angefangen.«
»Das ist eine ehrliche Arbeit, denke ich.« Schacht spricht es so aus, als ob es eine Spur anrüchig sei.
»Ich hab ja versucht, ihn zum Studium zu bewegen. Das hat er leider abgelehnt. Kein Interesse. Er hätte alles haben können. – Früher, da war er ganz anders. Voller Ehrgeiz und Lebenslust. Aber jetzt – der Krieg, der hat ihn total verändert.«
»Ich habe mich schon immer gefragt: Hast du ihn da nicht raushalten können?«
Berger zuckt mit den Achseln. »Er wollte nicht.«
»Immerhin ist er heil zurückgekehrt. Das können die wenigsten von sich und ihren Kindern behaupten.«
»Ah, da kommt er ja! – Wilhelm, der Herr Schacht isst heute Abend mit uns!«
»Guten Abend, Herr Schacht!« Nicht der erste und nicht der letzte Bankier, den ich auf diese Weise kennenlerne, denkt Wilhelm. Er weiß, dass sein Vater mit dem jetzigen Chef der Nationalbank für Deutschland zusammen die Schule besucht hat. Das Johanneum, genau wie er selbst.
Schacht hat einen kräftigen Händedruck.
»Ihr Vater hat mir von Ihnen erzählt. Sie waren ja auch in Belgien, habe ich gehört?«
»Im Krieg, ja, 1918«, sagt Berger. Dieses Thema möchte er lieber meiden. Aber Schacht will sowieso nichts von ihm wissen; er redet offenbar am liebsten von sich selbst. Sehr von sich eingenommen, dieser Mensch. Er bestreitet die Unterhaltung fast im Alleingang.
»Ich war ja auch in Belgien«, sagt er. »Schon 1914, gleich nach Kriegsausbruch ist man an mich herangetreten und hat mich gebeten, ob ich nicht vielleicht banktechnische Verwaltungsaufgaben in den besetzten belgischen Gebieten übernehmen könne. Sie wissen ja, dass ich aufgrund meiner Augen vom Wehrdienst freigestellt war.«
»Dabei guckt er wie ein Adler!«, lacht Wilhelms Vater.
Schacht sieht ihn etwas pikiert an. »Das würde ich nun nicht sagen!«
Eher wie ein Geier, denkt Wilhelm.
»Wie dem auch sei – nun war natürlich zunächst die Frage meiner Stellung innerhalb dieses Kreises hoher Offiziere in der belgischen Hauptstadt zu klären. Und um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, da habe ich gesagt, dass ich wünsche, im Offizierskasino zu speisen. – Dieses Huhn ist übrigens ausgezeichnet, mein lieber Berger!«
»Danke, ich werde das Kompliment gern weitergeben. – Und? Wie ist das ausgegangen? Hat man dich im Kasino speisen lassen?«
»Nein. Ich habe mich also an den Generalmajor von Lumm gewandt. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst?«
Wilhelm hat den Namen noch nie gehört, und selbst sein Vater schüttelt den Kopf.
»›Unmöglich‹, hat der gemeint, und das könne höchstens der Generalgouverneur genehmigen. Da habe ich gesagt: ›Dann fragen wir ihn eben!‹ Von Lumm hat gelacht und bloß gesagt, das sei völlig undenkbar, ihn in einer solchen Angelegenheit zu belästigen. Daraufhin habe ich mich an den zuständigen Herrn des Auswärtigen Amtes gewandt. Das war damals der Herr von der Lancken, und auch der hat abgelehnt. Da bin ich einfach hingegangen und habe mich beim Generalgouverneur angemeldet. Das war ja damals noch der General von der Goltz ...«
Wilhelm Berger hört nicht mehr hin. Er denkt: Damit haben sich die hohen Herren also beschäftigt, während wir im Schützengraben gehockt haben, bis zu den Knöcheln im Matsch, und gewartet haben, dass der Feind kommt. Tanks sollten sie haben, unzerstörbare Panzerfahrzeuge, die Engländer, und Gas natürlich sowieso. Todesangst haben wir gehabt.
»... und ehe ich überhaupt mein Anliegen vorbringen konnte, da hat der Goltz mich direkt gefragt: ›Sie essen doch heute mit mir im Kasino?‹, und da haben dann die anderen natürlich nicht schlecht gestaunt, als ich nicht nur im Kasino gegessen habe, sondern obendrein noch direkt an der Seite des Generalgouverneurs!«
»Köstlich, mein Lieber! – Du bleibst doch sicher noch auf eine Tasse Kaffee?«
»Nein, Friedrich«, Schacht faltet die Serviette zusammen, »ich fürchte, das Angebot muss ich heute ausschlagen. Ich hatte dir ja schon telegraphiert, dass ich nur kurz vorbeischauen kann; wir haben noch eine Besprechung in wichtigen Bankangelegenheiten.«
»Um diese Zeit?«
»Zu jeder Zeit, wenn es der Sache dient. Ich bin mit den Herren im Schauspielhaus verabredet.«
»Was hat er eigentlich gemacht in Belgien – abgesehen vom Essen?«, fragt Wilhelm, als der Besucher gegangen ist.
»Hat er doch gesagt. Hast du nicht zugehört?«
»Ich war nicht besonders aufmerksam, fürchte ich«, sagt Wilhelm. »Es war ein anstrengender Tag.«
»Hjalmar Schacht hatte dafür zu sorgen, dass die Belgier die Besatzungskosten in bar bezahlen.«
»Wie?«, sagt Berger. »Wir haben das Land überfallen, und dieser Schacht hat dann die Belgier obendrein noch dafür bezahlen lassen?«
Sein Vater schüttelt den Kopf. »Deine Ausdrucksweise ist unangemessen, Wilhelm. Wir haben alle nur das getan, was getan werden musste.«
10.
Beerdigung auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ein riesiges Areal, bemessen für die Toten einer Millionenstadt. Einige davon in prunkvollen Mausoleen, andere nicht. Der Wachtmeister Brandt bekommt ein schlichtes Grab. Auch die Trauergemeinde ist klein; die meisten sind Polizisten. Der Pastor hält eine kurze Ansprache. Es regnet in Strömen. Berger friert.
Es ist eine Art Unglück gewesen, hat Krohn gesagt, muss ein Unglück gewesen sein. Die Einbrecher sind zwar fast alle bewaffnet, aber gewöhnlich schießen sie nicht. Schon gar nicht auf die Polizei. Es geht nur um die Abschreckung. Aber wo Waffen im Spiel sind und der Einsatz so hoch ist, da kann leicht etwas passieren. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung, und schon fällt ein Schuss. Wer eine Waffe führt, muss bereit sein, sie zu ziehen; wer eine Waffe zieht, muss bereit sein, sie abzufeuern. Das gilt für Einbrecher wie für Polizisten.
Berger sieht in die Gesichter der Kollegen. Jetzt, wo die Aktivität vorbei ist, wo man nichts mehr tun kann, um die Täter direkt zu fassen, sieht er Leere, Hilflosigkeit und Wut. Brandt ist schon der dritte Polizist, der in diesem Jahr ermordet worden ist, wenn man den Hilfspolizisten aus Harburg mitzählt. Eines Tages könnte es dich selber treffen, Berger! Er wischt den Gedanken zur Seite.
Sie defilieren am Grab vorbei, werfen Erde auf den Sarg, kondolieren den Hinterbliebenen. Die Eltern sehen erschrocken aus, so als ob sie es noch immer nicht wahrhaben wollen. Eine junge Frau weint.
»Wir kriegen ihn!«, verspricht Jastorf ihr.
Sie nickt.
Berger bezweifelt, dass es sie tröstet.
11.
»So sieht’s aus, Krohn, so sieht’s aus!« Jastorf ist deprimiert.
»Jetzt setz dich erst mal hin«, sagt Krohn. Sie sind nach dem Dienst zu ihm in die Wohnung gezogen, nicht zum ersten Mal, und es ist auch nicht das erste Mal, dass der Kollege eine Aufmunterung braucht.
»Es heißt doch, es gibt so viele Arbeitslose und so wenige offene Stellen; nun haben wir einen Posten zu besetzen, und wen schickt man uns: diesen Herrn Berger. Bürgersöhnchen, Abiturient!«
»Reg dich ab.« Krohn öffnet das Fenster. Ein Schwall kalter Luft dringt in das Wohnzimmer. Krohn langt in den Blumenkasten, da lagert er den Alkohol.
Jastorf nimmt einen Stapel Zeitungen vom Stuhl, weiß nicht recht, wohin damit.
»Einfach fallen lassen!«, sagt Krohn.
Jastorf lässt sie fallen. Es setzt sich auf den Stuhl, immer noch angespannt. Krohn sitzt ihm gegenüber, völlig locker, der Stuhl ächzt unter seinem Gewicht. »Hier, trink dies!«, sagt er. Er gießt Jastorf einen Schnaps ein.
»Puh!«, sagt Jastorf. »Ist das wieder irgend so ein königlich-hannoversches Zeug?«
»Nicht reden, trinken!«
Jastorf schließt die Augen, kippt den Schnaps mit einem Zug hinunter. »Oh Mann!«, sagt er.
»Das ist der Hundertjährige«, sagt Krohn. »Seit 1816 machen sie den in Hittfeld. Da war mein König noch gar nicht geboren. Das kam erst später. Du weißt ja wahrscheinlich, dass er als legitimer Nachfolger Georgs III in der englischen Thronfolge an zweiter Stelle stand ...«
»Wenigstens dieses Unglück ist den Briten erspart geblieben!«
»Ich sehe, dir geht es schon wieder zu gut!«, sagt Krohn. Er schraubt die Flasche zu. »Was nun den Berger angeht, so muss ich dir recht geben: Er ist ziemlich jung.«
»Nicht nur das«, sagt Jastorf.
»Der Rest sind Vorurteile. Ja, es ist richtig, er ist ein verzogenes Bürgersöhnchen, aber was hast du erwartet? Du als Maurerkind und ich als Sohn eines Landarbeiters – wir sind die krassen Ausnahmen. Das war doch schon immer so: Die Zweitgeborenen der reichen Familien – ganz gleich, ob das nun Adel oder Bürgertum ist – die hatten nichts zu erben; die sind dann Offiziere geworden. Oder Beamte, zum Beispiel bei der Kripo.«
»Er ist das einzige Kind, soweit ich weiß.«
»Spielt das eine Rolle? Er ist intelligent, aufgeschlossen, gutwillig. Pfeffersack, aber kein Angeber. Abiturient, aber kein Besserwisser. Was willst du mehr?«
»Ach, ich weiß auch nicht.« Jastorfs Blick ruht auf der Schnapsflasche.
Krohn tut so, als ob er das nicht bemerkt. »Ich will dir sagen, was dich in Wirklichkeit wurmt: Er ist besser ausgebildet als wir. Heute sagen wir ihm, wo es langgeht, aber morgen ist er unser Chef. Das ist so, das bleibt so, da kannst du nichts dran drehen. Ich weiß ja, wie ehrgeizig du bist, und sie haben dir ja alles Mögliche versprochen, aber ich sage dir: Du wirst trotzdem kein Kommissar. Oben bleibt oben und unten bleibt unten. Das war beim Kaiser so, und das ist in der Republik nicht anders. Sieh mich an! Wenn du das akzeptierst, wie die Dinge liegen, dann kannst du ein feines Leben führen. Wenn nicht, machst du dich nur kaputt.«
»Es geht doch sowieso alles kaputt«, sagt Jastorf. »Hast du das gehört? In der Kleinen Reichenstraße sollen sie heute eine Sülzefabrik demoliert haben.«
»Ich mag keine Sülze«, sagt Krohn.
12.
Am nächsten Morgen ist der Aufruhr noch immer nicht vorbei.
»Was sollen wir tun?«, fragt Berger.
Den Lärm vom Rathausmarkt hört man bis zum Stadthaus.
»Nichts«, sagt Krohn. »Wir haben keine Anweisungen.«
»Aber – das können wir doch nicht einfach hinnehmen!«
»Doch. Das Stadthaus wird verteidigt, denke ich jedenfalls, aber mehr ist nicht drin. Was willst du denn machen mit ein paar Pistolen gegen den gesamten Pöbel der Stadt? Das sind über tausend Leute da draußen. Und wir sind im Gegensatz zur Schutzpolizei noch nicht mal als Ordnungsmacht zu erkennen. Wenn wir uns denen in den Weg stellen, da werden wir einfach weggefegt. Bei diesen Massen – da hilft nur noch Reichswehr.«
»Wolter sagt, Reichswehr sei unterwegs«, weiß Jastorf.
»Was für ein Wahnsinn!«
Angefangen hat es gestern mit dem Gerücht, in der Sülze vom Heil werde Hundefleisch verarbeitet. Die aufgebrachte Menge hat die Fabrik gestürmt, die Einrichtung verwüstet. Den Besitzer hatten sie aus seiner Wohnung geholt, im Triumphzug zum Rathausmarkt geschafft und in die Kleine Alster geschmissen, um ihn zu ertränken. Volkswehr und Polizisten hatten den alten Mann mit Mühe herausziehen können und waren mit ihm ins Rathaus geflüchtet.
»Ich war vorhin draußen«, sagt Jastorf. »Hab mir das angesehen. Die Kommunisten sind das, die wiegeln das Volk auf. Es heißt, zwei andere Sülzefabriken in der Lindenallee und an der Reismühle sind ebenfalls gestürmt worden. Angeblich sind die Angestellten gefangen genommen worden und sollen der Justiz des Volkes übergeben werden. Sie sind unterwegs zum Rathausmarkt.«
Berger sieht vom einen zum anderen. Schließlich nimmt er seine Pistole, schiebt das Magazin ein, lädt die Waffe durch.
»Was hast du vor? Mach keinen Fehler!«, beschwört ihn Krohn.
Berger ist klar, dass die Kollegen auch Angst haben. »Ich geh raus«, sagt er.
Krohn hält ihn zurück. »Wenn du in einer solchen Situation die Waffe ziehst, bist du ein toter Mann, Wilhelm!«
»Ja. – Lass mich los, Krohn!«
Das Gejohle ist lauter geworden. Berger will zum Rathaus, doch als er auf die Straße tritt, merkt er, dass das Geschehen sich in seine Richtung verlagert. Im Neuen Wall strömt ihm eine Menschenmenge entgegen. In der Mitte ein Pferdekarren mit einer Gruppe von Frauen. Man hat ihnen Schilder um den Hals gehängt: Wir machen die Sülze.
»In die Alster mit ihnen!«, ruft jemand aus der Menge. »Ratten geben sie uns zu fressen, jetzt werden sie wie die Ratten ersäuft!«
Berger sieht sich um, wägt das Risiko ab. Es sind keine tausend Leute, ein paar hundert höchstens, aber zu viele, als dass er allein etwas ausrichten könnte.
»Tod den Ausbeutern!«, ruft einer, offenbar der Rädelsführer.
Es ist absurd. Selbst dem größten Idioten sollte klar sein, dass diese zu Tode verängstigten Frauen keine Ausbeuter sind, sondern schlecht bezahlte Arbeiterinnen.
»Werft sie in das Alsterfleet!«
Den Rädelsführer würde er jedenfalls wiedererkennen.
In dem Augenblick, als der Zug auf Bergers Höhe ist, wagen zwei junge Frauen die Flucht.
Ein Aufschrei geht durch die Menge. »Lasst sie nicht durch!«
Aber sie sind schon durch. Berger springt hinzu, reißt eine Haustür auf, die Frauen rennen hinein. Die Menge drängt nach, aber in der Enge des Hausflurs ist der Einzelne im Vorteil. Berger und noch zwei andere, ihm völlig unbekannte Männer versperren dem nachdrängenden Volk den Weg.
»Platz da!«, verlangt ein junger Kerl. Er baut sich drohend vor Berger auf.
»Nein.«
Einen Augenblick herrscht Stille. Sie starren sich an. Der Mann hat eine Narbe im Gesicht. Er ist größer als Berger. Kein Zweifel, er ist auch stärker. Die Frauen sind nicht mehr zu sehen, haben sich irgendwo versteckt.
»He, was steht ihr hier rum?«, ruft jemand vom Eingang. »Jetzt schmeißen sie sie ins Wasser! Komm mit, Hannack, das musst du gesehen haben!«
Der Flur leert sich. Schließlich zieht auch der Große ab. Berger ist mit seinen beiden Helfern allein.
»Danke«, sagt er. »Mehr konnten wir nicht tun.«
Die beiden nicken.
13.
»Na, Adolf, wie war’s draußen in der Stadt?«, fragt Helmi Petersen.
»Ruhig. Reichswehr ist eingerückt, der Aufruhr ist zu Ende.« Zu seinem Sohn sagt er: »Hatzel, ich hab dir etwas mitgebracht!«
»Was ist das?«
»Das ist ein Würfelspiel.«
Der kleine Adolf Petersen, den die Eltern Hatzel nennen, ist fünf Jahre alt. Allzu viele Spiele hat er nicht. Auch dies ist nicht gekauft, sondern ein Reklamespiel der Hamburger Sparcasse von 1827. Es heißt Spar Dir was, dann hast Du was! Petersen hat es bekommen, als er seinen Anteil aus dem letzten Einbruch eingezahlt hat.
Hatzel würfelt eine Zwei.
»Oh, eine Zwei«, sagt Petersen. »Da kannst du gleich vorrücken bis zur Zwölf.«
»Was steht da auf dem Pfeil?«, fragt Hatzel.
»Da steht: Zur Sparkasse.«
»Mama, willst du nicht auch mitspielen?«, fragt Hatzel.
Helmi ist in der Küche. »Ich mache gerade das Abendbrot«, sagt sie. »Spielt ihr mal!«
Petersen selbst hat eine Sechs gewürfelt, aber die nützt ihm nichts. Auf dem Feld mit der Sechs ist ein Junge eingezeichnet, der seine Taschen umkrempelt: leer. 1x aussetzen steht da. Das ignoriert Petersen. Er behauptet: »Wer eine Sechs hat, darf noch einmal würfeln!«
Die Drei bringt ihn auf das Feld mit dem Spielwarenladen. Ach du Schreck, das ist bestimmt nicht gut. Aber der Junge ist clever, er kauft sich einen Roller und ist damit schneller in der Schule. Vorrücken auf die Siebzehn!
Das Spiel zieht sich in die Länge. Schon ist Hatzel wieder vorn. Er ist auf dem Feld mit der Sparkasse gelandet, kriegt fünfzig Mark ausgezahlt und fährt nun mit der Eisenbahn zum Feld Sechsundzwanzig.
»Das Fleisch ist wieder teurer geworden!«, ruft Helmi aus der Küche.
Macht nichts, denkt Petersen. Mit unserem kleinen Zuverdienst kommen wir schon über die Runden.
»Und ein neues Kleid bauche ich auch.«
»Schon wieder?« Sie gibt einfach zu viel Geld aus, denkt er.
»Ich kann doch nicht noch mal dasselbe anziehen wie im letzten Jahr!«
Hatzel hat inzwischen eine neue Wohnungseinrichtung gekauft. Für 1560 Mark. Wie ist das möglich? Das kluge Mädchen auf dem Spielbrett erläutert es mit erhobenem Zeigefinger der dummen Freundin: Spare!
»Spare!«, ruft Petersen in die Küche.
Helmi tut so, als habe sie das nicht gehört. Kann sie sich nicht selbst was schneidern wie andere Frauen auch? Aber dazu ist sie sich ja zu fein!
Hatzel liegt weit vorn. Petersen hat schon wieder Pech. Diesmal ist er auf dem Feld mit den Pokerspielern gelandet. Zurück auf 9 steht da. »Einmal aussetzen«, sagt Petersen. Gut, dass der Kleine noch nicht lesen kann.
»Was ist das da für eine Zahl?«, fragt Hatzel. Er weist auf die Neun.
»Das ist gar keine Zahl«, behauptet Petersen. »Das ist ein Fragezeichen.«
Gut, denkt er, dass im wirklichen Leben das Glücksspiel eine Menge einbringt. Solange man nicht selbst spielt, natürlich. Solange man die Spielbank leitet. Alles legal, ein privater Klub, wie er zu sagen pflegt, völlig ohne Steuern.
Doch hier auf dem Sparkassenspiel bringt alle Mogelei nichts. Schon ist Hatzel auf der Fünfundfünfzig angelangt, und von dort geht es per Flugzeug zur Sechzig, zum Ziel. Dort ist der Großvater eingezeichnet, wie er im Lehnstuhl sitzt, und jemand reicht ihm einen großen Sack voll Geld. Rente steht da drauf. Das war Hatzels Großvater nicht vergönnt. Der hat sich aufgehängt im Gefängnis, aber das weiß Hatzel nicht. Petersen vergleicht die Größe des Sacks mit den anderen Geldsäcken auf dem Spiel. Er ist mittelgroß. Schätzungsweise siebenhundert Piepen. Nicht schlecht, solch eine Rente. Sparen, sparen, sparen! Da wird er noch einige Tresore knacken müssen, bis er da hinkommt.
14.
Ich möchte erwachen beim Sonnenschein
Und es müsst alles wie früher sein:
Kein Krieg, kein Elend, kein Mühn und Plagen
Die Meinen müssten verwundert sagen:
Hast lang geschlafen,
Hast viel versäumt,
Du sprachst vom Kriege –
Du hast geträumt.
»Was hörst du für traurige Lieder?«
Wilhelm Berger hat nicht gemerkt, wie sein Vater hereingekommen ist. Er nimmt behutsam den Tonarm ab; die Grammophonplatte von Otto Reutter dreht sich stumm weiter.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. – Nachher kommt Hjalmar zu Besuch. Hast du Lust, mit dabei zu sein?«
Wilhelm schüttelt den Kopf. »Danke für die Einladung«, sagt er. »Aber ihr werdet ja doch nur über eure Geschäfte reden. Da störe ich nur.«
»Wie du willst.«
»Ich bin hundemüde.«
»Ich lasse dir etwas Essen auf dein Zimmer bringen.«
»Danke.«
Es ist grotesk, denkt Wilhelm. All das Elend, das ich Tag für Tag bei der Arbeit sehe, und dann dies. Ich bin wahrscheinlich der einzige Polizist in Hamburg, dem das Abendessen auf sein Zimmer gebracht wird. Bei uns ist in der Tat die Zeit stehen geblieben.
15.
»Dein Sohn ist nicht zu Hause?«, fragt Hjalmar Schacht.
Friedrich Berger schüttelt den Kopf. »Schon zu Bett gegangen. – Diese Polizisten haben sehr unregelmäßige Arbeitszeiten.«
»Das ist schlecht für die Gesundheit.«
»Ich weiß. Er sollte sich einen anderen Job suchen – und heiraten!«
»Es muss ja nicht jeder so früh heiraten wie du! – Aber wie alt ist er jetzt? Dreiundzwanzig? Und noch immer keine feste Beziehung?«
»Überhaupt keine Beziehung, soweit ich weiß.«
»Er ist doch nicht etwa ...«
»Schwul meinst du?« Friedrich Berger schüttelt den Kopf. »Er hat Briefe bekommen aus Belgien, von einer Thérèse irgendwas. Ich hab sie ins Feuer geworfen. Was soll er mit einem Soldatenliebchen?«
»Sehr vernünftig«, sagt Schacht. »Aber vielleicht solltest du mal selbst etwas arrangieren? Deine Geburtstagsfeier zum Beispiel, das würde sich doch anbieten. Wie alt wirst du? Lass mich nachdenken – fünfundvierzig, stimmt‘s? Wenn du nun ein paar Leute einlädst, die Töchter im heiratsfähigen Alter haben?«
»Ich kenne nur wenige Leute, die in diese Kategorie fallen.«
»Denk drüber nach! – Und wie gehts mit der Firma, was macht das Geschäft?«
»Mäßig«, sagt Berger. »Die Handelsbeschränkungen machen alle Bemühungen zunichte. Deutschland liegt am Boden. Wir müssen wieder ganz von vorn anfangen. Bei Null.«
»Bei Null?« Der Bankier lacht. »Mein lieber Berger, du bist gut! Das geht nicht. Wir können nicht bei Null anfangen.«
»Die Staatsverschuldung, ich weiß. – Noch ein Glas Wein?«
»Ja gern, danke. – Im Augenblick belaufen sich die Verbindlichkeiten Deutschlands auf knappe 90 Milliarden Mark. Die Finanzierung des Krieges durch Anleihen war ein Fehler.«
»Das überrascht mich jetzt. Hast du nicht selbst seinerzeit gedrängt, ich sollte die Kriegsanleihen zeichnen? Ich habe auf dein Anraten immerhin einige tausend Mark in diese Papiere investiert.«
»Das war damals auch richtig. Aus deiner Sicht jedenfalls. Für den Staat war es falsch.«
»Wie hätte der Krieg denn sonst finanziert werden sollen?«
»Durch Steuererhöhungen. So haben es die anderen gemacht. Das wäre zwar unpopulär gewesen, aber es hätte gleichzeitig die überschüssige Kaufkraft abgeschöpft. Es ist ein ziemlich ungesunder Zustand, wenn die Kaufkraft das Warenangebot übersteigt. – Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen!« Der Bankier zieht an seiner Zigarre. »Gutes Fabrikat! Wo hast du die denn bekommen?«
»Beziehungen. Man kennt halt ein paar Leute, wenn man im Im- und Export tätig ist.«
»Ja, das hat seine Vorteile.«
»Der Frieden hat überhaupt seine Vorteile.«
»Das soll sich noch zeigen.«
»Was meinst du damit?«
»Die neue Regierung hat es versäumt, finanzpolitisch einen harten Schnitt zu machen ...«
»Abwertung der Mark?«
»Eine völlig neue Währung. Hundert zu eins oder so ähnlich ...«
»Das hätte einen Aufruhr gegeben!«
»Und wenn! – Mein Lieber, das Problem ist doch jetzt nur vertagt. Die Preise steigen immer schneller, und die Regierung druckt mehr Geld, um die Nachteile für die Gehaltsempfänger auszugleichen. Das ist krank. Der Haushaltsplan für 1919 hat ein Gesamtvolumen von knapp 18 Milliarden Mark. Weißt du, wie hoch der Anteil des Schuldendienstes ist? Zahlung deiner vier Prozent auf die Kriegsanleihen inklusive?«
»Ein Drittel?«, mutmaßt Berger.
Der Bankier lacht. »10 Milliarden!«
»Da bleibt ja kaum noch ein Handlungsspielraum ...«
»Da bleibt gar kein Handlungsspielraum!«
»Und – worauf läuft das hinaus?«
»Ist das nicht offensichtlich? Die dänische Lösung.«
»1813 meinst du? Staatsbankrott?«
»Ja. – Wenn wir den Mut nicht aufbringen, ist das das Ende dieser Republik.«
Berger schüttelt den Kopf.
»Das Ende dieser Republik!«, beharrt der Bankier. »Verlass dich drauf! Wie lange hat die Räteregierung in Sachsen sich halten können? Ein paar Monate. Und jetzt hier unsere Sozialdemokraten? Auch nicht länger, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist auch gut so, weil sie von der Wirtschaft einfach keine Ahnung haben. Ganz im Vertrauen, es gibt bereits Gespräche zwischen verantwortungsbewussten Führungspersönlichkeiten aus Kreisen der Wirtschaft und der Reichswehr, die darauf abzielen, diesem traurigen Schauspiel ein Ende zu bereiten.«
Noch einmal schüttelt Berger den Kopf. »Das kann ich nicht glauben!«
»Glaub, was du willst.«
»Wer ist denn da drin verwickelt?«
»Die Namen habe ich jetzt nicht parat«, lügt Schacht.
»Lettow-Vorbeck wahrscheinlich«, mutmaßt Berger. »Und dieser Wangenheim hier in Hamburg auch? Ja, der vermutlich auch.«
Es wird geschossen!
15. März 1920
Wilhelm Berger sitzt in Heimfeld in der Wohnung der Eltern von Fritz Wehner. Wehner ist der einzige Verdächtige, der ihnen noch geblieben ist, reichlich Vorstrafen hat er, und er gilt als Mitglied der Barmbecker Verbrechergesellschaft, aber sie können ihm die Beteiligung an dem Einbruch in das Wäschegeschäft Lehmann nicht nachweisen. Die Befragung der Eltern ist eine reine Formsache. Dennoch hat es Monate gedauert, bis die Einwilligung aus dem preußischen Harburg im Stadthaus eingetroffen ist.
»Dieser Polizistenmord? Ja, wir haben davon in der Zeitung gelesen«, sagt Frau Wehner vorsichtig. Fünfzig Jahre mag sie alt sein, und es ist klar, dass Berger nicht der erste Polizist ist, mit dem sie zu tun hat. Einen Kaffee bekommt er hier nicht angeboten.
»Aber ob Ihr Sohn etwas damit zu tun haben könnte, das wissen Sie nicht zufällig.«
»Mein Fritz?« Sie schüttelt den Kopf.
»Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen?«
»Das ist schon eine Weile her. So um Weihnachten muss das gewesen sein.«
Berger nickt. Er denkt: Hier gibt es für uns nichts zu holen. »Und Ihr Mann – der ist bei der Arbeit?«
»Der Otto, ja der ist vorsichtshalber hingegangen. Ist ja Streik, angeblich, aber ob die Jute nun mitmacht oder nicht, das hat er nicht gewusst.«
Ja, der Generalstreik, der hat auch Bergers Anreise erschwert. Die Reichsbahn fährt nicht; da hat er die Straßenbahn nehmen müssen. An der Süderelbbrücke mussten alle aussteigen und sich kontrollieren lassen, Berger hat den normalen Ausweis vorgezeigt; die Einwohnerwehr hat ihn durchgewinkt.
»Und Sie verdienen sich durch Schneiderei ein paar Mark dazu?«
»Ja, Änderungen sind das vor allem. Die Leute haben ja kein Geld mehr, sich was Neues zu kaufen.«
Berger nickt. Er denkt: Änderungen können natürlich auch bei gestohlener Ware recht nützlich sein. Er nimmt eine Tischdecke zur Hand: »Es gibt tatsächlich Leute, die das Monogramm ändern lassen?«
»Ja, wenn die Decke verschenkt werden soll ...«
Auf der Kommode stehen drei gerahmte Fotografien von jungen Männern in Uniform.
»Das sind unsere Ältesten«, sagt die Frau. »Jetzt haben wir nur noch den Fritz.«
Und den verdächtige ich, ein Einbrecher zu sein. Wenn nicht Schlimmeres.
»Das hier, das ist er mit seiner Minna und der kleinen Erna.« Frau Wehner nimmt das Foto von der Wand.
Wachsam sieht er aus, der Fritz Wehner. Seine Frau eher gutmütig. Wehner hat den Arm um die Schulter seiner Tochter gelegt. Wie alt mag sie sein, diese Erna? Sechzehn? Ganz offensichtlich eine glückliche Familie. Berger verabschiedet sich und macht sich auf den Rückweg. Das Wetter ist trübe wie seine Stimmung. Drei Brüder tot, nur einer noch am Leben. Furchtbar. Aus anderen Familien ist keiner der Söhne zurückgekommen. Aber – ein Gutes hat er jedenfalls gehabt, der Weltkrieg, denkt Berger. Die Völker haben daraus gelernt. Krieg wird es so schnell nicht wieder geben.
2.
»Die Straße frei! – Es wird geschossen!«
Die Menschenmenge vor ihm gerät in Bewegung, zögerlich erst, dann in blinder Panik, als ein Maschinengewehr losfetzt. Berger rettet sich in einen Hauseingang. Mein Gott, denkt er, wo bin ich hier hineingeraten? Schreiende Menschen hasten vorbei. Das MG schießt wieder, diesmal nicht mehr über die Köpfe, diesmal gezielt. Wer sich jetzt nicht in Sicherheit gebracht hat, wird getroffen. Direkt vor Berger, mitten auf der Straße, bricht ein junger Mann zusammen, rührt sich nicht.
Ich muss ihn holen, denkt Berger. Er zögert. Muss ich wirklich? Das MG schweigt. Weiter entfernt brüllt ein Verwundeter. Sie werden nicht schießen, denkt Berger. Ich bin unbewaffnet, ich bin keine Gefahr. Er tritt auf die Straße.
»In Deckung!« Erst jetzt bemerkt Berger, dass auch auf der anderen Straßenseite Leute im Hauseingang stehen. Zwei Männer in Zivil, genau wie er. Einer hat ein Gewehr.
Berger geht weiter. Langsam, aufrecht, den Blick nur auf den Mann gerichtet, der da hilflos am Boden liegt. »Ich hole dich!«, sagt er, mehr zu sich selbst als zu dem Mann. Da fällt ein Schuss. Berger greift sich an den Arm, rennt zurück in den Hauseingang. Eine Schramme, denkt er, das ist nur eine Schramme. Aber es tut höllisch weh. Und wofür? Für nichts. Soviel hat er jedenfalls gesehen: Der Junge, der da draußen in seinem Blut liegt, der ist tot.
Der Mann drüben im Hauseingang gibt einen Schuss ab in Richtung des großen klassizistischen Gebäudes, das Berger vorhin nur unbewusst registriert hat. Auch woanders fallen Schüsse. Berger wird bewusst, dass er nirgendwo hin kann. Er sitzt in der Falle.
»Rein hier!« Hinter Berger hat sich die Haustür geöffnet.
Der Mann, der ihn in die Küche führt, mag vielleicht vierzig Jahre alt sein. Ein großer, kräftiger Kerl mit einem Vollbart.
»Lamprecht«, stellt er sich vor. »Ich bin der Lehrer.«
»Lehrer?«, fragt Berger. Er registriert, dass der Mann nur ein Bein hat.
»Ja, drüben in der Mädchenschule. Heute fällt der Unterricht aus.«
»Was ist denn los hier?«, fragt Berger.
»Gleich.«
»Gibt es hier irgendwo ein Telefon? Ich muss dringend telefonieren!«
»Gleich. Jetzt wollen wir uns erst einmal ihren Arm angucken.«
»Das ist nur eine Schramme!«, wehrt Berger ab.
»Das habe ich auch gedacht damals«, erwidert der Lehrer. Er weist auf sein Bein. »Aber dann war es doch ein kleines bisschen mehr. – Hertha, hol mal bitte das Verbandszeug!«
Die kleine Frau hat Berger erst jetzt bemerkt. Das ist der Schock, denkt er. Mein Gott, ich stehe tatsächlich unter Schock. Er lässt es mit sich geschehen, dass der Lehrer ihm das Jackett auszieht. Berger betrachtet den blutigen Ärmel. Das Loch – ob man das wohl stopfen kann?
»Und jetzt das Hemd!«
Berger beißt die Zähne zusammen.