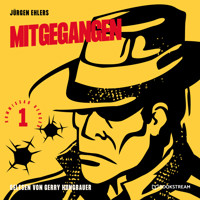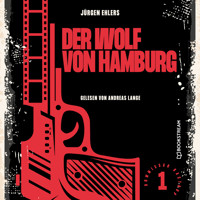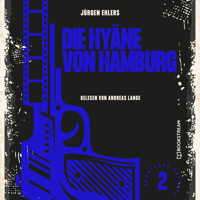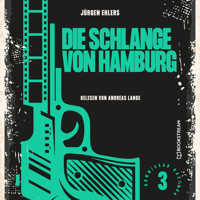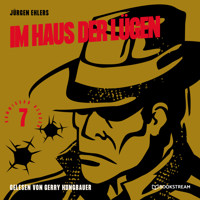Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Liebe und Verrat in den besetzten Niederlanden
- Sprache: Deutsch
In einer Sommernacht des Jahres 1941 beobachtet die 18-jährige Sofieke, wie ein Fallschirmagent in den besetzten Niederlanden landet. Der Student Gerhard soll für die Engländer spionieren. Er wird jedoch sofort festgenommen. Gerhard entgeht der Hinrichtung nur, indem er sich zum Schein bereiterklärt, als Doppelagent für die deutsche Spionageabwehr zu arbeiten. Arthur Seyß-Inquart, der mächtigste Nazi in den Niederlanden, ist Gerhards Nennonkel. Seine fröhlich-naive Tochter Dorli zeigt ihm den Palast, in dem sie jetzt wohnt. In dem hauseigenen Kino führt sie ihm die Wochenschau-Aufnahmen von der wunderbar versöhnlichen Rede vor, die ihr Vater bei der Amtseinführung vor einem Jahr gehalten hat. Sie ist stolz auf ihren Vater. Weder Gerhard noch sie ahnen, dass der Reichskommissar auch eine ganz andere, dunkle Seite hat. Durch Zufall treffen Gerhard und Sofieke wieder aufeinander. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Aber die beiden sind in größter Gefahr. Ihre Gegenspieler in der SS schrecken vor nichts zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PERSONEN
INSTITUTIONEN
JULI 1941
Sonntag, 6. Juli 1941
Montag, 7. Juli 1941
Dienstag, 8. Juli 1941
Mittwoch, 16 . Juli 1941
AUGUST 1941
Sonntag, 10. August 1941
15. August 1941
Dienstag, 26. August 1941
Mittwoch, 27. August 1941
Donnerstag, 28. August 1941
Freitag, 29. August 1941
SEPTEMBER 1941
Freitag, 5. September 1941
NOVEMBER 1941
Donnerstag, 6. November 1941
Freitag, 7. November 1941
Sonnabend, 8. November 1941
JANUAR 1942
Sonnabend, 3. Januar 1942
Dienstag, 20. Januar 1942
FEBRUAR 1942
Dienstag, 25. Februar 1942
Donnerstag, 27. Februar 1942
Freitag, 28. Februar 1942
MÄRZ 1942
Donnerstag, 5. März 1942
Freitag, 6. März 1942
Sonnabend, 7. März 1942
Sonntag, 8. März 1942
Montag, 9. März 1942
Freitag, 27. März 1942
Sonnabend, 28. März 1942
Sonntag, 29. März 1942
APRIL 1942
Donnerstag, 2. April 1942
Mittwoch, 15. April 1942
Freitag, 17. April 1942
MAI 1942
Montag, 18. Mai 1942
Freitag, 22. Mai 1942
JUNI 1942
Freitag, 12. Juni 1942
Mittwoch, 20. Juni 1942
Freitag, 26. Juni 1942
JULI 1942
Dienstag, 7. Juli 1942
Dienstag, 14. Juli 1942
Mittwoch, 15. Juli 1942
Donnerstag, 16. Juli 1942
AUGUST 1942
Donnerstag, 27. August 1942
NOVEMBER 1942
Dienstag, 3. November 1942
Montag, 16. November 1942
Dienstag, 17. November 1942
Mittwoch, 18. November 1942
Donnerstag, 19. November 1942
Sonntag, 22. November 1942
Montag, 23. November 1942
Dienstag, 24. November 1942
Mittwoch, 25. November 1942
Donnerstag, 26. November 1942
Freitag, 27. November 1942
QUELLEN
PERSONEN
Gerhard Prange (21), Student
Eltern und ältere Schwester Ilse in Hamburg
Sofieke Plet (17), untergetauchte Jüdin
Jaap (21), ihr älterer Bruder
Witwe ter Laak (68), ihre Vermieterin
Sara (5), ein jüdisches Mädchen
DIE FALLSCHIRMAGENTEN
Aart Alblas * (23), Deckname »Klaas«, Seeoffizier
Huub Lauwers * (26), Journalist
Thijs Taconis * (27), Student
Arnold Baatsen * (Abor), (23), Photograph
George Jambroes * (37), Lehrer
Arthur Seyß-Inquart * (49)
Reichskommissar für die besetzten Niederlande
Gertrud * (49), seine Frau
Dorli * (13), ihre Tochter
DIE SS
Heinrich Himmler * (41)
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei
Reinhard Heydrich * (37)
Leiter des Reichssicherheitshauptamts (RSHA)
Hanns Albin Rauter * (46)
Generalkommissar für das Sicherheitswesen
Gruppenführer Dr. Wilhelm Harster * (37)
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
Sturmbannführer Erich Deppner * (31)
Chef der Abteilung Gegnerbekämpfung
Untersturmführer Joseph Schreieder * (37)
Chef der Abteilung Gegnerbekämpfung
Else Geigerseder * (27), seine Sekretärin
Anton van der Waals * (39)
sein holländischer Spitzel
Kriminalsekretär Anton Bayer *
einer seiner Mitarbeiter
Marten Slagter * (37) und Leo Poos * (40)
holländische Polizisten
Heinrichs * (39)
Funkpeiler bei der Ordnungspolizei
Obersturmführer Alfred Gemmeker * (34)
Leiter des Durchgangslagers Westerbork
DIE WEHRMACHT
Major Hermann Giskes * (45)
Leiter der Gruppe III F der Abwehr
Matthijs Adolf Ridderhof * (46), sein holländischer Spitzel
Richard Christmann * (36), Ex-Fremdenlegionär
MITGLIEDER DES WIDERSTANDS
Kapitän Rudolf Hueting * (49) und seine Frau Janna * (48)
ihre Tochter Marie „Pum“ * (22)
Wout Teller * (32) und seine Frau Lies
J. Nakken * und seine Frau
Christiaan Frederik Van den Berg * (40),
Hauptmann der Reserve, Mitglied im Ordedienst
Jan Idema * (33), Notaranwärter
Frau Hoogervorst *
ihre Töchter Margrietha „Gré“ * (24) und Cocky * (17)
Jacques Batenburg * (23)
Verlobter von Gré
Salomon „Sieg“ Vaz Dias * (37)
Journalist
Johanna „Jopie“ Waldorp * (27),
Kurierin für Vaz Dias
Jan Bottema * (Kapitän Brandy), (38)
Fischerin Zoutkamp
Dr. Gerrit Kastein * (31),
Neurologe
Miep Blaauw * (19),
Studentin
Henriette Pimentel * (65),
Leiterin der Crèche in Amsterdam
Historische Personen sind durch ein * gekennzeichnet.
Altersangaben bezogen auf 1941.
INSTITUTIONEN
Die Special Operations Executive (SOE, Sondereinsatztruppe) war eine britische nachrichtendienstliche Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs.
Der Secret Intelligence Service (SIS) ist der britische Auslandsgeheimdienst. Er ist besser bekannt unter dem Namen MI6.
Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (Abkürzung SD) war ein Teil des nationalsozialistischen Machtapparates. In der Auslandsspionage konkurrierte der SD mit dem Amt Ausland/Abwehr der Wehrmacht.
Die Sicherheitspolizei (kurz SiPo) umfasste die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und die Kriminalpolizei (Kripo). Sie war Heinrich Himmler als »Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei« unterstellt.
Die Geheime Staatspolizei, auch kurz Gestapo genannt, war die Politische Polizei.
Die Ordnungspolizei (OrPo) (Schutzpolizei, Gendarmerie, Gemeindepolizei) war der Oberbegrifffür die uniformierte Polizei.
Abwehr ist die im deutschen Sprachgebrauch verbreitete Bezeichnung für den militärischen Geheimdienst der Wehrmacht.
Der Generale Staf sectie III (GS III) war der niederländische Nachrichtendienst. Er wurde nach Einmarsch der deutschen Truppen 1940 aufgelöst.
Seit zwei Wochen befindet sich Deutschland im Krieg mit der Sowjetunion. Deutsche Truppen stoßen rasch nach Osten vor. Im Westen dagegen herrscht Ruhe. Frieden in den besetzten Niederlanden. Fast.
Sonntag, 6. Juli 1941
Sofieke wusste, sie sollte um diese Zeit nicht mehr draußen sein. Aber sie war 17 Jahre alt, und niemand konnte sie daran hindern, eine Nacht im Freien zu verbringen. Auch nicht die Besatzer mit ihrer nächtlichen Ausgangssperre. Die schon gar nicht. Es war eine warme Sommernacht. Sofieke hatte ihr Fahrrad an einen Baum gelehnt und betrachtete den Nachthimmel. Die Sterne leuchteten hier außerhalb der Stadt so viel heller als dort, wo sie vor ihrer Flucht gewohnt hatte. Die Milchstraße war klar zu erkennen.
Sofieke Plet hatte die elterliche Wohnung in Amsterdam verlassen und war nach Den Haag gezogen. Ihr Vater war tot. Ihre Mutter wusste nicht, wo sie geblieben war. Und sie wusste erst recht nicht, dass Sofieke für ihre Flucht das Bankkonto der Familie geplündert hatte. Das Mädchen hatte zwar eine Spur schlechten Gewissens deswegen, aber wirklich nur eine Spur. Ihre Mutter arbeitete und brauchte dieses Geld nicht, während ihre eigene Zukunft vollkommen ungewiss schien. Als ihr klar war, dass sie als Jüdin die öffentliche Schule würde verlassen müssen, war sie untergetaucht.
Sofieke fühlte sich so frei und übermütig wie lange nicht mehr. Alle Sorgen der letzten Wochen lagen hinter ihr. Sie pflückte eine verspätete Pusteblume, hielt sie in die Luft und blies die Samen gegen den Himmel. Wie kleine Fallschirme, dachte sie.
Irgendwo in der Ferne brummte ein Flugzeug. Sie entdeckte es erst, als es die Milchstraße querte. Die Maschine flog nicht sehr hoch. Vielleicht steuerte sie Den Haag an. Sie flog ohne Positionslichter. Richtig, es war ja Krieg. Hier draußen konnte man es fast vergessen.
Plötzlich legte ihr jemand die Hand auf die Schulter. Sofieke fuhr zusammen. Die Hand gehörte zu einem Polizisten.
»Na, was machst du denn hier noch so spät?«, fragte er.
»Ich betrachte den Sternenhimmel«, erwiderte Sofieke.
»Jetzt? In der Sperrstunde?«
»Bei Tag kann ich die Sterne doch nicht sehen!«
»Ja, das ist richtig«, gab der Polizist zu. Er ließ ihre Schulter los.
Sein Kollege hatte weniger Verständnis. »Das geht nicht«, sagte er missbilligend. »Das können Sie nicht machen, junge Frau. Ich fürchte, wir müssen Sie mit auf die Wache nehmen.«
Sofieke erwiderte nichts. Sie wollte nicht mit auf die Wache.
»Es sei denn ...« Der Polizist sah Sofieke fragend an. Sein Blick gefiel ihr nicht.
Aber bevor er dazu kam, seinen Vorschlag näher zu erläutern, stieß sein Kollege ihn an. »Das Flugzeug!«, rief er. »Guck mal, das Flugzeug!«
Er deutete nach oben. Aber es war nicht das Flugzeug, das seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Das war inzwischen kaum noch wahrzunehmen; stattdessen hing ein schwarzer Fallschirm am Nachthimmel und schwebte langsam zu Boden.
»Ach du Scheiße!«, murmelte der zweite Polizist.
»Komm, den Kerl schnappen wir uns!« Beide rannten in die Richtung, in der der Fallschirmspringer landen würde.
Sofieke registrierte, dass die beiden plötzlich Pistolen in den Händen hielten. Der Springer hatte keine Chance. Er war viel zu nah. Die Polizisten würden ihn mit Sicherheit erwischen. Und was immer sie mit ihm vorhaben mochten, es war bestimmt nichts Gutes.
Die Nacht war verdorben. Sofieke stieg auf ihr Fahrrad und radelte davon.
Gerhard Prange schwebte am Fallschirm durch die Nacht. So sah es also aus, wenn man als Agent in Feindesland ankam. Hatte er alles richtig gemacht? Ja, hatte er. Sein Vater hatte durchgesetzt, dass Gerhard nach England gehen und in Cambridge studieren konnte. Dass sein Sohn als Fallschirmagent für die Engländer zurückkehren würde, ahnte er nicht. Er hätte es sicher auch nicht gebilligt.
Es war ein unerhörtes Risiko, das Gerhard eingegangen war, für die gute Sache. Wenn es überhaupt eine gute Sache gab in diesem Krieg. Nun gab es jedenfalls kein Zurück mehr. Da war schon der Boden.
Gerhard rollte sich ab. Es klappte nicht ganz so perfekt wie bei dem Übungssprung drüben in England, aber da war auch heller Tag gewesen, und er hatte gewusst, dass er auf freiem Feld landen würde. Diesmal wäre er fast in einem kleinen Waldstück heruntergekommen. Er löste rasch die Gurte, und der schwarze Fallschirm fiel in sich zusammen. Es war windstill. Er befreite sich aus der Springerkombi. Wo war das Funkgerät? Da lag es. Gerhard erschrak. Der Koffer war bei der Landung aufgeplatzt, der empfindliche Sender zerstört.
Die beiden Polizisten bemerkte Gerhard erst, als es schon viel zu spät war. Sie riefen irgendetwas auf Holländisch. Er reagierte nicht. Er blickte auf ihre Pistolen. Der größere der beiden deutete mit der Waffe an, dass er die Hände hochnehmen sollte. Zögernd hob Gerhard die Hände ein Stück weit in die Höhe. Nicht zu weit natürlich. Sie fühlten sich sicher, weil sie zu zweit waren, und weil sie bewaffnet waren. Zu sicher. Und wenn sie ihm Handschellen anlegen wollten, dann mussten sie ihm viel, viel näher kommen. Darauf wartete er. Na, komm schon, dachte er. Noch einen Schritt. Jetzt!
Als Gerhard zutrat, flog die Pistole des vorderen Polizisten in hohem Bogen davon. Der Mann schrie auf und stürzte zu Boden. Gerhard rannte. Schon war der Polizist wieder auf den Beinen und hinter ihm her. Der zweite Polizist fluchte lauthals; er konnte nicht schießen, ohne seinen Kollegen zu gefährden. Es waren keine hundert Meter bis zum Waldrand. Das musste doch zu schaffen sein!
Er drehte sich kurz um. Sein Vorsprung war größer geworden. Da verfing sich sein rechter Fuß in einem Stück Stacheldraht. Er strauchelte, stürzte. Bevor er wieder auf die Beine kam, waren die Polizisten heran. Sie packten ihn zu zweit, legten ihm Handschellen an. Und als sie sich sicher waren, dass er ihnen nicht mehr entkommen konnte, versetzten sie ihm ein paar Fußtritte.
Aus, dachte Gerhard.
Einen Moment lang befürchtete er, sie würden ihn gleich hier draußen erledigen, wo es keine Zeugen gab. Aber das taten sie nicht. Sie nahmen ihn in die Mitte, und wenig später war der Fallschirmagent Gerhard Prange auf dem Weg zur Polizeiwache. Es sah aus, als ob sein Einsatz schon beendet wäre, bevor er überhaupt begonnen hatte.
Aber während er zwischen den beiden Polizisten zu Fuß in Richtung Den Haag marschierte, dachte er an das, was man ihnen bei ihrer Agentenausbildung in Beaulieu eingetrichtert hatte: Ihr müsst jederzeit damit rechnen, dass ihr verhaftet werdet. Aber das ist nicht das Ende. Solange ihr am Leben seid, besteht immer noch Hoffnung.
»Du blutest ja!«
Ja, Gerhard Prange blutete. Seine erste Begegnung mit der niederländischen Polizei war unerfreulich abgelaufen. Die misstrauischen Beamten hatten nicht gewusst, was sie mit diesem Fallschirmspringer anfangen sollten. Sie sprachen kein Englisch, und sein Deutsch konnten oder wollten sie nicht verstehen. Sie hatten ihn verprügelt und ihn dann dem deutschen Sicherheitsdienst übergeben. Der SD hatte wenigstens begriffen, was er wollte: Arthur Seyß-Inquart sehen. »Er ist mein Onkel!«, hatte Gerhard behauptet.
Sie hatten ihn ausgelacht. Aber am Ende hatten sie doch im Amtssitz Am Plein 23 angerufen, und nun stand Gerhard dem mächtigsten Mann in den besetzten Niederlanden gegenüber. Er wischte sich das Blut aus dem Gesicht.
»Was machst du nur für Sachen?« Onkel Arthur schüttelte den Kopf.
Der Reichskommissar für die besetzten Niederlande war nicht wirklich sein Onkel, aber er kannte Gerhard, seit er ihn als zweijähriges Kind auf den Schultern getragen hatte. »Onkel Arthur« – bei der Anrede war es geblieben.
»Ich bin mit dem Fallschirm abgesprungen«, sagte Gerhard. Er hielt inne, denn in diesem Moment war aus einem anderen Raum irgendwo in diesem Gebäude ein unmenschlicher Schrei zu hören.
Arthur Seyß-Inquart wandte sich indigniert zur Seite. »Stellen Sie das ab!«, verlangte er.
Der SS-Mann, der Gerhard in das Vernehmungszimmer gebracht hatte, schlug die Hacken zusammen und verließ den Raum. Kurz danach wurde es ruhig.
Seyß-Inquart nahm den Faden wieder auf: »Du bist mit dem Fallschirm abgesprungen. Ja, das hat man mir erzählt.«
Gerhard war in England vom Kriegsausbruch überrascht worden. »Ich wollte nach Hause.«
»Nach Hause – schön und gut. Aber als englischer Agent?« Es klang nicht bedrohlich, aber es war schwer abzuschätzen, was sein Onkel wirklich dachte. Er verzog keine Miene. »Ich möchte nicht wissen, was dein Vater dazu sagt!«
»Mir blieb keine andere Möglichkeit. Die Engländer wollten mich bis zum Kriegsende in ein Internierungslager stecken. Sie haben mich gefragt, ob ich bereit sei, für sie zu arbeiten. Ich bin zum Schein darauf eingegangen. Sie haben mich zum Fallschirmagenten ausgebildet. Letzte Nacht bin ich hier abgesprungen und gleich verhaftet worden.«
Das war die verkürzte Version, die sich Gerhard zurechtgelegt hatte, und von der er annahm, dass sie für Onkel Arthur glaubhaft schien.
Seyß-Inquart sah ihn prüfend an. »Du bist dir darüber im Klaren, dass feindliche Agenten normalerweise erschossen werden?«
Gerhard nickte.
»In deinem Fall machen wir eine Ausnahme. Du bist kein richtiger Agent. Das stimmt doch, oder?«
»Ja.« Gerhards Nase blutete noch immer.
»Die Engländer wissen das nicht. Sie glauben, dass du ihr Mann bist, und dass du noch immer in Freiheit bist. Das nutzen wir aus. Ich habe vorhin mit dem Leiter unserer Spionageabwehr gesprochen. Er ist bereit, dich für unsere Zwecke einzusetzen. Als Doppelagent. Als Spion gegen England.«
»Und wenn ich mich weigere?«
Onkel Arthur lächelte. »Du hast die Wahl. Du kannst dich immer noch für die Erschießung entscheiden!«
War das ein Scherz? Gerhard war sich nicht sicher.
Major Hermann Giskes, Leiter der Gruppe III F der Abwehr, machte jedenfalls keine Scherze. Der Mann war etwa 40 Jahre alt. Er trug keine Uniform. Das Auffälligste in seinem zerknitterten Gesicht waren die Augen. Wachsam und misstrauisch.
Er sagte: »Laut Aussage hast du in England studiert?«
Gerhard nickte.
»Warum nicht in Deutschland?«
»Weil die Experten in meinem Fach in England sitzen. In Cambridge, um genau zu sein. John Maynard Keynes ist einer der größten ...«
»Erzähl mir nichts. – Du bist aus politischen Gründen ins Ausland gegangen.«
»Nein.«
»Auf der Flucht vor der Polizei.«
Gerhard schüttelte den Kopf.
»Dann stimmt es also nicht, dass du dich mit einem hochrangigen Vertreter der NSDAP herumgeprügelt hast? Und du hast den Mann auch nicht zusammengeschlagen, dass er hinterher ins Krankenhaus musste?«
»Doch, das habe ich.«
»Aber?«
»Das war nicht politisch«, behauptete Gerhard. »Das war privat.«
»Und um den Folgen dieser privaten Prügelei zu entgehen, bist du nach England gegangen?«
»Ja.«
Giskes sah Gerhard prüfend an. Ganz gleich, wie die Geschichte in Wirklichkeit gewesen sein mochte, die Engländer hatten offenbar daraus den Schluss gezogen, dass Gerhard kein Nazi sei. »Und du sagst, in England sind dann die Herrschaften vom Geheimdienst an dich herangetreten?«
»Ja«, bestätigte Gerhard.
Giskes hob die Augenbrauen. Das glaubte er nicht. »Hier steht, dass du dich freiwillig gemeldet hast«, behauptete er.
Gerhard widersprach: »Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet.«
Giskes schüttelte den Kopf. »Wie dem auch sei – lass uns zu den Fakten zurückkehren. Tatsache ist jedenfalls, dass du letzte Nacht mit dem Fallschirm aus einem englischen Flugzeug abgesprungen und hier gelandet bist. Als Spion. Aber du willst nicht erschossen werden, sondern lieber für uns arbeiten, stimmt das?«
Gerhard nickte.
»Sehr gut«, sagte Giskes. »Eine weise Entscheidung. Mal sehen, was wir mit dir machen. Erst einmal gehst du jedenfalls zurück ins Oranje-Hotel.«
Gerhard nickte. Dass das sogenannte Oranje-Hotel das Gefängnis von Scheveningen war, das hatte er inzwischen mitbekommen.
Gerhards zweite Nacht im Gefängnis. Er hatte eine bessere Zelle bekommen, und er war sich ziemlich sicher, dass ihn niemand mehr misshandeln würde. Dennoch konnte er lange Zeit nicht einschlafen. Seine Aufgabe war es, zu Arthur Seyß-Inquart Kontakt aufzunehmen. Die Idee war gewesen, dass er sich direkt bei seinem »Onkel Arthur« hatte melden sollen. Das war gelungen – wenn auch auf andere Weise als ursprünglich geplant. Gerhard sollte so viele Informationen wie möglich über den Reichskommissar sammeln. Das war wahrscheinlich immer noch möglich. Pech war nur, dass er seine Erkenntnisse nicht nach London weitergeben konnte. Sein Funkgerät war zerstört. Dass die Deutschen ihn gefangengenommen und zur Zusammenarbeit gezwungen hatten, spielte keine Rolle. Das war von vornherein als eine Möglichkeit eingeplant gewesen.
Am meisten beunruhigte ihn, dass er zu viel wusste. Der zweite Agent, der mit ihm im Flugzeug gesessen hatte, und der erst später abgesprungen war, hatte sich ihm zwar als »Klaas« vorgestellt. Gerhard wusste aber, dass er in Wirklichkeit Aart Alblas hieß und aus Dordrecht stammte. Sie waren zusammen mit anderen Freiwilligen in Beaulieu in Südengland ausgebildet worden, und wenn man wochenlang zusammenlebte, dann blieb es nicht aus, dass man Dinge erfuhr, die eigentlich geheim bleiben sollten. Nun wusste Gerhard zu viel, und ihm war klar: Wenn die Polizisten ihn weiter verprügelt hätten, und wenn sie gezielte Fragen gestellt hätten, dann hätte er irgendwann alles ausgeplaudert.
Der Wärter, der Gerhard in seine Zelle gebracht hatte, hatte in gebrochenem Deutsch und nicht ohne Häme geäußert: »So geht es allen feindlichen Agenten. Kaum gelandet und schon erledigt!« Aber Gerhard war keineswegs erledigt. Abgesehen von den Prügeln, die er bezogen hatte, lief bis jetzt fast alles nach Plan.
Aart Alblas, der zusammen mit Gerhard im Flugzeug gesessen hatte, war 23 Jahre alt. Genau wie Gerhard war er noch nie im Dunkeln abgesprungen. Eine mondhelle Nacht hatte es sein sollen, aber als endlich das Signal zum Absprung kam, war es stockfinster. Der Fallschirm öffnete sich, und dann war schon der Boden da. Alblas landete mit dem Wind im Rücken und schlug hart mit dem Kopf auf.
Als er sich etwas von dem Schmerz und von dem Schrecken erholt hatte, versuchte er, sich zu orientieren. Irgendetwas stimmte nicht. Dort drüben sollte ein Wald sein, das hatten sie in London gesagt. Aber da war kein Wald. Auch gut. Aart rollte mit einiger Mühe den Fallschirm ein. Es gelang nicht so gut wie bei der Übung in England. Egal, nur weg damit!
Vergraben. Er schraubte den Pionierspaten zusammen. Aber der Boden war steinhart. Das war kein Sandboden! Das hier war niemals die Provinz Drente, er war irgendwo anders gelandet.
Gerade in dem Moment kam der Mond wieder zum Vorschein. Aart sah flaches Land, von Gräben durchzogen. Er war in der Marsch gelandet. Der Boden, das war ausgetrockneter, steinharter Kleiboden. Unmöglich, hier ein Loch zu graben. Das Schlagen mit dem Spaten hörte man bestimmt kilometerweit.
In der Ferne sah er einen Bauernhof. Aart schleppte sein Gepäck dorthin. Sollte er versuchen, den Bauern zu überreden, den Fallschirm und den Sender für ihn zu verwahren? Ein verlockender Gedanke. Aber zu riskant. Aart entschied sich dagegen. Hinter der Scheune fand er einen ausgetrockneten Graben, in dem der Boden lockerer war. Dort vergrub er die Sachen.
Und jetzt? Wo war er gelandet? Vom Bauernhof führte ein Weg zur Straße. Dort stand ein Wegweiser. Alblas leuchtete mit der Taschenlampe. Grens 0,5 km stand da. Die deutsche Grenze! Er war in der Nähe von Nieuweschans gelandet. Glück gehabt, dachte er. Eine Minute später und er wäre den Deutschen geradewegs in die Arme gesprungen.
Jacques Batenburg war an diesem Sonntag in bester Stimmung. Er hatte gerade seinen Doktor der Wirtschaftswissenschaften bestanden und feierte mit seinen Freunden.
Seine Freundin Gré kam ins Zimmer: »Jacques, das Telefon!«
»Moment, ich bin gleich wieder da.«
Das Telefon stand auf dem Flur. Gré reichte Jacques den Hörer. »Ja, bitte?«
»Hier ist Aart. – Aart Alblas!«
»Ich denke, du bist in England!« Batenburg war überrascht.
»Nein, ich bin hier. Ich bin wieder in Holland, in Rotterdam-Feijenoord genauer gesagt, und ich brauche ganz dringend eine Unterkunft. Kannst du mich abholen?«
»Ja klar.«
Und jetzt? Wie konnte er von seiner eigenen Feier weglaufen, ohne Argwohn zu wecken? Seine Freundin fragte prompt: »Wo willst du denn hin?«
»Ich muss noch mal eben weg, Gré ...«
»Was? Jetzt? Das ist deine Feier, Jacques!«
»Ja, es geht nicht anders.«
»Ich komme mit.« Gré Hoogervorst hatte schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn ihr Freund »mal eben« irgendwohin wollte. Batenburgs Ausflüge dauerten manchmal ziemlich lange. Im Herbst 1940 war er mit seinem Freund Aart Alblas mal eben nach Frankreich gefahren, um in Dünkirchen zurückgebliebenen britischen Soldaten bei der Flucht zu helfen. Er hatte nichts erreicht, aber er war viele Monate fortgeblieben, und Gré war die ganze Zeit in Angst und Sorge gewesen. Das sollte ihr nicht zweimal passieren. Dieses Mal war Gré mit dabei.
Auf dem Bahnhof Rotterdam-Feijenoord entdeckten sie Alblas sofort. Aart erzählte, weshalb er hier war. Jetzt brauchte er einen Unterschlupf.
Jacques Batenburg schüttelte den Kopf. »Bei uns geht es nicht.«
»Ich hatte eigentlich an Jan Idema gedacht. Aber der geht nicht ans Telefon.«
Batenburg wusste, wo ihr Freund Idema war: zu Besuch bei einem Bekannten in Dubbeldam. Batenburg rief ihn dort an. »Kannst du bitte zum Bahnhof nach Dordrecht kommen?«
»Wieso?«
»Frag nicht, komm einfach. Und bring einen Hut und eine dunkle Brille mit.
»Was? Wozu das denn?«
»Das kann ich dir am Telefon nicht erzählen.«
»Na, hör mal …!«
»Komm einfach!«
Die Bahnfahrt von Rotterdam nach Dordrecht war riskant. Alblas durfte nicht erkannt werden. Aber Aart Alblas kannte so viele Leute. Bei jedem Halt kontrollierten Batenburg und seine Freundin, ob keine Bekannten unter den neu zusteigenden Fahrgästen waren. Sie hatten Glück.
Endlich waren sie in Dordrecht. Da stand Idema. Batenburg lief zu ihm hin. »Wo ist der Hut? Und die Brille?« Die hatte Jan im Auto gelassen. Das war ihm zu idiotisch vorgekommen.
»Begreifst du es denn nicht? Aart ist wieder da! Aart Alblas! Und er darf nicht erkannt werden.«
Idema eilte zurück, um die Sachen zu holen.
Die anderen setzten sich in den Warteraum. Alblas versteckte sich hinter einer Zeitung. Der Haagsche Courant vom Vortag. Was gab es Neues? Die Sowjets überall auf dem Rückzug – deutsche Truppen rücken bis zur Stalin-Linie vor. Wahrscheinlich alles gelogen. Wo war überhaupt diese Stalin-Linie? Und wo blieb Idema?
Da kam er endlich und nahm den verkleideten Aart Alblas mit. Gottseidank. Erleichtert kehrten Jacques und Gré zurück zu ihrer Feier.
Zu Hause zeigte Alblas seinem Freund Idema den Sender, den er mitgebracht hatte. »Er kann nicht eingepeilt werden!«, behauptete er.
Idema zog die Augenbrauen hoch. »Ein Sender, der nicht zu peilen ist? So was gibt es nicht!«
»Doch, das gibt es.« Alblas war sich ganz sicher. »Ich habe es selbst gesehen. Wir haben mit dem Sender eine Probesendung in Schottland durchgeführt, und die Peilung ergab, dass wir uns angeblich in der Sahara befanden!« Idema schüttelte ungläubig den Kopf.
Die beiden kannten sich seit vielen Jahren. Aart war mit mehreren Freunden zusammen im März 1941 von einem kleinen Hafen südlich von Rotterdam mit einem Motorboot losgefahren – in Richtung England. Sie hatten sich als deutsche Offiziere verkleidet. Unterwegs wurden sie von echten deutschen Offiziere gegrüßt, die sie tatsächlich für Kameraden hielten. Als sie auf der offenen See waren, hatten sie ihre Mützen und die Hakenkreuzfahne über Bord geworfen. Alles war gutgegangen.
»Und jetzt bist du wieder hier!«
Alblas nickte. »Ja. Im Auftrag der Königin.«
»Im Auftrag der Königin? Du meinst, Wilhelmina hat dich persönlich beauftragt, nach Holland zurückzugehen?«
Aart Alblas nickte stolz. Die niederländische Regierung und die königliche Familie waren im Exil in England. Und Wilhelmina hatte ihm zum Abschied die Hand gegeben. Eigentlich hatte er zur Marine gewollt, aber dann war er beim MI6 gelandet, beim englischen Geheimdienst. Er hatte einen Schnellkurs in Morsen und Fallschirmspringen absolviert. Und letzte Nacht war er zurückgekommen, per Fallschirm, aber er war in Groningen gelandet statt in Drente. »Jedenfalls freue ich mich, dass ich wieder in den Niederlanden bin!«
Jan Idema nickte. »Und jetzt? Was willst du hier jetzt tun?«
Alblas zog einen Zettel aus der Tasche, worauf er sich verschiedene Dinge notiert hatte. Das waren die Anweisungen, die er auf dem Weg zum Flugplatz bekommen hatte, einschließlich der möglichen Anlaufpunkte. Idema zog die Augenbrauen hoch. Er fand es ziemlich unvorsichtig, solche Dinge in schriftlicher Form mit sich herumzutragen, aber Alblas duldete keine Kritik an seinen Auftraggebern.
»Übrigens kriegst du noch Geld von mir«, sagte er. Idema hatte seinerzeit die Kosten für die Flucht mit dem Motorboot bezahlt. Nun konnte er Jan alles zurückzahlen.
»Wie viel hast du denn mitbekommen?«
»Rate!«
»Na, vielleicht 50.000 Gulden?«
Alblas schüttelte den Kopf. Nein, so viel hatte er nicht. 2000 Gulden hatten sie ihm gegeben.
Idema sah ihn verblüfft an. »Damit kommst du nicht weit!«
»Wenn das Geld alle ist, kriege ich mehr«, behauptete Alblas. »Ich muss es nur beantragen.«
Idema schwieg. Er wusste aus eigener Erfahrung, wie schnell 2000 Gulden ausgegeben waren. Das war gar nichts, wenn man ernsthaft illegal arbeiten wollte. Aart Alblas war ein netter Kerl, aber er war auch ein bisschen naiv.
Es wurde still im Zimmer. Nur das Ticken der Uhr war zu hören. Es war spät am Nachmittag, fast schon 17:00 Uhr. Zeit für die gläubigen Menschen hier in Dordrecht, zur Kirche zu gehen. Alblas stand auf und ging ans Fenster. Idema begriff, was er sehen wollte: seinen Vater und seine Mutter, seinen Bruder und seine Schwestern, die hier über den Vrieseplein zum Gottesdienst gingen. Nach ein paar Minuten kam Alblas mit feuchten Augen zurück. Er hatte sie gesehen. Aber sie durften nicht wissen, dass er zurück war. Wie gern hätte er sie eingeweiht!
»Zieh dich um«, sagte Jacques. »Wahrscheinlich passen dir meine Sachen.«
Alblas zog seine Jacke aus.
Idema starrte ihn fassungslos an. »Ja, bist du denn verrückt?«
»Wieso?«
»Es sieht doch jeder sofort, dass du direkt aus England kommst!« Idema wies auf die eingenähten Etiketten.
Montag, 7. Juli 1941
»Und jetzt?«, fragte Giskes. »Was machen wir mit diesem Fallschirmagenten?«
Richard Christmann zuckte mit den Achseln. Christmann, Ex-Fremdenlegionär, war der zweite Mann der Spionageabwehr in Scheveningen. Der Mann aus dem Elsaß war jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt.
»Dieser Prange, der lügt uns doch die Hucke voll!«, setzte Giskes nach.
»Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht«, entgegnete Christmann. »Dass er keinen konkreten Auftrag bekommen hat, das besagt gar nichts. Alle Agenten, die wir bisher geschnappt haben, sind ohne konkreten Auftrag losgeschickt worden. Alles Weitere wurde später per Funk festgelegt. Aber in diesem Fall geht das nicht. Gerhard hat kein Funkgerät mehr.«
»Sagt er.«
»Nein, ich habe das überprüft. Es war wohl eine ziemlich harte Landung.«
»Na schön. Aber glaubst du wirklich, dass er jetzt auf unsere Seite kommt? Wird er nicht stattdessen über einen anderen Agenten Kontakt mit London aufnehmen? Über einen, den wir noch nicht kennen?«
»Ich weiß es nicht.« Christmann zündete sich eine Zigarette an, suchte den Aschenbecher.
»Auf der Fensterbank!«, sagte Giskes. Er selbst nahm sich eine Zigarre.
Eine Weile rauchten die beiden schweigend.
»Was soll der Mann hier?«, sagte Giskes schließlich. »Warum schicken die Engländer einen deutschen Agenten hierher in die Niederlande?«
»Wegen Arthur Seyß-Inquart vermutlich.«
»Seyß-Inquart! Soll er den etwa ausspionieren? Dazu ist sein ›Onkel Arthur‹ viel zu gerissen. Der lässt den Jungen gar nicht erst an sich heran.«
»Vielleicht ja doch.«
Giskes schüttelte den Kopf. »Wir müssen ihn überwachen, das ist klar. Aber wie soll das gehen, womöglich monatelang? Das Personal haben wir nicht.«
»Vielleicht geht es schneller, wenn wir ihn ein bisschen aus der Reserve locken.«
»Wie stellst du dir das vor?«
»Es gibt da ein hübsches, großes Haus in der Laan van Poot ...«
Giskes hob die Augenbrauen. »Du denkst an Hueting? Ist der noch auf freiem Fuß?«
Christmann nickte. Es war ein offenes Geheimnis, dass Rudolf Hueting Kontakte zum Untergrund hatte. »Dort quartieren wir ihn ein. «
»Bei Hueting! Was der wohl sagt, wenn wir ihm einen deutschen Soldaten ins Haus setzen? Wahrscheinlich schmeißt er ihn raus. Oder er schießt ihm eine Kugel in den Kopf!« Giskes lachte.
Laan van Poot 214 war ein großes, modernes Haus, und es lag direkt hinter den Dünen, knapp zehn Minuten vom Strand entfernt. Niemand hatte auf Gerhard geschossen, aber seine Vermieter hatten ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er hier unerwünscht war. Frau Hueting hatte ihn wortlos nach oben geführt.
Das Zimmer im oberen Stockwerk, das Gerhard bekommen sollte, war nicht viel besser ausgestattet als die Gefängniszelle im Oranje-Hotel. Es mochte früher einmal als Kinderzimmer gedient haben. Jetzt war es so gut wie leergeräumt. Es enthielt nur noch Tisch, Bett und Stuhl – und sonst gar nichts. Das war nicht immer so gewesen. Es war ganz offensichtlich, dass hier einmal ein Teppich gelegen hatte, dass Bilder an den Wänden gehangen hatten, und dass es auch einen Schrank und wahrscheinlich einen Schreibtisch gegeben hatte. Nichts davon war mehr vorhanden. Gerhard betätigte den Lichtschalter. Nichts passierte. Jemand hatte die Glühbirne aus seiner Lampe herausgeschraubt.
Gerhard ging wieder nach unten. Die Hausfrau arbeitete in der Küche. Er klopfte an die offene Tür. Frau Hueting reagierte nicht. Er räusperte sich. Keine Reaktion.
Gerhard sagte: »Es tut mir leid, dass ich hier bei Ihnen einquartiert worden bin. Ich habe mir diese Unterkunft nicht ausgesucht. Ich bin Soldat, ich muss dort wohnen, wo man mich hinschickt.«
Die Frau sah ihn an, sagte aber kein Wort.
Verstand sie kein Deutsch? Gerhard wiederholte seinen Satz auf Englisch. Es half nichts. Sie wollte ihn nicht verstehen. Gerhard wusste nicht, was er tun sollte.
Die Frau starrte ihn an. Schließlich sagte sie: »Warum gehen Sie nicht einfach?« Sie verstand also Deutsch.
Gerhard nickte. »Bis später dann!«
Aber die Frau hatte sich schon wieder ihrem Abwasch zugewandt. Sie blickte nicht auf, als die Haustür hinter ihm zufiel.
Sofieke Plet wohnte in der De Carpentierstraat. Es klingelte an der Haustür. Sofieke ging nach unten und öffnete. Draußen stand ihr Bruder Jaap. »Komm mit nach oben«, sagte sie. Jaap war der einzige Mensch, den sie ins Vertrauen gezogen hatte.
»Geht das?«, fragte Jaap. Er deutete auf die Tür der Erdgeschosswohnung. Im Parterre wohnte die Witwe ter Laak, Sofiekes Vermieterin.
»Ja, das geht. Die alte Frau ist sehr nett.«
»Auch bei Männerbesuch?«
»Sie hat nicht gesagt, dass ich keinen Männerbesuch haben darf. – Und außerdem ist sie schwerhörig.«
»Weiß sie, dass du erst 17 bist?«
Sofieke schüttelte den Kopf. Die beiden gingen nach oben.
»Hübsch hast du es hier!«, sagte Jaap anerkennend. Er sah sich in der Wohnung um. »Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wovon du leben willst?«
»Die Wohnung ist nicht so teuer, wie du denkst. Und sie war möbliert. Nichts von dem, was du hier siehst, habe ich selbst gekauft.«
»Das sehe ich.« Jaap betrachtete amüsiert das gerahmte Foto der königlichen Familie. »Trotzdem wird dein Geld nicht ewig reichen.«
»Eine Weile schon!«
»Und dann?«
»Vielleicht könnte ich Unterricht geben«, sagte Sofieke zögernd.
»Unterricht? Aber du bist keine Lehrerin!«
Nein, Sofieke war keine Lehrerin. Sie hatte nicht einmal die Schulausbildung abschließen können. Hätte sie vielleicht doch wie ihre Freundinnen in das von den Nazis eigens eingerichtete Joodsch Lyceum gehen sollen, um einen Abschluss zu bekommen? Nein, das wäre töricht gewesen. Als Jüdin hätte sie niemals Lehrerin werden dürfen. Dabei wusste sie, dass sie gut unterrichten konnte. »Wahrscheinlich geht es trotzdem«, sagte sie.
»Vielleicht könntest du ein Zimmer untervermieten«, schlug Jaap vor. »Am besten an einen Deutschen. Und den lässt du so viel Miete zahlen, wie deine ganze Wohnung kostet. Oder gleich doppelt so viel, dass du außerdem ganz bequem davon leben kannst!«
Sofieke lachte. Das würde nicht funktionieren. Sie sagte: »Du lässt mich nicht im Stich, oder?«
»Schwesterherz, du weißt, dass ich alles für dich tue, aber viel Geld habe ich auch nicht.«
»Wichtiger sind die Papiere. Ich brauche neue Papiere.«
»Die kriegst du«, versicherte Jaap. »Aber das dauert noch ein bisschen. Noch habe ich sie nicht.«
Dienstag, 8. Juli 1941
»Na, hast du dich schon ein bisschen eingelebt?«, fragte Christmann am nächsten Morgen.
Gerhard berichtete. Seine Vermieter sprachen nicht mit ihm. Die Frau hatte ihm wortlos das Frühstück serviert und auf seine Fragen nicht geantwortet. Die Tochter war kurz ins Zimmer gekommen. Als sie gesehen hatte, dass der Deutsche dort saß, hatte sie auf dem Absatz kehrtgemacht und die Tür hinter sich zugeknallt.
Christmann lachte. »Die Holländer mögen uns nicht. Wir haben ihr Land besetzt. Aber ist das so schlimm? Irgendwann werden sie sich daran gewöhnen. Das Leben geht weiter. Und – um ehrlich zu sein – es geht den Leuten hier besser als unseren Leuten zu Hause in Deutschland. Hier herrscht Frieden. Hier gibt es keinen Fliegeralarm, und niemand braucht zu befürchten, dass seine Kinder irgendwann in den Krieg ziehen müssen. – Aber einige Leute brauchen etwas länger, um zu begreifen, wie gut es ihnen geht.«
»Ja, mag sein.« Gerhard war es nicht gewohnt, dass ihn irgendjemand nicht haben wollte. Es verdross ihn.
»Jedenfalls sitzt du nicht mehr im Gefängnis.«
»Der Unterschied ist nicht groß.«
»Du hast Glück gehabt, mein Freund!«
Gerhard sah Christmann fragend an.
»Du hast großes Glück gehabt, dass du bei uns gelandet bist. Wenn Seyß-Inquart dich da nicht rausgeholt hätte, dann wärst du jetzt schon tot. Der Sicherheitsdienst der SS, der hätte dich erschießen lassen. Ohne Gerichtsurteil. Theoretisch muss soetwas zwar von der vorgesetzten Dienststelle genehmigt werden, aber die Herrschaften sind da nicht kleinlich. So eine Genehmigung wird auch schon mal nachträglich erteilt.«
»Und ihr? Warum habt ihr mich nicht einfach der Gestapo überlassen?«, fragte Gerhard trotzig.
»Weil wir dich lebend brauchen.«
»Das verstehe ich nicht.«
Der Agent erläuterte es ihm. »Wir haben hier zwei konkurrierende Dienststellen, die sich mit der Spionageabwehr befassen. Das eine, das sind wir. Die Abwehr, geleitet von Major Hermann Giskes, wir gehören zur Wehrmacht. Das andere ist die Abteilung Gegnerbekämpfung der Gestapo. Deren Chef ist so ein kleiner, dicker Mann mit einem Glatzkopf. Der Hauptsturmführer Joseph Schreieder. Er lächelt immer. Aber wenn du nicht auf seinen Mund achtest, sondern auf seine Augen, dann weißt du Bescheid.«
»Und ihr arbeitet zusammen?«
Christmann schüttelte den Kopf. »Wir arbeiten gegeneinander.«
»Das geht?«, fragte Gerhard überrascht.
»Konkurrenz belebt das Geschäft. Die SS hat mehr Macht, aber wir sind besser. Solange die anderen immer ihre gefangenen Agenten erschießen lassen, werden sie auf der Stelle treten. Erst kürzlich haben sie ein Funkgerät erbeutet, aber jetzt können sie nichts damit anfangen, weil der Funker tot ist. Aber wir – wir haben jetzt dich.«
»Ihr wisst, dass ich kein Funkgerät mehr habe.«
Christmann lächelte. »Wir haben dich«, wiederholte er.
Aart Alblas musste so schnell wie möglich aus Dordrecht verschwinden. Hier kannten ihn zu viele Menschen. Er brauchte umgehend ein sicheres Quartier. Den Haag wäre eine Möglichkeit. Sie fanden eine kleine Pension in der Riouwstraat. Nichts Besonderes, aber sie konnten nicht allzu wählerisch sein.
Jetzt musste der Sender abgeholt werden. Alblas reiste zusammen mit Jacques Batenburg und Gré Hoogervorst in den Norden. Jan Idema hatte arrangiert, dass sie bei einem seiner Verwandten übernachten konnten, einem Bauern. Sie liehen sich Fahrräder. Singend und mit aufgekrempelten Ärmeln, so als ob sie Urlauber wären, radelten sie über Nieuweschans zu dem Bauernhof, wo Alblas seinen Sender vergraben hatte.
Jetzt zeigte sich, dass Alblas kaum einen schlechteren Platz hätte wählen können. Der Bauer war ein Mitglied des NSB. Auf dem Hof wehte die schwarz-rote Parteifahne der Nationaal-Socialistische Beweging. Außerdem lag der Hof in Sichtweite der Grenze, und dort liefen ständig deutsche Patrouillen entlang.
Gut, dass sie Gré mit dabeihatten. Während Alblas in dem ausgetrockneten Graben nach seinem Sender grub, begannen Jacques und Gré ein Stück weiter im offenen Gelände, sich auszuziehen. Von jenseits der Grenze sahen zwei deutsche Soldaten mit ihren Ferngläsern zu. Aart Alblas konnte währenddessen ungestört seinen Koffer bergen.
Am späten Nachmittag brachte Jans Verwandter sie zum Bahnhof. Sie waren in ausgelassener Stimmung. Gré bestand darauf, dass sie den Koffer trug. Alblas schlug das Herz bis zum Halse, als er sah, wie ein Wehrmachtsoffizier auf sie zulief.
»Junge Frau, darf ich Ihnen den Koffer tragen?«
»Danke, das ist sehr nett!« Gré strahlte den Mann an.
»Kommen Sie, wir setzen uns in das Wehrmachtabteil, das ist nicht so überfüllt!« Der Offizier nahm ihr den Koffer ab und ging diensteifrig vor ihr her zu dem reservierten Abteil.
Alblas und Batenburg stiegen weiter hinten ein. Gré war einfach zu übermütig. Wie würde das ausgehen?
Als sie umsteigen mussten, sahen sie, dass wieder ein deutscher Soldat den Koffer mit dem Funkgerät trug. Wieder ging Gré mit ihm in eines der für die Deutsche Wehrmacht reservierten Abteile. Und auch am Ende ihrer Reise, am Bahnhof Hollands Spoor in Den Haag, brauchte Gré den schweren Koffer nicht zu tragen. Der freundliche deutsche Offizier, der ihr geholfen hatte, gab einem Soldaten den Auftrag, sich des Koffers anzunehmen. Gré schenkte dem Deutschen ein freundliches Lächeln. Als sie auf dem Bahnhofsvorplatz waren, bedankte sie sich artig bei dem Soldaten und sagte, dass sie es nun allein schaffen werde. Als Alblas und Batenburg angelaufen kamen, sah Gré sie triumphierend an.
»Das ist kein Spiel, Gré«, sagte Jacques Batenburg missbilligend.
»Aber es hat funktioniert!«
Batenburg schüttelte den Kopf.
Bei Idema in der Wohnung probierten sie den Sender aus. Batenburg bestand darauf, zuerst die Gebrauchsanweisung zu lesen, bevor er das Gerät an das Netz anschloss.
»Völlig unnötig«, befand Aart Alblas. »Das ist alles voreingestellt.«
Batenburg ließ sich nicht beirren. Schon hatte er den Koffer geöffnet. »Aha!«, sagte er. »Siehst du das hier? Diese kleinen Stecker?«
»Was ist damit?«
»Da steht 102 + 0 + 10V. Was glaubst du wohl, was das heißen könnte?«
»Ist das die Netzspannung? 112 Volt?«
Jacques nickte. »Und was glaubst du wohl, was passiert, wenn so ein hochempfindliches Funkgerät plötzlich mit der doppelten Spannung konfrontiert wird? – Das kann nicht gut sein, Aart, das kann ganz und gar nicht gut sein!«
Batenburg änderte die Position der Stecker. Ohne diese Inspektion wäre der Apparat sofort durchgebrannt. Aart schaltete das Funkgerät ein. Es funktionierte. »Danke«, sagte er.
Aber damit war nur das erste Hindernis aus dem Weg geräumt. Der Sender funktionierte zwar, aber Alblas bekam dennoch keine Verbindung zum Hauptquartier in London.
»Wir brauchen eine vernünftige Antenne«, befand Jacques Batenburg. Etwas Ähnliches hatte er schon befürchtet.
Sie brauchten eine 18 Meter lange Antenne, und die konnte Alblas auf keinen Fall in der Riouwstraat anbringen. Bei der dichten Bebauung wäre das sofort aufgefallen. Was jetzt?
Batenburg zögerte einen Moment. Schließlich sagte er: »Bei Gré, da könnte es gehen.«
Was immer die Abwehr mit Gerhard vorhaben mochte, sie schien keine besondere Eile zu haben. Er solle sich zunächst einmal in der Stadt umsehen, hatte Christmann gesagt, und sich dann gegen Abend noch einmal in der Dienststelle melden. Gerhard kam sich vor wie in seiner Studentenzeit in Cambridge. Er schlenderte durch Den Haag, besah sich die Sehenswürdigkeiten und ließ sich in einem Straßencafé Kaffee und Kuchen servieren. Er war in Zivil, aber natürlich wurde sofort deutlich, dass er ein Deutscher war, wenn er nur den Mund aufmachte.
Der Kellner bediente ihn mit der gleichen Höflichkeit wie die holländischen Gäste.