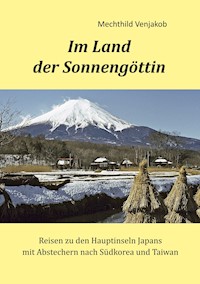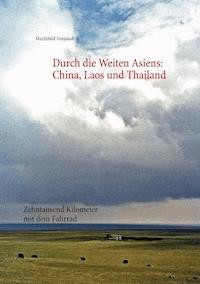
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Autorin reist mit Fahrrad und Zelt von China über Laos nach Thailand. Sie erzählt von Naturparadiesen, abgelegenen Seen und kargen Landschaften, von Klöstern, Palästen und archäologischen Parks, von ethnischen Minderheiten, Schlammpisten und Erdrutschen. Einmal verliert sie ihr Fahrrad, ein andermal unterbricht ein Unfall mit Folgen die Fahrt. In China erlebt sie die dünne Luft auf dem Dach der Welt und in Laos und Thailand die tropische Hitze und den Monsun. Viele Fotos veranschaulichen den Reisebericht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
China
Durch halb China: von Hongkong über Guiyang nach Chengdu
Zu den steinernen Wächtern von Guilin
Von Reisterrassen, Wind- und Regenbrücken
Jede dunkle Wolke hat einen silbernen Rand
Schnurstracks über die Hügel
Hoch hinaus: von Chengdu über Songpan, Zoige und Xiahe nach Xining
Aufstieg nach Songpan, einer alten tibetischen Stadt
Zoige, kleine Stadt im Grasland
Die Klosterstadt Langmusi
Zum Labrang-Kloster nach Xiahe
Ein neuer Begleiter und ein großer Plan
Ein geplatzter Traum: von Xining nach Golmud und zurück
Aufstieg zum Qinghai-See
Durch die Wüste
Immer südwärts: von Xining nach Chengdu
Durch die Min-Berge in Gansu
Naturparadiese in den Bergen der Provinz Sichuan
Wenn das Visum ausläuft – Abstecher nach Hongkong
Gewalttour: von Chengdu zum Lugu- und zum Erhai-See
Am Klosterberg Emei Shan und im Dadu-Tal
Schlammschlachten – von Xichang nach Yan Yuan
Wenn man sein Fahrrad tragen muss – zum Lugu-See
Im Reich der Mosuo-Frauen am Lugu-See
Rüttelpiste – vom Lugu-See nach Dali am Erhai-See
Im Land der Bai
Der Sturz
Südländisches Flair in Xishuangbanna
Laos
Von Norden nach Süden – das Fahrrad auf dem Dach
Land und Leute
Im hohen Norden des Landes – Muang Xai
Luang Prabang – alte Königsresidenz und Stadt der Tempel
Vang Vieng – Karstlandschaft und Höhlen
Vientiane – dörflich und verschlafen
Savannakhet, Pakxe und Champasak
Thailand
Reiseziele in Siam
Land und Leute
Von Laos über Surin nach Bangkok
Bangkok, ein Moloch
Kanchanaburi am River Kwai
Ayutthaya und Sukhothai, die alten Königsstädte
Chiang Mai und das Goldene Dreieck
Südthailand
Fahrradtour durch die nördlichen Gebiete Thailands
Nationalparks und Khmer-Ruinen
Am Mekong
Im gebirgigen Norden
Zurück nach Bangkok
Ausklang
Anhang
Die Fahrradrouten im Überblick, Karten
Dank
Ein Reiseleben
Weitere Bücher
Vorwort
Da sitze ich im März 1997 auf einmal als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache auf dem Campus der Chung-Ang-Universität in Ansong, Südkorea, und muss unzählige Eindrücke und Informationen einordnen, mich erinnern, wo was ist und wie die Arbeitsabläufe in einer Universität funktionieren. Obwohl ich noch nicht unterrichtet habe, war ich zwei Tage lang von morgens bis spätnachmittags unterwegs, sprach mit Professoren und Studenten, wurde herumgeführt und eingewiesen, unterhalten, zum Essen eingeladen und, und, und … Die koreanischen Menschen scheinen genauso aufgeregt wie ich zu sein. Ich fange langsam an zu relaxen. Alle sind freundlich und überaus höflich. Die konfuzianischen Werte werden in Südkorea noch gelebt: Jüngere Personen müssen älteren Ehrerbietung erweisen und ihren Anweisungen folgen. Der älteste Professor hebt die Tafel auf und alle Gäste gehen nach Hause. Die Altersrangordnung gilt selbst unter den jungen Leuten, der ältere Student hat das Sagen, der jüngere ordnet sich unter.
Nach einer zehnmonatigen Fahrradtour durch China im Jahr 1996 bewarb ich mich von Hongkong aus als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an etlichen Universitäten in Japan und Südkorea. Von der Chung-Ang-Universität in Ansong, etwa 80 Kilometer südlich von Seoul, bekam ich eine Zusage. Im koreanischen Konsulat in Hongkong erhielt ich ein Arbeitsvisum für zehn Monate, flog nach Seoul und wurde von zwei Studenten vom Flughafen abgeholt. Mit anderen ausländischen Sprachdozenten wohne ich jetzt im Gästehaus auf dem Campus im Grünen, mit Todd aus Kanada, Jim aus den USA, Svetlana, Alex und Irina aus Russland und mit Bruno und Dianne aus Frankreich. Wir geben Konversationskurse, jeder in seiner Muttersprache. Die koreanischen Deutschprofessoren machen die Studenten und Studentinnen, die Germanistik studieren, mit Werken Goethes und Schillers vertraut und ich bringe ihnen einfache Sätze bei, wie: „Woher kommst du? Wo wohnst du? Ich bin krank. Ich muss zum Arzt.“ Das Sprechen der deutschen Sprache fällt vielen meiner liebenswerten Studenten schwer und ich habe das Jahr über viel zu tun.
Der gute und regelmäßige Verdienst kommt mir sehr gelegen, denn die Ausgaben in den vergangenen Monaten waren hoch gewesen. Ich hatte mein Fahrrad in Hongkong rundum überholen lassen. Fast alle Komponenten wurden ausgetauscht: Felgen, Reifen, Vorderblatt, Ritzel, Kette, Kabel, Bremsklötze. Die gesamte Ausrüstung hatte gelitten, ich kaufte mir Goretex- und Polartec-Kleidung und brauchte noch ein neues Zelt. Eine Zahnarztrechnung hatte ein tiefes Loch in mein Reisebudget gerissen. Zudem musste ich mich für die Arbeit an der Universität einkleiden, denn ich wollte nicht in Wanderschuhen vor die Studierenden treten.
Südkorea ist das Land der „Morgenstille“. Der Name passt gut zu den Nationalparks und zu den buddhistischen Tempeln, Klöstern und Einsiedeleien in den Bergen, die ich an Wochenenden und in den Semesterferien besuche.
Am Ende des Jahres läuft der Arbeitsvertrag aus. Die Uni würde ihn gerne verlängern, doch ich habe schon die nächste Fahrradtour durch China im Kopf. Weihnachten fliege ich zurück nach Hongkong, um David, meinen Freund, zu besuchen. 1994 waren wir gemeinsam der Seidenstraße durch Pakistan und China für Tausende von Kilometern gefolgt. Anschließend arbeiteten wir in Hongkong. David unterrichtete Englisch und ich Deutsch an einem Fremdspracheninstitut. Ein Jahr später machte ich mich mit meinem Fahrrad allein auf den Weg, denn David wollte seine Arbeit nicht aufgeben. Das will er auch jetzt nicht. Am 20. Februar 1998 bringt er mich frühmorgens zum Schnellboot, mit dem ich Hongkong verlasse.
China
Durch halb China:
von Hongkong über Guiyang nach Chengdu
20. 02. 1998 — 01. 05. 1998: 2145 Kilometer
Zu den steinernen Wächtern von Guilin
Zhaoqing — Wuzhou — Guilin: 559 Kilometer
Die gemütlichen und beschaulichen Bootsfahrten gehören der Vergangenheit an. Im Schnellboot sitze ich nur wenig bequemer als im Flugzeug. Die Fenster sind nicht zu öffnen, eine Klimaanlage bläst kalte Luft in den Raum. In den Ecken der Decke stecken Plastikblumen, und da die Passagiere bei Laune gehalten werden müssen, laufen fade Filme über zwei große Bildschirme. Schlager beschallen den sterilen Raum. Draußen im Wind darf niemand mehr stehen. Die Außentüren sind verriegelt.
Das Wetter schlägt dem Schnellboot ein Schnippchen. Es wird zeitweise so nebelig, dass die Sicht keine fünfzig Meter beträgt. Der Kapitän drosselt die Geschwindigkeit und tuckert wie in alten Tagen durch die schaumgekrönten Wellen. Chinesische Dschunken, Schlepper und Frachter tauchen im Dunst auf, am Flussufer zeichnen sich die Umrisse von Palmen, Bananenstauden und Häusern ab. Kurz vor Zhaoquing ragen schöne Berggruppen am Steilufer auf. Dann wird das Ufer wieder flach.
Kurz vor vierzehn Uhr legt der Katamaran in Zhaoqing am Xi Jiang an. Ich bepacke mein Fahrrad und frage nach der Bank of China, um Geld zu wechseln. Eine junge Frau radelt voraus und zeigt mir den Weg. Bald sind wir im Zentrum inmitten des chinesischen Verkehrsgewühls, durch das sich jeder ohne Hektik bewegt. Die Radfahrer fahren wie sie wollen, wenn es sein muss auch gegen den Strom. Niemand regt sich darüber auf. Die Frau führt mich zur Bank und verabschiedet sich erst, nachdem ich einen Reisescheck eingetauscht habe und keine Hilfe mehr benötige.
Auf der Route 321 nimmt der Verkehr außerhalb der Stadt ab, doch für einen kleinen Radfahrer ist er immer noch sehr stark. Lastwagen und Busse rauschen an mir vorbei und ihre Hupen dröhnen in einem fort. Plötzlich ist die Landschaft bergig. Unten im Tal fließt der breite Xi-Fluss. Ein weißgrauer Schleier verdeckt den Himmel. Er gibt der Umgebung weiche Konturen, den Häusern, Büschen und Bäumen an den Flussufern, den Bergen und auch den Wolken. Müde erreiche ich den kleinen Ort Lubu und frage einen Mann nach einem Hotel. Er bringt mich zu einem Restaurant in der Straße, das dem Hotel angeschlossen ist. Ich schiebe mein Fahrrad ins große Restaurant. Sofort bin ich von etwa zehn Leuten umringt. Alle freuen sich, ich bin die Sensation des Tages – eine Ausländerin auf einer Fahrradtour. Aber Geschäft bleibt Geschäft, und freundlich handeln wir den Preis aus. Dafür nehmen wir uns Zeit. Anschließend helfen alle, meine Sachen aufs Zimmer zu tragen. Ich dusche und bin zu müde, um essen zu gehen.
Wenn das Zimmer gemütlicher wäre, würde ich bleiben, um mich einen Tag lang auszuruhen, aber wegen der kahlen Wände und des abgetretenen Teppichs auf dem Boden wirkt es kalt. Ich packe lieber wieder.
Den ganzen Tag über radele ich auf der vierspurigen Route 312 ein bergiges Flusstal hoch. Kleine Gemüsefelder, manchmal auch Reisfelder, breiten sich zu beiden Seiten der Straße aus. Die Dörfer bestehen aus zwei- bis dreistöckigen weißen und roten Backsteinhäusern. Neubauten sind mit einem Flachdach ausgestattet. Die Straße verläuft über einen Damm, von dem aus ich die Landschaft überblicke.
Am Mittag dringen für kurze Zeit ein paar Sonnenstrahlen durch die dicken Wolkenschichten. Ein etwa zwölfjähriger Junge, der mit seinem Freund auf dem Gepäckträger spazieren fährt, radelt neben mir her und lacht mich an. Er gestikuliert, zeigt auf die Gangschaltung, hebt den Daumen und anerkennend und neidlos bedeutet er mir, dass er mein Flöhchen gut findet. Er ist überglücklich, als er die Frage „How are you?“ versteht und mit „fine“ zu beantworten weiß.
Ein leichter Gegenwind setzt ab Mittag ein und raubt mir die letzten Kräfte. Nach etwa siebzig Kilometern fahre ich nach De Xing hinein. Neue fünf- und sechsstöckige, weiß gekachelte Häuserkästen säumen die Hauptstraße. Am Ende geht es nach links in den älteren Teil der Stadt. Hier befinden sich die Läden. Die ausladenden Kronen der Platanen verdecken die Mietshäuser. Menschen flanieren auf den Gehsteigen. Durch die Straßen rollen überwiegend Motor- und Fahrräder, Autos gibt es kaum.
Den ganzen nächsten Tag über folgt die Straße dem Fluss, nur einmal führt sie für ein kurzes Stück ohne große Steigungen durch die Berge. Am frühen Nachmittag gibt es einen Schauer und nach einer Weile regnet es sich ein. Wuzhou, mein heutiges Ziel, wirkt in der Nässe unter grauem Himmel trostlos. Ich nehme das erste Hotel an der Straße, das Long Men Hotel, und bekomme ein Einzelzimmer mit Bad. Die Temperaturen sinken am Abend auf dreizehn Grad Celsius. Ich schlafe zwölf Stunden und fühle mich immer noch wie gerädert. Das Wetter inspiriert kein bisschen zum Weiterfahren, sondern schlägt aufs Gemüt. In aller Ruhe trinke ich Kaffee und zahle für die nächste Nacht.
Die engen Marktstraßen der Stadt sind belebt, zumindest bis zum Mittag, als es anfängt zu gießen. Verloren hocken die Menschen unter ihren Regenschirmen hinter Gemüse- und Fruchtbergen und ziehen die Schultern ein. Fahrradrikschas mit Plastikdach, Radfahrer, Mofa- und Motorradfahrer, Fußgänger – alle bahnen sich ihren Weg, der in Wellenlinien verläuft. In den Restaurants wird auf Kanonenöfen gekocht. Sie sind mit glühenden, zylinderförmigen Briketts gefüllt.
Am frühen Abend errichten die besseren Restaurants der Stadt auf quadratischen Tischen auf dem Gehsteig ihr Buffet. Undefinierbare Fleischstückchen füllen große Bleche, Nieren, Leber, Hirn und anderes. Die chinesischen Delikatessen schwabbeln. Kleine Eulen mit flachem, weißem Gesicht zerren an Stricken, mit denen sie außen an einen Käfig gebunden sind. Sie stehen zum Schlachten bereit wie die hinter Gittern piepsenden Rebhühner. Gackernde Hühner, ein Igel, Schildkröten und eine dünne, lange Schlange sind zum Verzehr bestimmt. Fische aus dem Fluss und Austern vervollständigen den Speiseplan. Die Einwohner sind überwiegend einfach gekleidet, Arbeiter und Arbeiterinnen stecken in Baumwollhosen und abgewetzten Jacketts, einige tragen Gummistiefel. Ein Strohhut mit breiter Krempe schützt viele Köpfe vor der Sonne und heute vor dem Regen.
Am nächsten Morgen ist die Wäsche nach sechsunddreißig Stunden immer noch nicht trocken. Draußen hat sich der Nebel gelichtet und ist zum grauen Himmel aufgestiegen. Langsam wandelt er sich, die Sonne kommt raus und die Temperaturen steigen auf angenehme zwanzig Grad Celsius.
Die Angestellten des Hotels schicken mich auf die Nordroute 207. „Don’t cross the bridge!“, sagen sie. Die Landstraße ist holprig. Die Reis- und Zuckerrohrfelder sind nahe gerückt. Das Fahrradfahren macht wieder Spaß. Ab und zu donnern Lastwagen und Busse mit qualmendem Auspuff vorbei, aber meistens bin ich allein auf der Straße. Die Hügel sind mit Gebüsch bewachsen und an einigen Stellen mit Kiefern aufgeforstet. Daneben wachsen Eukalyptus- und Ginkgobäume und feiner Bambus, dessen Rohre aneinanderklicken. Die Bauern haben die Felder schon abgeerntet und teilweise gepflügt. Die nassen, fetten Schollen glänzen in der Sonne. Gutmütige Wasserbüffel grasen auf kleinen Weiden.
Ich überwinde eine Bergkette und von der wellenförmig verlaufenden Panoramastraße aus blicke ich über unzählige Hügel, die sich vor höheren Gebirgszügen ausbreiten. Nach genau fünfzig Kilometern erreiche ich den Ort Libu und stürze hungrig in ein Straßenrestaurant. Die Kellnerin serviert mir Bandnudeln mit Gemüse und mageren Fleischstückchen. Dazu gibt es zwei Spiegeleier. Diese schmackhafte und reichhaltige Mahlzeit kostet nur fünf Yuan.
Ich überwinde die zweite Bergkette des Tages und erblicke die ersten Kalksteinberge, für die diese Region berühmt ist. Zwei dieser steinernen Wächter glänzen blauschwarz in der Ferne, sie sind von wulstiger und mächtiger Natur. Einsam erheben sie sich inmitten von Feldern. Für kurze Zeit führt die Straße an einem ruhigen, grünen Fluss entlang, der von Bambuswäldchen eingerahmt ist. Immer wieder tauchen ältere Dörfer auf, deren Häuser aus Lehmsteinen erbaut sind. Der Ort Xindu besteht aus zwei- und dreistöckigen, mit Kacheln überzogenen Bauten. Dahinter führt eine vierspurige Asphaltstraße schnell in die Berge hinein. Die Hänge sind mit Kiefern aufgeforstet.
Am späten Nachmittag erreiche ich Batou und gehe ins nächstbeste Restaurant. Ich bekomme wieder ein exzellentes Mahl: Bandnudeln, Eier, Tofu und Gemüse. Die Mädchen verraten mir auch, wo ich preiswert übernachten kann, gleich nebenan gibt es ein Zimmer für zehn Yuan. Für diesen Preis kann ich keine Dusche erwarten, aber es ist noch warm genug, um sich kalt waschen zu können. In meinem Gesicht zeigt sich die erste Bräune. Am späten Abend, als ich schon im Bett liege, klopft es an die Tür: Zwei Männer treten ein und stellen sich vor, der eine ist Polizist, der andere Englischlehrer. Der Englischlehrer dolmetscht und bittet um meinen Pass, den der Polizist durchlättert. Der Hotelmanager musste die Ankunft einer Ausländerin offensichtlich melden.
Auf meiner Tour am nächsten Morgen zeigt sich bald eine Kalksteinkette, die sich von Osten nach Westen zieht, bizarre Schemen im Grau des Tages. In Hexian wird in vielen Betrieben der in der Umgebung gewonnene Marmor geschliffen. Die Maschinen stehen draußen und kreischen. Ein paar Ziegeleien stellen Backsteine aus Lehm her. Großzügig geschwungenes Weideland und terrassierte Felder rahmen die Straße hinter dem Industrieort ein. In der Ferne schimmern Bergzüge und vereinzelte Kalksteinformationen. Hinter einer kleinen Anhöhe breitet sich plötzlich die über die Grenzen hinaus berühmte Karstlandschaft aus, Kalksteinklippen erheben sich hinter den Feldern und überragen das Bauernland. Alte und neue Dörfer säumen den Weg, die Häuser sind in einheitlichem Stil errichtet. Ich erreiche einen kleinen Ort, vermutlich Bong An, und gehe dort in ein einfaches Hotel.
Das Bad in den einfachen Hotels dieser Region besteht aus einer Hocktoilette und einem Wasserhahn, unter dem sich kein Waschbecken befindet. Wenn kein Eimer darunter steht, platscht das Wasser auf den Boden und auf die Füße. Zinkeimer stehen in der Ecke des Raums. Eine Wasserspülung für die Toilette gibt es nicht. Der Benutzer füllt den Zinkeimer und kippt ihn in die Toilettenschüssel. Das funktioniert prima!
Am nächsten Tag fahre ich durch ein Dorf, in dem die Straße weggebrochen ist. In den gelben, verschlammten Pfützen steht der Verkehr in beiden Richtungen. Busse, Lkws und Sammeltaxis sitzen fest. Ein Betonsteg verläuft vor den Häusern zu beiden Seiten der Straße. Ich schiebe mein Rad hinauf und dränge mich an den vielen Fußgängern vorbei. Einige tragen ihre Lasten an einem Schulterstab. Es ist eng. Bis zum Ortsausgang zwänge ich mich durch das Chaos, dann ist die Straße wieder asphaltiert und frei.
In Ertang hole ich mir eine Cola an einem Stand und setze mich zu ein paar jungen Leuten, die unter einer gespannten Plane um ein glühendes Kohlebecken herum sitzen. Es fängt an zu tröpfeln. Bis zu meinem eigentlichen Ziel, Yangshuo, sind es noch vierzig Kilometer. Hundert Meter zurück gibt es ein Hotel. Ein sechzehnjähriger Junge bringt mich dahin. Die Angestellte gibt mir ein Einzelzimmer mit einem breiten, knarrenden Holzbett. Wie üblich ist die Bettwäsche benutzt und schmutzig. In der Ecke steht ein Holzsessel neben einem Schreibtisch auf dem kalten Estrichboden. Die Wände sind weiß gekalkt und mit Spinnweben überzogen. Das Plumpsklo befindet sich im Erdgeschoss. Nebenan entdecke ich zwei Kabinen, jeweils mit einem Wasserhahn in etwa achtzig Zentimeter Höhe – ohne Waschbecken. Unter meinem Bett steht ein Eimer. Den nehme ich mit, um mich zu waschen. Um das Licht im Zimmer – eine Glühbirne unter der Decke – an- und auszumachen, muss ich draußen vor der Tür an einer Schnur ziehen. Warum nicht drinnen? Was denkt sich bloß der Mensch, wenn er solch unpraktische Konstruktionen anfertigt? — Am schönsten ist die Aussicht aus dem Fenster: Der Blick geht weit über die schwarzen Ziegeldächer bis hin zu den bizarren Kalksteinbergen, dunkle Schatten im Regen. Gegenüber dem Haus wächst Bambus wie in einem übergroßen Strauß Blumen. Vögel, so klein wie Zaunkönige, zwitschern. Auf dem Erdweg, der an den Lehmhäusern des Dorfes vorbeiführt, laufen viele Menschen, die in Eimern am Schulterstab Wasser nach Hause tragen.
Zum Frühstück esse ich unten im Restaurant eine Nudelsuppe. Gewischt wird dort wohl nie. Der Boden ist mit Kniest bedeckt. Ich ziehe die Regenkleidung an und fahre hinaus in den Morgenregen, der für etwa eine Stunde anhält. Viele Chinesen halten beim Radfahren in einer Hand einen Regenschirm, andere schützen sich vor der Nässe mit einem Regencape.
Laut Karte gibt es eine Nebenstrecke nach Yang Shuo, meinem ersten großen Ziel. Ich biege von der Hauptroute ab. Eine breite, belebte Straße führt bald über eine Flussbrücke. Am anderen Ufer beginnt eine Erdstraße, nass vom Regen. Ich schiebe über zwei steile Anhöhen und radele hinunter in die Ebene. Zur Linken blicke ich auf eine Flussschleife, die sich schwarz vom diesigen Licht des Tages abhebt. Hier und da stehen Häuser.
Nach ein paar Kilometern endet die Erdstraße in einem Ort. Und wo geht es weiter? Ein Mann zeigt zu dem recht breiten Fluss hinunter. Das ist ja spannend! Ein auf Fässern schwimmender Brettersteg für Fußgänger und Radfahrer führt auf die andere Seite. In der Mitte sitzt ein Kassierer und kassiert ein paar Fen Wegegebühren.
Eine jetzt asphaltierte Straße führt auf und ab durch die berühmte Karstlandschaft. Die Berge sind nah und überall, sie entspringen der geschwungenen Ebene und wachsen in den Himmel. Da soll es mir egal sein, wie viele Kilometer es noch bis Yang Shuo sind. Ausländische Touristen auf gemieteten Fahrrädern kommen mir entgegen. Ja, es sei nicht mehr weit zum Städtchen, erklären sie mir.
Yang Shuo, ein kleiner Ort, liegt wie Guilin am Li-Fluss. Rucksackreisende halten sich lieber hier auf als in der großen Stadt Guilin. Die Landschaft am Li-Fluss wurde von Dichtern besungen, so schön ist sie. Bizarr geformte Kalksteinberge ähneln dem Zuckerhut von Rio oder wirken verwunschen wie in einer Märchenwelt, nebelumflort und schimmernd in dunklem, geheimnisvollem Blaugrün. Manche der mit Gebüsch bepelzten Buckel fallen senkrecht zum Fluss ab. — In Yang Shuo angekommen, gehe ich ins Yang Shuo Holiday Inn. Dieses Hotel bietet ein Bett im Dreibettzimmer für nur zehn Yuan an. Im Flur befindet sich eine heiße Dusche. Was braucht der Mensch mehr?
Am Morgen beträgt die Zimmertemperatur, jetzt Anfang März, gerade einmal dreizehn Grad Celsius. Ich gehe ins Café de Paris, um zu frühstücken. „Dort gibt es den besten Schokoladenbananenpfannkuchen im Ort“, hatte mir mein Zimmernachbar gestern erzählt.
Seit Mai letzten Jahres arbeitet die neunzehnjährige Zhou Chun Fang aus Wuhan hier, um ihr Englisch zu verbessern. Wir unterhalten uns lange. Ihr Englisch ist gut. „Als Kind musste ich immerzu lernen und durfte nicht spielen“, erzählt sie. Ihr Vater war während der Kulturrevolution Soldat und wurde gefeuert, weil das Verhalten seines Bruders nicht den kommunistischen Vorstellungen entsprach. Diese Ungerechtigkeit hätte ihr Vater bis heute nicht verwunden. Zhou Chun Fangs Bruder ist vierzehn. Sie liebt ihn und versucht mit Erziehungsvorschlägen sein Leben leichter zu machen als ihres. Sie meint, sie habe einen Knacks, es fehle ihr an Selbstbewusstsein. Alle anderen Mädchen im Restaurant wären glücklich. Einige von ihnen hätten nur zwei Jahre lang die Schule besucht. „Warum bin ich nicht glücklich?“, das frage sie sich immer wieder. Sie meint, sie denke zu viel, während die anderen das Leben so nähmen wie es ist. Sie liest anspruchsvolle Literatur, schreibt gern und hofft, dass ihre Geschichten einmal veröffentlicht werden.
Zurzeit sind kaum Touristen unterwegs. In allen Restaurants, in die ich gehe, bin ich der einzige Gast. Die Kellnerinnen sitzen herum, stricken und langweilen sich. Auch am nächsten Tag nieselt es ohne Unterbrechung. Schwaden umwallen die Hügel. Im Hotelzimmer wickele ich mich in meinen Schlafsack und schreibe Briefe.
Auch am Dienstag regnet es ununterbrochen. Am Mittwoch wasche ich den gelben Schlamm von meinem Fahrrad und bringe Flöhchen auf Hochglanz. Morgens wallen noch die Grauschleier, am frühen Nachmittag scheint zum ersten Mal seit Langem wieder die Sonne. Der Himmel wird blau.
Im Bamboo House laufen abends immer Videofilme. Dort gibt es auch den besten Kartoffelbrei der Stadt. Fan, die Kellnerin, ist achtzehn, sieht aus wie fünfzehn und hat immer gute Laune. Mit den drei jungen Leuten, die im Restaurant kochen und bedienen, spielt sie Karten, wenn keine Gäste im Lokal sitzen. Die Angestellten essen und schlafen umsonst und bekommen zweihundert Yuan Taschengeld im Monat.
Ich lerne Zhang Dan kennen, Englischlehrerin an einer Mittelschule. Vier Jahre habe sie an einer Uni in Nanning studiert, sagt sie. Ein Jahr Deutsch hat sie auch belegt und jetzt spricht sie ein paar Wörter. Nebenher gibt sie Touristen Chinesischunterricht. Sie gehört zu den strahlenden, lernbegierigen Sonnenkindern, während ihr Zwillingsbruder keine Lust zum Studieren hat und zurzeit arbeitslos ist. Ihr Vater ist Lokomotivführer, ihre Mutter Ärztin.
Am Sonntagabend schüttet es. Es regnet die ganze Nacht und den ganzen nächsten Morgen. Am Dienstag will ich weiterfahren, egal wie das Wetter ist. Ich frühstücke noch einmal im Café de Paris, verabschiede mich von den Angestellten im Bamboo House und treffe auch noch Zhang Dan, die gerade auf dem Weg zur Schule ist. Ich verlasse Yangshuo. Der Himmel ist bedeckt, die nassen Zeiten sind keineswegs vorbei.
Die 323 nach Guilin ist gut ausgebaut und nicht zu stark befahren. Ein breiter Radweg macht das Radeln sicher. Hinter Feldern, Obstgärten und Kiefernforsten, die auf weichem Grasboden stehen, ziehen sich die schönen Kalksteinberge vereinzelt und in Ketten hin. Anfangs komme ich gut voran, bis Gegenwind einsetzt. Als ich am Mittag eine Nudelsuppe esse, fallen die ersten Tropfen, und als ich Guilin erreiche, fängt es an zu regnen. Ich biege nach links ab. Der runde, hohe Turm des Hongkong Hotels überragt den Kreisverkehr. Ich halte dort an und der Portier guckt herablassend auf mein Flöhchen herab. Er weiß nicht so recht, ob ich mit meinem kostbaren Stück direkt am Eingang parken darf. Die Zimmerpreise sind in US-Dollar angegeben, die Übernachtungen sind teuer. Ich fahre die Straße hinunter auf der Suche nach dem Chinese Overseas Hotel. Erfolglos! Stattdessen finde ich ein kleines chinesisches Hotel mit niedrigen Preisen, doch angeblich ist es besetzt. In Guilin dürfen Ausländer wahrscheinlich nur in teuren Touristenhotels übernachten. Ich verlasse das Hotel und kehre zu meinem Fahrrad zurück.
Draußen regnet es mittlerweile Bindfäden. Ich frage mich, was ich überhaupt in Guilin will. Anstatt im Regen durch die Stadt zu kurven, um nach einer einigermaßen erschwinglichen Unterkunft zu suchen, kann ich genauso gut weiterfahren und in einem der nächsten Dörfer übernachten. Ich ziehe die Regenkleidung an und mache mich auf in die Nässe. Ich folge der Straße zum Flughafen, die durch die wunderbare Karstlandschaft führt. Dann biege ich auf die 323 ab, eine Landstraße. Der Wind bläst mir in den Rücken und ich surre durch den Regen, der ab und zu aufhört. Das erste lang gestreckte Straßendorf wirkt im Regen ungemütlich und chaotisch. Hier will ich nicht bleiben! Die kantigen Berge Guilins weichen Halbmondhügeln, die von Kiefern gekrönt sind. Die steinernen, aus Muschelkalk bestehenden Kegel und Wächter rund um Guilin gehören bereits der Vergangenheit an. Ich genieße die neue Landschaft. Die einsame Straße verläuft schließlich an bewaldeten Berghängen vorbei. Ab und zu liegen Dörfchen am Wegesrand. Eine Herberge kann ich nicht entdecken. Schließlich schlage ich das Zelt neben ein paar Pfützen auf einem Stück Rasen auf. Zum Kochen benutze ich das reichlich vorhandene Pfützenwasser. Ich trinke Tee und wieder fängt es an zu regnen. Zufrieden liege ich im Zelt und lasse mich von dem Geplätscher einlullen.
Von Reisterrassen, Wind- und Regenbrücken
Guilin – Longsheng – Rongjiang – Guiyang: 725 Kilometer
Die mit Schlaglöchern übersäte Straße verläuft eben durch ein breites Flusstal, bis sie in die Berge führt. Rasant fällt sie durch ein Nebental ab, um erneut anzusteigen. Die dritte Anhöhe auf meinem Weg liegt fast achthundert Meter über dem Meer. Ein Willkommensgruß auf dem hohen, viereckigen Tor, das die Straße überspannt, empfängt mich: „Longsheng Hot Spring, the Sky on Earth!“
Nach einem Sturzflug von zwölf Kilometern erreiche ich die Talsohle und den kleinen Ort Miaoping, der sich malerisch am Fluss vor den hohen Bergen ausbreitet. Neben weiß gekalkten Steinhäusern stehen die alten, großen, auf Stelzen gebauten Holzhäuser. Terrassenfelder mit Teeplantagen ziehen sich über die Hügel. Die Straße folgt den Schleifen des Flusses bis Longsheng, einer richtigen kleinen Stadt. Auf der rechten Seite erblicke ich ein Hinweisschild „Stream Restaurant, Group have meal.“ Eine Frau winkt, ich solle hereinkommen und essen. „Nein, erst brauche ich ein Hotel!“ Übernachten könne ich auch hier. Das ist ja wunderbar! Alle Probleme sind gelöst. Mit schweren, müden Beinen trage ich meine Sachen ins Zimmer und lasse mir anschließend sofort eine Mahlzeit zubereiten. Ich sitze auf einem Stühlchen an einem niedrigen Tisch in der Küche. Ein Gemälde an der Wand zeigt den Vorsitzenden Mao. Der Große Führer schaut herab und guckt mir beim Essen zu. Auch im Treppenaufgang hängt er in Lebensgröße. Wie Jesus in der Wüste steht er, gen Himmel blickend im Wind, und scheint die Erleuchtung gefunden zu haben, ein Mann, der drei Generationen seines Volkes drangsalierte und mehrere Millionen Menschen ins Verderben stürzte.
Die Reisterrassen von Longsheng, Guangxi
Longsheng ist das Zentrum dreier Minoritäten, der Zhuang, Yao und Dong, die hier ringsum in Bergen und Tälern wohnen. Über die Jahrhunderte haben sie ihre Reisterrassen in die Berghänge geschlagen. Die eindrucksvollsten soll es im Dorf Longji geben. Da fahren alle Besucher hin – ich auch. Als wenn ich es nicht besser wissen müsste! Bereits im Bus zahle ich einen erhöhten Preis. In einem Dorf an der Hauptstraße steige ich um in einen anderen Bus, der dem Erdweg am Fluss entlang folgt und mich nach Longji bringt. Das Dorf besteht aus alten Holzhäusern mit Balkon, in denen die Dorfbewohner der Yao wohnen. Ich steige aus dem Bus. Wie die Hyänen stürzen sich mindestens zehn Frauen auf mich und kesseln mich ein. Jede bietet sich als Führerin an und schreit mir ihre Preise zu: Der Aufstieg zu den imposanten Terrassen soll zehn Yuan kosten. Für weitere zehn Yuan zeigen sie außerdem, wie sie ihre langen Haare, die sie niemals schneiden, bändigen und frisieren. Der Haarknoten der Frauen sitzt auf der Stirn und guckt unter einem feinen, schwarzen Tuch hervor, das den Kopf bedeckt. In den Ohren stecken schwere Silberreifen, die die Ohrläppchen lang gezogen haben. Die Frauen tragen schwarze Plisseeröcke und pinkfarbene, mit Kreuzstich bestickte Blusen.
Ich flüchte und renne den Fluss hoch. Die Horde rast hinter mir her. Zwei der hartnäckigsten Frauen werden nicht müde, mir zu folgen. Ich ernenne die jüngere Frau zur Führerin, wir laufen über die schwankende Hängebrücke zu einer Häuseransammlung auf der anderen Seite des Flusses. Endlos steigen wir über die gut ausgebauten Steinplattenstufen den steilen Berghang empor. Bis in den Himmel reichen die Terrassen. Meine Führerin quält sich mit einem schlimmen Husten herum und keucht den Weg hinauf. Das Ziel ist nicht mehr zu verfehlen und deshalb gebe ich ihr zehn Yuan. „Mit solch einer Erkältung gehört man ins Bett“, sage ich, und sie kehrt um.
Oben am Berg steht eine Gruppe Männer mit einer Sänfte und wartet auf Kundschaft. Ihre Dienste benötige ich nicht. Ich bin fast oben und stehe vor einer überdachten Holzbrücke über den Wildbach, der zu Tal stürzt. Sie dient gleichzeitig als Karten-Verkaufshäuschen, der Eintritt in die höchste Region der Reisterrassen beträgt noch einmal fünf Yuan. Der Ausblick über die unzähligen Terrassenstufen ins tiefe Tal ist bereits jetzt über alle Maßen eindrucksvoll, sodass ich nicht weiter aufsteige, sondern den langen Weg ins Tal antrete. Unten im Dorf angelangt, wartet wahrhaftig ein Bus auf der Straße. Ich springe sofort hinein, um nach Longsheng zurückzukehren. Der Ausflug war schön und gesund. Nachmittags laufe ich durchs Städtchen und zu einem Freilichtmuseum am Ortsrand. In eine grüne Felsenschneise haben die Konstrukteure eine imposante Wind- und Regenbrücke über den Fluss gebaut. Sie besteht aus mehreren hölzernen Pavillons, die von vier sich nach oben verjüngenden, geschwungenen Dächern geschützt sind. Am Berghang liegen die zwei- und dreistöckigen Holzhäuser der Dong.
Die Sonne löst am nächsten Morgen den Dunst auf und scheint den ganzen Tag. Die nette Familie, der das Hotel gehört, sieht mich ungern gehen. Alle winken mir zum Abschied nach. Den ganzen Tag über radele ich flussabwärts. Der Fluss ist breit und milchig-grün. Ahornblätter sprießen lindgrün. Männer mit Flinten jagen nach Vögeln.
Ich erreiche die Nordsüdroute 209 und radele über eine Flussbrücke durch einen belebten Marktort. Die Straße löst sich immer mehr auf und geht in Schotter über. Im nächsten Dorf staut sich der Verkehr. Ich drücke mich an den Lkws vorbei und quäle mich über eine mit Schlaglöchern übersäte Lehmpiste. Schließlich tauchen die ersten Häuser von Sanjiang auf. Direkt an der Flussbrücke steht das Department Store Hostel. Ein Mann winkt mir schon zu. Zimmer gibt es in mehreren Preislagen, Touristen zahlen den doppelten Preis. Ich nehme ein Bett in einem Dreibettzimmer, das mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher ausgestattet ist. Später schlendere ich durch den Ort. Die Straßen werden wohl nie gefegt. Schmutz liegt in den Ecken und der Staub steht in der Luft.
Eine Schotterpiste folgt am nächsten Tag dem breiten Strom, dem Xun Jiang, weiterhin flussabwärts. Ich komme flott voran. Gestern hatte ich überlegt, ob ich nicht besser umkehren sollte, um im Bogen über Asphaltstraßen zur Provinz Guizhou zu gelangen. Nun bin ich froh, diese Strecke ausprobieren zu können. Nur selten kommen Busse oder Lkws des Weges. Wenn sie vorbeirauschen, wirbeln sie Staub auf, der die Umgebung und mich einhüllt.
In einem der Dörfer tauchen zwei traditionelle Wind- und Regenbrücken auf. Holzhäuser liegen hinter Reisfeldern. Auf quadratischem Grundriss erbaute pagodenartige Holztürme bilden das Zentrum der Dong-Dörfer. Mit Baumrinde unterlegte Ziegeldächer liegen stufenförmig übereinander und bilden eine durchbrochene, schützende Haube über dem Raum, in dem sich die Dorfbewohner treffen, um ihre Angelegenheiten zu besprechen.
Die Reisfelder werden gerade gepflügt. Wasserbüffel ziehen den Pflug und stehen bis zum Bauch im Schlamm, die Bauern, die sie antreiben, bis zu den Kniekehlen. Wer einmal die mühevolle Bestellung der Reisfelder von der Saat bis zur Ernte verfolgt hat, wird nie wieder im Leben ein Reiskorn missachten oder vergeuden.
Die Frauen dieser Gegend stecken in weiten, schwarzen Hosen und einem schwarzen Kaftan. Ein Haarknoten, um den sie ein weißes Band geschlungen haben, krönt ihren Kopf.
Das Dorf Fulu ist der letzte Ort in der Provinz Guangxi. Kaum in der Provinz Guizhou angekommen, ist die Schotterstraße breit und glatt ausgebaut. Ich radele fast wie auf Asphalt und komme schnell voran. Nach einer Tagesleistung von zweiundachtzig Kilometern erreiche ich das Dorf Balou. An einem Haus hängt ein chinesisches Schild, auf dem das Schriftzeichen „ok“ glänzt. Sollte das „ok“ ein Hinweis auf ein Hotel sein? Ich klopfe an. Tatsächlich, ich finde eine Herberge vor und bezahle fünf Yuan für eine Nacht. Eine Dusche gibt es nicht, noch nicht einmal fließendes Wasser. Der Donnerbalken befindet sich außerhalb des Hauses an der Straße etwa dreißig Meter entfernt.
Elektrizität ist allerdings vorhanden. Die große Errungenschaft in dieser Herberge ist die Karaokeanlage, die einzige im Ort. Am Abend findet sich das halbe Dorf ein. Die jungen Leute singen abwechselnd ins Mikrofon zu der in voller Lautstärke aufgedrehten Musik. Auch mich lädt man ein und ich setze mich zu den Leuten. Männer und Mütter mit Kleinkindern haben es sich auf Bänken und Stühlen bequem gemacht und die Kinder des Dorfes springen herum und spielen. Alle haben Spaß.
Ich starte in einen gutes Wetter verheißenden Tag. In langen Wellen führt die Schotterpiste auf und ab durch die Hügel. Im nächsten größeren Ort gibt es ein Touristenhotel und ein chinesisches Reisebüro: CITS. Ein paar Meter weiter sind auf einem staubigen Platz Marktstände aufgebaut. Dort frühstücke ich an einem Nudelsuppenstand und eine Frau vom Stand gegenüber bringt mir einen Plastikbecher Wasser zum Trinken. Minoritäten bevölkern die Straßen, einige Männer tragen schwarze Blusen zu schwarzen, weiten Hosen. Alle sehen arm und abgearbeitet aus. An Schulterstäben baumeln Körbe, die mit Hühnern oder Säcken gefüllt sind. Auf dem Rücken einiger Männer hängt ein schuhförmiger Korb, aus dem eine Machete lugt.
Die Route 321 führt vom Fluss weg in die Berge. Die Schotterstraße wird so steil, dass ich schieben muss. Eine Panoramastraße beginnt und folgt den Konturen des Bergrückens. Die Piste fällt zu einem Dorf ab, in dem ein zwölfstöckiger Holzturm aufragt. Mein Traum von einer langen Abfahrt zerschlägt sich schnell, denn schon wieder geht es über alle Maßen steil bergauf. Auf dem höchsten Punkt zeigt mein Höhenmesser 938 Meter an. Langweilig ist das Klettern nicht, denn zu beiden Seiten der Piste kann ich auf die Reisterrassen in den Tälern blicken. Sie überziehen ganze Berghänge und die Nachmittagssonne spiegelt sich im Wasser, das die Setzlinge umspült. Die höheren Bergzüge zerfließen bläulich-schwarz im Dunst.
Die Piste ist an vielen Stellen frisch ausgebessert worden: Wellen und Schlaglöcher sind mit spitzen Steinen gefüllt, die von den Lastwagen platt gefahren werden müssen. Als Radfahrer kann ich da nichts bewirken, ich schiebe um diese Stellen herum. Nadelwald säumt die abfallende Piste. In vierhundert Meter Höhe spannt sich die Brücke über den Fluss. Ein Dorf liegt am Berghang.
Es ist spät geworden. Wo soll ich in diesem unebenen Gelände nur schlafen? Auf einem Rasenstück direkt an der Straße? Aus dem Fluss hole ich mir Wasser und sehe in der Ferne ein weiteres Dorf, das aus Backsteinhäusern besteht. Das will ich mir noch ansehen. Dort finde ich wahrhaftig eine Herberge, zahle fünf Yuan für die Nacht und bin froh, mich niederlassen zu können. Die Toilette ist im Haus. Es gibt sogar einen Wasserhahn. Ich kann mir den Staub aus den Haaren waschen und mich notdürftig erfrischen. Im Restaurant unten sitzen ein paar Leute rund um ein chinesisches Fondue. Ich darf mich dazusetzen und mitessen. Auch in diesem Haus erschallt Karaokemusik. Die Leute lieben Karaoke. Heute Abend probiere ich den Reiswein des Dorfes, einen süßen, guten, aber gefährlichen Likör, der mir sofort zu Kopf steigt und mich erheitert.
Vor den dunklen Holzhäusern bauen die Menschen schon am frühen Morgen den Markt auf. Mütterchen kauern hinter einem Gemüseberg auf der Erde; an niedrigen Tischen sitzen die Leute auf Hockern oder schmalen Bänken und essen Nudelsuppe. Ich genehmige mir auch eine. Die Kramläden öffnen. Männer und Frauen schleppen Säcke und Körbe an Tragestäben heran, packen ihre Waren aus und hoffen auf ein gutes Geschäft.
Ich radele zur 321 zurück, die, dem Fluss folgend, nach Rongjiang führt. Die Schotterstraße ist streckenweise extrem holprig. Ziemlich lustlos trete ich in die Pedale. Rongjiang liegt auf der anderen Flussseite hinter Raps- und Reisfeldern in der Ebene, die von einem niedrigen Bergzug begrenzt wird. Ich entdecke ein Schild an einem Tor: „Reception Office“, fahre auf den Hinterhof und bekomme ein Bett in einem Dreibettzimmer im Erdgeschoss. Die Angestellten sind freundlich und schlagen den Staub vom Gepäck. Als Radfahrer werde ich immer wieder bewundert. Eine Frau macht mir klar, ich könne im oberen Stock duschen. Jetzt schon? Nachmittags um zwei? Ja, jetzt schon! Was für ein Genuss, den pulverfeinen Staub aus den Haaren und den Poren zu spülen! Im Gang steht ein riesiger Boiler, dem ich heißes Wasser zum Waschen der Kleidung entnehmen kann. Ich schalte den Schwarz-Weiß-Fernseher an und gucke mir faul und träge die Nachrichten an. Wie üblich gibt es Neuigkeiten aus verschiedenen Regionen Chinas und positive Berichte über die Errungenschaften des Landes. Selten wird über das Ausland berichtet, wenn, dann über Arafat und Palästina.
Am nächsten Tag schlendere ich durch die Stadt. In den Nebenstraßen stehen noch die traditionellen Holzbauten. An den runden Tischen in den Restaurants laben sich die Gäste an chinesischem Fondue, das in einem Topf gart. In den Gassen hocken Schulkinder auf Fußbänkchen vor einem Stuhl, machen ihre Hausaufgaben auf der Straße und mühen sich mit den chinesischen Schriftzeichen ab, von denen man fast dreitausend kennen muss, um einen informativen Text lesen zu können.
Auf dem Hof putze und überhole ich Flöhchen, ziehe ein neues Gangschaltungskabel ein und bin gespannt, ob die Schaltung in den Bergen nun besser funktioniert. Ein paar Männer schauen zu und dürfen mein Flöhchen ausprobieren. Sie verteilen Zigaretten an die Ausländerin mit den öligen Händen und finden sie offensichtlich prima.
In den langen Nebenstraßen des Städtchens findet täglich Markt statt, streckenweise unter grünen, welligen Plastikplanen. Am Ende einer Straße befinden sich der Hühnermarkt und nebenan der Schlachtplatz. Steinöfen werden von hinten mit Holz befeuert. In großen Eisenschalen kocht der Sud, in den die toten Hühner geworfen werden, damit man anschließend ihre Federn leichter ausrupfen kann. Ein Meerschweinchen liegt tot auf dem Boden und ein Hund mit eingeschlagener Schnauze in seinem hellroten Blut. Eine derbe Frau in Gummistiefeln packt ihn und stürzt ihn kopfüber in die zu kleine Schale mit dem Sud. Die steifen Hundebeine gucken über den Rand. Die Schlachtecke stinkt nach Blut, Tod und Brutalität. Ich bedauere die Tiere und gehe hier lieber weg. An Fleischständen verkaufen die Händler unter anderem Hundefleisch, eine Delikatesse für die Chinesen. Schweineköpfe liegen dekorativ auf Tischen zwischen den Fleischstücken.
Die Angehörigen der Minoritäten in ihren schmutzigen, abgetragenen Trachten sehen zumeist armselig aus. Eine Frau läuft barfuß durch die Straßen, vielleicht kann sie die umgerechnet eineinhalb Euro nicht aufbringen, um sich die chinesischen grünen Turnschuhe zu kaufen. Andere Frauen bieten ein paar Kräuter aus den Bergen oder Zuckerrohrstangen zum Verkauf an. Die vielen Garküchen der kleinen Stadt laufen wahrscheinlich am besten. Ein sommerlicher, sonniger Tag geht zu Ende.
Wind- und Regenbrücke in einem Dong-Dorf, Guizhou
Ein Reisfeld wird gepflügt, Guizhou
Mit meinem geputzten Flöhchen wünsche ich mir nun eine Asphaltstraße. Im Sonnenschein radele ich über die Brücke zurück und geradeaus durch die Ebene von Rongjiang. Alte Dorfkomplexe breiten sich aus, einige mit dreistöckigem Turm. Ich surre über den Asphalt, merke aber schnell, dass die Himmelsrichtung nicht stimmt. Die Strecke verläuft nach Nordosten und führt nach Liping. Da will ich aber gar nicht hin, es sei denn, die Teerstraße ginge nicht in Schotter über. Ich radele weiter und bin gespannt! Am Ende der Ebene steigt die Straße an, macht einen Rechtsbogen und – Schotter fängt an! Nein, dann fahre ich lieber nach Rongjiang zurück und auf der anderen Seite wieder hinaus.
Mein Weg führt weiter am Duliu Jiang entlang. Das Flusstal wird enger, doch noch ist die Piste ohne große Steigungen zu befahren. Dafür ist der Belag extrem schlecht, noch schlimmer als Kopfsteinpflaster. Manchmal schiebe ich über die spitzen Steine, um Flöhchen zu schonen. Am Fluss tauchen immer wieder flache Stellen auf, Wiesenstücke, auf denen ich zelten könnte. Das Wasser steht hier und da ruhig und still wie ein See. Alle halbe Stunde knattert ein Lkw vorbei und wirbelt Staub auf. Die Temperaturen sind wie im Hochsommer auf vierunddreißig Grad Celsius in der Sonne gestiegen. Ein paar schöne Dörfer liegen auf beiden Uferseiten. Die Bewaldung nimmt zu, viele Leute sind nicht unterwegs.
Vom ewigen Rütteln tun mir die Schultern weh. In dem kleinen Dorf Xingua angekommen, finde ich eine einfache Unterkunft für fünf Yuan. Neben den Holzhäusern sind neue Steinhäuser entstanden, andere werden noch gebaut. In der Herberge gibt es eine kalte Dusche über dem Stehklo, kein Problem bei den sommerlichen Temperaturen. Das Restaurant zu ebener Erde ist der Treffpunkt der Dorfbewohner, sie kommen in den späten Nachmittagsstunden und gucken bis spätabends fern, einen eigenen Fernseher scheint hier noch niemand zu haben.
Am nächsten Morgen ist Bewölkung aufgezogen. Die Temperaturen sind auf neun Grad Celsius gefallen! Die Luft riecht nach Regen. Schon früh sitze ich auf dem Fahrrad und begebe mich auf die Holperpiste. Im nächsten Dorf frühstücke ich. Die Leute am Tisch freuen sich, eine Ausländerin auf verstaubtem Fahrrad zu sehen. „Nihau! Nihau! Guten Tag!“, erschallt es aus allen Ecken. Eine ältere Frau wirft mir eine Kusshand zu, als ich mich verabschiede. — Die Hände werden kalt, und unter die dünne Stoffhose ziehe ich bald eine lange Unterhose. Das Mittagessen ist heute umsonst. Mit fünf Mädchen und einem einbeinigen Mann sitze ich um einen zylinderförmigen, mit Briketts beheizten Ofen, auf dem in einer eisernen Schale Tofu und Gemüse kochen, scharf gewürzt. Wir sitzen auf Schemeln und Fußbänkchen, jeder hält eine Schale Reis in der Hand, und gemeinsam essen wir aus der großen Schale auf dem Ofen. Die Erwachsenen versuchen, die gaffenden Schulkinder zu vertreiben, ohne viel Erfolg. Wie alt ich sei, will man wissen, ob ich Kinder habe, warum ich kurze Haare hätte und keinen Knoten auf dem Kopf. Auf meine witzigen Gesten hin lachen alle. In einem chinesischen Magazin zeigen sie auf das Foto einer Frau mit einer langen Nase. Ich zeige auf meine, und alle lachen wieder fröhlich.
Auf dem Markt in Rongjiang, Guizhou
Landschaft in Guizhou
Schon gegen fünfzehn Uhr erreiche ich Sandu, eine klitzekleine Stadt. Am Ortsrand entstehen Neubauten, die man, wie es in China üblich ist, weiß kachelt. Im Zentrum stehen ältere, graue Häuser. Schnell finde ich ein Hotel. Auch hier bringen mir die Angestellten Wohlwollen entgegen. Eine der drei Frauen lädt mich ein, mich an einem glühenden Holzkohlebecken hinter der Rezeption aufzuwärmen. Jeder möchte meinen Pass in den Händen halten und ihn durchblättern. Die Anmeldung dauert lange, weil niemand weiß, wie das Anmeldeformular ausgefüllt werden muss. Aber ich sitze ja warm und versuche, so gut es geht, zu helfen. Ich gebe zwanzig Yuan, aber die Frauen möchten vierzig. Für vierzig Yuan bekäme ich ein Doppelzimmer. Ein Schlafsaal genüge mir auch, mache ich ihnen klar. Okay, nun bekomme ich ein Doppelzimmer für zwanzig Yuan. Es ist mit einem Farbfernseher, zwei Sesseln, einem abgetretenen, roten Teppich und einem Badezimmer ausgestattet. Eine der Frauen läuft mit und zeigt mir die Dusche. Das Wasser ist heiß, der Komfort kennt keine Grenzen.
Am Abend fällt der Strom aus und das Zimmermädchen bringt mir eine Kerze. Kurz darauf ruft sie mich erneut zum Aufwärmen an das Kohlebecken an der Rezeption. Eine ältere, mütterlich aussehende Frau geht anschließend mit in mein Zimmer und schlägt die Schlafdecke zurück. Alle sind um mich besorgt.
Heute ist Frühlingsanfang. Noch ist es bewölkt, aber es ist heller als gestern. Eine Asphaltstraße führt aus Sandu hinaus, geht aber leider in Schotter über – und was für Schotter! Felsen und Steine ragen aus dem Lehmboden. Die Straße wird gerade ausgebaut und erweitert. Wahrscheinlich soll sie später asphaltiert werden. Die Einfassungen aus Beton sind weitgehend gegossen. Teilweise sind zwanzig Zentimeter hohe Lagen aus Felsen und Steinen gelegt. Dazwischen gibt es von den Lkws gezogene Spuren. Kilometer um Kilometer setzt sich dieses Desaster fort. Ich schiebe und schiebe, manchmal auch bergab. Fahrzeugen droht ein Achsenbruch.
In Wellen führt die Piste höher und höher. Immerzu denke ich, nun ist es geschafft! Nein, nur kurz radele ich bergab, um erneut bergan zu schieben. Je höher es geht, umso schöner wird die Sicht über die Reisterrassen, über Hügel, Dörfer und die zerklüfteten Bergwände in der Ferne. Die Frauen in den Dörfern tragen schwarze und dunkelblaue Kleider, die mit bestickten Bändern verziert sind. Silberplaketten, an denen eine dreieckige Schürze baumelt, hängen über der Brust. Eine einer Zipfelmütze ähnliche Kopfbedeckung sitzt auf dem Haupt, die Füße stecken in roten oder grünen Wollstrümpfen. Die Frauen sind sauber gekleidet und machen einen gesunden Eindruck. Ab und zu begegnen mir Karren, die von kleinen Pferden gezogen werden.
Nach fünfundzwanzig Kilometern habe ich eine Höhe von etwa neunhundert Metern und ein kleines Plateau erreicht. Die Piste wird flacher, steigt aber weiterhin leicht an. Kiefernwälder, deren Böden mit Gras bedeckt sind, säumen den Weg. Die hohe Bergkette zur Linken ist hauchfein mit Schnee bestäubt. Die Temperaturen sind auf vier Grad Celsius gefallen. Ein eisiger Wind weht mir von Norden entgegen. Endlich bin ich oben. Fünf Stunden lang habe ich nun schwer gearbeitet, viele Kilometer habe ich geschoben.
Danzhai, eine winzige Stadt, liegt oben am Berghang. Eine zwölfprozentige Steigung ist zu überwinden. Ich schiebe eine Einbahnstraße hoch, erreiche den Ort, und ein junger Mann führt mich eine steile Gasse hinauf zu einem Hotel. Fünfzig Yuan verlangt der Angestellte für ein Doppelzimmer, dann dreißig, und schließlich gibt er mir ein Bett im Dreibettzimmer für fünf Yuan. Darüber bin ich maßlos erstaunt. Für chinesische Verhältnisse ist das Zimmer sogar gemütlich. Der Fußboden ist mit Steinplatten belegt. Neben dem Bett steht ein Nachttisch, über dem eine Lampe hängt. Eine Dusche kann ich für den Preis nun allerdings nicht erwarten, auch keinen Fernseher. Es ist eiskalt. Ich gehe noch eine Nudelsuppe essen. An einer glühenden Kohleschüssel aus Porzellan, die neben dem Tisch im Restaurant steht, wärme ich mich auf. Danzhai liegt eintausend Meter hoch.
Der Atem steht am nächsten Morgen in der Luft. Lustlos gucke ich in den grauen Tag. Schließlich steige ich aus dem warmen Schlafsack, packe und mache mich auf den Weg. Ein paar Regentropfen fallen. Bei dem netten, älteren Ehepaar von gestern gehe ich frühstücken. Ich solle bleiben, meint der Mann, es gäbe Regen. Ob ich auch Handschuhe und Mütze hätte. Ich zeige ihnen meine Kapuze und Handschuhe, die ich aus den Tiefen der Tasche geholt habe, und sie sind zufrieden. Heute bin ich warm verpackt.
Nach einer drei Kilometer langen Abfahrt fängt die elende Schotterstraße wieder an. Ich komme mir vor wie auf einem sturmzerzausten Ozean im Kampf gegen die rauen Wellen. Den ganzen Tag über setzt sich die Achterbahnfahrt fort. An einer Stelle mühe ich mich fünf Kilometer bergauf und erreiche eine Höhe von tausendeinhundert Metern. Die Temperaturen sind auf zwei Grad Celsius gesunken. Weicher Schnee umhüllt die Kiefernnadeln der Bäume am Straßenrand, die schwer in der eisgrauen Luft hängen.
Im nächsten Dorf findet gerade ein großer Sonntagsmarkt statt. Ich genehmige mir dort einen „chinesischen Berliner“, gedämpftes Brot mit Zuckermasse gefüllt, und schaue dem Treiben auf dem Markt zu. Außerhalb des Ortes kommen mir viele Pferdekarren entgegen. Es sind flache, zweirädrige Gefährte, die heftig wippen. Die Besitzer stehen wie griechische Wagenlenker darauf und fallen nicht herunter. Die ponyähnlichen, schlanken Pferde traben mit hoher Geschwindigkeit bergab. Fasziniert schaue ich zu.
Die Landschaft verschwimmt im Dunst. In Wellen folgt die 321 dem oberen Plateaurand in tausend Meter Höhe, führt hinunter zu einem dampfenden See und fällt schließlich steil bergab durch ein enges, bewaldetes Tal. Unten liegt Duyun, eine ausgedehnte Stadt, die aus Funktionsbauten besteht. Sie ist grau wie das Wetter. Ein Radfahrer grüßt mich freundlich und ich frage ihn nach einer Bleibe. Er fährt voraus. Ein paar Hundert Meter weiter erreichen wir ein Hotel gegenüber einer Steinpagode, die an der anderen Uferseite steht. Die Angestellte bietet mir ein Zimmer für einhundert Yuan an. Eine Preisliste auf Chinesisch hängt an der Wand und ich zeige auf die Zahl zwanzig. Überraschung! Für den Preis bekomme ich ein Doppelzimmer mit Bad und kleinem Farbfernseher. Alte Sessel stehen an der weiß getünchten Wand auf dem Estrichboden. Eine wirklich heiße Dusche wärmt mich auf.
Am nächsten Tag sind die Straßen nass von der in der Luft hängenden Feuchtigkeit. Ich zahle für eine weitere Nacht und schlendere am Fluss entlang durch Duyun. Die Steinpagode und das rote, alte Brückenhaus über dem Fluss leuchten im Grau des Tages. In den belebten Marktstraßen hängen an den Fleischständen bleiche Hunde mit starren Beinen an Haken neben Schweinefleisch zum Verkauf. In dieser Gegend Chinas drapiert man die als delikat geltenden Hinterteile und Beine der Hunde auch auf den Theken der Restaurants. Durch die Straßen stromern Obdachlose, deren schmutzige Gesichter und Kleidung sich dunkel vom trüben Licht des Tages abheben. Sie ähneln Bergleuten, die gerade aus dem Schacht gekommen sind. Vielleicht schlafen sie in der entsetzlichen Kälte auf warmer Kohlenasche, um nicht zu erfrieren.
Das Wetter bleibt weiterhin trostlos. Wie gestern Morgen sind die Straßen nass, Dunst und Nebel hängen tief. Trotzdem fahre ich los und folge vorsichtshalber der Ausschilderung nach Guiyang, der Hauptstadt der Provinz Guizhou. Diese Strecke ist erheblich weiter, aber ich möchte unter keinen Umständen mehr auf Schotterstraßen radeln, vor allen Dingen nicht bei dem schlechten Wetter. Den ganzen Tag über folge ich den Wellen der Landschaft auf einer mit Schlaglöchern durchsetzten Asphaltstraße, trotzdem freue ich mich über die Teerdecke! Ein Schmierfilm bedeckt die Straße und bald auch mein Fahrrad, meine Schuhe und meine Hose. Nur die gelben Rapsfelder und ab und zu ein paar blühende Mandel- und Obstbäume hellen den Tag auf. Ansonsten ist das Wetter deprimierend, meine Stimmung auf dem Nullpunkt. Die Straße verläuft schließlich in der Nähe der Eisenbahnlinie, die die kleinen Täler auf Viadukten überwindet.