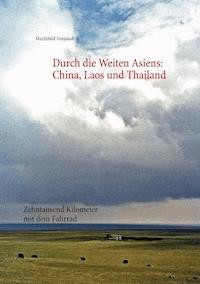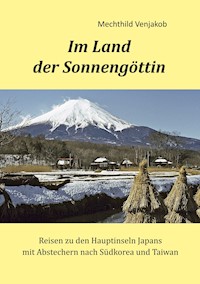8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine Reise über Land von Laos nach Deutschland, ein Traum, den Mechthild Venjakob verwirklichte: Fast zwölftausend Kilometer radelte sie durch Laos, China, die Mongolei, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland. Rund sechstausend Kilometer saß sie in der Transsibirischen Eisenbahn von Ulan Bator nach Moskau. Auf dem Qinghai-Tibet-Plateau erlebte sie eisige Kälte, in der Wüste Gobi Hitze, Durst und die tiefste Stille ihres Lebens. Begeistert erzählt sie von Moskau und St. Petersburg. Sie besuchte die Baltischen Staaten und zeltete in den Wäldern Polens. Nach neun Monaten erreichte sie ihr großes Ziel, ihre Heimatstadt Paderborn. Zahlreiche Reisefotos veranschaulichen ihren packenden Reisebericht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Autorin
Mechthild Venjakob, 1943 in Paderborn geboren, war fünfzehn Jahre als Lehrerin im Schuldienst tätig. Als Auslandsschullehrerin verbrachte sie zwei Jahre in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Dort düste sie in den Ferien mit ihrem VW-Käfer durch die Anden Südamerikas, durch Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und Kolumbien. Sie kehrte nach Deutschland zurück, unterrichtete noch fünf Jahre im Ruhrgebiet, kündigte den Schuldienst 1981 und löste ihre Wohnung auf, um sich die nächsten zwanzig Jahre dem Reisen zu widmen.
Sie nahm Züge und Busse, wanderte im Himalaja und in den Rockies und machte große Fahrradtouren durch Indien, Laos, Pakistan, Japan, China, durch Europa und durch die USA. Hilfsarbeiten in Australien, Neuseeland, Alaska, Colorado und England halfen ihr in den ersten zehn Jahren ihres Reiselebens über die Runden. Dann unterrichtete sie Deutsch als Fremdsprache an Instituten in Bremen, Hongkong und in Südkorea.
Im Jahr 2000 kehrte sie über Land von Laos nach Deutschland zurück, davon 12700 Kilometer mit dem Fahrrad. Sie ließ sich in ihrem Geburtsort Paderborn nieder, um über ihr Leben nachzudenken, das fantastischer war als ein Traum, den manch einer träumt.
Inhaltsverzeichnis
V
ORWORT
L
AOS
—
KLEINES
L
AND AM
M
EKONG
Vientiane, die Hauptstadt — dörflich und verschlafen
Nach Vang Vieng im Karstgebirge
Königliches Luang Prabang
Zur laotisch-chinesischen Grenze
C
HINA
: V
ON
S
ÜDEN NACH
N
ORDEN
Yunnan — Im Land „Südlich der Wolken"
In
der Heimat der Dai
Hohe Berge und tiefe Täler auf dem Weg nach Kunming
Kunming, die „Stadt des ewigen Frühlings"
In Sichuan — am Fuße des höchsten Plateaus der Welt
Auf langem Weg ins Dadut-Tal
Die Flügel beschnitten
Von Wachtürmen und heiligen Plätzen
Wieder unterwegs
Eisige Zeiten auf dem Qinghai-Tibet-Plateau
Von Klöstern und Kälte im Grasland: Kangmar und Aba
Kurz vorm Scheitern
Endspurt: Nach Xining
Nordchina, Geschichten vom Wind:
Gansu und Ningxia: Gelbes Land am Gelben Fluss
Durch die Innere Mongolei: Baotou, Hohhot und zur chinesisch-mongolischen Grenze nach Erenhot
D
IE
MONGOLEI —
IM
L
AND DER
REITER
Die Mongolische Republik
Durch die Wüste Gobi nach Ulan-Bator
Der Grenzübertritt: von Erenhot nach Zamyn Uud Hitze, Durst und Wüstensand auf dem Weg nach Ulan Bator
Die Fahrradtour zum Khorgo-Thek-Nationalpark
IM RIESENREICH RUSSLAND
Mit dem Schmuggelzug von Ulan -Bator nach Moskau
Moskau
Mit dem Fahrrad von Moskau nach St. Petersburg
St. Petersburg und Schloss Peterhof
D
URCH
DAS BALTIKUM
Estland mit Tallinn und Pärnu
Lettland mit Riga
Litauen mit Vilnius
DURCH POLEN
NACH
DEUTSCHLAND
Immer geradeaus
Endspurt nach Paderborn
N
ACHWORT
A
NHANG
Die Etappen im Überblick
Dank
Weitere Bücher der Autorin
VORWORT
Die Sonne steht tief. Ihre goldenen Strahlen bringen den Smog, der Bangkok einhüllt, zum Leuchten. Umtost vom Verkehr in den Straßen radele ich mit meinem bepackten Fahrrad zum Hauptbahnhof, um den Zug nach Nong Khai am Mekong zu nehmen. Der große Strom Asiens bildet an dieser Stelle die Grenze zwischen Thailand und Laos, meinem nächsten Reiseziel.
Neben mir knattern Tuk-Tuks, die dreirädrigen Autorikschas des Landes. Sie verpesten mit ihren schwarzen Abgasen die Luft. Busse und Pkws dröhnen. Meterweise schieben sie sich vorwärts. Die motorisierten Fahrer hupen. Meine Augen jucken und tränen. Irritiert trete ich in die Pedale und halte die Luft an, nicht nur, weil sie so schlecht ist, sondern auch, weil ich Sorge habe, unter die Räder zu kommen. Die Tuk-Tuk-Fahrer und ich schlängeln uns durch den Stau. Wir überholen alle und sind am schnellsten. Und ich bin, glaube ich, am gefährdetsten. Endlich erreiche ich die rettenden Hallen des riesigen Bahnhofs und steige bald in den Nachtzug, der mich in zwölf Stunden nach Nong Khai bringt.
Ich bin ein bisschen traurig, Thailand zu verlassen. Wehmütig blicke ich zurück auf eine schöne Zeit. Ich erinnere mich an die vielen freundlichen Menschen, denen ich begegnet bin, an Übernachtungen in traditionellen, behaglichen Gästehäusern aus Holz, an meine dreitausend Kilometer lange Radtour durch Nordthailand, an die weißen Sandstrände des Südens und an bunte Tempel und Klöster unter Palmen und tropischer Sonne. Ob ich Thailand jemals wiedersehen werde, ist ungewiss.
Die vergangenen sechs Jahre und acht Monate hatte ich in Asien verbracht. 1994 flog ich mit meinem damaligen Freund nach Indien. Unsere Radtour führte uns von Indien über Pakistan nach China. (Siehe: Auf alten Handelsrouten). In Hongkong und Südkorea unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache. Mehrere große Fahrradtouren führten mich erneut durch China zum Jangtse und zum Gelben Fluss, durch Wüsten und über das höchste Plateau der Welt, das Qinghai-Tibet-Plateau. (Siehe: Vom Südchinesischen Meer auf das höchste Plateau der Erde/Durch die Weiten Asiens: China, Laos und Thailand). Ich besuchte Japan und Taiwan (Siehe: Im Land der Sonnengöttin), Malaysia, Singapur, Indonesien, Borneo und die ausgedehnten Ruinen von Angkor Wat in Kambodscha, deren Steinquader moosbegrünt, verwittert, mächtig und geheimnisvoll im überwuchernden Dschungel liegen.
Insgesamt waren zwanzig Reisejahre vergangen. 1981 gestartet, war ich meistens unterwegs gewesen. Auch wenn ich arbeitete, lebte ich provisorisch und befand mich gewissermaßen auf der Durchreise. Inzwischen war ich 57 und ergraut. Das ewige Fernweh, das mich von Jugend an begleitet hatte, war verebbt. Ich hatte genug gesehen und erlebt. Das Verlangen nach einer gemütlichen Wohnung war in letzter Zeit immer stärker geworden. Ich wünschte mir ein eigenes Plätzchen. Ich wollte sesshaft werden.
Nach den vielen mehrmonatigen Fahrradtouren der vergangenen zwei Jahrzehnte nahm ich jetzt die letzte große in Angriff. Mit meinem Fahrrad wollte ich über Land zurück nach Deutschland. Das war mein Traum. Wie ich das im Einzelnen bewerkstelligen sollte, wusste ich nicht. Es musste sich finden. So hatte ich es immer gemacht, die Richtung, in die es gehen sollte, peilte ich über den Daumen an, viel mehr nicht. Das Ungefähre ließ viele Möglichkeiten offen, die bei fester Planung nicht mehr existieren würden. Ich liebte die Fahrten ins Blaue. Sie waren abenteuerlich und mit einem Gefühl der Freiheit verbunden. Manchmal ergaben sich ungeahnte Wendungen.
Zunächst wollte ich durch Laos und dann weiter durch China fahren. Würde mir radelnd eine Ausreise nach Kasachstan oder in die Mongolei gelingen? Das hinge davon ab, ob ich ein Visum für das jeweilige Land organisieren konnte. Aber wo? Wenn das außerhalb der Hauptstadt nicht klappte, müsste ich von Peking aus das Flugzeug nach Europa nehmen, das war mir klar, denn zurückradeln würde ich sicherlich nicht.
Jetzt stand ein Jahrtausendwechsel bevor. Dem chinesischen Horoskop nach war das kommende Jahr 2000 das Jahr des Drachen. Der Drache war im alten China das Zeichen des Kaisers und des Himmels, ein Symbol der Macht und des Glücks. In diesem Sinne konnte das Jahr 2000, auf das die Welt zusteuerte, für mich nur ein gutes und herausragendes werden, der krönende Abschluss meines langen Reiselebens.
LAOS – KLEINES LAND AM MEKONG
29.12.1999–19.01.2000
Pha That Luang, der Große Heilige Stupa, Vientiane, Laos
Vientiane, die Hauptstadt – dörflich und verschlafen
Am frühen Morgen steige ich aus dem Zug, schwinge mich in den Sattel und radele zur Freundschaftsbrücke über den Mekong, die Thailand und Laos verbindet. „Halt! Stopp!“ Ein Uniformierter verbietet mir die Weiterfahrt. Ich müsse einen Bus nehmen, um auf der anderen Uferseite Laos betreten zu dürfen. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Dreimal fährt ein Minibus vor und lädt Grenzgänger ein. Mein Fahrrad ist zu sperrig für den kleinen Bus. Lange warte ich auf einen großen. Endlich kommt einer. Ich hebe Fahrrad und Gepäck in den Gang. Wir fahren über die Brücke und ein wenig später steige ich vor einem laotischen Zollhäuschen aus. Ein Beamter drückt für fünfzehn US-Dollar ein fünfzehntägiges Visum in meinen Pass. Es kann losgehen! Die Sonne scheint, ein angenehmer Wind streicht durch mein Haar. Ich fahre durch die tiefgrüne Landschaft der Tiefebene, die Vientiane umgibt. Der Nordostmonsun der Wintermonate sorgt zurzeit für ein trockenes und kühles Klima im tropischen Land. Am Mittag erreiche ich Vientiane, die Hauptstadt von Laos.
Das kleine buddhistische Land ist mir bereits vertraut. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln hatte ich es vor zwei Jahren von Norden nach Süden durchquert. Ich besuchte damals die alten Königsstädte Luang Prabang und Vientiane und im Süden Pakxe und die Khmer-Ruinen von Champasak.
Laos ist ein kommunistisches Land. 1975 beendeten die Anhänger der Pathet-Lao-Partei die Herrschaft der Könige. Sie riefen die Laotische Demokratische Volksrepublik aus. Vier Jahrzehnte hatte ihr Untergrundkampf gegen die königlich-laotische Streitmacht gedauert, die zuerst von den Franzosen unterstützt wurde und später, nach der Niederlage der Franzosen im ersten Indochina-Krieg, von den USA. Nach der unblutigen Revolution flohen viele Einwohner nach Thailand oder in den Westen. Sie hatten Angst vor Repressionen. Doch wie ich es schon beobachtet hatte, dürfen die Laoten nach wie vor ihre Religion ausüben. Der Glaube scheint ihnen ohnehin wichtiger als jede Ideologie zu sein. Sie entzünden Räucherstäbchen auf ihren Hausaltären, besuchen die vielen Tempel in Städten, Dörfern und Klöstern und auf den Straßen leuchten die orangeroten Roben der Mönche.
Im vergangenen Sommer war ich im Saylom Yen Guest House in der Saylom Road gewesen, um dort zu übernachten und mir ein neues Visum für Thailand zu besorgen. Seine Zimmer mit Veranden liegen um einen Innenhof, Tische und Bänke laden draußen zum Sitzen ein. Nebenan gibt es in einem kleinen Restaurant frische Baguettes mit Omelett, meine Lieblingsspeise in Laos.
Vientiane wirkt dörflich und verschlafen. Hochhäuser oder gar Wolkenkratzer gibt es nicht. Große, von weiß getünchten Steinmauern umgebene Tempelanlagen ziehen sich an den staubigen Straßen hin. Auf den hohen, gekalkten Tempelwänden ruht ein steiles Dach. Die Architektur erinnert, was Höhe und Größe anbelangt, an Kirchen Europas. Vientiane setzt sich aus mehreren Siedlungen zusammen, die sich jeweils um einen Tempel gruppieren.
Das Wahrzeichen des Landes liegt außerhalb der Stadt: Pha That Luang, ein fünfundvierzig Meter hoher Stupa. Vor zwei Jahren hatte ich ihn besucht. Ein überdachter Wandelgang, in dem ein paar verstaubte Statuen stehen, umschließt den mächtigen Stupa, der eine geschlossene Lotosblüte darstellt, das Symbol der Reinheit. Treppenaufgänge führen zu drei Terrassen hinauf. Gläubige umrunden bei Tempelfesten das Heiligtum auf den verschiedenen Ebenen. Symbolisch steigen sie auf bis zur Stufe der höchsten Erkenntnis. Schon im 3. Jahrhundert vor Christus, lange bevor Lan Xang bestand, das „Land der Millionen Elefanten“, sollen buddhistische Sendboten des indischen Kaisers Ashoka an dieser Stelle einen Knochensplitter Buddhas hinterlassen haben. Seit undenklichen Zeiten ist dieses Fleckchen Erde ein Pilgerziel der Buddhisten.
Auf einer Säule vor dem Stupa steht die Statue des Königs Setthathirat, der Pha That Luang Mitte des 16. Jahrhunderts erbauen ließ. Damals ließ eine dicke Lage Blattgold den Stupa glänzen. Chinesische Banditen sollen das Bauwerk im 19. Jahrhundert geplündert und zerstört haben. Was man heute sieht, ist in unserem Jahrhundert rekonstruiert worden. Von den vier Tempeln rund um den Stupa stehen noch zwei. In einer Ecke befindet sich der Begräbnisstupa des „Roten Prinzen“ Souvanna Vong, des ersten Präsidenten des kommunistischen Landes, der hier 1995 bestattet wurde.
Im Ho Phra Kaeo Tempel, dem Tempel der früheren Könige, heute ein Museum, stehen bis zu vierhundert Jahre alte Skulpturen. König Setthathirat ließ ihn erbauen, um dem Smaragd-Buddha, den er aus Nordthailand mitgebracht hatte, einen würdigen Platz zu geben. Diese fünfundsiebzig Zentimeter große Statue aus grüner Jade wurde von den Siamesen unter Rama I. 1779 zurückerobert. Sie steht heute im Wat Phra Kaeo im Königspalast von Bangkok, über alle Maßen verehrt von den Thailändern.
Ein interessanter Tempel in Vientiane ist der Wat Si Muang, der Tempel mit der Stadtsäule. Hier lassen sich Volksmagie und Geisterkult beobachten. Schon vor dem Tempel herrscht bunte Betriebsamkeit. An Ständen kaufen die Gläubigen Blumen und Opfergaben, um sie dem Schutzgeist von Vientiane darzubringen, der die Stadtsäule bewohnt. Zweiunddreißig Seelen oder Geister bevölkern ihrer Vorstellung nach den menschlichen Körper, über jede Körperfunktion herrscht ein Geist. Buddhastatuen stehen auf dem Hof und in der Tempelhalle. Die Gläubigen knien auf dem Boden, erbitten ihr Glück und opfern Orangen, Bananen und Reis. Räucherstäbchen rauchen, ihr Duft erfüllt die Luft.
Ich schlendere zum viertausendfünfhundert Kilometer langen Mekong, der Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam und Kambodscha durchfließt, oftmals als Grenzfluss. An der Uferpromenade baut man seit einem Jahr. Autoparkplätze legt man dort an, ich kann es nicht fassen! Die gemütlichen Hüttenrestaurants oben auf dem Damm mussten weichen. Dort saß ich oft, trank Kaffee und blickte über den Mekong hinüber nach Thailand. Wenn dort abends in den Häusern die Lampen eingeschaltet wurden, spiegelten sich ihre Lichter wie Sterne im dunklen Strom.
Die chinesische Botschaft in Vientiane ist klein und überschaubar. Der Mann und die Frau, die dort sitzen, sind freundlich und entspannt. Die ruhige Atmosphäre der Hauptstadt hat offensichtlich auf sie abgefärbt. Die junge Frau verspricht mir ein Dreimonatsvisum. Ich kann es kaum glauben. Nach Neujahr bekäme ich den Pass wieder.
Silvester, das Jahrtausendereignis, verläuft für mich sang- und klanglos. Ute, meine Zimmemachbarin, eine Deutsche, will am Neujahrstag früh in den Süden von Laos fahren und hat keine Lust, durch die Straßen zu ziehen. Allein will ich mich auch nicht umgucken. So bleibe ich im Haus, lese und schlafe dem Jahr 2000 entgegen.
Am Neujahrstag esse ich mit Rudi, meinem siebzigjährigen Zimmernachbarn, zu Mittag im kleinen Restaurant nebenan. Zur Feier des Tages spendiert er eine Flasche französischen Rotwein. Er erzählt aus seinem bewegten und schicksalhaften Leben: Sein Vater war Deutscher, seine Mutter Französin. Er wuchs in Frankreich auf und erlernte den Beruf des Bäckers. Einige Jahre war er als Fernfahrer tätig. In den Fünfzigern kämpfte er als Zweiundzwanzigjähriger im Indochinakrieg. Seine erste große Liebe, eine Vietnamesin, kam im Krieg um, seine zweite Frau, eine Französin, starb mit vierundzwanzig an Wundstarrkrampf. Mit drei Kindern stand er allein da. Seine jetzige Frau heiratete ihn trotzdem. Sie war nicht seine große Liebe, aber die Ehe hält noch immer. „Zurzeit ist sie bei Kindern und Enkelkindern in Frankreich, kommt aber bald, um mit mir durch Laos zu reisen“, sagt Rudi.
Ariel aus Israel, Ari genannt, ungefähr sechzig Jahre alt, breit, untersetzt, ein Bär, spricht Deutsch mit sächsischem Akzent. Im Gästehaus verbreitet er Fröhlichkeit und gute Laune, wann immer er auftaucht. Er zeigt mir sein Fahrrad, ein Kinderfahrrad, das er in Bangkok für zwanzig Euro erstanden hat. Es sei für kleine Menschen gebaut, meint er, aber nicht für seine Massen. Einen Schraubenschlüssel trage er immer bei sich, um die Schrauben am Lenker nachzuziehen. Mit seinen Pranken streicht er sich über seinen Stoppelschädel, der sich über einem Stoppelgesicht wölbt. Die Augen stehen eng und dunkel. Er möge Länder wie Laos, „wo die Menschen mit die Hühner schlafen gehen“, sagt er. Später treffe ich ihn in der Stadt. Er sitzt auf seinem Kinderfahrrad und stößt sich mit den Füßen ab, um vorwärts zu kommen.
Als Radfahrer möchte ich nicht unter Zeitdruck geraten. Darum beantrage ich eine Verlängerung des laotischen Visums um zehn Tage. Vor einem Jahr bekam ich eine innerhalb von zwanzig Minuten. Heute ist das anders. Ich solle um fünfzehn Uhr wiederkommen. Um fünfzehn Uhr sehe ich meinen Pass aufgeschlagen auf dem Tisch liegen. Er ist gestempelt. Aber Pustekuchen, mitnehmen darf ich ihn nicht. „Der Chef muss noch unterschreiben“, sagt die Bedienstete, „er ist gerade in einer Versammlung.“ Morgen früh um neun Uhr solle ich wiederkommen.
Am nächsten Morgen packe ich mein Fahrrad, denn ich will die große Tour beginnen. Zuerst fahre ich zur Ausländerbehörde, um meinen Pass abzuholen. Der Chef ist um neun Uhr noch nicht da, obwohl sie um acht Uhr aufmacht. Seine Unterschrift fehlt also immer noch. Im neuen Jahr herrschten neue Bestimmungen, erfahre ich: Ob ich schon im Reisebüro dreihundert Meter die Straße hinunter bezahlt hätte. Überhaupt, wenn ich den Pass heute haben wolle, müsse ich statt zwanzig US-Dollar dreißig bezahlen. – Das darf doch nicht wahr sein! – ,,Ich möchte meinen Pass sofort“, sage ich, „der Chef wollte gestern bereits unterschrieben haben! Länger kann ich nicht warten. Mein Fahrrad steht beladen im Hof!“ Heute reise ich ab, egal, ob ich die Verlängerung bekomme oder nicht. Ein Beamter begleitet mich zum Reisebüro, wo ich trotz aller Argumente dreißig US-Dollar zahlen muss. So ist das im „Lao-Visitor-Year 1999-2000“. Das Geschäft mit den Touristen hat begonnen.
Der Beamte ist, wie er mir erzählt, fünfundvierzig Jahre alt und hat drei Kinder. Als junger Mensch verbrachte er sieben Jahre in der Sowjetunion, um Russisch zu studieren. „The system in Laos is very hard“, meint er. Er würde gern in Deutschland oder Australien leben und arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Die Löhne in Laos seien zu niedrig. Zurückgekehrt ins Amt, besorgt er meinen Pass und kurz vor zwölf Uhr sitze ich auf meinem Fahrrad.
Am Plaza Hotel vorbei führt die Straße Richtung Osten zur Stadt hinaus, wendet sich nach Norden und verläuft auf China zu. Die Reisfelder liegen brach; die Stoppeln glänzen zwischen Palmen und tropischen Bäumen hell in der Sonne. Holz- und Steinhäuser, Shops und Cafés säumen die Straße. Die Temperaturen sind auf dreiunddreißig Grad Celsius gestiegen. Ein Regenschirm dient vielen laotischen Radfahrern als Sonnenschirm.
Ich mache Pause und lege mich unter einen Baum. Schnell bin ich umringt von kleinen Jungen und Mädchen. Die Mädchen, ängstlich und schüchtern, bilden eine Reihe, fassen sich an den Händen, halten Abstand und gucken mich misstrauisch an, fluchtbereit, sollte die Fremde zuschnappen und beißen. Die Jungen sehen mich auch prüfend an und geben sich dann draufgängerisch, nähern sich und rennen umher. Ein Knirps baut sich vor mir auf, strahlt mich an, zeigt auf die Gangschaltungshebel am Lenker und zählt die Ritzel am Hinterrad, ganz Fachmann. Die Kinder sind zum Knuddeln.
Ich radele weiter durch eine geschwungene Landschaft, aus der in der Ferne gezackte Bergzüge aufragen. Nach vierundsiebzig Kilometern erreiche ich Phon Hong, mein Tagesziel. In einem klitzekleinen Laden kaufe ich Wasser, lösche meinen Durst und frage nach einem Hotel. Der Ladenbesitzer wirft sein Moped an, setzt seine zwei kleinen Kinder hinten auf den Gepäckträger – festhalten! – und knattert auf einem holprigen Weg voraus, der bergan führt. Das Hotel liegt auf einem Hügel, umgeben von Rasen, Bäumen und Büschen. Von hier aus blicke ich ins Umland bis zu den Bergen im Norden, die in der untergehenden Sonne dunkel und transparent vor dem fahlen Himmel wirken. Mein Führer öffnet die Tür zu einem Schlafsaal mit fünf Betten. Zwanzigtausend Kip, etwa zehn US-Dollar, soll die Übernachtung kosten. „Nee, viertausend Kip sind genug!“, sage ich. „Mehr zahle ich nicht. Ich brauche nur ein Bett zum Schlafen und nicht fünf!“ Der Mann schließt ein Zimmer mit zwei Doppelbetten auf. Das Palaver geht weiter. Nachdem wir uns auf zehntausend Kip geeinigt haben, ziehe ich ein und der Mann fährt mit seinen Kindern zurück ins Dorf.
Die ulkige Währung des Landes ist nicht viel wert. Die Hotelzimmer in Vientiane sind in US-Dollar ausgezeichnet. Hundert US-Dollar entsprechen zurzeit etwa zweihunderttausend Kip. Die Banken händigen solch einen Betrag in Fünfhunderter-, Tausender- und Zweitausender-Noten aus, immer zehn oder zwanzig Scheine zusammengebündelt. Es ist ein schier zweckloses Unterfangen, die Packen nachzählen zu wollen. Ich weiß nicht wohin mit dem Zaster, fülle damit den Tagesrucksack und polstere die Gesäßtaschen meiner Hose.
Der ausgefranste Plastikboden meines Zimmers wellt sich, das Bad ist verdreckt und mistig, Spinnweben füllen die Ecken. Ein Heer von Ameisen schwemmt beim Duschen in den Abfluss. Offensichtlich ist hier lange Zeit niemand mehr gewesen. Bald bekomme ich Besuch. Drei etwa sieben Jahre alte Mädchen gucken sich neugierig in meinem Zimmer um. Schnell verlieren sie ihre Scheu, spielen Fangen und rennen um und über die Betten.
Braunrot lackierte Steinbänke verlaufen am Geländer der Veranda entlang, die sich ums Haus zieht. Dort stelle ich meinen Benzinkocher auf und breite Töpfe und Proviant aus, um Tee und eine Nudelsuppe zu kochen. Bevor ich mich an die Arbeit mache, werfe ich die niedlichen Kinder aus meinem Zimmer: „Ihr geht jetzt nach Hause. Es wird bald dunkel.“ Ob sie hinunter ins Dorf müssen, oder ob sie in der Nähe des Hotels wohnen, weiß ich nicht. Lachend und kreischend laufen sie davon.
Eine Frau kommt mit ihrem Mann des Weges. Vielleicht hat es sich herumgesprochen, dass eine Ausländerin in ihrem Dorfhotel übernachtet. Die beiden bleiben stehen und schauen mir eine Weile beim Hantieren zu. Die Frau entdeckt meine Zigarettenschachtel zwischen dem Krimskrams auf der Bank. Ohne zu fragen ergreift sie sie und nimmt sich gleich vier Zigaretten heraus, zwei für sich und zwei für ihren Mann. Ganz schön frech! Im „Lao-Visitor-Year 1999-2000“ ist es offensichtlich erlaubt, sich bei ausländischen Gästen zu bedienen.
Die beiden gehen. Ungestört esse ich zu Abend. Die Temperaturen sind angenehm. Orion und die Plejaden bestimmen den Winterhimmel. Der erste Tag meiner Jahrestour ist um, der erste Schritt auf einem mindestens achtzehntausend Kilometer langen Weg getan. Wie wohl mein Unternehmen im Einzelnen verlaufen wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Radwanderung nach Norden führt.
Steg über den Nam Song, Vang Vieng, Laos
Auf dem Weg zu den Höhlen in den Karstbergen, Vang Vieng, Laos
Nach Vang Vieng im Karstgebirge
Die Sonne steigt am nächsten Morgen hinter einem Bergzug auf, ruht für kurze Zeit eiförmig auf dem Kamm und ergießt ihre Strahlen wie die Glut eines Hochofens in die Ebene von Phon Hong. Die Halme der frisch bestellten Reisfelder stehen schwarz im rötlichen Lichtschein. Bodennebel füllt die kleinen Täler. In dünnen Schleiern steigt er auf und schwingt wie Tüll vor dem Gesicht der Landschaft, bevor er sich unter der magischen Wirkung der Sonnenkraft im goldenen Licht auflöst. Ich packe, setze mich aufs Fahrrad und rolle hinunter in die Ebene. In einem Marktort halte ich an und esse eine Nudelsuppe zum Frühstück. In einem Shop nebenan entdecke ich mit Sesam gewürztes Ölgebäck, hole mir zwei Teilchen und setze mich auf die Bank vor dem Haus, um diese Köstlichkeit zu verzehren. Dabei schaue ich dem morgendlichen Treiben auf der Straße zu. Frauen sitzen im gelben Staub vor ihren Restaurants, putzen Gemüse und zerhacken Fisch auf Holzstammscheiben. Busse halten, Leute steigen aus und Tuk-Tuks knattern die Straße entlang, vollgestopft mit Menschen, Säcken, Taschen und Körben. Etliche Leute hängen auf dem hinteren Trittbrett, einige sitzen auf dem Gepäck, das sich auf dem Dach türmt.
Ich schwinge mich in den Sattel und erreiche bald die Arme eines Stausees zwischen den Hügeln. Der Asphalt ist rau, die Hitze groß. Die Temperaturen sind auf vierunddreißig Grad Celsius geklettert. Weit und breit kein Baum. Nur deren Stümpfe stehen noch am Hang. Der glühende Hauch, der von der schattenlosen Straße aufsteigt, saugt meine letzten Kräfte auf. Ausgedörrt und zerschlagen trinke ich in einem Dorf zwei Flaschen Pepsi und sitze eine Weile, um mich zu erholen. Am Stand gegenüber gibt es einzeln abgepackte Kekse, fünfhundert Kip das Stück. Auch Zigaretten kann man einzeln kaufen, immer ein Zeichen dafür, dass die Menschen nur wenig Geld haben und sich nicht viel leisten können. Am Pepsi-Stand reicht mir die Verkäuferin einen Klumpen Klebereis als Zugabe. So langsam komme ich wieder zu mir.
Flach und bequem führt die Straße das letzte Stück durch die Ebene von Vang Vieng. Sie ist eingeschlossen von knubbeligen, zerklüfteten Kalksteinketten. Ein hoher, weich geschwungener Gebirgszug überragt die bizarr geformten Berge. Vang Vieng liegt östlich davon. Ich radele quer über den Flugplatz und checke in einem Gästehaus in der Nähe des Marktes ein. Es gibt warme Duschen, beileibe nicht selbstverständlich in Laos. Ich nehme eines der Zimmer im Erdgeschoss und schiebe „Tiger“, mein Fahrrad, mit Sack und Pack in den Raum. Bequemer geht es nicht!
Die Preise sind doppelt so hoch wie vor zwei Jahren. Viele neue Gästehäuser, Restaurants und ein Intemetcafé sind entstanden. In einem der Souvenirläden bietet man Textilien an, gewebte Stoffe aus Baumwolle und Seide, Tischdecken, Schals und Kissen. Töpferwaren aus Ton, Schalen, Vasen und Teller aus Bambus, Holzschnitzereien, Silberschmuck und alte Opiumpfeifen zählen zu den beliebten Andenken.
Ich schlendere zu meinem damaligen Stammlokal am Flussufer. Und wen treffe ich dort? Ari, den Bär. Sein Kinderfahrrad hat er an einen Pfahl angeschlossen. In Israel würde er Geschäfte unter der Hand machen, erzählt er mir. Welche, das verrät er nicht. Am nächsten Morgen frühstücke ich in seinem Gästehaus. Da kommt er! Er setzt sich zu mir an den Tisch. „Du hast doch sicher Kettenöl dabei!“, meint er. „Kannst du mir etwas abgeben?“ Nach dem Frühstück holt er sein Gefährt und geht mit, um sich mein teures, in Bangkok gekauftes Ol auszuleihen. Es ergießt sich auf die Kette seines Kinderfahrrads und tropft auf den Boden. Aber was will ich machen!
Ich gehe ins Sunset Restaurant. Die damals baufällige Holztreppe ist ersetzt und führt ins vergrößerte Lokal, die Veranda schwebt jetzt über dem Fluss. Neue Gästebungalows stehen auf der Rasenfläche nebenan. Eine Tasse Lao-Kaffee kostet zweitausendfünfhundert Kip statt achthundert wie damals. Die schmale Fußgängerbrücke aus Bambus, die in der Mitte des Flusses aufhörte, hat ihre Fortsetzung zum anderen Ufer gefunden. Ein Kassierer sitzt unter einem Sonnenschirm und streicht hundert Kip für die Benutzung ein. Auf der anderen Seite stehen Traktoren mit Anhängern bereit, um Touristen zu Dörfern und Tropfsteinhöhlen zu transportieren. Vang Vieng am Nam Song ist berühmt für seine Höhlen in der Umgebung. Noch liegt die unterirdische Welt unberührt, ohne elektrische Beleuchtung, ohne Stufen und Stege. Höhlenfans kommen trotzdem voll auf ihre Kosten. Sie können einen Führer anheuem, der sie mit batteriebetriebenen Lampen ausstattet und mit ihnen durch die dunklen Gänge tappt. Sie können sich wie Höhlenforscher fühlen.
Lastwagen und Traktoren mit Anhängerladung wühlen sich von Ufer zu Ufer. Sie schieben weiß schäumende Wassermassen vor sich her. Einige benutzen den seichten Fluss als Autowaschanlage. Sie fahren ins Kiesbett, seifen ihre Blechkiste ein und kippen mit Eimern Wasser über die jetzt glänzende Karosse. Einheimische stehen im Wasser, fischen mit Mistgabeln Tang vom Flussgrund und befördern ihn in fein geflochtene Körbe, die sie auf dem Rücken tragen. Kinder baden, johlen und lassen sich in Autoschläuchen den Fluss hinuntertreiben. Und wer nähert sich auf dem blauen Wasser, das von dunklen Karstbergen eingerahmt ist? Ein Berg von Mensch füllt einen Autoschlauch aus: Ariel. Vor dem Restaurant wälzt er sich ins Wasser, watschelt an Land, setzt sich zu mir ins Restaurant und genehmigt sich eine Nudelsuppe. Seine Papiere und sein Geld trägt er unter zwei Duschhauben auf dem Kopf.
Die Frau des Hauses läuft wie ich um sechs Uhr morgens durch die Dunkelheit über den Hof. Sie hat nichts dagegen, für mich ein Frühstück zuzubereiten, brät ein Omelett und macht ein Baguette warm. Ich frühstücke und schwinge mich in der Morgendämmerung auf mein Fahrrad. Dunstschleier steigen hinter den Bergen auf, Wolkenbänke schieben sich über den Himmel. Bambushütten auf Stelzen säumen den Weg. Einige sind mit Bambusstreifen gedeckt, andere mit Wellblech. Schon die Babys lernen, Ausländern zur Begrüßung zuzuwinken. Wann immer ich eine Siedlung durchradele, nimmt das Rufen und Winken kein Ende. „Sawasdee! Sawasdee! Guten Tag! Guten Tag!“ Die Kleinkinder machen große Augen. Sie sind fasziniert, wenn ich zurückrufe. Wie ein Ball, den man sich zuwirft, schallen die Rufe hin und her. Am Straßenrand duschen Leute, eingehüllt in einen Sarong, unter einem hoch montierten Wasserhahn oder waschen ihre Wäsche. Nicht überall scheint es diese Einrichtung zu geben. Einige Erwachsene und Kinder sehen schmuddelig aus.
Für eine Weile führt die Straße fast eben an den kompakten Karstbergen vorbei, bis sie über Steilstufen höher und höher aufsteigt. Manchmal muss ich schieben, dort, wo auf Schildern zehn Prozent Steigung angekündigt sind. Nach sechsunddreißig Kilometern stehe ich auf einer Anhöhe. Die Kalkberge im Rücken scheinen gewachsen zu sein und nehmen den südlichen Himmel ein. Für acht Kilometer fällt die Straße permanent ab. Wer einmal im Leben dieses schwerelose Segeln erlebt hat, diese Leichtigkeit des Seins, wird das Fahrradfahren nie wieder aufgeben, und mag es tausendmal die Hölle sein, im Regen, im Wind, wenn die Sonne brennt oder die Kälte beißt. — Flüsschen gurgeln durch den Landstrich, Bäche fließen am Straßenrand. Kleine Felder breiten sich vor abgeholzten Hügeln aus, ein Dickicht aus üppigen Gräsern und Büschen überzieht die Kuppen. In größeren Höhen wildert der Dschungel mit undurchdringlichem Blätterwerk zwischen bizarr geformten Bäumen. Mannshohe Gräser mit fein verästelten, silbergrauen Blütenständen an der Spitze wiegen sich am Straßenrand im Wind.
Am Mittag ziehe ich ins einzige Gästehaus des Straßendorfes Kasi ein. In flirrender Hitze laufe ich einmal die Dorfstraße hinauf und hinunter und sitze den Rest des Nachmittags draußen vor der Tür im Schatten eines Feigenbaums auf einer blau gestrichenen Bank. In Kasi ist der Hund verfroren. Die einzige Abwechslung bringen Überlandbusse, die hier Pause machen. Die Reisenden steigen schwitzend aus, um sich zu erfrischen. Sie betreten das Restaurant zu ebener Erde und können etwas essen und trinken. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen ab und ich schlafe gut.
In der morgendlichen Kälte von siebzehn Grad Celsius hocken die Leute vor ihren Hütten an Feuerchen, die von Holzscheiten gespeist werden, und wärmen sich auf. Einige sind in Decken gewickelt. Nebelhauch durchsetzt die Luft, Wölkchen am Himmel schweben grazil und weiß. Nach sieben Kilometern ist die Ebene zu Ende, die Straße führt ins Gebirge. Im Angesicht eines riesigen Karstberges, der die grandiose Landschaft überragt, beginne ich den Aufstieg. Unterbrochen von kurzen Gefällstrecken klettere ich hoch zum Dorf Phou Khoun. Es liegt auf einem Querhang am Ende des Tals in fast tausendvierhundert Meter Höhe. Ich blicke zurück auf Wölbungen, Buckel, Zinnen und Türme, die sich aus dunklen, schemenhaft erkennbaren Tälern in der Tiefe in den weiten, sonnendurchfluteten Himmel erheben.
Die Strecke von Vang Vieng nach Phou Khoun dürfte eine der markantesten und großartigsten der laotischen Bergwelt sein. Vor zwei Jahren hatte ich sie im Bus zurückgelegt und war begeistert. Jetzt, vom Fahrrad aus, wirkt die Landschaft auf mich noch gewaltiger. Die Straße windet sich in endlosen Schleifen an den Berghängen entlang. Sie steigt weiter an. Endlich habe ich den höchsten Punkt erreicht.
Die Schatten sind lang geworden. Ein Stück radele ich bergab. Hinter einer halb verfallenen Hütte am Straßenrand schlage ich das Zelt neben einem Strauch auf einer Wiese auf. Von hier aus schweift mein Blick über die tiefer gelegene Bergwelt im Osten, weit wie ein Meer. Hinter dem westlichen Gebirgszug ist die Sonne verschwunden. Die Mondsichel leuchtet wie eine Silberschale am schwarzen Firmament und ein glanzvoller Sternenhimmel ergießt sich über den einsamen Fleck hoch oben in den Bergen.
Ich koche Tee und Kartoffelbrei mit Thunfisch und da ich zu faul oder, besser gesagt, zu müde war, den Wassersack im letzten Dorf zu füllen, kann ich die Salzkruste, die die Haut überzieht, nicht abwaschen. Der Transport des zusätzlichen Gewichts wäre bergauf zu mühsam gewesen. Weil das Wetter gut ist, spanne ich nur das Innenzelt. Kondenswasser schlägt sich an den Wänden nieder und der Schlafsack wird klamm! Als erfahrener Camper hätte ich es besser wissen müssen. Aber trotzdem: Wie gut die kühle, frische Luft riecht und schmeckt!
Der Tag beginnt mit der ersehnten Abfahrt. Nach schon acht Kilometern geht sie über in eine Panoramastraße, die an den oberen Hängen entlangführt. Sie verläuft auf und ab durch Dörfchen, die sich auf Bergrücken ausbreiten. Die Gefällstrecken bringe ich immer schnell hinter mich, das Erobern der vielen Steigungen dauert länger. Es zehrt an meinen Kräften. Die Sonne brennt, Es ist bald Mittag. In Kau Cham halte ich an, um mich zu erholen. Dort stehen Bambushütten zu ebener Erde oder auf Stelzen. Durch die offenen Türen kann ich ins Innere blicken. In manchen Hütten ist der Erdboden zu erkennen, andere sind mit Matten ausgelegt. Am Rande des Dorfplatzes gibt es sogar eine Post. Gegenüber liegen Läden und Restaurants. Nachdem ich eine Nudelsuppe gegessen habe, bin ich hungriger als zuvor. Ich bestelle mir eine Gemüsesuppe mit einer Portion Klebereis und werde halbwegs satt.
Klebereis ist das Hauptnahrungsmittel in Laos. Der Stärkeanteil dieser Reissorte ist so hoch, dass die Reiskörner beim Kochen zusammenkleben. Man isst den Reis mit den Fingern. Auf dem Markt und in den Restaurants serviert man ihn in zylinderförmigen Körbchen mit Deckel.
Lkw-Fahrer und Buspassagiere machen in diesem Nest Rast zum Essen. Darunter sind westliche Rucksackreisende, die sich müde und steif die Beine vertreten. Wie schön, dass ich nicht im engen Bus sitze, denke ich. Die Leute wissen gar nicht, was sie verpassen, wenn sie nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Ein Stückchen hinter Kau Cham stehe ich auf dem Pass. Jetzt erfolgt die Belohnung auf meine morgendliche Schufterei in der Affenhitze des heutigen Tages. Die Route fällt für einundzwanzig Kilometer ab. Die wie ein Sturzflug wirkende Fahrt endet an einer Flussbrücke tausend Höhenmeter tiefer. Ein paar Hütten stehen hier. „Sawasdee!“, ertönt es aus offenen Türen und Fenstern.
Während der Abfahrt ins Tal erblicke ich die Straßenschneise auf der anderen Flussseite hoch oben in einem Querhang. „Das ist dein Weg! Garantiert! Da oben musst du wieder hin. Alles, was ich an Höhe verloren habe, muss ich wieder hinauf", denke ich entsetzt. Und richtig, dorthin führt mein Weg! Bald geht es wieder bergan, aber die Straße ist exzellent begradigt. Rhythmisch und gleichmäßig trete ich in die Pedale und gewinne an Höhe. Es ist heiß, obwohl die Sonne ihren höchsten Punkt schon lange überschritten hat. Streckenweise werfen die Hänge schützende Schatten über den Asphalt. Auf dem Pass angekommen, blicke ich über eine gerundete Bergwelt im Spätnachmittagslicht. Gebirgszüge und Einschnitte verlaufen in alle Himmelsrichtungen. Ein Berg in Gestalt eines Dinosauriers mit Wulst- und Stachelmassen überragt alle anderen. Und zum zweiten Mal sause ich heute lange bergab.
Das Dorf Xiang Ngeun liegt nur noch dreihundertfünfzig Meter hoch. Die Dämmerung setzt ein. Wo soll ich schlafen? Im Laden frage ich. „Ein Gästehaus gibt es nicht, du kannst im Privathaus gegenüber schlafen“, sagt der Kaufmann. Und wirklich, der Hausherr auf der anderen Straßenseite macht ein Zimmer frei. Eine Matratze liegt auf dem Boden. Eine Kleiderstange spannt sich von Wand zu Wand. Hosen und Hemden sind wahllos darüber geworfen oder hängen auf Bügeln. Fließendes Wasser gibt es nicht. Der freundliche Besitzer stellt einen Eimer kaltes Wasser aufs ungepflegte Lao-Klo. Ich stelle mich über die Hocktoilette und schütte es mir über den Kopf.
Beim Abendessen sitze ich auf einem Stühlchen vor dem Restaurant im Holzhaus nebenan. Der Koch brät Nudeln mit Gemüse auf einem Holzofen, schlägt ein Ei darüber und serviert mir meine reichhaltige Mahlzeit.
Xiang Ngeun macht einen idyllischen Eindruck. Steinhäuschen stehen zwischen Holzhütten. Lattenböden, die vom Straßenrand bis zu den Häuserfassaden reichen, decken die Kanalisation ab. Straßenlaternen gibt es nicht. Der Lichterschein aus den Häusern fällt auf die dunkle Straße. Kinder toben und probieren ihre Mountainbikes aus. Palmen heben sich gegen den Sternenhimmel ab. Ich gehe aufs Zimmer und das Geschrei der spielenden Kinder begleitet mich in den Schlaf.
Königliches Luang Prabang
Kurz nach Sonnenaufgang esse ich an einem Stand gebratene Bananen zum Frühstück. Gestärkt rausche ich über die leicht wellige Straße, die in der Nähe eines Flusses verläuft. Es ist neblig und kühl. Nebeltröpfchen benetzen meine Fleecejacke. Teakwäldchen, Bananenstauden und Büsche säumen die Straße.
Schon kurz vor neun Uhr erreiche ich die Königsstadt Luang Prabang. Das Jaliya Guest House, in dem ich vor zwei Jahren wohnte, hat angebaut. Die Zimmer im Hinterhof sind fertig, der Garten ist mit Topfblumen, Steintischchen und -bänken geschmückt. Die neuen, hübschen Zimmer in kleinen Bungalows kosten fünf US-Dollar. Ich nehme eins zu ebener Erde im alten Haus für zwei US-Dollar. Die junge Wirtin hat mich sofort wiedererkannt und freut sich, mich zu sehen. Sie fragt, ob mein gebrochener Arm verheilt und wo ich gewesen wäre.„Damals warst du viel dicker!“, sagt sie. „Wirklich? Das habe ich gar nicht bemerkt“, sage ich. Sie bringt mir Teewasser und nach dem Duschen schlendere ich durch die Stadt. Am Mekong und in den Straßen gibt es viele neue Restaurants und Gästehäuser.
Gegen zehn Uhr vertreibt die Sonne den Nebel und erwärmt die Luft. Ein wolkenloser Himmel überspannt Luang Prabang und die Berglandschaft am Mekong. Die braunen, glatten Fluten strömen breit durch das Tal. Die Hauptstraße verläuft am Mount Phousi vorbei, an mit Gold verzierten Tempeln und am Königspalast, heute ein Museum. Die Fassaden der französischen Kolonialbauten brillieren im Sonnenlicht, feine Restaurants, europäische Bäckereien, Souvenirshops und Gästehäuser haben sich auf Besucher aus aller Welt eingestellt. Die UNESCO hat die ehemalige Königsstadt im „Land der Millionen Elefanten“ zum Weltkulturerbe erklärt, rechtzeitig, ehe Hochhäuser den Charakter der Stadt ruinieren konnten. Häuser und Tempel sind renoviert und restauriert.
Ich steige auf den hundertfünfzig Meter hohen Phousi-Hügel. Ein Stupa mit goldener Spitze steht auf der Kuppe, am Ende eines Pfads ein kleiner Bergtempel. Mein Blick schweift über den Mekong, den Nam Kham, der in ihn mündet, und die vielen Kokosnusspalmen, unter denen sich Luang Prabang versteckt. Nur die großen Tempel mit ihren ausladenden, geschwungenen Dächern stechen hervor. Am Fuße des Hügels zeigen die Wandgemälde im Innern eines kleinen Tempels Luang Prabang als eine himmlische Stadt.
Blick auf Luang Prabang am Mekong, Laos
Wat Mai, einer der größten Tempel in Luang Prabang, Laos
Einer der größten Tempel der Stadt ist Wat Mai in der Hauptstraße. Er stammt aus dem 18. Jahrhundert. Von Anfang an stand er unter dem Schutz der Könige. Sein gefächertes Dach reicht fast bis zum Boden. Eine vergoldete Reliefwand bedeckt die Giebelseite, goldene Dekors glitzern auf rotem und nachtblauem Grund an Säulen und Decken.
Den prächtigen goldenen Stadttempel Wat Xieng Thong ließ König Setthathirat 1560 erbauen. Er liegt in der Nähe der Nam-Khan-Mündung in den Mekong und gehörte zum Königshaus. Ein „Baum des Lebens“, eine Mosaikarbeit, bedeckt die südliche Giebelseite des Haupttempels. Ein überlebensgroßer Buddha sitzt im Innenraum, umgeben von kleineren Buddhastatuen. In der andächtigen Stille klingen die Stimmen gedämpft. Nur ein Hahn kräht draußen schrill.
Im Tempelpark stehen Kapellen, die wie Grabmonumente anmuten. Stupas vor blühenden Büschen sind, wie der Haupttempel, reich mit Mosaiken verziert. In der Nähe des Osttors befindet sich die königliche Begräbnisbarke in einer Kapelle, in einer anderen stehen vergoldete, raumhohe Urnen auf einem Wagen, der seiner Form nach der Königsbarke ähnelt. Im Schatten der Bäume sitze ich in Muße und lasse die Harmonie dieses Platzes auf mich wirken.
Ich besuche den Melonenstupa aus dem Jahre 1514. Palmen umgeben ihn. Im Hof des Tempels wachsen himmelhohe Bäume. Wie in allen Tempelkomplexen der Stadt befinden sich die Kutis, die Zellen der Mönche, am Rand der Anlage. Die orangefarbenen und braunen Gewänder der Klosterbrüder hängen zum Trocknen auf Balustraden, Geländern und Wäscheleinen und bilden blendende Flecken zwischen Büschen, Tempelmauern, Himmel und Erde.
König Sisavang Vong ließ den Palast, heute ein Museum, 1904 erbauen. Dieser vorletzte Herrscher der laotischen Monarchie hatte zwölf Frauen und mindestens vierundzwanzig Kinder. Er unterhielt eine Tanztruppe, um die klassischen Tänze zu pflegen, gründete die Weberstadt Ban Pha Nom in der Nähe Luang Prabangs und richtete eine Silberschmiede ein. Außerdem lag diesem Feingeist das traditionelle Puppenspiel am Herzen. 1959 starb er.
Im Protokollraum steht ein kleiner, niedriger Thron. Im Empfangssaal nebenan hat der französische Maler Alix de Fanterau 1930 die Wände mit Szenen aus dem täglichen Leben der Laoten bemalt. Im sich verändernden Lichteinfall des Tages treten Märkte, Menschen, Tempel, Elefanten, Palmen und Pflanzen plastisch hervor, sie sollen eine Erweiterung des Raums nach draußen vorspiegeln. In den Gängen stehen große runde Bronzetrommeln, deren Zylinder sich nach oben erweitern. Die Froschskulpturen auf dem Deckel symbolisieren die ersehnte Monsunzeit, denn der Regen verspricht Leben, Fruchtbarkeit und Wohlstand. Mosaike aus japanischem Glas schmücken die Wände des Krönungssaales. Sie stellen Märchen, Legenden und Zeremonien dar. In der Mitte der Halle steht der goldene Thron, er ist noch höher als der im Protokollraum.
Die Privatgemächer sind königlich groß, ansonsten kahl und ohne Schmuck, fast bescheiden. Dem Palast dieses Jahrhunderts fehlt der Pomp der französischen Schlösser. In Vitrinen stehen Buddhafiguren und Geschenke aus aller Welt, unter anderem aus den USA, aus China und Dänemark.
In einem Tempel in einer Ecke des Schlossparks befindet sich das Nationalheiligtum des Landes, der Prabang-Buddha, eine dreiundachtzig Zentimeter große und vierundfünfzig Kilogramm schwere Statue aus Bronze, Silber und Gold. Seit Beginn der laotischen Geschichtsschreibung begleitet der Prabang-Buddha die Geschicke des Landes und gab der Stadt ihren Namen: Die „Stadt des großen Buddha-Images“.
Im ersten Jahrhundert soll die Statue entstanden sein. Im Jahr 1356 fand sie ihren Weg von Angkor, dem Zentrum des einst mächtigen Khmer-Imperiums, nach Lan Xang, dem ersten Reich von Laos. Der mit einer Khmer-Prinzessin verheiratete Fürstensohn Fa Ngum hatte es drei Jahre zuvor gegründet. Er baute seine Macht aus und sein Schwiegervater aus dem fernen Angkor sandte ihm als Zeichen seiner Anerkennung den Prabang-Buddha. Auch Mönche, Gelehrte und Künstler schickte er mit, und in Lan Xang, dem „Land der Millionen Elefanten“, breitete sich der Theravada-Buddhismus aus.
Einundzwanzig Könige folgten. Im 17. Jahrhundert zerfiel Lan Xang in drei Teile, in Luang Prabang, Vieng Chan, dem heutigen Vientiane, und in Champasak im Süden. Der dreiköpfige Elefant symbolisiert die drei Reiche einer Nation.
Im Laufe seiner Geschichte musste sich das kleine Land immer wieder wehren: gegen die Burmesen, die Könige von Siam und die Vietnamesen. Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen die Franzosen das Zepter. Sie errichteten ihr Protektorat, damit war Laos dem französischen Kolonialreich in Indochina einverleibt. König Sisavang Vong durfte in Luang Prabang residieren. Als er 1959 starb, bestieg sein Sohn Sisavang Vatthana den Thron. Er hatte nur noch eine Frau und fünf Kinder. Er war ein großer Liebhaber der französischen Literatur.
Ich halte bei einer netten, schüchternen Laotin an, die frische Fruchtsäfte für zweitausend Kip anbietet. Im Mixer bereitet sie Bananen-, Papaya-, Ananas- und Apfelshakes zu, auf Wunsch gemischt. Den Rest aus dem Mixer gießt sie nach, wenn das Glas sich leert. Auf dem Bürgersteig sitze ich auf einer gerundeten Steinbank am runden Steintisch. Der schlauchähnliche hohe Raum im Hintergrund ist dunkel, die Wände sind braun vom Alter. Hinten in der Ecke steht ein ungemachtes Bett, Krimskrams liegt herum. Von Putzwut ist hier nichts zu spüren.
Ich gehe in die Lanzxang Bank, um einen Teil eines Hundertdollar- Reiseschecks in Kip einzutauschen. Für den anderen Teil möchte ich Dollarscheine haben. Das sei leider nicht möglich, sagt die Angestellte, nur in Vientiane könne ich Dollar kaufen. — Die Bank ist voll mit Reisenden, die ihre Papierpacken abzählen. Jeder Packen besteht aus Zweitausend-Kip-Noten. Absurd! Unglücklicherweise besitze ich nur große Schecks. Ich tausche fünfunddreißig US-Dollar um, die ich noch in bar habe. Mal sehen, ob ich damit die restlichen Tage in Laos über die Runden komme.
Auf dem Morgenmarkt herrscht reges Treiben. Ein kleines Baguette mit Wurstfüllung kostet zweitausend Kip. Ich esse drei, anschließend zwei Stück Kuchen und, immer noch hungrig, eine Nudelsuppe mit Gemüse, denn am Essen darf ein Radfahrer niemals sparen. Er verbrennt, je nach Anstrengung, dreihundert bis fünfhundert Kilokalorien pro Stunde. Kein Wunder, dass ich ständig ans Essen denke. Wenn ich im Sattel sitze und der Magen fängt an zu knurren, verlässt mich ganz schnell die Kraft. Ich werde missmutig und glaube bald vom Fahrrad zu fallen.
Nicht weit vom Jaliya Guest House befindet sich ein neues indisches Restaurant. Dort esse ich zu Abend. Es gibt herrliche Fladenbrote und schmackhafte Currys. Leider sind die Portionen zu klein und esslustig trete ich vor die Tür. An einem Stand vor dem Restaurant bereitet ein Junge Bananenpfannkuchen zu, von denen ich mir einen genehmige. Ich habe vierzehntausend Kip ausgegeben und übe mich darin, mir um die Zukunft keine Sorgen zu machen, denn was sagen die Buddhisten? „Die Vergangenheit ist tot, die Zukunft noch nicht da. Lebe jetzt! Sei dir des Augenblicks bewusst! Wenn du sitzt, dann sitzt du, wenn du liegst, dann liegst du, wenn du gehst, dann gehst du, und“ – füge ich hinzu – „wenn du isst, dann isst du.“ Das indische Restaurant ist gut besucht, andere stehen leer, zum Beispiel das chinesische in der Nähe.
Mein Bargeld wird knapp. Mir bleibt nichts anderes übrig als einen großen Reisescheck umzutauschen. Da stehe ich mit einem Batzen von Kip-Scheinen! Als ich wieder auf die Straße trete, komme ich mit John, einem Engländer, ins Gespräch. Er steht am Anfang seiner Reise durch Laos und wechselt mir den größten Teil meines Kip-Segens in US-Dollar zurück.