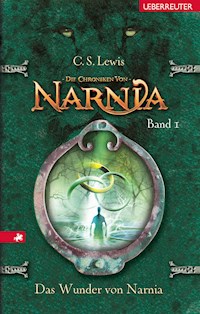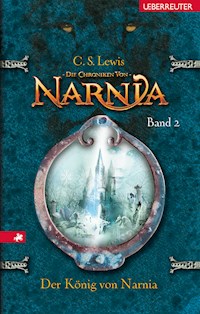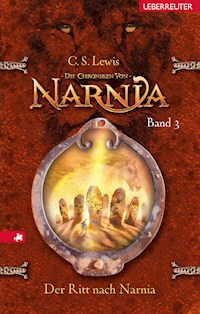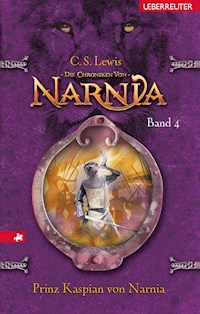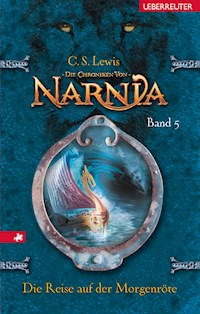Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die hier erstmals in deutscher Übersetzung vorliegenden Texte von C.S. Lewis bieten einen neuen und faszinierenden Blick auf einen der einflussreichsten christlichen Denker des 20. Jahrhunderts. Der Band versammelt Beiträge, in denen sich C. S. Lewis kritisch mit dem anti-christlichen Gedankengut seiner Zeit auseinandersetzt, Reflexionen auf die Literatur- und Geistesgeschichte des Abendlandes sowie Essays, die ein neues Licht auf seine eigenen phantastischen Werke (z.B. die "Narnia"-Geschichten) wie auch auf das Werk "Der Herr der Ringe" seines Freundes J. R. R. Tolkien werfen. Lewis erläutert zudem seine apologetische Methode und die Grundzüge seiner Auslegung der biblischen Schriften. Ausschnitte aus privaten Briefen zeugen von seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben, zu dem er erst als Erwachsener zurückgefunden hatte. Ausgewählt, übersetzt und erläutert von dem renommierten Lewis-Kenner Norbert Feinendegen, bieten diese Texte weit mehr als bloße Wege zu einem besseren Verständnis von C. S. Lewis. Sie sind hochaktuell und helfen, in einer Zeit des Umbruchs Orientierung zu gewinnen bei der Klärung der eigenen philosophisch-theologischen, geistesgeschichtlichen und literarischen Fragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C.S. Lewis Durchblicke
www.fontis-verlag.com
Siehe auch:www.facebook.com/CSLewisOfficial/www.facebook.com/CSLewisOfficialdeutsch/
C. S. Lewis
Durchblicke
Texte zu Fragen über Glauben, Kultur und Literatur
Deutsche Erstveröffentlichung von Essays, Vorträgen, Briefauszügen und Passagen aus dem Werk von C. S. Lewis,
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Published by Fontis-Verlag Basel under license from the C. S. Lewis Estate. Rights Manager: Iona Teixeira Stevens, Harper Collins, London
© 2019 by Fontis-Verlag, Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Foto Umschlag: Andrey Armyagov / Shutterstock.com Fotos im Anhang: © C. S. Lewis Estate E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-528-5
Inhalt
EINFÜHRUNG
I. Philosophisch-theologische Durchblicke
II. Geistesgeschichtliche Durchblicke
III. Literaturwissenschaftliche Durchblicke
I. PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHE DURCHBLICKE
1. Hinter den Kulissen
2. Meditation in einem Geräteschuppen
3. Hedonik
4. Gespräch über das Fahrradfahren
5. Demokratische Erziehung
6. Meine erste Schule
7. «Bulverismus» oder Die Grundlage des Denkens des 20. Jahrhunderts
8. Schreckliche rote Dinger
9. Christliche Apologetik
10. Bevor wir miteinander reden können
11. Moderne Bibelübersetzungen
12. Bibelkritik oder Auslegung der Heiligen Schrift?
13. Die Geschichte Jesu – ein wahrer Mythos
14. Über die Angst Jesu
15. Gott und das Böse
16. Gott und das Leid
17. Der Schmerz der Tiere – Ein Problem für die Theologie
18. Vivisektion
19. Über den Unterschied von Katholizismus und Protestantismus
20. Christliche Wiedervereinigung. Ein Anglikaner spricht zu Katholiken
II. GEISTESGESCHICHTLICHE DURCHBLICKE
1. De descriptione temporum
2. Die Erscheinungen retten
3. Vorstellung und Denken im Mittelalter
4. Vom Modellcharakter aller Weltbilder
5. Hierarchie
6. Das Natur- und Menschenbild der Renaissance
7. Das leere Universum
8. Eine Weihnachtspredigt für Heiden
9. Xmas und Christmas: Ein verschollenes Kapitel aus Herodot
III. LITERATURWISSENSCHAFTLICHE DURCHBLICKE
1. Bluspels und Flalansferes: Ein semantischer Alptraum
2. Was ist Dichtung?
3. Psychoanalyse und Literaturkritik
4. «Der Hobbit»
5. Tolkiens «Der Herr der Ringe»
6. Manchmal sagen Märchen am besten, was man sagen will
7. Über drei Weisen, für Kinder zu schreiben
8. Über Science-Fiction
9. Eine Replik auf Professor Haldane
Anmerkungen
Englisches Literaturverzeichnis
Anhang: Einige Fotos aus C. S. Lewis’ Leben
EINFÜHRUNG
Ein neuer C.S. Lewis? Nein, neu sind die in diesem Band versammelten Texte alle nicht. Lewis starb bereits 1963, und fast alle dieser Texte sind schon seit Jahren publiziert. Aber ja, sie sind insofern neu, als keiner dieser Texte bisher in deutscher Übersetzung vorlag. Da stellt sich natürlich die Frage: Lohnt sich eine solche Übersetzung denn jetzt noch? Hat C.S. Lewis uns heute, über 50 Jahre nach seinem Tod, noch etwas zu sagen? Und ist das, was er uns möglicherweise noch zu sagen hat, ausgerechnet in diesen verstreuten Texten zu finden, die in den bisherigen Übersetzungen seiner Werke nicht berücksichtigt wurden? Die Antwort ist ein klares: Ja, es lohnt sich!
In der Tat ist eine ganze Reihe wichtiger Texte von C.S. Lewis bisher noch nie in Deutsch erschienen. Die Gründe hierfür sind vielfältig; zum Teil handelt es sich um Vorträge und Essays, die an etwas abgelegenen Stellen publiziert wurden, oder um Abschnitte aus literaturwissenschaftlichen Arbeiten, oder um Passagen aus privaten Briefen.
Darunter befindet sich ein so grundlegender Vortrag wie «De descriptione temporum», Lewis’ Antrittsvorlesung auf dem 1954 für ihn in Cambridge eingerichteten Lehrstuhl für die Literatur des Mittelalters und der Renaissance, in der er seine Sicht der Kultur- und Literaturgeschichte des Abendlandes präsentiert.
Und darunter befindet sich «Christliche Apologetik», ein Vortrag, in dem er die Grundzüge seiner apologetischen Methode darlegt.
Dazu kommt eine Reihe kurzer philosophischer Essays (man könnte sie fast schon «Miniaturen» nennen), in denen Lewis die Grenzen der bereits zu seiner Zeit dominierenden naturalistischen Weltsicht aufzeigt und für eine offenere Wahrnehmung der Welt in all ihrer Vielfalt und Reichhaltigkeit eintritt. Er verwendet hier zwar nicht den Ausdruck «Phänomenologie», aber es ist fast so etwas wie seine eigene phänomenologische Methode, die Lewis in diesen Essays entwickelt.
Ebenfalls unter diesen Texten sind Äußerungen zu literarischen Fragen, die ein neues Licht sowohl auf seine eigenen fantastischen Werke als auch auf den Herrn der Ringe seines Freundes J.R.R. Tolkien werfen.
Die vorliegende Zusammenstellung solcher Texte von C.S. Lewis, die bisher nicht in Deutsch vorlagen, ist dabei mehr als ein bloßes Sammelsurium von Stellungnahmen zu völlig unterschiedlichen Themen; diese Äußerungen bilden unverkennbar auch gedanklich eine Einheit. Und sie bieten zudem mehr als bloße Wege zu einem besseren Verständnis von C.S. Lewis: Sie können uns auch heute noch helfen, Orientierung zu gewinnen bei der Klärung unserer eigenen philosophisch-theologischen, geistesgeschichtlichen und literarischen Fragen.
Die Überlegungen, die er seinen Lesern in diesen Texten anbietet, kommen dabei auf den ersten Blick oft recht leicht daher, sie lassen sich aber nicht selten mit den Grundfragen unseres Glaubens und Denkens in Verbindung bringen. Dieses Bemühen, über die für uns Menschen wesentlichen Dinge in allgemein verständlicher Sprache zu sprechen, hat seine Wurzel in Lewis’ Überzeugung, dass jemand, der nicht in der Lage ist, seine eigenen Glaubensüberzeugungen (ob nun religiös, philosophisch oder ästhetisch) in schlichter Sprache auszudrücken, entweder nicht weiß, was er eigentlich sagen will, oder selbst nicht hinter dem von ihm Behaupteten steht (vgl. Nr. I,9 «Christliche Apologetik» in diesem Band).
Dabei ist es erstaunlich, wie aktuell – und darum zum Teil auch herausfordernd – einige dieser Texte heute immer noch sind. In mancherlei Hinsicht kann man sie sogar als prophetisch bezeichnen: Es scheint, als habe Lewis schon zu seiner Zeit mit wachem Blick Entwicklungen wahrgenommen und auf sie aufmerksam gemacht, deren Bedeutung erst deutlich später allgemein erkannt werden sollte. Trotzdem war sein Gesprächskontext natürlich ein anderer als der unsrige heute in Deutschland, und auch das Herausgreifen einzelner Passagen aus umfangreicheren Werken von Lewis sowie die Vielzahl seiner literarischen Anspielungen macht einige erläuternde Hinweise erforderlich. Aus diesem Grund werden im Folgenden kurze Einführungen in die einzelnen Texte gegeben; zudem wurden auch die Anmerkungen an einigen Stellen deutlich über das hinaus erweitert, was Walter Hooper bei der Herausgabe der Texte im englischen Original für erforderlich hielt. An einigen wenigen Stellen wurden auch Angaben über von ihm vermutete Quellen literarischer Anspielungen berichtigt.1 Um den Lesefluss nicht zu unterbrechen und klar zwischen den Texten von Lewis und den Hinweisen des Herausgebers zu unterscheiden, werden die Einführungen den Texten gemeinsam vorangestellt. Dies heißt jedoch nicht, dass es erforderlich wäre, diese Einführungen alle gelesen zu haben, bevor man mit der Lektüre von Lewis’ Texten beginnt. Die meisten Leserinnen und Leser werden wohl eher (je nach Bedarf und Interesse) vor oder nach der Lektüre des jeweiligen Essays einen Blick auf sie werfen wollen.
Die ausgewählten Texte (die weit davon entfernt sind, den gesamten «Rest» des Werkes von Lewis in Deutsch zu präsentieren) ordneten sich bei der Zusammenstellung quasi von selbst in drei Gruppen von «Durchblicken», die nun die drei Hauptteile dieses Bandes ausmachen. Die Chronologie der Entstehung dieser Texte findet dabei ausdrücklich keine Berücksichtigung. Dies ist auch insofern nicht erforderlich, als mittlerweile als erwiesen gelten kann, dass das erwachsene (christliche) Denken von C.S. Lewis keinen wesentlichen Wandel mehr durchgemacht hat.2 Am Ende des Bandes ist ein Verzeichnis mit Ausgaben der englischen Originaltexte von C.S. Lewis angefügt.
I. Philosophisch-theologische Durchblicke
1. «Hinter den Kulissen» (engl. «Behind the Scenes») erschien zuerst in «Time and Tide» (Nr. 37, 1. Dezember 1956). Was Lewis hier als den Kontrast zwischen dem Erscheinen der Dinge und Personen auf der Bühne der Welt und ihrem Sein hinter den Kulissen unserer (stets subjektiv gefärbten) Wahrnehmung skizziert, ist nicht weniger als eines der großen Themen neuzeitlicher Philosophie. Es ist die Frage Kants, wie wir mit der Differenz zwischen Erscheinung (Phainomenon) und Ding an sich (Noumenon) umgehen sollen, es ist F.H. Bradleys Frage nach der Realität, die sich hinter dem subjektiven Erscheinen der Dinge in unserem Bewusstsein verbirgt. Lewis’ Essay ist ein Plädoyer dafür, den Begriff «Realität» nicht für jene fernen Abstraktionen zu reservieren, die wir mit den Methoden naturwissenschaftlicher, philosophischer und psychologischer Erkenntnis aus der tatsächlichen Vielfalt unserer Erfahrungen herausdestillieren. Alles ist Realität, soweit es Teil unserer Erfahrungswelt ist, und hat als solches eine Bedeutung; nichts sollte von vorneherein ausgeschlossen werden, bloß, weil es nicht in unser aktuelles Weltbild passt oder nicht mit unseren (subjektiv ausgewählten!) wissenschaftlichen Erkenntnismethoden erfasst und auf den Begriff gebracht werden kann.
2. «Meditation in einem Geräteschuppen» (engl. «Meditation in a Toolshed») erschien erstmals am 17. Juli 1945 im «Coventry Evening Telegraph». Hinter dem Kontrast zwischen dem «Sehen entlang» und dem «Sehen auf etwas» verbirgt sich die für das Denken von Lewis zentrale Unterscheidung von «enjoyment» («Genuss») und «contemplation» («Betrachtung»), die er dem Buch Space, Time and Deity (1920) des australischen Philosophen Samuel Alexander entnahm3 und die sich ganz ähnlich auch bei anderen Philosophen finden lässt. Lewis begründet in diesem Essay, weshalb unsere subjektive Weise des Erfahrens (= das Erscheinen der Dinge auf der Bühne der Welt) dem scheinbar objektiven Blick der Wissenschaften nicht unterlegen, sondern erkenntnistheoretisch vorgeordnet ist: Was die Phänomene sind, die wir in ihrem Entstehen wissenschaftlich zu erklären oder philosophisch zu deuten versuchen, wissen wir nur durch unsere Erfahrungen, und diese sind immer subjektiv. Damit nimmt er um fast 30 Jahre Thomas Nagels berühmten Essay «Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?» (1974) vorweg, der in den Debatten der Analytischen Philosophie des Geistes den Vorrang der Erlebnisperspektive des Einzelnen erkenntnistheoretisch begründete.
3. «Hedonik» (engl. «Hedonics») erschien erstmals in «Time and Tide» (Nr. 26, 16. Juni 1945). In diesem Essay wendet Lewis die Grundgedanken der ersten beiden Essays bei der Reflexion einer eigenen konkreten Erfahrung von Sinn bzw. tiefer Freude an. Auch hier zeigt sich der Vorrang, den er den Phänomenen selbst einräumt, das heißt der konkreten Erfahrung in ihrer spezifischen Qualität. Dass wir eingebettet in das Prosaische unseres Alltags immer wieder Erfahrungen von besonderer Freude machen, ist für ihn nicht weniger eine Tatsache als das wissenschaftliche Faktum, dass Wasser bei normalem Luftdruck bei 100 Grad Celsius kocht. Eine Philosophie, die es ernst meint mit ihrem Erfahrungsbezug (und den Begriff der Erfahrung nicht von vorneherein reduktionistisch auf das naturwissenschaftlich Erfassbare einschränkt), muss auch für solche Erfahrungen offen sein und sie in ihre Deutung der Welt mit einbeziehen. Lewis sagt das in diesem Essay zwar nicht explizit, aber das gilt nach seiner Überzeugung natürlich auch für unsere religiösen Erfahrungen.
4. «Gespräch über das Fahrradfahren» (engl. «Talking about Bicycles») wurde erstmals im Oktober 1946 in der Zeitschrift Resistance veröffentlicht. Die Theorie einer «Entzauberung der Welt» durch Wissenschaft und Technik der Moderne wurde 1917 von dem deutschen Soziologen und Kulturkritiker Max Weber aufgestellt und auch in der englischsprachigen Welt breit rezipiert.4 Bezeichnenderweise mehren sich heute die Stimmen, die für eine Wieder-Verzauberung (engl. Re-Enchantment) der Welt eintreten beziehungsweise eine solche bereits seit einiger Zeit im Gang sehen.5 Eben hierfür trat Lewis in diesem Essay bereits vor gut 70 Jahren ein.
5. «Demokratische Erziehung» (engl. «Democratic Education») erschien erstmals in «Time and Tide» (Nr. 25, 29. April 1944) und liefert den Hintergrund für das abschließende Beispiel aus dem vorigen Essay. Es ist erstaunlich, mit welcher Klarheit Lewis bereits die Gefahr einer permanenten Nivellierung der Anforderungen nach unten erkannte, die hinter dem (völlig berechtigten) Ruf nach Fairness oder Chancengleichheit in der Erziehung lauert. Immer weniger zu verlangen, um allen Schülern das Gefühl zu geben, gleich begabt zu sein (bzw. ohne jede Rücksicht auf das tatsächlich Geleistete das Recht auf einen guten Schulabschluss für alle zu fordern, wie das heute teilweise geschieht), hilft, so lautet die herausfordernde These von Lewis, letztlich niemandem: nicht einmal dem schwachen Schüler. Sie hilft ihm deshalb nicht, weil sie um den Preis einer falschen Selbstwahrnehmung erkauft ist, die die tatsächlichen Unterschiede im Leistungsvermögen ausblendet und so auf Dauer nur zu Enttäuschung und Frustration führen kann.
6. «Meine erste Schule» wurde erstmals in «Time and Tide» (Nr. 24, 4. September 1943) veröffentlicht, gut zehn Jahre, bevor Lewis dieser Schule in seiner Autobiografie Überrascht von Freude (engl. Surprised by Joy [1955]) ebenfalls ein Kapitel widmete. An beiden Stellen versucht er, seinen Lesern das Gute zu vermitteln, das die schwierige Zeit an dieser Schule ihm für sein Leben mitgegeben hat. Die Wynyard School in Watford, Hertfordshire war ein Internat, das von Robert Capron, einem äußerst grausamen und brutalen Schulleiter, geleitet wurde (in Anlehnung an das deutsche Konzentrationslager Bergen-Belsen nennt Lewis Watford daher in Überrascht von Freude auch «Belsen»). Die Schule stand bereits kurz vor dem Ruin, als Lewis im September 1908 dorthin kam, nicht einmal einen Monat nach dem frühen Krebstod seiner Mutter. Er besuchte das Internat bis Juli 1910, als es den Betrieb – nur fünf Schüler waren noch dort – endgültig einstellen musste. Erst gegen Ende seines Lebens bekam Lewis bestätigt, was er schon lange vermutet hatte: Robert Capron war geisteskrank gewesen; er starb im November 1911 in einem Heim für psychisch Kranke.
7. «‹Bulverismus› oder Die Grundlage des Denkens des 20. Jahrhunderts» (engl. «‹Bulverism,› or The Foundation of 20. Century Thought») wurde am 7. Februar 1944 als Vortrag im Oxford UniversitySocratic Club gehalten, dessen Präsident C.S. Lewis von 1941–1954 war. Der zweite Teil ist leider nur in der Form von Notizen der Sekretärin des Socratic Club überliefert. Die Tatsache, dass Lewis der Veröffentlichung von Vortrag und Notizen im «Socratic Digest» (Nr. 2, Juni 1944) zustimmte, belegt jedoch, dass er mit der Niederschrift seiner Ausführungen einverstanden war.6 Dieser Essay präsentiert in Kurzform Lewis’ zentrales Argument gegen den Naturalismus aus Wunder (engl. Miracles [1947/1960]). Er kritisiert aber auch in typisch Lewis’scher Manier die heute noch weit verbreitete Strategie, in öffentlichen Debatten das Zur-Geltung-Kommen echter Argumente zu verhindern, indem man über die vermeintlichen Gründe für die (als gegeben vorausgesetzte) Falschheit der Position seiner Gegner spekuliert.
8. «Schreckliche rote Dinger» (engl. «Horrid Red Things») wurde erstmals in der «Church of England Newspaper» (Nr. 51, 6. Oktober 1944) veröffentlicht, während Lewis gerade am Manuskript von Miracles arbeitete. Miracles enthält ein Kapitel mit demselben Titel, von dem dieser Essay eine Art Kurzfassung darstellt. Lewis betont in ihm zum einen die Notwendigkeit, über nicht mit unseren Sinnen wahrnehmbare Größen (wie z.B. unsere Vorstellungen von Gott) in Bildern und Metaphern zu sprechen; die ausführliche Begründung erfolgt in «Bluspels und Flalansferes», dem Essay Nr. III,1 im vorliegenden Band. Zum anderen betont er die Differenz zwischen unserem Denken und den unsere Denkakte unvermeidlich begleitenden Bildern. Dies macht nach seiner Ansicht eine Korrektur überkommener Glaubensvorstellungen möglich, die aber den eigentlichen Kern des christlichen Glaubens bewahrt.
9. «Christliche Apologetik» (engl. «Christian Apologetics») ist ein Vortrag, den C.S. Lewis Ostern 1945 in Carmarthen/Wales bei der «Carmarthen Conference for Youth Leaders and Junior Clergy» vor einer Versammlung von anglikanischen Priestern und Jugendleitern der Kirche von Wales hielt; erstmals veröffentlicht wurde der Text 1970 in God in the Dock. Er erläutert in diesem Vortrag die Grundzüge seines eigenen apologetischen Vorgehens, weist aber auch darauf hin, dass sich nicht alles davon 1 : 1 in andere Kontexte übertragen lässt (noch nicht einmal auf die damalige Situation in der Kirche von Wales!); dies gilt natürlich umso mehr für unsere heutige Situation in Deutschland. Der Vortrag enthält dennoch wertvolle Anregungen, wie christliche Apologetik (bzw. Neuevangelisierung) heute aussehen könnte bzw. auch müsste. Besonders wichtig und aktuell ist Lewis’ Feststellung, dass Apologetik nur dort gelingen kann, wo man sich immer wieder neu auf die Sprache seiner Adressaten einlässt.
10. «Bevor wir miteinander reden können» (engl. «Before We Can Communicate») erschien erstmals in der Zeitschrift «Breakthrough» (Nr. 8, im Oktober 1961). Lewis war gebeten worden, seine Gedanken darüber zu formulieren, wie es möglich ist, in einer modernen Zeit und Gesellschaft eine gelingende Kommunikation zwischen Christen und Nichtchristen auf den Weg zu bringen. Er fokussiert seine Antwort ganz auf einen Aspekt, den er bereits gut fünfzehn Jahre vorher in «Christliche Apologetik» betont hatte. Das größte Kommunikationshindernis ist ein Sprachproblem:7 Viele (vor allem wenig gebildete) Leute verstehen einfach die Sprache von Theologie und Kirche nicht mehr. Es ist daher erforderlich, den christlichen Glauben immer wieder neu in die Umgangssprache einer gegebenen Zeit und Gesellschaft zu übersetzen. Dies, so betont Lewis, hat für den Übersetzer den positiven Nebeneffekt, dass er nicht umhinkann, sich selbst unmissverständlich klar zu machen, was er eigentlich sagen bzw. übersetzen will.
11. «Moderne Bibelübersetzungen» (engl. «Modern Translations of the Bible») erschien ursprünglich als eine Einführung in eine zeitgemäße Neuübersetzung der neutestamentlichen Briefe (J.B. Phillips, Letters to Young Churches. A Translation of the New Testament Epistles [1947]). In «Christliche Apologetik» hatte Lewis geschrieben, dass wir unsere Theologie immer wieder neu in die Sprache unserer Zeit übersetzen müssen; hier sagt er nun dasselbe über unsere Bibelausgaben. Der Text lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gefahren eines Festhaltens an den altbekannten Bibelübersetzungen, in England besonders an der King James Version von 1611, die bis heute einen großen (bei uns in etwa mit der Lutherbibel vergleichbaren) Einfluss auf das religiöse Denken und Empfinden ausübt. Und zudem korrigiert Lewis das weit verbreitete Missverständnis, die paulinischen Briefe würden eine Verzerrung der vermeintlich ursprünglicheren, schlichteren Liebesbotschaft Jesu darstellen. Nein, so Lewis, das exakte Gegenteil ist der Fall: Die Theologie des Paulus steht nicht im Widerspruch zum Jesusbild der Evangelien, sondern ist als den Lesern der (erst später geschriebenen) Evangelien bekannt vorauszusetzen.
12. «Bibelkritik oder Auslegung der Heiligen Schrift?» (engl. Titel «Letters to Malcolm. Letter XIIa») ist ein Kapitel, das Lewis dem Manuskript seines letzten theologischen Werkes Letters to Malcolm (1964, dt. Titel Du fragst mich, wie ich bete) nachträglich hinzufügte, um darin die Grundzüge seiner Auslegung der biblischen Schriften darzulegen. Lewis hatte bereits 1959 seine skeptische Haltung gegenüber der biblischen (Fach-)Exegese in dem Vortrag «Fern-seed and Elephants» (dt. Titel «Laiengeblök») mündlich erläutert, den Text aber (vermutlich aufgrund seiner kontroversen Natur) nicht publiziert. Dies mag ihn auf die Idee gebracht haben, das in Letters to Malcolm noch einmal in etwas vorsichtigerer Form zu tun. In diesem Text beschreibt er seine Position als eine kritische Mittelposition zwischen Fundamentalismus und Modernismus. Aus heute nicht mehr rekonstruierbaren Gründen wurde das Kapitel dennoch nicht mit veröffentlicht; es wurde in Lewis’ Nachlass gefunden und erschien erstmals in der Zeitschrift «SEVEN» (Nr. 34, 2017).
13. «Die Geschichte Jesu – ein wahrer Mythos» ist eine Zusammenstellung von Passagen aus Briefen, die C.S. Lewis in den Monaten nach seiner Konversion zum Christentum an seinen Jugendfreund Arthur Greeves sowie seinen Bruder Warren schrieb. 1930 hatte Lewis sich nach einem langen Weg des Nachdenkens und Reflektierens auf seine eigenen Erfahrungen vom Atheismus zur Anerkennung eines personalen Gottes durchgerungen. In der Nacht des 19. September 1931 führte er mit seinen Freunden Hugo Dyson und J.R.R. Tolkien ein langes Gespräch über das Wesen und die Natur des Mythischen und sein Verhältnis zum christlichen Glauben. Dieses Gespräch brachte ihn neun Tage später zum Glauben an Christus. Die hier ausgewählten Briefe (2000/2004 erstmals vollständig in Band I und II der Collected Letters of C.S. Lewis veröffentlicht) zeigen, wie Lewis sich mit dem neu gewonnen Glauben auseinandersetzt, ihn mit seiner eigenen Erfahrung von «Joy» verbindet und sein Verständnis der Inkarnation als ein «Mythos, der ein Faktum wurde» entwickelt.8
14. «Über die Angst Jesu» entstammt einem Brief von Lewis an seinen Studienfreund Owen Barfield vom August 1939 (erstmals veröffentlicht in Letters of C.S. Lewis [1966]). Der Text wirft einen Blick auf die Frage nach dem Verhältnis von Gottheit und Menschheit Jesu Christi. Indem Lewis dabei die Freiheit Jesu in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt, bietet dieser kurze Abschnitt einen wichtigen Anknüpfungspunkt für ein neuzeitliches Verständnis der zwei Naturen Jesu.
15. «Gott und das Böse» ist einem Brief an Arthur Greeves vom 12. September 1933 entnommen; der Brief erschien erstmals 1979 in They Stand Together. The Letters of C.S. Lewis to Arthur Greeves (1914–63). Lewis beschreibt das Verhältnis des Menschen zu Gott hier bereits mittels einer humorvollen Analogie, die später wiederholt in seinen theologischen Schriften zum Einsatz kommen sollte: das Verhältnis eines Hundehalters zu seinem Hund (so z.B. in Über den Schmerz [engl. Titel The Problem of Pain, 1940]). Basis für das Verhältnis des Willens Gottes zu unserem fehlbaren menschlichen Willen ist die Auffassung des hl. Augustinus, das Böse habe kein eigenes Sein, sondern sei stets ein Mangel an Gutem. Lewis hielt diese Ansicht auch später für die einzig tragfähige Grundlage für eine Metaphysik des Guten.
16. «Gott und das Leid» ist eine Zusammenstellung von Abschnitten aus Briefen, die Lewis zwischen 1949 und 1959 schrieb, viele Jahre nach der Veröffentlichung von Über den Schmerz. Erstmals veröffentlicht wurden diese Briefe, die von einer vertieften Auseinandersetzung mit der Theodizeefrage zeugen, in Letters of C.S. Lewis (1988) sowie Band II und III der Collected Letters of C.S. Lewis (2004/2006).
Besonders deutlich ist dabei a) die christologische Orientierung von Lewis’ Gedanken (Christus als Mitleidender; menschliches Leid als Leiden mit Christus) sowie die zentrale Bedeutung, die er dem Gedanken der Stellvertretung einräumt. Die Theorie und Praxis der Stellvertretung bildete den Mittelpunkt der Theologie seines Freundes Charles Williams, sie spielt aber auch eine zentrale Rolle in Lewis’ Roman Till We Have Faces (1956, dt. Titel Du selbst bist die Antwort). Als der Knochenkrebs bei seiner Frau Joy 1957 zum Stillstand kam, während er selbst an Osteoporose erkrankte, deutete Lewis dieses Ereignis ebenfalls (vorsichtig) als einen Akt der Stellvertretung.
17. «Der Schmerz der Tiere: Ein Problem für die Theologie» (engl. «The Pains of Animals. A Problem for Theology») erschien erstmals im Februar 1950 in «The Month» (Nr. CLXXXIX). Der Essay ist eine Antwort auf die (dort ebenfalls abgedruckte) Kritik des britischen Philosophen C.E.M. Joad (1891–1953) am neunten Kapitel «Der Schmerz des Tieres» von Über den Schmerz und verdeutlicht einige Aspekte von Lewis’ Haltung zum Problem des Schmerzes der Tiere. Joad war wie Lewis erst spät zum christlichen Glauben zurückgekehrt, wozu auch sein Auftritt im Socratic Club im Januar 1944 und die Lektüre von Die Abschaffung des Menschen (engl. The Abolition of Man [1943]) beigetragen hatten.
18. «Vivisektion» (engl. «Vivisection») erschien erstmals 1947 als Flugblatt der «New England Anti-Vivisection Society». Der Text knüpft insofern an den vorherigen Text an, als auch er Lewis’ Skepsis bezüglich unseres möglichen Wissens über den Schmerz der Tiere betont. Und auch er nimmt das Leid der Tiere absolut ernst: Stellt der nur schwer abzuweisende Anschein grundlosen Leidens im Tierreich bereits ein Problem für die Güte Gottes dar, so ist erst recht zu fragen, wie sich die Tatsache, dass Menschen Tieren bewusst Leid zufügen, mit den Grundprinzipien menschlicher Ethik vereinbaren lässt. Lewis betont: Handeln wir grausam gegenüber Tieren, so verhalten wir uns in-human; wir bleiben unter unserer eigenen Würde als Menschen. Und wir ebnen die Bahn für die Grausamkeit von Menschen gegenüber Menschen.9
19. «Über den Unterschied von Katholizismus und Protestantismus» ist ein Auszug aus Lewis’ literaturwissenschaftlichem Standardwerk The Allegory of Love (1936). In diesem Abschnitt über Edmund Spensers epischen Ritterroman The Faerie Queene bringt Lewis die literarische Form der Allegorie in Verbindung mit den spezifischen religiösen Temperamenten von Katholizismus und Protestantismus (wozu für ihn auch der Anglikanismus zählt). Indem er das Verhältnis dieser beiden Konfessionen auf eine einzige Grunddifferenz zurückführt, wirft Lewis ein erhellendes Licht auf die Unterschiede, die Katholiken und Protestanten auch heute noch voneinander trennen. Dies schließt freilich nicht aus, dass es in beiden Konfessionen ihrerseits katholisierende und/oder protestantisierende Tendenzen in dem von ihm beschriebenen Sinn gibt.
20. «Christliche Wiedervereinigung» (engl. «Christian Reunion») wurde von Walter Hooper im Nachlass von C.S. Lewis gefunden und 1990 erstmals in der Sammlung ChristianReunion publiziert. Die Blätter, auf denen Lewis den Text mit der Hand notiert hat, legen nahe, dass er ca. 1944 entstand. Der Anlass ist nicht bekannt, der Text scheint aber auf Einladung von römisch-katholischer Seite geschrieben worden zu sein. Da Lewis es sonst stets ablehnte, sich zu ökumenischen Streitfragen zu äußern, ist dieser Text seine einzige ausdrückliche Stellungnahme zur Frage einer möglichen Wiedervereinigung von Anglikanern und Katholiken; dies erklärt vielleicht auch den vorsichtigen, eher beschreibenden Tonfall. Bemerkenswert (und auch heute noch bedenkenswert) ist seine abschließende Prognose, die Wiedervereinigung werde, wenn überhaupt, dann von den Zentren der verschiedenen Konfessionen aus erfolgen und nicht von ihren Rändern.
II. Geistesgeschichtliche Durchblicke
1. «De descriptione temporum» (dt. «Über die Beschreibung der Zeiten») ist C.S. Lewis’ Antrittsvorlesung am 29. November 1954 auf dem neu für ihn eingerichteten Lehrstuhl für Literatur des Mittelalters und der Renaissance in Cambridge; erstmals veröffentlicht wurde der Text in They Asked for a Paper (1962). Bis 1954 war Lewis in Oxford fast dreißig Jahre lang Tutor für die Literatur des Mittelalters und der Renaissance gewesen, wo ihm jedoch aus politischen Gründen der Weg auf einen Lehrstuhl versperrt blieb. Er präsentiert und begründet in dieser Vorlesung eine Überzeugung, die seiner gesamten literaturwissenschaftlichen Arbeit wie auch seinem philosophisch-theologischen Denken zugrunde liegt: Der größte Bruch in der Geistesgeschichte des Abendlandes erfolgte nicht – wie von Autoren der Moderne zumeist behauptet – zwischen dem Mittelalter und der Renaissance (d.h. im 15./16. Jh.), sondern erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Durchsetzung eines evolutiven Weltbildes und der Einbettung des Menschen in eine nun rein mechanisch verstandene Natur.
Die nachfolgenden Abschnitte dieses zweiten Teils illustrieren alle auf die eine oder andere Weise diese Überzeugung und reflektieren sie philosophisch. Man muss dabei nicht jeden der zahlreichen Autoren kennen, auf die Lewis verweist oder die er zitiert; seine Zitate und literarischen Bezüge dienen für gewöhnlich dazu, das allgemeine Empfinden oder die grundsätzliche Denkweise der jeweiligen Zeit zu charakterisieren.
2. «Die Erscheinungen retten» ist Kapitel II «Reservations» aus The Discarded Image (1964), C.S. Lewis’ Einführung in die Literatur des Mittelalters und der Renaissance. Dieses Buch geht auf Einführungsvorlesungen zurück, die Lewis zwischen 1931 und 1954 regelmäßig in Oxford hielt und welche er 1962 noch selbst für die Veröffentlichung vorbereitete. In ihm beschreibt er die Grundzüge des mittelalterlichen Weltbildes, die nach seiner Überzeugung auch dem literarischen Schrifttum der Renaissance noch zugrunde liegen; eine Unkenntnis dieses Weltbildes führt nach seiner Ansicht zu gravierenden Missverständnissen beim Lesen nahezu der gesamten vormodernen Literatur. In diesem Kapitel weist Lewis auf das Provisorische dieses Weltbildes hin – eine erkenntnistheoretische Beschränkung, die er auch für die Wahrnehmung unseres heutigen Weltbildes einfordert.
3. «Vorstellung und Denken im Mittelalter» (engl. «Imagination and Thought in the Middle Ages») besteht aus zwei Vorlesungen, die Lewis im Juli 1956 vor einer Gruppe von Zoologen in Cambridge hielt; erstmals veröffentlicht wurden sie 1966 in Studies in Medieval and Renaissance Literature. Sie bieten eine Art Kurzversion von The Discarded Image für ein breiteres Publikum: Während die meisten Leser dieses Buch durch seinen Umfang und die Fülle seiner literarischen Bezüge recht herausfordernd finden dürften, präsentiert «Vorstellung und Denken im Mittelalter» die Grundzüge des mittelalterlichen Weltbildes in einer leichter zugänglichen Form.
4. «Vom Modellcharakter aller Weltbilder» ist das abschließende Kapitel «Epilogue» aus The Discarded Image. Die hier präsentierten Reflexionen auf den Modellcharakter aller Weltbilder sind der Darstellung des mittelalterlichen Weltbildes zwar nur in der Form eines Epilogs nachgestellt, sie stellen aber nach Lewis’ eigener Aussage dennoch eines der drei Hauptthemen des Buches dar.10 Sie weisen dabei eine geradezu erstaunliche Ähnlichkeit zu den Analysen auf, die der US-amerikanische Philosoph Thomas Kuhn zur gleichen Zeit in seinem wissenschaftstheoretischen Klassiker Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962) vortrug; der von Kuhn in diesem Buch eingeführte Begriff «Paradigma» trifft dabei ziemlich genau das, was Lewis hier als «Modell» bezeichnet. Lewis prognostiziert am Ende des Kapitels, es werde nicht nur die Entdeckung neuer wissenschaftlicher Fakten, sondern auch ein Wandel auf geistiger Ebene sein, der das Ende unseres gegenwärtigen Modells von der Welt einläutet. Damit würde er heute gewiss die Zustimmung jener Philosophen finden, die darauf hinweisen, dass das im 20. Jh. vielfach als alternativlos behauptete naturalistische (neo-)darwinistische Paradigma inzwischen einen Großteil seiner Plausibilität eingebüßt hat.11
Die Texte «Die Erscheinungen retten» und «Vom Modellcharakter aller Weltbilder» bilden im vorliegenden Band die wissenschaftstheoretische Klammer um die Darstellung des mittelalterlichen Weltbildes – ganz so, wie Lewis sie auch in The Discarded Image seinen Lesern präsentiert.
5. «Hierarchie» ist Kapitel XI «Hierarchy» aus A Preface to Paradise Lost (1942), Lewis’ Interpretation von John Miltons epischem Gedicht «Paradise Lost» (1667) über den biblischen Sündenfall. C.S. Lewis beschreibt in diesem Kapitel einen Aspekt antiker und mittelalterlicher Ethik, dessen Kenntnis nach seiner Überzeugung zum Verständnis nahezu aller Literatur aus der Zeit vor 1800 erforderlich ist: den Glauben an eine hierarchische Wertordnung im Kosmos, deren Störung notwendig Unheil und Verderben nach sich zieht. In Die Abschaffung des Menschen verteidigt Lewis den zentralen Gedanken dieser Konzeption, es gebe objektive Werte in der Natur, an denen der Mensch sich in seinem Handeln orientieren muss, ohne jedoch an der traditionellen Rangordnung der Werte in all ihren Details festzuhalten.12 Dies verbietet ihm bereits sein Verständnis von Freiheit und Demokratie, das eine der alten Sicht vergleichbare Einteilung der menschlichen Gesellschaft in Stände oder soziale Ränge kategorisch ausschließt.
6. «Das Natur- und Menschenbild der Renaissance» ist dem Einführungskapitel «New Learning and New Ignorance» in Lewis’ Literaturgeschichte English Literature in the 16th Century (1954) entnommen. Auf diesen Seiten tritt Lewis der gängigen Ansicht entgegen, die im 16. und 17. Jahrhundert aufkommenden Naturwissenschaften hätten die ältere animistische Vorstellung von der Natur quasi von selbst verdrängt: im Gegenteil, nun blühten Astrologie und Magieglaube erst richtig auf. Heute wissen wir, dass die Naturwissenschaft dort Erfolg hatte, wo diese anderen vermeintlichen Wissenschaften versagten, doch in der Renaissance selbst verlief die Front nicht zwischen Naturwissenschaft und Aberglaube, sondern zwischen jenen, die an die Macht der Natur über den Menschen glaubten (Astrologen) und jenen, die an die Macht des Menschen über die Natur glaubten (Magier und Naturwissenschaftler). Von hier aus lässt sich eine weitere Brücke zu Die Abschaffung des Menschen schlagen, wo Lewis ebenfalls die ursprüngliche Verwandtschaft von Magier und Naturwissenschaftler betont und eindringlich vor den Folgen warnt, die das Streben nach uneingeschränkter Macht über die Natur nach sich zieht.13
7. «Das leere Universum» (engl. «The Empty Universe») entstand als Vorwort zu Douglas E. Hardings Buch The Hierarchy of Heaven and Earth. A New Diagram of Man in the Universe (1952). Der Text zeigt quasi im Zeitraffer, wohin Naturwissenschaft und philosophische Aufklärung letztlich führen, wenn sie die alte qualitative Betrachtung der Natur (einschließlich der Natur des Menschen) völlig aufgeben: in einen Nihilismus, in dem alles – auch der Mensch selbst – jeden Sinn und jede Bedeutung verloren hat. Diesen Nihilismus fand Lewis exemplarisch in The Concept of Mind (1950) seines Oxforder Philosophen-Kollegen Gilbert Ryle zum Ausdruck gebracht: Für Ryle war der Gedanke, der Geist oder die Seele des Menschen sei ebenso eine objektive Realität (ein substanzielles «Ding») wie die Gegenstände der physischen Natur, ein bloßes sprachliches Missverständnis.14 Diese und ähnliche Thesen des Neopositivismus sind zwar heute überholt, doch das Programm lebt weiter in der Behauptung heutiger Hirnforscher, unser Glaube, ein für sein eigenes Tun verantwortliches Ich zu sein, sei eine vom Gehirn hervorgebrachte Illusion.
8. «Eine Weihnachtspredigt für Heiden» (engl. «A Christmas Sermon for Pagans») erschien im Dezember 1946 in «The Strand Magazine» (Band 112, Nr. 672). Dieser erst kürzlich wiederentdeckte Essay trägt unverkennbar die Handschrift von C.S. Lewis. Zum einen präsentiert er eine Überzeugung, die später auch in «De descriptione temporum» Thema sein wird: Es ist falsch, die Entchristlichung der Länder der westlichen Welt als einen Rückfall ins Heidentum zu beschreiben; die Heiden der Antike standen dem Christentum weitaus näher als der heutige Post-Christ. Deshalb kann eine Re-Christianisierung Europas auch nur dann gelingen, wenn die Menschen erst wieder zu Heiden (im antiken Sinn) werden. Den Grund hierfür nennt Lewis unter anderem auch in Pardon, ich bin Christ (engl. Titel Mere Christianity [1952]): Die christliche Erlösungsbotschaft spricht nur zu Personen, die anerkennen, dass es einen objektiven Standard für Recht und Unrecht (bzw. Gut und Böse) gibt, und die wissen, dass sie selbst immer wieder hinter diesem Standard zurückbleiben. Auch betont Lewis in diesem Essay nicht weniger deutlich als in Die Abschaffung des Menschen oder Die böse Macht (engl. Titel That Hideous Strength [1945]), dass das neuzeitliche Programm der Eroberung der Natur durch den Menschen unweigerlich zur Herrschaft von Menschen über Menschen führt.
9. «Xmas und Christmas. Ein verschollenes Kapitel aus Herodot» (engl. «Xmas und Christmas. A Lost Chapter from Herodotus») wurde erstmals in «Time and Tide» (Nr. 35, 4. Dezember 1954) veröffentlicht. Lewis schildert hier die englischen Weihnachtsbräuche seiner Zeit im Stil der Historien des griechischen Geschichtsschreibers Herodot (ca. 485–425 v. Chr.). Indem er dabei die Position des antiken Historikers einnimmt, der sich sehr über das wundert, was er da von anderen berichtet bekommt, kann er seinen Zeitgenossen humorvoll die Absurdität ihrer Weihnachtsbräuche vor Augen führen – die sich in mancherlei Hinsicht gar nicht so sehr von unseren heutigen Bräuchen unterscheiden.
III. Literaturwissenschaftliche Durchblicke
1. «Bluspels und Flalansferes. Ein semantischer Alptraum» (engl. «Bluspels und Flalansferes. A Semantic Nightmare») ist ein Vortrag, den C.S. Lewis am 3. Dezember 1936 vor dem «Philological Club» der Universität Manchester hielt; erstmals veröffentlicht wurde er 1939 in dem Essay-Band Rehabilitations. Bereits in den 1920er Jahren hatte sich Lewis in langen Debatten mit seinem Freund Owen Barfield mit dem Problem der Metaphorik der Sprache auseinandergesetzt. An deren Ende hatte die gemeinsame Erkenntnis gestanden, dass alle sprachlichen Ausdrücke, die sich nicht unmittelbar auf Objekte der Sinneswahrnehmung beziehen, notwendig metaphorisch sind – und dies trifft für nahezu unser gesamtes (auch unser wissenschaftliches) Sprechen zu. Als Konsequenz ergab sich daraus für Lewis, dass uns als Sprechenden letztlich nur drei Möglichkeiten offenstehen: a) die in unserer Sprache vergrabenen «toten» oder «versteinerten» Metaphern wiederzubeleben, b) bewusst neue Metaphern zu erfinden oder c) zu sprechen, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, was man eigentlich sagen will.15 Diese in «Bluspels und Flalansferes» begründete Überzeugung ist die Basis sowohl für seine Kritik am pseudowissenschaftlichen Jargon seiner Zeit als auch für den bewussten und oft sehr erhellenden Einsatz von Bildern, Analogien und Metaphern in seinen eigenen Schriften.
2. «Was ist Dichtung?» ist ein Auszug aus einem 1939 unter dem Titel The Personal Heresy herausgegebenen Streitgespräch zwischen Lewis und dem Literaturkritiker E.M.W. Tillyard. Ausgangspunkt der Debatte war Lewis’ Widerspruch gegen die von Tillyard in seinem Buch Milton (1930) vertretene Auffassung, Literatur sei in erster Linie als Ausdruck der Persönlichkeit des Dichters zu lesen. Nach Lewis’ Ansicht geht es beim Lesen von Dichtung jedoch nicht darum, auf den Dichter zu schauen, sondern auf das, was dieser uns durch seine Dichtung zeigen will. Beide Autoren steuern jeweils drei Essays zu diesem Band bei, der hier vorliegende Abschnitt stammt aus Lewis’ drittem und abschließenden Beitrag (entstanden 1939). Er charakterisiert in diesem Text die Sprache des Dichters als eine Spezialisierung der Umgangssprache, die darauf abzielt, die Konkretheit und spezifische Qualität von Erfahrungen zu übermitteln.16 Und er affirmiert die traditionelle, auf den römischen Dichter Horaz (65–8 v. Chr.) zurückgehende These, der Zweck von Literatur sei es, zu erfreuen und zu belehren.
3. «Psychoanalyse und Literaturkritik» (engl. «Psycho-analysis and Literary Criticism») ist der Titel eines Vortrags, den C.S. Lewis am 29. Januar 1940 vor einem Literaturclub am Oxforder Westfield College hielt; er wurde erstmals 1942 von der English Association in «Essays and Studies» (Nr. 27) publiziert.
Lewis setzt sich in diesem Vortrag kritisch mit zwei Thesen Sigmund Freuds (1856–1939) auseinander: a) der Behauptung, die bewegende Kraft hinter aller Literatur (ja sogar aller Kunst) seien unsere frühkindlichen Wünsche und b) der Behauptung, der Symbolismus imaginativer Werke ließe sich durchweg als Ausdruck der unbewussten Triebregungen des «Es» entschlüsseln.
Auch Carl Gustav Jungs (1875–1961) Theorie der Archetypen kommt zur Sprache, welche in der Tat in gewissem Maß mit Lewis’ eigener Theorie des Mythischen konvergiert, der er aber nur einen geringen Erklärungswert für die große Wirkung solch universaler Bilder auf die menschliche Vorstellung zuerkennt. Lewis selbst hielt diesen Vortrag für so wichtig, dass er ihn 1962 in der Sammlung They Asked for a Paper erneut veröffentlichte.
4. «Der Hobbit» ist eine Zusammenstellung von zwei kurzen Besprechungen des Kinderbuches The Hobbit von J.R.R. Tolkien (1937). Die erste Besprechung erschien am 2. Oktober 1937 in «The Times Literary Supplement», die zweite am 8. Oktober 1937 in der Zeitschrift «The Times».
C.S. Lewis hatte die Entstehung der mythischen Welt seines Freundes Tolkien seit den 1920er Jahren mitverfolgt und wusste bei Erscheinen des Hobbit, dass in diesem Buch nur ein kleiner Ausschnitt einer weitaus umfangreicheren Mythologie für eine junge Leserschaft adaptiert worden war. Nicht ohne Grund hob er daher die Einmaligkeit und innere Stimmigkeit der Welt hervor, in der sich die Figuren bewegen: Tolkien hat seine Hobbits, Trolle, Elben, Orks und Drachen keineswegs bloß erfunden, er hat sie über Jahre hinweg in ihrem natürlichen Lebensraum persönlich studiert.
5. «Tolkiens ‹Der Herr der Ringe›» (engl. «Tolkien’s ‹The Lord of the Rings›») ist aus zwei Besprechungen des berühmten Fantasywerkes von J.R.R. Tolkien zusammengestellt. Lewis hatte das Wachsen des Herrn der Ringe (1954/1955) nicht nur miterlebt, es war nicht zuletzt seiner beständigen Ermutigung zu verdanken, dass dieses gewaltige Werk schließlich veröffentlicht wurde.17 Er besprach The Fellowship of the Ring, den ersten Doppelband des aus sechs einzelnen Büchern bestehenden Werkes, gleich nach dessen Erscheinen («Time and Tide», Nr. 35, 14. August 1954). Die anderen beiden Doppelbände The Two Towers und The Return of the King besprach er dann gemeinsam («Time and Tide», Nr. 36, 22. Oktober 1955).18 Diese Rezensionen zeugen nicht nur von einer exzellenten Kenntnis der Welt des Herrn der Ringe und der Intentionen ihres Autors, sondern sie prophezeien auch bereits, dass dieses Werk ein Klassiker werden wird. Wichtige Aspekte von Lewis’ eigenem Verständnis des Mythischen kommen dabei ebenfalls zur Sprache.
6. «Manchmal sagen Märchen am besten, was man sagen will» (engl. «Sometimes Fairy Stories Say Best What’s to Be Said») erschien erstmals in der «New York Times Book Review» vom 18. November 1956. Schon zu Lewis’ Lebzeiten kam der Vorwurf auf, seine Narnia-Geschichten (erschienen 1950–1956) seien simple Allegorien, konzipiert und geschrieben mit dem Ziel, Propaganda für das Christentum zu betreiben.
Lewis wehrt sich in diesem Essay gegen diesen Vorwurf: Die wahre Entstehungsgeschichte seiner Bücher ist um einiges komplexer, als die meisten Leser dies offenbar vermuten, und die Didaktik stand dabei keineswegs im Vordergrund. Auch sind die Narnia-Geschichten gar keine Allegorien (die eine 1 : 1-Übersetzung ihres Inhalts in die christliche Theologie erlauben würden), sondern der Gattung der «Fairy Tale» (dt. «Märchen») zuzurechnen.
7. «Über drei Weisen, für Kinder zu schreiben» (engl. «On Three Ways of Writing for Children») ist ein Vortrag, den C.S. Lewis vor der «British Library Association» (dt. «Bibliotheksgesellschaft») hielt; er wurde erstmals in ihren «Proceedings, Papers and Summaries of Discussions at the Bornemouth Conference 29th April to 2nd May 1952» veröffentlicht. Lewis erläutert hier genauer, was ihn an der literarischen Gattung der Fairy Tale besonders interessiert – und was ihn auch dazu brachte, sie als literarische Form für seine Narnia-Geschichten zu wählen. Zudem geht er auf den Vorwurf ein, Fairy Tales seien keine ernsthafte Literatur für Erwachsene, und tritt dem Vorwurf entgegen, sie würden eine Flucht aus der Realität darstellen. Lewis stellt dem eine Überzeugung entgegen, die er auch in vielen anderen seiner Werke verteidigt, nämlich die spezifische Form des Realismus von Mythos und Fairy Tale. Seine Verteidigung dieser Überzeugung macht dabei unverkennbar Gebrauch von seiner kritischen Auseinandersetzung mit Freuds psychoanalytischer Theorie der Literatur (vgl. den Essay Nr. III,3 «Psychoanalyse und Literaturkritik» in diesem Band).
8. «Über Science-Fiction» (engl. «On Science Fiction») wurde am 24. November 1955 dem «Cambridge University English Club» vorgetragen. Lewis erläutert in diesem Text, was er an der zu seiner Zeit in der Literaturwissenschaft überwiegend abschätzig betrachteten Gattung der Science-Fiction besonders schätzt. Dabei unterscheidet er zwischen verschiedenen Formen der Science-Fiction und stellt diese kurz vor. Seine Ausführungen zu Science-Fiction-Geschichten mit dem Charakter des Mythischen werfen ebenfalls ein erhellendes Licht auf Lewis’ eigene Absichten beim Schreiben seiner interstellaren Romane. Bedenkenswert ist auch sein Plädoyer dafür (gerichtet an die Verächter der Science-Fiction), nur Dinge zu kritisieren, die man selber kennt und liebt: Wer nie Freude an einer Sache hatte, wird wohl kaum je in der Lage sein, die Faszination anderer zu verstehen, die sie bei der Beschäftigung mit ihr verspüren, und daher mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit seinem Urteil über diese Sache in die Irre gehen.
9. «Eine Replik auf Professor Haldane» (engl. «A Reply to Professor Haldane») entstand in Reaktion auf die scharfe Kritik des britischen Biologen und Genetikers John Burdon Sanderson Haldane (1892–1964), erschienen im August 1946 im «Modern Quarterly» unter dem Titel «Auld Hornie, F.R.S.».
Lewis’ Antwort auf Haldanes Vorwürfe gegenüber seinen fantastischen Science-Fiction-Romanen Jenseits des schweigenden Sterns (engl. Titel Out of the Silent Planet [1938]), Perelandra oder Der Sündenfall findet nicht statt (engl. Titel Perelandra [1943]) und Die böse Macht wurde erst posthum in der Essay-Sammlung Of Other Worlds (1966) veröffentlicht. Der Text ist leider nicht ganz vollständig erhalten, er wurde aber dennoch mit aufgenommen, da er wichtige Aspekte von Lewis’ Sicht auf seine eigene interstellare Trilogie benennt und gegenüber dem Marxisten Haldane ausführlich die Gründe für sein Bekenntnis zur Demokratie darlegt.
Bonn, im Februar 2019 Dr. Norbert Feinendegen
I. PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHE DURCHBLICKE
1. Hinter den Kulissen
Wurde ich als kleiner Junge mit ins Theater genommen, so war es das Bühnenbild, was mich am meisten interessierte. Das Interesse war kein ästhetisches. Ohne Zweifel sahen die Gärten, Balkone und Paläste der edwardischen19 «Szenerie» für mich hübscher aus, als sie es heute tun würden, aber darum ging es nicht. Eine hässliche Szenerie hätte mich nicht weniger angesprochen. Und noch weniger hielt ich diese Leinwandgemälde für Realitäten. Im Gegenteil, ich glaubte (und wünschte), alle Dinge auf der Bühne seien künstlicher, als sie es tatsächlich waren.
Trat ein Schauspieler in gewöhnlicher moderner Kleidung auf, so glaubte ich nie, dass er einen wirklichen Anzug mit echter Weste und Hose trug, die er auf gewöhnliche Weise anzog. Ich glaubte, er trage – und ich meinte irgendwie, er müsse tragen – eine Art von Theater-Overall, den er in einem überzog und der unsichtbar auf dem Rücken befestigt war. Der Bühnen-Anzug sollte kein Anzug sein; er sollte etwas völlig anderes sein, das trotzdem (daher das Vergnügen) vom Parkett aus wie ein Anzug aussieht. Das ist vielleicht der Grund, weshalb ich auch als Erwachsener weiter an die Theorie vom kalten Tee geglaubt habe, bis mir ein echter Schauspieler sagte, dass jemand, der eine Hauptrolle in einem Londoner Theater spielt, es sich leisten könne und sicherlich auch vorziehen würde, (nötigenfalls) auf eigene Kosten echten Whisky zu besorgen, anstatt jeden Abend kurz nach dem Abendessen ein Glas kalten Tee zu trinken.
Nein, ich wusste sehr genau, dass die Szenerie aus gemalter Leinwand bestand; dass die Räume und Bäume der Bühne, wenn man sie von hinten sehen würde, keineswegs wie Räume oder Bäume aussehen würden. Eben darin lag der Reiz. Das war die Faszination unseres Puppentheaters zuhause, bei dem wir unsere eigene Szenerie herstellten. Man schnitt ein Stück Pappe in der Form eines Turmes aus und bemalte es, und dann klebte man einen gewöhnlichen Spielzeug-Klotz auf die Rückseite, um es aufrecht hinzustellen. Das Entzücken bestand darin, vor und zurück zu gehen. Man ging nach vorne und da war dein Turm. Man ging nach hinten und dort – rohe braune Pappe und ein Klotz.
Im echten Theater konnte man nicht «dahinter» gehen, aber man wusste, dass es genauso sein würde. In dem Augenblick, in dem der Schauspieler in den Kulissen verschwand, betrat er eine andere Welt. Man wusste, dass es keine Welt von besonderer Schönheit oder besonderem Zauber war; jemand muss mir gesagt haben – zumindest glaubte ich das –, dass es eine eher triste Welt nackter Böden und geweißter Wände sei. Der Reiz lag in der Vorstellung, in der Lage zu sein, in drei Schritten in eine Welt hinein- und aus einer Welt heraustreten zu können.
Man wollte (in diesem Alter) kein Schauspieler sein, um Ruhm oder Applaus zu ernten, sondern lediglich, um dieses Vorrecht des Übergangs zu haben. Aus Garderoben und nackten Wänden und zweckmäßigen Fluren zu kommen – und plötzlich zu kommen – in Aladdins Höhle oder das Kinderzimmer der Darlings20 oder was auch immer –, zu werden, was man nicht war, und zu sein, wo man nicht war – das schien höchst beneidenswert zu sein.
Das Beste war, wenn sich die Tür auf der Rückseite der Bühne öffnete und ein kleines Stück Flur freigab – unechter Flur natürlich, seine Paneele nur aus Leinen, um zu suggerieren (wovon man wusste, dass das nicht stimmte), dass der Raum auf der Bühne Teil eines ganzen Hauses war. «Man kann gerade noch einen kleinen Zipfel vom Flur im Spiegelhaus sehen … und soweit man sehen kann, ist er unserem Flur sehr ähnlich; doch weißt du, weiter hinten kann es ganz anders sein.» So Alice zum Kätzchen.21 Nur, dass der Bühnenflur einem keinen Raum für Mutmaßungen ließ. Man wusste, dass er «weiter hinten» ganz anders war; dass er aufhörte, überhaupt ein Flur zu sein.
Ich beneidete die Kinder in den Logen. Wenn man so weit zur Seite saß wie sie, dann konnte man vielleicht durch Recken des Halses den angedeuteten Flur entlang spähen und tatsächlich den Punkt sehen, an dem er aufhörte, zu existieren: die Verbindung zwischen dem Wirklichen und dem Scheinbaren.
Jahre später war ich «dahinter». Die Bühne war für ein elisabethanisches22 Stück ausgestattet. Der Bühnenhintergrund stellte eine Palastfront dar, mit einem begehbaren Balkon in der Mitte. Ich stand (aus einer Perspektive) auf dem Palastbalkon, das heißt ich stand (aus der anderen Perspektive) auf einer Planke, die von einem Gerüst gestützt wurde, und schaute durch ein viereckiges Loch in einem Leinentuch hindurch. Es war ein sehr erhebender Moment.
Was, so frage ich mich, steckt hinter all dem? Und was, wenn überhaupt, folgt daraus? Ich habe keineswegs etwas gegen freudianische Erklärungen, vorausgesetzt, sie schließen nicht alle anderen Erklärungen aus.23 Vermutlich wird jemand sagen, es könnte etwas mit frühkindlichen Fantasien über den weiblichen Körper zu tun haben. Es fühlt sich in keiner Weise so an. «Natürlich nicht», wird man mir antworten: «Das ist auch nicht zu erwarten, nicht mehr, als – lasst uns überlegen, was eine gute Parallele wäre – ja, nicht mehr, als dass die Räume und Wälder der Bühne von vorne wie eine Ansammlung merkwürdig geformter Latten und Leinentücher aussehen, die man vor einem ‹dahinter› liegenden staubigen, zugigen, weißgetünchten Ort angeordnet hat.»
Die Parallele ist ziemlich exakt. Der Komplex, der seinen Weg durch das Unbewusste schlängelt und sich plötzlich transformiert (und nur durch diese Transformation Zutritt erhält), während er in das einzige «Bewusstsein» eintritt, das ich jemals direkt kennen kann: Er ist wirklich wie der Schauspieler, der mit seinem nicht geschauspielerten Ausdruck durch die nackten, zugigen Kulissen geht und dann plötzlich als Mr. Darling im Kinderzimmer oder als Aladdin in der Höhle in Erscheinung tritt.
Doch erstaunlicherweise können wir die freudianische Theorie genauso leicht in das Vergnügen integrieren, mit dem ich begonnen habe, wie dieses Vergnügen in die freudianische Theorie. Ist unser Vergnügen an Tiefenpsychologie (das auch ich durchaus verspüre) nicht selbst ein Fall dieses Vergnügens am Kontrast zwischen «hinter den Kulissen» und «auf der Bühne»? Ich beginne mich zu fragen, ob uns dieser Kontrast im Theater nicht deshalb bewegt, weil er ein höchst passendes Symbol für etwas Universales ist.
Alle möglichen Gegenstände tun tatsächlich genau das, was der Schauspieler tut, wenn er durch die Bühnenflügel nach vorne tritt. Photonen oder Wellen (oder was immer es ist) kommen von der Sonne durch den Raum zu uns. Sie sind im wissenschaftlichen Sinn «Licht». Doch wenn sie in die Luft eintreten, werden sie «Licht» in einem anderen Sinn: was normale Menschen Sonnenlicht oder Tag nennen, jenes Brodeln von blauer oder grauer oder grüner Helligkeit, in dem wir uns bewegen, um zu sehen. Tag ist somit eine Art Kulisse.
Andere Wellen (diesmal der Luft) erreichen mein Trommelfell und wandern einen Nerv hinauf und reizen mein Gehirn. All dies geschieht hinter den Kulissen; ebenso geräuschlos, wie die getünchten Korridore des Theaters undramatisch sind. Dann treten sie irgendwie (ich habe es nie erklärt gesehen) auf die Bühne (niemand kann mir sagen, wo diese Bühne ist) und werden, sagen wir, die Stimme eines Freundes oder die Neunte Sinfonie. Oder natürlich das Radio meines Nachbarn; der Schauspieler kann auf die Bühne treten, um eine schwatzhafte Rolle in einem schlechten Stück zu spielen. Aber jedes Mal findet diese Transformation statt.
Biologische Bedürfnisse, die vorübergehende physiologische Zustände hervorrufen oder durch sie stimuliert werden, steigen hoch in das Gehirn eines jungen Mannes, treten auf die mysteriöse Bühne und erscheinen als «Liebe» – sei es (denn dort werden alle Arten von Stücken aufgeführt) die von Dante gefeierte Liebe, die Liebe eines Guido oder die eines Mr. Guppy.24
Wir können dies den Kontrast von Realität und Erscheinung nennen. Doch vielleicht wird uns die Tatsache, dass wir ihm zuerst im Theater begegnet sind, vor der drohenden Abwertung bewahren, die in dem Wort «Erscheinung» lauert. Denn natürlich ist im Theater das Stück, die «Erscheinung», die Sache. All die «Realitäten» hinter den Kulissen existieren nur um seinetwillen und sind nur insofern von Belang, als sie ihm dienen. Eine gute, neutrale Parabel ist Schopenhauers Geschichte von den zwei Japanern, die ein englisches Theater besuchen.25 Der eine bemühte sich, das Stück zu verstehen, obwohl er von der Sprache kein Wort verstand. Der andere bemühte sich, zu verstehen, wie die Szenerie, die Beleuchtung und die übrige Maschinerie funktionieren, obwohl er noch nie hinter den Kulissen eines Theaters gewesen war. «Hier», sagt Schopenhauer, «haben wir den Philosophen und den Naturwissenschaftler.» Aber statt «Philosoph» hätte er auch «Dichter», «Liebhaber», «Glaubender», «Bürger», «sittlich Handelnder» oder «normaler Mensch» sagen können.
Aber beachten wir, dass Schopenhauers Parabel in zweierlei Hinsicht zusammenbricht. Der erste Japaner hätte versuchen können, Englisch zu lernen; aber wurde uns jemals eine Grammatik oder ein Wörterbuch gegeben, können wir den Lehrer der Sprache finden, in der dieses universelle Drama gespielt wird? Einige (ich gehöre zu ihnen) würden sagen: Ja; andere würden sagen: Nein; die Debatte geht weiter. Und der andere Japaner hätte versuchen können – hätte an Drähten ziehen und Erläuterungen erhalten können –, Zugang zum Bereich hinter den Kulissen zu bekommen und die Dinge hinter der Bühne selbst in Augenschein zu nehmen. Er wusste zumindest, dass es solche Dinge gab.
Uns sind beide dieser Möglichkeiten nicht gegeben. Niemand kann je «dahinter» gehen. Niemand kann, in irgendeinem normalen Sinn, ein Photon, eine Schallwelle oder das Unbewusste treffen oder erfahren. (Dies mag einer der Gründe sein, weshalb uns der Besuch eines Theaters fasziniert; wir tun etwas, das uns in den meisten Fällen nicht möglich ist.) Wir sind im äußersten Fall nicht einmal absolut sicher, dass diese Dinge überhaupt existieren. Sie sind Konstrukte, Dinge, die angenommen werden müssen, um unsere Erfahrung zu erklären, die aber niemals selbst erfahren werden. Sie mögen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, doch letztlich sind sie hypothetisch.
Selbst die Existenz der Schauspieler außerhalb der Bühne ist hypothetisch. Vielleicht existieren sie gar nicht, bevor sie die Bühne betreten. Und wenn sie es doch tun, dann mögen sie, da wir nicht dahinter gehen können, in ihrem Leben und Charakter jenseits der Bühne ganz anders sein, als wir uns das vorstellen, und sehr verschieden voneinander.
2. Meditation in einem Geräteschuppen
Ich stand heute im dunklen Geräteschuppen. Draußen schien die Sonne und durch einen Spalt am oberen Ende der Tür kam ein Sonnenstrahl herein. Von dort, wo ich stand, war dieser Lichtstrahl mit den sich in ihm bewegenden Staubkörnchen die auffälligste Gegebenheit im Raum. Alles andere war nahezu stockdunkel. Ich sah den Strahl, aber keine Dinge durch ihn.
Dann bewegte ich mich und der Strahl traf meine Augen. Sofort verschwand das vorherige Bild. Ich sah keinen Geräteschuppen mehr und (vor allem) keinen Strahl. Stattdessen sah ich, umrandet von der unregelmäßigen Ritze am oberen Ende der Tür, grüne Blätter, die sich draußen auf den Ästen eines Baumes bewegten, und dahinter, gut neunzig Millionen Meilen entfernt, die Sonne. Am Strahl entlang sehen und auf den Strahl sehen sind zwei völlig verschiedene Erfahrungen.
Aber das ist nur ein sehr einfaches Beispiel für den Unterschied zwischen dem Sehen auf etwas und dem Sehen entlang von etwas. Ein junger Mann trifft ein Mädchen. Die ganze Welt sieht anders aus, wenn er sie sieht. Ihre Stimme erinnert ihn an etwas, von dem er sein ganzes Leben lang versucht hat, sich daran zu erinnern, und zehn Minuten Unterhaltung mit ihr sind kostbarer als alle Gefälligkeiten, die ihm alle übrigen Frauen der Welt erweisen könnten. Er ist, wie man sagt, «verliebt». Nun kommt ein Wissenschaftler und beschreibt diese Erfahrung von außen. Für ihn ist das alles eine Sache der Gene des jungen Mannes, ein wohlbekannter biologischer Impuls. Das ist der Unterschied zwischen einem Sehen entlang des sexuellen Impulses und einem Sehen auf ihn.
Haben wir uns einmal daran gewöhnt, diese Unterscheidung zu machen, so werden wir täglich Beispiele für sie finden. Der Mathematiker sitzt und denkt nach, und ihm scheint, er betrachte zeitlose und raumlose Wahrheiten über mathematische Größen. Doch der Hirnphysiologe, könnte er in den Kopf des Mathematikers blicken, würde dort nichts Zeit- und Raumloses finden – nur kleine Bewegungen in der grauen Gehirnmasse. Der Wilde tanzt vor Nyonga und fühlt mit jedem Muskel, dass sein Tanz dazu beiträgt, die neuen Grünpflanzen und den Frühlingsregen und die Babys hervorzubringen. Der Anthropologe, der diesen Wilden beobachtet, stellt fest, dass dieser ein Fruchtbarkeitsritual des Typs Soundso vollzieht. Das Mädchen weint über seine zerbrochene Puppe und hat das Gefühl, einen echten Freund verloren zu haben; der Psychologe sagt, ihr aufkeimender mütterlicher Instinkt sei vorübergehend auf ein geformtes und bemaltes Stück Kunststoff übergeflossen.
Haben wir diese einfache Unterscheidung einmal verstanden, so ergibt sich daraus ein Problem. Wir erhalten eine Erfahrung einer Sache, wenn wir ihr entlang blicken, und eine andere, wenn wir auf sie blicken. Welches ist die «wahre» oder «gültige» Erfahrung? Welche sagt uns am meisten über die Sache? Und wir können diese Frage kaum stellen, ohne zu bemerken, dass in den letzten gut fünfzig Jahren jedermann die Antwort für selbstverständlich hielt. Es galt als ausgemacht, dass wir, um die wahre Beschreibung von Religion zu erhalten, nicht religiöse Menschen fragen müssen, sondern Anthropologen, dass wir, um die Wahrheit über erotische Liebe zu erfahren, nicht zu Liebenden gehen müssen, sondern zu Psychologen, dass wir, um eine «Ideologie» zu verstehen (wie das mittelalterliche Rittertum oder die Vorstellung des 19. Jahrhunderts von einem «Gentleman»), nicht auf jene hören müssen, die sie innerlich gelebt haben, sondern auf Soziologen.
Es ging durchweg nach den Vorstellungen jener, die auf die Dinge sehen; die Leute, die entlang der Dinge sehen, hat man eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht.
Man hält es inzwischen sogar für selbstverständlich, dass die äußere Beschreibung einer Sache die von innen gegebene Beschreibung irgendwie «entlarvt» oder als falsch widerlegt. «All diese moralischen Ideale, die von innen so transzendental und so schön aussehen», sagt der Besserwisser, «sind in Wahrheit nichts als eine Ansammlung biologischer Instinkte und ererbter Tabus.» Und niemand dreht den Spieß um und erwidert: «Wenn du dich nur in die Innenperspektive begeben würdest, würden die Dinge, die für dich wie Instinkte und Tabus aussehen, plötzlich ihre wahre, transzendentale Natur offenbaren.»
Das ist in der Tat die ganze Grundlage der spezifisch «modernen» Denkweise. Und ist es nicht, so könnte man fragen, eine höchst vernünftige Denkweise? Denn schließlich täuscht uns der Blick von innen oft genug. Das Mädchen zum Beispiel, das uns so wunderbar erscheint, solange wir in es verliebt sind, kann in Wahrheit eine sehr unattraktive, dumme und unsympathische Person sein. Der Tanz des Wilden vor Nyonga lässt nicht wirklich das Saatgut wachsen. Hat uns der Blick entlang von etwas schon so oft getäuscht, sind wir dann nicht besser beraten, nur dem Blick auf etwas zu trauen – also in der Tat all diese Innenerfahrungen als wertlos zu betrachten?
Nein, das sind wir nicht. Es gibt zwei gravierende Einwände, die dagegen sprechen, sie alle zu missachten. Der erste Einwand ist der folgende: Wir können nicht nachdenken – und daher auch nicht richtig nachdenken –, wenn wir nichts haben, worüber wir nachdenken können. Ein Physiologe kann zum Beispiel Schmerz untersuchen und feststellen, dass er dieses oder jenes neuronale Ereignis «ist» (was immer ist bedeutet). Doch das Wort Schmerz hätte für ihn keine Bedeutung, wenn er nicht durch eigenes Leiden selbst einmal «innen gewesen» wäre. Hätte er niemals entlang von Schmerz geblickt, so wüsste er einfach nicht, worauf er schaute. Das eigentliche Objekt seiner Untersuchungen von außen existiert für ihn nur deshalb, weil er, zumindest ein Mal, innen war.
Dieser Fall wird wohl kaum je eintreten, weil jeder Mensch schon einmal Schmerz empfunden hat. Doch es ist sehr wohl möglich, sein ganzes Leben lang Erklärungen über Religion, Liebe, Moral, Ehre und so weiter abzugeben, ohne sie jemals von innen erlebt zu haben. Und wenn wir das tun, so hantieren wir lediglich mit Spielmarken. Wir erklären ein Ding, ohne zu wissen, was es ist. Das ist der Grund, weshalb ein Großteil des modernen Denkens genau genommen Nachdenken über gar nichts ist – der ganze Denkapparat, sich emsig im Leeren drehend.
Der andere Einwand ist der folgende: Gehen wir zurück in den Geräteschuppen. Ich mag abgetan haben, was ich beim Blick entlang des Lichtstrahls gesehen habe (d.h. die sich bewegenden Blätter und die Sonne), weil dieser «in Wahrheit nur ein Streifen staubigen Lichts in einem dunklen Schuppen» war. Das heißt, ich könnte mich darauf festgelegt haben, meine «Seitenansicht» des Lichtstrahls als die «wahre» zu betrachten. Doch diese Seitenansicht selbst ist ebenfalls ein Fall jener Tätigkeit, die wir «Sehen» nennen. Und dieser neue Fall könnte ebenfalls von außen betrachtet werden. Ich könnte mir von einem Wissenschaftler erklären lassen, dass das, was ein Lichtstrahl in einem Schuppen gewesen zu sein schien, «in Wahrheit nur eine Erregung meiner Sehnerven» war. Und das wäre ebenso gut (oder schlecht) eine Weg-Erklärung wie die vorherige. Das Bild des Lichtstrahls im Werkzeugschuppen müsste nun ebenso beiseitegelegt werden wie das vorherige Bild der Bäume und der Sonne. Und wo stehen wir dann?
Mit anderen Worten, wir können aus einer Erfahrung nur heraustreten, indem wir in eine andere Erfahrung eintreten. Deshalb werden wir, wenn alle Innenerfahrungen in die Irre führen, immer in die Irre geführt. Der Hirnphysiologe kann, wenn er will, sagen, das Denken des Mathematikers sei «nur» kleine physische Bewegungen in der grauen Masse. Aber was ist dann mit dem Denken des Physiologen selbst in eben diesem Moment? Ein zweiter Hirnphysiologe könnte, wenn er darauf blickt, es ebenfalls zu nicht mehr als kleinen physischen Bewegungen im Schädel des ersten Physiologen erklären. Wo soll dieser Unsinn nur enden?
Die Antwort ist, dass wir erst gar nicht erlauben dürfen, dass dieser Unsinn beginnt. Wir müssen, um dem Irrsinn zu entgehen, von Anfang an bestreiten, dass das Sehen auf etwas grundsätzlich und wesenhaft wahrer oder besser ist als das Sehen entlang von etwas. Man muss entlang jeder und zugleich auf jede Sache blicken. In bestimmten Fällen werden wir Gründe finden, die eine oder die andere Sichtweise als unterlegen zu betrachten. So muss zum Beispiel die Innensicht rationalen Denkens wahrer sein als die Außensicht, die nur Bewegungen der grauen Masse sieht, denn wenn die Außensicht die richtige wäre, wäre alles Denken (diesen Gedankengang eingeschlossen) wertlos, und das widerspricht sich selbst. Es kann keinen Beweis geben, dass es keine Beweise gibt. Auf der anderen Seite mag die Innensicht des Tanzes des Wilden vor Nyonga als Täuschung erkannt werden, weil wir Gründe für die Annahme finden, dass Saatgut und Babys nicht wirklich von ihm beeinflusst werden.
Wir müssen in der Tat jeden Fall für sich betrachten. Aber wir müssen ohne Vorurteile für oder gegen eine der beiden Sichtweisen beginnen. Wir wissen nicht im Voraus, ob der Liebende oder der Psychologe die zutreffendere Darstellung von Liebe gibt, ob beide Darstellungen in ihrer jeweiligen Weise gleichermaßen zutreffend sind, oder beide gleichermaßen falsch. Wir müssen es halt herausfinden. Aber die Zeit des Einschüchterns muss enden.
3. Hedonik
Es gibt Freuden, deren Ursachen man nahezu unmöglich benennen kann und die nur sehr schwer zu beschreiben sind. Ich habe gerade eine solche Freude erlebt, als ich mit der U-Bahn von Paddington nach Harrow fuhr. Ich bin mir keineswegs sicher, ob es mir gelingen wird, Ihnen davon eine Vorstellung zu vermitteln, doch meine einzige Chance besteht darin, Sie von Anfang an mit der Tatsache vertraut zu machen, dass ich bin, was man früher ein Landei nannte. Abgesehen von einer kurzen Weile in einem Londoner Krankenhaus während des letzten Krieges habe ich nie in London gelebt. Daher kenne ich es nicht nur schlecht, sondern habe auch nie gelernt, es als einen ganz normalen Ort zu betrachten. Wenn ich auf dem Rückweg von einem meiner Besuche unter die Erde tauche, um nach Paddington zu gelangen, weiß ich nie, ob ich an der Treppe unter dem Hotel oder an einem anderen Ort am Ende der Abfahrtsgleise wieder ans Tageslicht komme. «Alles ist Schicksal», soweit es mich betrifft; ich muss auf beides gefasst sein, wie ich auf Nebel, Regen oder Sonnenschein gefasst sein muss.
Doch die größte terra incognita26