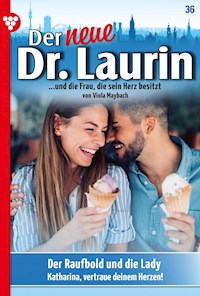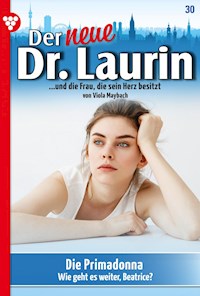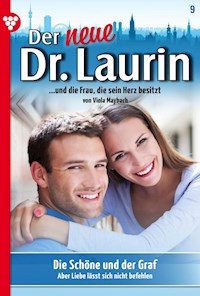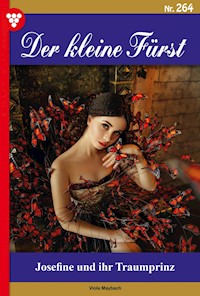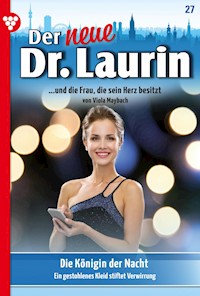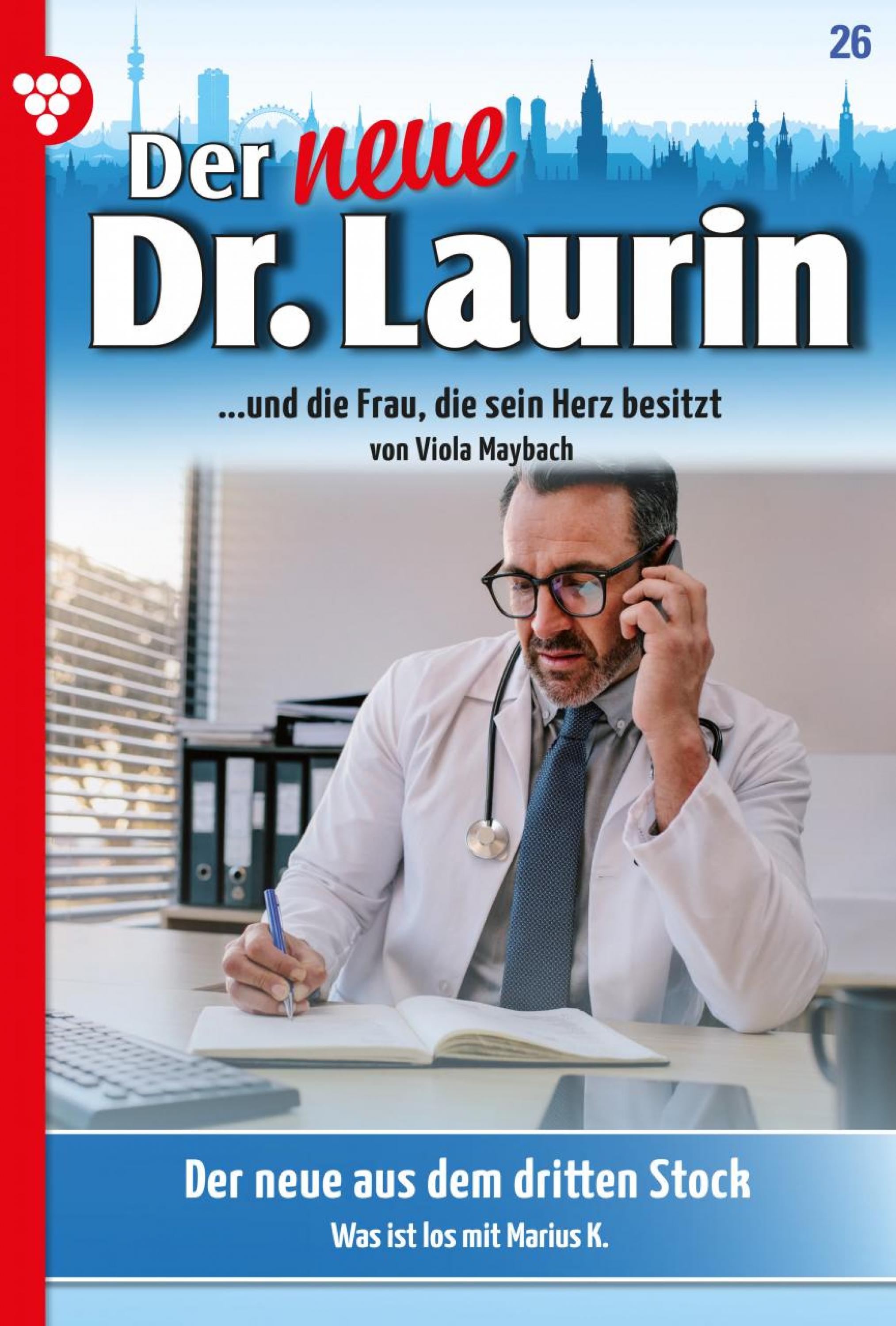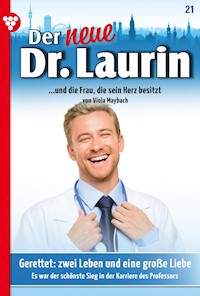30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der kleine Fürst
- Sprache: Deutsch
Viola Maybach hat sich mit der reizvollen Serie "Der kleine Fürst" in die Herzen der Leserinnen und Leser geschrieben. Alles beginnt mit einem Schicksalsschlag: Das Fürstenpaar Leopold und Elisabeth von Sternberg kommt bei einem Hubschrauberunglück ums Leben. Ihr einziger Sohn, der 15jährige Christian von Sternberg, den jeder seit frühesten Kinderzeiten "Der kleine Fürst" nennt, wird mit Erreichen der Volljährigkeit die fürstlichen Geschicke übernehmen müssen. "Der kleine Fürst" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. E-Book 1: Nur Mut, Stephanie! E-Book 2: Der schöne Theodor E-Book 3: Erst der Unfall - dann das Glück! E-Book 4: Die Schöne - mit den zwei Gesichtern E-Book 5: Du wirst nie erwachsen, Lucie! E-Book 6: Ein dunkles Geheimnis E-Book 7: Die einsame Prinzessin E-Book 8: Dreifaches Glück E-Book 9: Ihre letzte Chance E-Book 10: Der geheimnisvolle Graf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Nur Mut, Stephanie!
Der schöne Theodor
Erst der Unfall - dann das Glück!
Die Schöne - mit den zwei Gesichtern
Du wirst nie erwachsen, Lucie!
Ein dunkles Geheimnis
Die einsame Prinzessin
Dreifaches Glück
Ihre letzte Chance
Der geheimnisvolle Graf
Der kleine Fürst – Staffel 41 –
E-Book 401- 410
Viola Maybach
Nur Mut, Stephanie!
Roman von Maybach, Viola
»Warum suchst du ihn eigentlich?«, erkundigte sich Michaela von Zitzewitz bei ihrer Freundin Stephanie von Bervelde. »Ich meine, du kennst ihn doch überhaupt nicht, Steffie! Ich begreife nicht, warum es dir so wichtig ist, ihn zu finden.«
Sie lagen am Swimmingpool der Familie Zitzewitz, den sie an diesem Tag ganz für sich allein hatten: Ein großes Becken, über das im Winter ein Glasdach geschoben werden konnte, so dass man ganzjährig schwimmen konnte. Die Zitzewitz’ bewohnten eine elegante Villa, etliche Kilometer von Schloss Sternberg und dem gleichnamigen kleinen Ort entfernt. Die Villa fand Stephanie nicht besonders beeindruckend – zu weitläufig, zu kühl –, doch der Pool hatte es ihr angetan. So oft es ging, besuchte sie Michaela, die eine ebenso begeisterte Schwimmerin war wie sie.
»Wegen meiner Oma«, antwortete sie jetzt, als sie sich neben ihrer Freundin auf eine Liege fallen ließ. Es war einer dieser heißen Tage, an denen sie das Wasser am liebsten überhaupt nicht verlassen hätte. Vorsichtshalber waren sie mit ihren Liegen in den Schatten ausgewichen, in der Sonne hätten sie es überhaupt nicht aushalten können. »Sie hat Jonathan gemocht und öfter von ihm erzählt«, fuhr Stephanie fort. »Es klang immer ein bisschen geheimnisvoll, das hat mich neugierig gemacht. Und kurz bevor meine Oma gestorben ist, hat sie noch einmal von ihm gesprochen.«
»Und – was hat sie da gesagt?«, fragte Michaela.
»Dass sie es schön gefunden hätte, uns beide einmal zusammen zu erleben.«
»Wie ist dieser Jonathan noch mal mit dir verwandt?«
»Er ist der Enkel eines Cousins meiner Oma«, erklärte Stephanie.
»Ein entfernter Verwandter also«, stellte Michaela fest.
»Ja«, bestätigte Stephanie. Sie reckte sich wohlig, ihr Bikini war schon wieder trocken. Nur die blonden Haare fühlten sich noch feucht an. Aber sie würde ohnehin gleich wieder ins Wasser springen. »Sehr entfernt, aber meine Oma hatte trotzdem ein enges Verhältnis zu ihm. Er muss sie mehr geliebt haben als seine eigene Großmutter. Trotzdem ist er nicht zu ihrer Beerdigung gekommen.«
»Vielleicht weiß er gar nicht, dass sie gestorben ist«, gab Michaela zu bedenken. »Er scheint ja alle Brücken hinter sich abgebrochen zu haben. Wer hätte ihm davon erzählen sollen?«
»Meiner Oma hat er von unterwegs jedenfalls Briefe geschrieben. Aber sie wird ihm wohl kaum geantwortet haben. Er ist ja nie lange an einem Ort geblieben, und ob er sie auch angerufen hat, weiß ich nicht.«
»Und von wo hat er ihr geschrieben, weißt du das?«
»Von überallher. Er scheint wirklich die ganze Welt bereist zu haben. Aber ich habe die Briefe nicht gefunden.«
»Wenn du ihn schon seit Jahren suchst – wieso hast du mir nie davon erzählt?«, wollte Michaela wissen. Es klang ein wenig gekränkt.
»Weil ich es selbst ein bisschen ..., na ja, ein bisschen verrückt finde, ich wollte nicht ausgelacht werden. Er ist ein völlig fremder Mensch für mich, ich habe mit ihm überhaupt nichts zu schaffen. Aber mittlerweile denke ich, ich finde ihn sowieso nicht, und deshalb werde ich die Sache aufgeben. Und ich wollte dir endlich erklären, warum ich so oft am Computer sitze und im Internet herumsuche.«
»Alles nur wegen dieses Knaben?«
Stephanie musste lachen. »Ein Knabe ist er nicht mehr, er muss etliche Jahre älter sein als ich.«
»Hast du mit Leuten geredet, die ihn kannten? Ich meine, immerhin gehört er ja im weitesten Sinn zur Familie, da muss es doch ziemlich viele Leute geben, die dir helfen könnten.«
»Es gibt einige Tanten und Onkel, die sich an ihn erinnern, aber er ist ja schon seit dreizehn Jahren nicht mehr hier gewesen, Michaela! Sie haben ihn als aufmüpfigen Jungen in Erinnerung, der seinen Eltern viel Kummer gemacht hat. Er hat noch einen älteren Bruder und eine Schwester.«
»Und warum ist er eigentlich weggegangen? Damals muss er doch noch Schüler gewesen sein, oder?«
»Klar. Er war siebzehn, als er abgehauen ist – immerhin hat er daran gedacht, seinen Eltern mitzuteilen, dass er lebt, nicht entführt wurde, und dass es ihm gut geht. Er hat jedes Jahr eine Art Bericht verfasst, mehr nicht. Nur meine Oma, die hat richtige Briefe von ihm gekriegt.«
»Klingt so, als hätte er für seine sonstige Familie nicht viel übrig gehabt.«
»Meine Oma hat ihn verstanden, sie hat gemeint, das waren ziemlich engstirnige Leute. Mit Jonathans Eltern und Geschwistern hatte sie überhaupt keinen Kontakt. Zuerst waren sie natürlich außer sich, dass er weg war, aber sie haben sich wohl schnell damit abgefunden. Er muss viel Unruhe in die Familie gebracht haben.«
»Und als er endlich weg war, herrschte wieder ›Zucht und Ordnung‹?«
»So ungefähr, ja.«
Michaela richtete sich auf, stützte sich auf ihrem rechten Unterarm ab und warf Stephanie einen prüfenden Blick zu. »Wenn ich ehrlich sein soll, Steffie: Das klingt nicht so, als würdet ihr euch gut verstehen, dieser Jonathan und du.«
»Ich muss mich ja auch gar nicht mit ihm verstehen«, erwiderte Stephanie, ohne die Augen zu öffnen. »Ich will nur herausfinden, warum meine Oma ihn so mochte.«
»Hat sie dir das nicht erzählt?«
»Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur einfach gemerkt, wie gern sie ihn hatte. Vielleicht, weil er so anders war. Manchmal war ich sogar ein bisschen eifersüchtig auf ihn.«
»Du scheinst mir das genaue Gegenteil dieses Mannes zu sein – eine Abenteurerin bist du wahrhaftig nicht.«
Stephanie lachte und richtete sich ebenfalls auf. »Das stimmt«, gab sie freimütig zu. »Ich mag es, wenn alles seinen geordneten Gang geht. Unvorhergesehene Ereignisse machen mich eher nervös. Ich könnte niemals hier alles stehen und liegen lassen und mich als Vagabundin durchs Leben schlagen.« Sie sprang auf. »Nur im Wasser kann ich ziemlich wild sein, wie du weißt!«
Sie nahm Anlauf und hechtete mit einem perfekten Sprung wieder ins kühlende Nass.
Michaela sah ihr eine Weile zu, wie sie mit langen eleganten Zügen durchs Wasser kraulte, dann tat sie es ihrer Freundin nach.
*
Eberhard Hagedorn, langjähriger Butler auf Schloss Sternberg, unterzog den Besucher einer raschen, aber gründlichen Prüfung. Der blonde junge Mann war groß gewachsen, trug seine Haare recht lang, und er war nicht so gekleidet, wie man es von den Schlossgästen gemeinhin gewohnt war: Seine
Jeans hatten schon bessere Tage gesehen, das Hemd war ein Freizeithemd, und an den Füßen des Unbekannten erblickte Eberhard Hagedorn braune Stiefel, die ihrem Besitzer schon sehr lange gute Dienste zu tun schienen. Staubig waren sie außerdem.
Aber die blauen Augen im gut geschnittenen Gesicht des Mannes blitzten fröhlich, um seinen Mund zuckte ein Lächeln, und alles in allem wirkte er so sympathisch, dass man ihm nicht böse sein konnte, weil er sich in diesem unpassenden Aufzug hier präsentierte. Dennoch blieb natürlich die Frage, was er hier wollte. Vermutlich suchte er Arbeit und hatte sich ganz einfach an der Tür geirrt.
»Na, Herr Hagedorn?«, lachte der Besucher jetzt. »Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie nicht wissen, wer ich bin?«
Eberhard Hagedorn, von dem nicht wenige sagten, dass er der Inbegriff des perfekten Butlers war, unterzog den jungen Mann erneut einer eingehenden Betrachtung. Seine Augen weiteten sich. »Jonathan von Clees!«, rief er. »Sind Sie das wirklich? Als ich Sie das letzte Mal sah, waren Sie noch ein Teenager!«
Jonathan lachte noch lauter. Er kümmerte sich nicht darum, ob sein Verhalten unpassend war, sondern umarmte den alten Butler voller Zuneigung. »Ich freue mich, dass Sie sich noch an mich erinnern.«
Eberhard Hagedorn erwiderte die Umarmung nur kurz, dann befreite er sich rasch, denn natürlich gehörte es sich nicht, dass er mit den Gästen des Hauses einen derart vertraulichen Umgang pflegte. »Bitte, kommen Sie herein, Herr von Clees. Ich bin sicher, die Frau Baronin und der Herr Baron freuen sich, Sie zu sehen.«
»Nur Sofia und Fritz?«, fragte Jonathan verwundert. »Sind denn Lisa und Leo nicht da? Und ihr Kleiner – Christian? Den kenne ich als Zweijährigen, er war sehr putzig damals.« Leise lachend setzte er hinzu: »Die Leute haben ihn ›Der kleine Fürst‹ genannt – weil er neben Leo mit seinen einsneunzig so winzig war.«
Etwas an Eberhard Hagedorns Gesicht ließ ihn stutzen. »Ist etwas passiert, Herr Hagedorn? Ich bin gestern erst in Deutschland gelandet, und da ich keine Sehnsucht nach meiner Familie hatte, bin ich gleich nach Sternberg gefahren, weil ich nur hier Freunde habe. Ich bin also nicht auf dem Laufenden über die Ereignisse in Deutschland.«
Noch immer hatte Eberhard Hagedorn nichts gesagt. Er holte tief Luft. »Kommen Sie bitte herein. Vielleicht wäre es ganz gut, ich würde Ihnen ein paar Informationen geben, bevor Sie Baronin Sofia und Baron Friedrich sprechen.«
Er führte den Gast, was ausgesprochen ungewöhnlich war, in einen kleinen Salon, ohne ihn den Schlossbewohnern anzukündigen, doch in diesem besonderen Fall hielt er es für unerlässlich, so vorzugehen.
»Reden Sie schon, Herr Hagedorn«, drängte Jonathan.
»Fürstin Elisabeth und Fürst Leopold hatten vor mehreren Monaten einen tödlichen Unfall, Herr von Clees«, sagte der Butler, nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Es hatte schwere Unwetter hier in der Gegend gegeben, mit schlimmen Überschwemmungen. Sie wollten sich ein Bild von den Schäden machen, die Sturm und Regen angerichtet hatten. Als sie mit einem Hubschrauber unterwegs waren, sind sie von einer Windbö erfasst worden …« Eberhard Hagedorn hatte es sich lange nicht mehr gestattet, über das tragische Unglück zu sprechen, seine Stimme klang heiser. »Der Hubschrauber ist abgestürzt, der Pilot und das Fürstenpaar waren sofort tot.«
In Jonathans Augen glänzten Tränen.
»Und ich habe nichts davon gewusst«, sagte er leise. »Wie furchtbar, Herr Hagedorn.« Er hatte sichtlich Mühe, das soeben Gehörte zu verarbeiten. Nach einer Weile fragte er: »Und jetzt? Was ist mit dem Jungen?«
»Prinz Christian lebt jetzt in der Familie seiner Tante«, erklärte der Butler. »Zum Glück wohnt die Frau Baronin mit dem Baron und ihren beiden Kindern ja schon lange auf Sternberg, so dass Prinz Christian in seiner gewohnten Umgebung bleiben konnte. Er ist jetzt fünfzehn Jahre alt, und der Familienzusammenhalt hilft ihm, den Verlust zu verkraften. Und übrigens wird er immer noch ›Der kleine Fürst‹ genannt, der Name ist ihm geblieben. Er kann seinem Vater ja erst nachfolgen, wenn er volljährig ist.«
Jonathan schüttelte langsam den Kopf, er fühlte sich benommen. Nach einer Weile fragte er: »Zwei Kinder haben die Kants jetzt? Damals hatten sie nur einen Sohn, Konrad. Aber ich erinnere mich jetzt, dass Sofia schwanger war, als ich weggegangen bin.«
»Baronin Anna ist jetzt dreizehn«, erklärte Eberhard Hagedorn. »Sie und Prinz Christian sind ein Herz und eine Seele, auch das hilft ihm.«
»Noch ein Verlust«, murmelte Jonathan. »Lisa und Leo waren ja etliche Jahre älter als ich, aber ich habe sie immer so bewundert – und ich habe mich wohl gefühlt in ihrer Gegenwart. Bei ihnen konnte ich so sein, wie ich war, ich musste mich nicht verbiegen, damit sie mich akzeptierten. Und nun sind sie nicht mehr da.«
»Haben Sie noch andere Tote zu beklagen, Herr von Clees?«, fragte Eberhard Hagedorn.
»Ja, Amalie von Bervelde, eine entfernte Verwandte von mir, die ich aber insgeheim als meine Großmutter angesehen habe, ist während der Zeit meiner Abwesenheit ebenfalls gestorben«, erklärte Jonathan. »Da sie schon alt war und auch nicht mehr ganz gesund, hatte ich jemanden beauftragt, mir regelmäßig Bericht zu erstatten. So habe ich von ihrem Tod erfahren.«
»Sie hatten auch mit ihr keinen direkten Kontakt?«
»Wenn ich mit ihr gesprochen habe, geriet ich jedes Mal in Versuchung, zurückzukehren, um sie zu sehen und in aller Ruhe mit ihr zu reden – aber ich wollte nicht hierher zurück, Herr Hagedorn. Deshalb habe ich nur selten angerufen, ihr aber regelmäßig geschrieben. Ich wusste, dass sie sich darüber freut.« Jonathan stand auf, er wischte sich über die Augen. »Meine Güte«, sagte er. »Lisa und Leo leben nicht mehr. Ich danke Ihnen, dass Sie es mir gesagt haben, so bin ich jetzt wenigstens vorbereitet.«
»Es ist für die Frau Baronin immer noch schwierig, darüber zu sprechen«, erklärte der Butler. »Sie hat sich mit Fürstin Elisabeth so gut verstanden; die beiden standen einander sehr nahe.«
»Und Christian? Ich weiß gar nicht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll«, murmelte Jonathan. »Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich gar nicht gekommen.«
»Für Sie ist diese Nachricht neu, aber wir alle hier hatten ja bereits etliche Monate Zeit, uns damit
auseinanderzusetzen«, erwiderte Eberhard Hagedorn. »Das Leben hier läuft wieder in normalen Bahnen. Sie müssen also nicht sofort auf das Unglück zu sprechen kommen.«
Jonathan drückte ihm noch einmal fest die Hand, dann bat er, den Herrschaften seine Ankunft anzukündigen.
*
Die dreizehnjährige Anna von Kant und ihr fünfzehnjähriger Cousin Christian von Sternberg waren mit Christians Boxer Togo unterwegs gewesen – so lange, dass selbst der unermüdliche Togo nichts einzuwenden hatte, als sie sich endlich auf den Heimweg machten. Sie waren noch etwa fünfzig Meter vom Schloss entfernt, als ein Auto auf dem Schlossplatz vorfuhr, das sie noch nie gesehen hatten. Es war ein kleines Modell, nagelneu, dem ein großer blonder, reichlich verwegen aussehender Mann entstieg. Er sah sich um, bemerkte sie aber nicht, und stiefelte dann entschlossen auf das Eingangsportal zu.
»Wer ist das denn?«, fragte Anna entgeistert. »Und was will er im Schloss? Er sieht eher aus, als wollte er in den Ställen arbeiten.«
»Herr Hagedorn wird ihm schon sagen, dass er sich geirrt hat«, meinte Christian. Unwillkürlich waren sie stehen geblieben.
Das Portal wurde geöffnet, Eberhard Hagedorn erschien, der junge Mann schien ihm etwas zu erklären – und dann bot sich den beiden Teenagern ein so ungewohntes Bild, dass Anna unwillkürlich nach Luft schnappte: Der Blonde trat auf den Butler zu und schloss ihn herzlich in die Arme. Und Eberhard Hagedorn ließ das zu, erwiderte die Umarmung sogar, wenn auch nur kurz. Dann befreite er sich und ließ den Besucher eintreten.
»Was war das denn?«, fragte Anna entgeistert. »Ich habe den Mann in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wieso umarmt er Herrn Hagedorn? Und wieso darf er ins Schloss?«
»Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer er ist.«
Sie wechselten einen Blick, dann setzten sie sich wieder in Bewegung. Als sie das Schloss betraten, erwartete sie eine weitere Überraschung: Annas Mutter, Baronin Sofia, kam ihnen nervös entgegen. »Habt ihr Herrn Hagedorn gesehen?«, fragte sie. »Ich muss dringend etwas mit ihm besprechen, aber er scheint wie vom Erdboden verschwunden zu sein.«
Anna und Christian mussten nicht einmal einen Blick wechseln, um übereinstimmend die Köpfe zu schütteln und die Baronin somit anzuschwindeln.
Warum sie das taten, hätten sie nicht erklären können – aber wenn Herr Hagedorn, den sie beide sehr gern hatten, mit einem abenteuerlich aussehenden Besucher im Schloss verschwand und dann unauffindbar war, musste er einen guten Grund dafür haben.
»Herr Hagedorn war noch nie verschwunden, Tante Sofia«, bemerkte der kleine Fürst.
Als hätte der Butler diese Worte gehört, wurde hinter ihnen eine Tür geöffnet, und er kam aus einem der Salons, gefolgt von dem großen Blonden.
Die Augen der Baronin weiteten sich angesichts dieses ungeheuerlichen Vorgangs, doch der Besucher kam ihr zuvor. »Hallo, Sofia«, sagte er. »Herr Hagedorn war so freundlich, mich über einige Ereignisse während meiner Abwesenheit aufzuklären, die immerhin mehr als dreizehn Jahre gedauert hat. Jetzt bin ich einigermaßen informiert.«
Sie trat einen Schritt näher, die Augen leicht zusammengekniffen. Anna und Christian warteten gespannt auf ihre nächsten Worte. Auch aus der Nähe kam ihnen der Blonde nicht bekannt vor, was nach dreizehnjähriger Abwesenheit ja auch nur normal war.
»Jonathan!«, rief die Baronin endlich. »Das glaube ich nicht – Jonathan von Clees!«
Er drückte sie an sich. »Herr Hagedorn hat mich auch erst mit einiger Verzögerung erkannt, aber immerhin!«
»Ach, Jonathan, wie schön, dich wiederzusehen!«
Eberhard Hagedorn zog sich unauffällig zurück – er hatte seine Pflicht erfüllt. Alles Weitere durfte er nun sicherlich getrost den Schlossbewohnern überlassen.
*
»Bitte sehr, Frau Mahlmann«, sagte Stephanie freundlich und überreichte der alten Dame die Papiere, die sie soeben ausführlich mit ihr besprochen hatte. »Damit ist alles erledigt.«
»Danke, Frau von Bervelde«, seufzte die ältere Dame. »Was hätte ich bloß ohne Sie getan?«
»Dafür sind wir da«, erklärte Stephanie. »Hoffentlich haben Sie Freude an der Wohnung.« Sie begleitete ihre Kundin noch zum Ausgang, dann kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück. Seit mehreren Jahren arbeitete Stephanie in der Kreditabteilung einer Bank, und sie wusste, dass sie den idealen Job für sich gefunden hatte. Sie liebte Zahlen, und sie hatte es gern ordentlich und übersichtlich. Nicht wenige ihrer Freunde zogen sie damit auf, dass sie ihre Wohnung stets in Ordnung hielt, ihre Blusen immer perfekt gebügelt waren und dass sie in jedem Januar bereits ihre Steuererklärung abgab. Dabei hatte Stephanie keine Hilfe im Haushalt, sie machte alles selbst. Ihre Familie war nicht vermögend und was sie besaß, hatte sie sich selbst erarbeitet.
»Kannst du mir mal helfen, Steffie?«, fragte eine klägliche Stimme neben ihr. »Ich blicke hier einfach nicht durch …«
Stephanie unterdrückte einen Seufzer. Ihre Kollegin Olivia Berkel war außergewöhnlich nett – und außergewöhnlich chaotisch. Sie hatte keine Ordnung in ihrer Ablage und ihrer Kundendatei, und sie geriet schnell unter Stress. Dann brachte sie noch mehr durcheinander als sonst und brauchte hinterher Hilfe, um sich überhaupt wieder zurechtzufinden. Schon mehr als einmal hatte Stephanie sie vorsichtig gefragt, warum sie bei der Bank blieb, wo ihr die Arbeit doch so offensichtlich nicht lag. »Meine Eltern wollen aber, dass ich hier bleibe – sie finden, ich brauche was Solides.«
»Was ist denn los?«, fragte sie jetzt.
Olivia erklärte ihr das Problem, und innerhalb weniger Minuten hatte Stephanie es behoben. Die dunklen Augen ihrer Kollegin strahlten dankbar. »Ich weiß nicht, wie ich ohne dich hier zurechtkommen sollte, Steffie!«
»Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, Olivia! Such dir endlich eine Arbeit, die dir liegt und bei der du Spaß hast! Irgendwann wird es den Chefs hier auffallen, dass du für den Job nicht geeignet bist.«
Stephanie konnte es sich leisten, so deutlich zu werden, da Olivia wusste, wie sie es meinte.
»Ich traue mich nicht, diesen Krieg mit meinen Eltern auszutragen«, murmelte Olivia. »Ehrlich, ich bin nicht besonders mutig, Steffie. Die werden mich in der Luft zerreißen. Wir haben nicht viel Geld, es war eine Belastung für sie, mich so lange durchzufüttern. Jetzt habe ich die Lehrzeit endlich hinter mir und sogar einen Job ergattert – wenn ich den aufgäbe, würden sie mich verstoßen.«
»Werden sie nicht, sie lieben dich schließlich. Und wenn du einen anderen Job vorweisen kannst …«
»Spinnst du? Da müsste ich ja erst einmal wissen, was ich gern machen würde. Außerdem habe ich nichts anderes gelernt.«
»Du ziehst dich gut an«, bemerkte Stephanie. »Das heißt, du verstehst etwas von Mode.«
»Ja, und? Das ist ja noch kein Beruf.«
»Es könnte aber einer werden«, fuhr Stephanie fort. Der Gedanke war ihr jetzt erst gekommen, aber sie spann ihn in Gedanken rasch weiter: Michaela hatte eine eigene Boutique eröffnet, die von Anfang an gut gelaufen war. Neulich hatte sie erwähnt, dass sie daran dachte, halbtags eine Verkäuferin einzustellen. Vielleicht konnte Olivia ihr samstags, wenn die Bank geschlossen hatte, aushelfen, um zu sehen, ob das etwas für sie war? Aber darüber musste sie natürlich zuerst mit Michaela reden, bevor sie Olivia davon erzählte.
»Nicht für mich, Steffie. Ich müsste wieder eine Ausbildung machen, also praktisch noch einmal von vorn anfangen – und ich würde viel weniger verdienen als jetzt. Glaub mir, ich habe schon über alles Mögliche nachgedacht, aber das führt zu nichts. Ich muss hierbleiben.« Nach einer kurzen Pause setzte sie hinzu: »Meine Mutter hat ihren Job verloren, jetzt ist es bei uns zu Hause noch enger. Du weißt ja, dass ich noch vier jüngere Geschwister habe.«
»Tut mir leid, das mit dem Job deiner Mutter wusste ich nicht.«
Olivia nickte. »Nochmals vielen Dank«, sagte sie und wandte sich wieder ihrem Computer zu.
Stephanie sah, dass sie mit den Tränen kämpfte und ließ sie daher in Ruhe. Für dieses Mal hatte sie ohnehin bereits genug gesagt.
Noch am selben Abend sprach sie mit Michaela über ihre Kollegin – doch Michaela reagierte ähnlich skeptisch wie Olivia. »Sie hat keine Ausbildung, das sagst du selbst, Steffie. Was soll ich dann mit ihr?«
»Sie hat ein Gespür für Mode, und sie kann gut mit Menschen umgehen. Die Kunden, die sie betreut, sind alle ganz begeistert von ihr, weil sie ehrlich und warmherzig ist und versteht, welche Ängste die Leute um ihr Geld haben. Sie ist nur leider etwas chaotisch …«
»Und so eine soll ich freiwillig in meinen Laden lassen?«, rief Michaela. »Eine, die mir hier alles durcheinanderbringt? Also, ich verstehe dich nicht. Willst du mich ruinieren?«
»Ich glaube nicht, dass sie bei dir auch chaotisch wäre«, antwortete Stephanie nach längerem Nachdenken. »Du müsstest sie mal sehen – sie zieht sich wirklich gut an, was man sogar bei uns in der Bank merkt, wo ja doch ziemlich enge Kleidervorschriften herrschen. Aber trotzdem schafft sie es, sich immer so zu kleiden, dass es nicht langweilig wirkt. Das ist hohe Kunst, wenn du mich fragst. Ich trage immer nur Kostüme und Hosenanzüge mit wechselnden Blusen. Sie ist da viel erfinderischer, und trotzdem sieht sie seriös aus.«
»Also, ich will dich ja nicht beleidigen, meine Süße, aber verglichen mit dir ist beinahe jede Frau fantasievoll angezogen«, bemerkte Michaela. »Wenn du mir ein einziges Mal gestatten würdest, dich anzuziehen, würde ich eine andere Frau aus dir machen.«
Lachend wehrte Stephanie ab. »Nein, danke, ich will die bleiben, die ich bin, und für die Bank bin ich genau richtig angezogen.«
»Aber dir fällt immerhin auf, dass deine Kollegin auch richtig angezogen ist, obwohl sie mehr Abwechslung in ihre Garderobe bringt.«
»Ja, schon – ich sehe das und weiß trotzdem, dass es für mich nichts ist. Jetzt hör auf, von mir zu reden, Michaela. Es geht um Olivia.«
Michaela gab ihren Widerstand auf. »Wenn sie will, kann sie nächsten Samstag mal vorbeikommen, wir beschnuppern uns, und ich lasse sie mal eine Kundin bedienen«, erklärte sie. »Aber ich sage ihr deutlich die Meinung, darauf soll sie sich gefasst machen.«
Stephanie beugte sich vor und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Danke, du bist eine wahre Freundin, und ich weiß, was es dich kostet, mein biederes Aussehen zu ertragen.«
»Du bist eine so schöne Frau«, stellte Michaela wieder einmal fest, »ich würde aus dir eine Granate machen. Aber du willst ja unauffällig bleiben und weiterhin in grauen, blauen und schwarzen Kostümen und Anzügen auftreten. Langweiliger geht’s wirklich nicht.«
»Ab und zu siehst du mich immerhin auch im Bikini«, erinnerte Stephanie sie.
»Ja, wenn das nicht wäre, hätte ich die Hoffnung auch schon aufgegeben!«, lachte Michaela. »Komm rein, ich habe Hunger.«
Stephanie folgte ihr in die Villa. »Wie lange willst du eigentlich hier noch wohnen bleiben? Hast du nicht manchmal Lust auf eine eigene Wohnung?«, fragte sie durchaus besorgt, denn wenn Michaela umzog, gehörte die Nutzung des Swimmingpools der Vergangenheit an.
»Ich ziehe hier überhaupt nicht weg, glaube ich. Warum sollte ich? Die Villa ist riesig, meine Eltern sind ständig unterwegs, und ich habe diesen tollen Pool. Das Einzige, was ich gern hätte, wäre ein völlig abgetrennter Bereich für mich, dafür müsste man nur eine Wand einziehen und einen eigenen Eingang schaffen. Das werde ich ihnen vorschlagen, wenn sie zurückkommen. Ich finde es nett, sie in der Nähe zu haben, wenn sie hier sind.«
»Und ich bin auch froh, wenn du bleibst, wegen des Pools«, meinte Stephanie. »Das ist zwar egoistisch, aber die reine Wahrheit.«
Die Haushälterin der Familie Zitzewitz hatte einen sehr schmackhaften Auflauf zubereitet, den sich die beiden jungen Frauen schmecken ließen. Danach setzten sie sich noch auf die Terrasse, bis Stephanie gähnend feststellte: »Ich muss los, Micky, ich bin müde. Ich rufe dich morgen an wegen Olivia, okay?«
»Die hatte ich schon beinahe wieder vergessen«, murmelte Michaela. »Ja, ruf mich an. Einen Samstag werde ich die Chaos-Queen schon aushalten.«
Sie umarmten einander, dann setzte sich Stephanie in ihren Wagen und fuhr in die kleine Wohnung, die sie sich vor kurzem gekauft hatte. Sie nahm die Post aus dem Briefkasten, warf sofort alles Unwichtige weg und legte den Rest ordentlich ab. Auch in der Küche gab es noch ein wenig aufzuräumen, weil sie morgens beim Verlassen der Wohnung sehr in Eile gewesen war. Erst als auch das erledigt war, machte sie sich zum Schlafen bereit.
Keine Viertelstunde später schaltete sie ihre Nachttischlampe aus und schlief ein.
*
»Überall?«, fragte Anna ungläubig. »Du willst damit sagen, dass du wirklich die ganze Welt gesehen hast?«
»Na ja, nicht die ganze natürlich«, räumte Jonathan an. »Ich bin nicht auf jedem Inselchen im Pazifik gewesen, falls du das meinst. Und ich habe auch nicht jedes afrikanische Land besucht. Aber allein in Afrika habe ich mich insgesamt drei Jahre aufgehalten, also denke ich, dass ich dort ganz gut Bescheid weiß. In Südamerika war ich zwei Jahre, in den USA auch. Dann Asien …«
Sie hörten ihm gebannt zu. Besucher wie Jonathan von Clees waren selten auf Sternberg – er wirkte wie jemand aus einer anderen Welt. Sein zwangloses Benehmen war ungewöhnlich, sein Aussehen war es, und seine Berichte waren es erst recht. Als sie am Abend zuvor erfahren hatten, dass er mit siebzehn Jahren aus seinem Elternhaus marschiert war, um es bis zum heutigen Tag nie wieder zu betreten, hatte Annas älterer Bruder Konrad ausgerufen: »Wenn ich das auch machen wollte, würde das heißen, dass ich nächstes Jahr Sternberg verlasse!«
»Wünschst du dir das denn?«
Einige Augenblicke war es still gewesen, dann hatte der Junge mit verlegenem Lächeln gestanden: »Nee, eigentlich nicht. Mir gefällt es hier ganz gut.«
»Dann freu dich!«
Jetzt streiften Anna und Christian mit Jonathan durch das Waldgebiet, das noch zum Schlosspark gehörte. Togo war längst aus ihrem Blickfeld verschwunden, er folgte aufregenden Spuren, von denen die Menschen nichts ahnten.
»War es bei dir zu Hause so schrecklich, Jonathan?«, fragte Christian.
Die Antwort kam prompt und unmissverständlich. »Ja.«
Nach einer Weile setzte Jonathan hinzu: »Sie haben mich nicht geschlagen oder misshandelt, das dürft ihr nicht denken. Aber meine Eltern waren, um es vorsichtig auszudrücken, Menschen, die sich an strikte Regeln hielten und es nicht akzeptieren konnten, wenn jemand sich nach mehr Freiheit sehnte. Es gab eine Vielzahl von Verboten bei uns, gelacht wurde selten, und hatte man ein Verbot missachtet, wurde man streng bestraft.«
Er holte tief Luft. »Meine Eltern sind jetzt beide tot, mit meiner Schwester und meinem Bruder hat mich schon damals nichts verbunden. Sie leben heute noch so wie damals, hatten nie das Bedürfnis, auszubrechen. Um es kurz zu machen: Ich bin einfach in die falsche Familie hineingeboren worden – ich sah sogar anders aus als die anderen, mit meinen blonden Haaren und den blauen Augen.«
Er lachte leise, es klang ein wenig traurig, bemerkten Anna und Christian. »Als Junge habe ich mir oft vorgestellt, dass ich bei meiner Geburt vertauscht worden bin und eigentlich in eine ganz andere Familie gehöre. Das war eine tröstliche Vorstellung.«
»Wissen sie, dass du in Deutschland bist?«
»Ich habe beide angerufen, ihre Freude hielt sich in Grenzen. Ich denke nicht, dass wir uns sehen werden.«
»Weshalb bist du eigentlich zurückgekommen?«, fragte der kleine Fürst zögernd. »Es klingt so, als gäbe es hier niemanden, den du gern gesehen hättest.«
»Ich wollte das Grab einer Frau besuchen, die ich immer sehr gern gehabt habe. Wir waren nur entfernt miteinander verwandt, aber sie war in meiner ganzen weitläufigen Verwandtschaft der einzige Mensch, der mich so geliebt hat, wie ich war. Ihr habe ich immer geschrieben, von überall her.« Jonathan stockte kurz, dann fuhr er fort: »Und ich wollte euch alle hier auf Sternberg gern wiedersehen.«
Zum ersten Mal sprach er nun in Christians Gegenwart von dessen verstorbenen Eltern. »Vor allem deine Mutter und deinen Vater, Chris. Sie haben nie versucht, mich zu verändern, sondern mich so akzeptiert, wie ich war. Und sie haben mich nicht merken lassen, dass ich runde zehn Jahre jünger war als sie, sondern mich ernst genommen. Es war der größte Schock für mich zu erfahren, dass sie nicht mehr leben.«
Er wartete einen Augenblick und setzte dann leiser hinzu: »Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich nicht hier gewesen bin, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen.«
Christian nickte nur, erwiderte aber nichts.
»Sie liegen da vorn auf dem Hügel«, sagte Anna an seiner Stelle.
»Dann werde ich sie dort besuchen, wenn es dir recht ist, Chris«, sagte Jonathan.
»Du kannst mich begleiten, ich gehe jeden Tag zu ihnen. Heute Abend, vor dem Essen.«
»Sehr gern, danke.« Jonathan atmete tief durch und beschloss, das Thema zu wechseln, bevor der Junge in traurige Stimmung geriet. »Jetzt wisst ihr also einigermaßen Bescheid über mein Leben, nun erzählt mir von euch. Dich habe ich damals noch nicht sehen können, Anna, denn du warst ja noch nicht auf der Welt. Konny war schon ziemlich frech und fand, dass er eigentlich keine Geschwister brauchte – und du warst schon mit zwei Jahren ›Der kleine Fürst‹, Chris.«
»Der bin ich ja immer noch.« Christians Stimme klang nachdenklich. »Im Vergleich zu dir erleben wir nicht besonders viel, nicht, Anna? Wir verreisen auch nur selten. Aber wir haben viele Gäste hier, das ist schön. In der Schule ist auch immer was los. Langweilig ist es eigentlich nie.«
»Ich bin auch nicht von zu Hause ausgerissen, weil ich es langweilig fand«, erklärte Jonathan. »Es war mir zu eng, ich bekam keine Luft. Das ist etwas anderes, glaub mir. Wenn ich mich von meiner Familie geliebt gefühlt hätte, wenn sie mich hätten sein lassen, wie ich nun einmal war – ich wäre sicherlich geblieben. Freut euch, dass ihr hier aufwachsen dürft, wo es so schön ist und wo alles getan wird, damit es euch gut geht.«
Seine Stimme hatte zum Schluss so ernst geklungen, dass Anna und Christian eingeschüchtert schwiegen. Jonathan sah wie ein Cowboy aus dem Wilden Westen aus – das fand zumindest Anna, aber so stark und unbekümmert, wie er auf den ersten Blick wirkte, war er offenbar nicht. Hinter seinem unbeschwerten Lächeln, das er so oft zeigte, verbargen sich bittere Erlebnisse und vielfältige Verletzungen.
Sie hatten ihn schon vorher gemocht, er war ihnen seiner offenen Art wegen gleich sympathisch gewesen, doch erst in diesen Minuten, als sie eher schweigsam und in sich gekehrt den Schlosspark durchquerten, um rechtzeitig zum Tee zurück zu sein, schenkten sie ihm, ohne es in Worten auszudrücken, ihre uneingeschränkte Zuneigung.
*
Olivia Berkel zögerte, als sie der Boutique von Michaela von Zitzewitz so nahe gekommen war, dass sie den Schriftzug ›Modeladen Nr. 5‹ lesen konnte. Die Zahl bezog sich auf die Hausnummer, wie sie gleich darauf erkannte. Sie war Stephanie wirklich dankbar für ihre Bemühungen, aber im Grunde hielt sie es für eine Schnapsidee, diesen Samstag in einer Modeboutique zu verbringen und dort ›auszuhelfen‹. Wozu sollte das gut sein? Sie würde ihre Arbeit in der Bank sowieso nicht aufgeben, das konnte sie sich gar nicht leisten …
Aber sie war trotzdem neugierig. Schon vor einigen Tagen war sie an dem Geschäft vorbeigelaufen, um zu sehen, welche Art von Mode Michaela von Zitzewitz führte. Erfreut hatte sie festgestellt, dass ihr jedes im Fenster ausgestellte Teil gut gefiel. Das war ihr Stil, den würde sie bestimmt auch verkaufen können.
Aber ich verstehe nichts davon, sagte sie sich jetzt. Ich kenne mich mit ein paar Marken aus, ich weiß, welche Farben mir gefallen, ich weiß, was man zusammen tragen kann. Aber von Stoffen habe ich keine Ahnung – und wie es wäre, einer Kundin etwas verkaufen zu müssen, das ihr in meinen Augen überhaupt nicht steht … Also, ich weiß nicht, ob ich das fertig brächte.
Sie hatte das Geschäft erreicht und stellte fest, dass erneut umdekoriert worden war. Auch die neu ausgestellten Kleidungsstücke gefielen ihr. Wenn sie richtig viel Geld gehabt hätte, wäre sie mit Freuden hier einkaufen gegangen. Sie holte tief Luft, stieß die Tür auf und trat ein.
Die Dunkelhaarige hinter der Theke musste Michaela von Zitzewitz sein. Eine schöne Frau, deren blaue Augen Olivia mit prüfendem Blick musterten. Sie war, natürlich, sehr modisch gekleidet und bestimmt die beste Werbung für ihr Geschäft, schoss es Olivia durch den Kopf.
»Guten Tag«, sagte sie schüchtern, »ich bin Olivia Berkel, eine Kollegin von Stephanie von Bervelde. Sie hat mit Ihnen über mich gesprochen, glaube ich.«
Michaela, die Olivia schon eine ganze Weile beobachtet hatte, wie sie sich mit zögernden Schritten ihrem Laden näherte, nickte und streckte Stephanies Kollegin die Hand hin. »Hallo, guten Morgen. Ich weiß nicht viel von Ihnen – nur, dass Sie in der Bank nicht besonders glücklich sind.«
»Nein, das bin ich nicht und werde es nie sein. Aber ich muss da bleiben, fürchte ich …«
Geschickt brachte Michaela sie zum Reden und erfuhr so noch einige Einzelheiten, die Stephanie nicht gewusst oder zumindest nicht erwähnt hatte. Sie ließ Olivia, während diese redete, nicht aus den Augen. Stephanie hatte zumindest in einem Punkt Recht gehabt: Ihre Kollegin verstand es, sich anzuziehen und das mit offenbar beschränkten Mitteln, denn sie trug keine teure Kleidung. Außerdem wirkte sie sympathisch, was für den Verkauf ebenfalls wichtig war. Dumm konnte sie auch nicht sein, denn immerhin hatte sie ihre Banklehre beendet und einen Job gefunden. Blieben also zwei Minuspunkte: Sie hatte keine Ausbildung als Textilfachverkäuferin, und sie neigte zum Chaos.
Verwirrt stellte Michaela fest, dass dieser Besuch anders verlief als von ihr geplant. Sie hatte diese Olivia eigentlich ein paar Stunden lang beschäftigen und sich dann freundlich wieder von ihr verabschieden wollen. Nun jedoch überlegte sie bereits, ob es nicht doch eine Möglichkeit gab, mit ihr zusammenzuarbeiten.
»Frau von Zitzewitz?« Olivias Augen ruhten fragend auf ihr.
»Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Was möchten Sie wissen?«
»Ob es Ihnen lieber wäre, wenn ich gleich wieder gehe. Ich habe ja echt keine Ahnung vom Geschäft und …«
»Nun sind Sie mal hier, da können Sie auch ein bisschen arbeiten«, fand Michaela. »Kommen Sie, ich erkläre Ihnen, was ich hier verkaufe – und was nicht und warum nicht.«
Sie machten einen Rundgang durch den Laden, der fast zwei Stunden dauerte. Allerdings wurden sie mehrmals durch Kundinnen unterbrochen. Währenddessen hielt sich Olivia im Hintergrund und hörte zu, wie Michaela die Damen beriet.
Als sie den Rundgang beendet hatten und wieder allein waren, fragte Michaela: »Nun, was sagen Sie?«
»Ein toller Laden«, sagte Olivia mit leuchtenden Augen. »Seltsam, dass ich nie daran gedacht habe, beruflich etwas mit Mode zu machen. Es wäre so viel interessanter für mich und schöner als in der Bank …« Sie brach ab und setzte schließlich mit leiser Stimme hinzu: »Ehrlich, ich hasse meine Arbeit. Ich kann ganz gut mit Zahlen umgehen, verstehen Sie das bitte nicht falsch, ich war in Mathematik immer gut in der Schule. Aber bloß weil man etwas kann, heißt es ja noch lange nicht, dass man es auch gern tut. Und in der Bank gibt es eigentlich nur ein Gebiet, das mir wirklich Freude macht: der Umgang mit den Kunden. Alles andere hasse ich.«
»Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber Stephanie erwähnte,
dass Sie …, na ja, manchmal den Überblick verlieren.«
»Manchmal ist gut«, murmelte Olivia niedergeschlagen. »Das passiert jeden Tag mindestens einmal. Bei Stress verliere ich die Übersicht – aber komischerweise nur in der Bank.«
Sie sah Michaelas skeptischen Blick und setzte eifrig hinzu: »Das stimmt, Sie müssen mir glauben! Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich da eigentlich gar nicht sein will.«
Die Tür des Ladens öffnete sich, gleich mehrere Kundinnen auf einmal drängten herein. Michaela fragte höflich, ob sie Hilfe brauchten oder sich nur umsehen wollten. Gleich darauf war sie in ein intensives Gespräch mit einer der Kundinnen vertieft. Eine andere kam kurz darauf direkt auf Olivia zu, mit einer Hose in der Hand. »Die würde ich gern anprobieren«, sagte sie, »haben Sie sie auch noch in Größe 38 da?«
Olivia zögerte nur einen winzigen Augenblick. Zu dem Rundgang hatte auch ein Blick in Michaelas Lager gehört. »Ich sehe gleich mal nach«, sagte sie, nahm der Kundin die Hose aus der Hand und ging ins Lager. Sie fand das Gesuchte in kurzer Zeit und kehrte zu der Kundin zurück, die mit der Hose in der Kabine verschwand.
Als sie wieder auftauchte, bat sie Olivia, ihr zu sagen, wie sie die Hose an ihr fände.
»Zu eng geschnitten für Sie«, antwortete Olivia offen. »Wir haben ein anderes Model, das ich für Sie geeigneter finde. Es hat den gleichen Farbton, ist aber etwas lässiger …«
Sie wunderte sich selbst, dass sie sich das Sortiment so genau gemerkt hatte. Mit sicherem Griff nahm sie die Hose, die sie meinte, vom Ständer und reichte sie der jungen Frau.
»Ich probiere sie mal an«, sagte diese.
Eine halbe Stunde später hatte Olivia ihr nicht nur eine Hose, sondern auch noch zwei dazu passende Blusen und ein T-Shirt verkauft. Sie brachte die Kundin zur Tür, wünschte ihr noch einen schönen Tag und kehrte zufrieden in den Laden zurück.
»Sie sind ein Naturtalent!«, stellte Michaela fest, als sie wieder allein waren. »Ich habe Sie beobachtet – und ich glaube Ihnen nicht, dass Sie nie zuvor Mode verkauft haben.«
»Stimmt aber«, sagte Olivia mit strahlendem Lächeln. »Ach bitte, Frau von Zitzewitz, lassen Sie mich in Zukunft samstags hier aushelfen! Ich habe es ja bisher für eine richtige Schnapsidee von Steffie gehalten, aber jetzt …«
Michaela streckte ihre Hand aus. »Meine Freunde nennen mich Micky. Auf gute Zusammenarbeit, Olivia!«
*
»Es gibt jemanden, den ich hier in Deutschland gern noch besuchen würde, bevor ich mich wieder auf die Reise mache«, sagte Jonathan zögernd, als er abends allein mit Baronin Sofia und Baron Friedrich in der Bibliothek saß. »Sie heißt Stephanie von Bervelde und ist die Enkelin meiner Wunsch-Großmutter Amalie von Bervelde, die vor zwei Jahren gestorben ist. Und vor allem werde ich zu Amalies Grab fahren. Um die Wahrheit zu sagen: Das ist einer der Gründe für meine Rückkehr. Ich bin ihr zu großem Dank verpflichtet. Ohne sie hätte ich es niemals geschafft, aus der Enge meines damaligen Lebens auszubrechen.«
»Wir kannten Amalie, aber sie war in den letzten Jahren gesundheitlich angeschlagen und hat ihr Haus nicht mehr oft verlassen. Stephanie sehen wir ab und zu, aber …« Die Baronin zögerte, sie hatte Angst, sich falsch auszudrücken.
»Aber?«, fragte Jonathan. »Mögt ihr sie nicht?« Bevor sie antworten konnten, setzte er hinzu: »Aber das kann nicht sein, Tante Amalie hatte sie sehr gern. Manchmal habe ich ihr eine Adresse hinterlassen, an die sie mir postlagernd Briefe schicken konnte. Sie hat sich nur Sorgen gemacht, dass Steffie – so hat sie sie immer genannt – nicht aus ihrer Haut heraus kann. Sie scheint sehr ordentlich und pflichtbewusst zu sein. Stimmt das?«
»Das ist ja der Punkt, Jonathan«, schmunzelte der Baron. »Wir haben Steffie auch gern, aber sie ist …, sie ist so korrekt und ordentlich, dass wir uns in ihrer Gegenwart immer ein wenig verkrampfen.«
»O je, ich höre schon, dass ich mir den Besuch lieber spare«, sagte Jonathan. »Verklemmte und kleinkarierte Leute gibt es in meiner Familie mehr als genug, mein Bedarf in dieser Hinsicht ist gedeckt.«
»Kleinkariert ist sie nicht, verklemmt eigentlich auch nicht – aber sie arbeitet in einer Bank, und da muss es ja korrekt zugehen. Vielleicht hat das ein bisschen auf sie abgefärbt. Wenn sie reitet, geht sie allerdings aus sich heraus.«
»Und wenn sie schwimmt«, ergänzte die Baronin. »Das habe ich jedenfalls schon mal jemanden sagen hören, aber wir haben sie nie im Wasser erlebt.«
»Wie ist sie denn nun?«, fragte Jonathan mit hochgezogenen Augenbrauen. »Wenn ich ehrlich sein soll: Ich kann sie mir nach euren Worten überhaupt nicht vorstellen.«
Die Baronin seufzte. »Sie ist ein sehr lieber Mensch. Wir haben sie von Herzen gern, Jonathan, aber wenn du mich fragst: Ein Schuss mehr Abenteurerblut in den Adern würde ihr nur guttun. Sie ist still, bescheiden und zurückhaltend. Sehr erfolgreich in ihrem Beruf, und wir haben noch nie erlebt, dass sie in irgendeiner Weise aus der Rolle gefallen wäre.«
»Ein braves Mädchen«, stöhnte Jonathan. »Alles, was ihr über sie sagt, klingt schrecklich langweilig.« Er sah den Blick, den Sofia und Friedrich tauschten und beeilte sich zu versichern:
»Keine Sorge, das ist meine eigene Interpretation, mir ist bewusst, dass ihr nichts Böses über sie gesagt habt.«
»Sie ist reizend!«, versicherte die Baronin. »Aber ich fürchte, in einem Punkt hast du Recht, Jonathan: Zugleich ist sie so brav, dass es schon ein bisschen langweilig ist.«
»Dann frage ich mich aber, warum Tante Amalie sie so gern hatte«, brummte Jonathan. »Na ja, im Grunde spielt es auch keine Rolle mehr, es war ohnehin kein fester Plan, sie kennenzulernen, sondern eher ein Gedanke. Aber jetzt, nachdem wir über sie gesprochen habe, neige ich dazu, dieses Vorhaben aufzugeben.«
»Überleg es dir noch einmal«, riet der Baron. »Wir sind schließlich kein Maßstab, Jonathan, wir kennen Steffie nicht gut genug. Außerdem hatte sie ja wohl Kontakt zu ihrer Großmutter bis zu deren Tod und könnte dir so vielleicht noch einiges erzählen, was vielleicht wichtig für dich ist.«
»Das stimmt«, gab Jonathan nachdenklich zu. »Über diesen Punkt habe ich noch gar nicht nachgedacht. Na gut, ich muss diese Entscheidung ja nicht heute treffen.«
»Wie lange wolltest du denn in Deutschland bleiben?«
»Ich habe, wie es meine Art ist, keine Pläne gemacht. Wenn es mir gefällt, bleibe ich ein bisschen länger – wenn nicht, reise ich bald wieder ab.« Er grinste verschmitzt. »Bei euch gefällt es mir sehr gut, hier könnte ich es eine Weile aushalten.«
»Wir würden uns freuen«, versicherte der Baron.
»Ich habe nur Spaß gemacht, Fritz. In ein paar Tagen reise ich weiter, es gibt einige geschäftliche Dinge, die ich außerdem regeln will.«
»Das hast du uns bisher noch nicht verraten: Wie du eigentlich in all den Jahren dein Geld verdient hast!«
»Mit Büchern«, erklärte Jonathan. »Reiseliteratur – was sich in meinem Fall ja anbietet. Ich habe großes Glück gehabt, dass sich gleich mein erstes Buch richtig gut verkauft hat. Ich habe es mit achtzehn geschrieben, es war ein Ratgeber für Leute, die wie ich die Welt sehen wollten und überall auf eine preiswerte Unterkunft und vielleicht einen Job angewiesen waren. Heute gibt es jede Menge solcher Bücher, aber damals hatte ich die Nase vorn. Der Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, hat es beworben mit dem Hinweis, dass ich selbst reise und erst achtzehn Jahre alt bin. Seitdem habe ich kein Problem, meine Manuskripte zu veröffentlichen.«
»Dein Name ist mir noch nie aufgefallen«, gestand der Baron.
»Weil meine Bücher bisher in Deutschland nicht erschienen sind. Ich hatte daran kein Interesse, aber allmählich ändert sich das. Hier wird ja noch viel gelesen, also könnte mir das schöne Einnahmen bescheren, die ich gut gebrauchen kann. Ich bleibe ja nicht ewig jung und muss auch an später denken, wenn ich nicht mehr reisen kann und vielleicht kein Geld mehr verdiene.«
»Was für ein aufregendes Leben«, sagte die Baronin. »Aber auch anstrengend, Jonathan. Du bist ja nirgends zu Hause.«
»Das stimmt«, gab er mit entwaffnender Offenheit zu. »Und wenn ich ehrlich sein soll, Sofia: In letzter Zeit sehne ich mich manchmal danach. Gut möglich, dass mein unstetes Leben bald ein Ende findet. Manchmal macht mich die Vorstellung, dass ich ewig herumziehen werde, ein bisschen müde.«
»Dann nutz’ die Zeit hier, in Ruhe darüber nachzudenken«, riet der Baron. »Und wir lassen dich nur abreisen, wenn du versprichst, noch einmal wiederzukommen, bevor du erneut auf große Fahrt gehst.«
»Dieses Versprechen gebe ich euch gern«, erwiderte Jonathan, um nach einer Weile leiser hinzuzufügen: »Wohin sollte ich auch sonst gehen?«
Danach schwiegen sie alle. Wenig später gingen sie auseinander.
*
»Es war einfach super, Steffie«, sagte Michaela. »Die ist ein Naturtalent, deine Olivia.«
»Sie ist nicht meine Olivia«, erwiderte Stephanie. »Aber ich wäre froh, wenn ich ihr helfen könnte – und dir gleich mit. Sie ist nett, und sie ist unglücklich in der Bank. Außerdem macht sie mir eine Menge Arbeit, das kann ich dir sagen. Kein Tag ohne Katastrophe bei ihr. Ich weiß gar nicht, wie sie das immer hinkriegt.«
»Sie ist nicht bei der Sache, weil sie sich für das, was sie tut, nicht interessiert«, erklärte Michaela sachlich. »Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal ein paar Wochen mit ihr am Samstag. Zuerst muss ich sicher sein, dass sie immer gut ist und nicht nur gelegentlich. Aber im Prinzip reicht es mir nicht, wenn ich nur am Wochenende Hilfe habe. Ich brauche eine Frau, die mich im Laden jeden Tag entlastet, damit ich mich nicht ständig gehetzt fühle und auch mal wieder ein Privatleben habe, das über abendliches Schwimmen mit dir hinausgeht.«
»Sie wird die Bank nicht aufgeben«, meinte Stephanie. »Sie hat zu viel Angst, Micky.«
»Wenn sie wirklich so gut ist, wie ich jetzt denke, rede ich mit ihren Eltern«, beschloss Michaela. »Ich bin ja bereit, sie anständig zu bezahlen, wenn sie auch Verantwortung übernimmt …«
»Es wird aber vermutlich trotzdem weniger sein, als sie jetzt in der Bank verdient, oder? Das ist der springende Punkt – und die Sicherheit. Noch immer gelten Bankjobs als einigermaßen krisenfest, wie du weißt. Wenn du deine Kundinnen verlierst und schließen musst, hat Olivia keinen Job mehr.«
»So ist das Leben, voller Risiken.« Michaela war nicht aus der Ruhe zu bringen. »Meine Güte, wir sind jung. Wenn etwas schiefgeht, probieren wir was Neues, oder nicht?«
»Du vielleicht, ich nicht«, erwiderte Stephanie. »Mit mir musst du diese Diskussion nicht führen, Micky. Ich würde so argumentieren wie Olivias Eltern.«
»Aber du hast mir doch in den Ohren gelegen, dass ich es mit ihr versuchen soll.«
Stephanie lächelte schief. »Bei anderen weiß ich immer ziemlich genau, was gut für sie ist. Denen kann ich auch dazu raten, etwas wagemutiger zu sein. Aber wenn es um mich geht, sieht das anders aus. Na, du kennst mich ja lange genug und weißt, dass ich ein Angsthase bin – der Typ, der immer auf Nummer sicher geht. Typisch Bankangestellte eben.« Sie warf Michaela einen nachdenklichen Blick zu. »Ich habe mich schon öfter gefragt, wieso du eigentlich mit mir befreundet bist, Micky. Im Grunde bin ich doch ein bisschen langweilig, oder?«
»Finde ich überhaupt nicht – du steckst voller Überraschungen, Steffie. Man muss dir nur zusehen, wenn du schwimmst, dann weiß man, dass in dir noch etwas anderes schlummert als die brave Bankerin.«
»Wenn du dich da mal nicht irrst!« Stephanie sprang auf, warf dem Swimmingpool einen letzten bedauernden Blick zu und verschwand im Haus. Gleich darauf kam sie wieder, korrekt gekleidet, wie sie bei Michaela aufgetaucht war. »Ich muss los, Micky. Morgen habe ich keine Zeit, da arbeite ich bis sechs, anschließend habe ich noch ein Kundengespräch außer Haus. Die Woche ist sowieso voll mit Terminen. Wie sieht’s am Wochenende aus?«
»Der Pool steht dir zur Verfügung – aber meine Eltern kommen zurück, wir werden also nicht mehr ungestört sein.«
»Deine Eltern haben mich noch nie gestört, die sind doch immer so rücksichtsvoll und lassen uns in Ruhe, wenn sie merken, dass wir allein sein wollen.«
»Deshalb halte ich es ja auch so gut hier aus«, feixte Michaela. »Ich bring dich noch zur Tür.«
Sie umarmten einander zum Abschied. »Dann also bis zum Wochenende. Mach keinen Blödsinn bis dahin!«, rief Michaela ihrer Freundin hinterher.
Stephanie lachte nur. Sie und Blödsinn machen, das war ein ziemlich absurder Gedanke!
*
Jonathan stand lange vor dem schlichten Stein, auf dem nur ›Amalie von Bervelde‹ stand, darunter waren zwei Daten eingraviert: Geburts- und Todestag. Dreiundachtzig Jahre alt war sie geworden. Plötzlich bedauerte er es zutiefst, sie nicht öfter angerufen zu haben – aber zuerst hatte ihm das Geld dafür gefehlt und später hatte er sich davor gefürchtet, Heimweh zu bekommen, sobald er ihre Stimme hörte. So war es dann auch gewesen, bei den wenigen Malen, da er seinem Bedürfnis, ihre Stimme zu hören, nachgegeben hatte. Sie war eine so liebenswerte und kluge Frau gewesen!
Viele Erinnerungen stürmten jetzt auf ihn ein, als er sie sich vorstellte, die kleine rundliche Frau mit den silbernen Haaren und den leuchtend blauen Augen, die er so gern als Oma gehabt hätte. Es war schön gewesen, sich in ihren Armen zu verstecken – selbst als er dafür eigentlich schon zu groß gewesen war, hatte er sich von ihr immer noch gern umarmen lassen. Alles an ihr war rund und weich gewesen – und wie gut sie immer gerochen hatte! Nach Kuchenteig und Gewürzen, das wusste er noch ganz genau. Eine betörende Mischung. Überhaupt, ihre Kuchen …
Ihm wurde heiß in der Sonne, und so sah er sich nach einem schattigen Platz in der Nähe um, denn er wollte gern noch bleiben an diesem friedlichen, stillen Ort. Er fand eine Bank unter einer ausladenden Kastanie. Von dort aus hatte er Amalies Grab direkt im Blick. Es war sehr gepflegt, das beruhigte ihn irgendwie. Sie war also nicht vergessen, jemand kümmerte sich regelmäßig um das Grab. Er schüttelte den Kopf, als ihm einfiel, dass das wahrscheinlich die Friedhofsgärtnerei war – wieso hatte er daran nicht gleich gedacht? Heutzutage konnte man das ja alles in fremde Hände geben, kaum jemand hatte noch die Zeit, regelmäßig ein Grab zu pflegen. Aber es hatte eine Vase mit Rosen vor dem Stein gestanden, die allerdings schon die Köpfe hängen ließen. So hatte er sie austauschen können – weiße gegen rote Rosen. Sie hatte Rosen geliebt, in allen Farben.
Hier hätte es ihr gefallen, dachte er. Ein wirklich schöner Platz ist das für die ewige Ruhe. Er versank erneut in Erinnerungen und schreckte erst auf, als er eine schmale Blondine im strengen Kostüm näher kommen sah. Er blickte ihr zerstreut entgegen. Seine Aufmerksamkeit wurde erst geweckt, als sie vor Amalies Grab stehenblieb. In den Händen hielt sie einen Rosenstrauß. Er konnte erkennen, dass es mehrstielige waren und erinnerte sich, dass diese Sorte einen intensiven Duft verströmte.
Die junge Frau ging zu der Vase, hatte sich bereits gebückt und die Hand ausgestreckt, als sie zögerte. Sie richtete sich wieder auf und betrachtete die frischen roten Rosen in der Vase nachdenklich. Jonathan begriff, dass sie sich fragte, wer die Blumen gebracht hatte. Dennoch blieb er sitzen und beobachtete sie weiter.
Sie musste diejenige sein, die das Grab pflegte. Und plötzlich begriff er, wer sie war: Stephanie von Bervelde, Steffie – Amalies Enkelin.
Nun stand er doch auf und näherte sich dem Grab. »Sind Sie Stephanie von Bervelde?«, fragte er leise.
Sie fuhr herum, sichtlich erschrocken, weil sie ihn nicht bemerkt hatte. Als sie einen fremden Mann vor sich sah, verschlossen sich ihre Züge sofort wieder. »Wer sind Sie?«, fragte sie, ohne seine Frage zu beantworten. Ihre Augen glitten über seine Kleidung, während sie darauf wartete, dass er ihre Frage beantwortete. Besonders lange verweilte ihr Blick auf seinen zerschlissenen Jeans und den Cowboystiefeln. Er konnte ihre Gedanken lesen: Sie fand seinen Aufzug für einen Besuch auf dem Friedhof absolut unpassend, aber natürlich verbot ihr ihre gute Erziehung, ihm das unverblümt zu sagen.
»Jonathan von Clees«, antwortete er. »Mein Name wird Ihnen nichts sagen, aber …«
»Das glaube ich nicht!«, stieß sie hervor. »Seit Jahren bin ich auf der Suche nach Ihnen, aber Sie waren ja wie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt stehen Sie hier plötzlich einfach vor mir!«
Er war so verblüfft, dass ihm zunächst die Worte fehlten. Endlich konnte er aber doch fragen: »Und wieso waren Sie auf der Suche nach mir?«
»Wegen meiner Oma«, erklärte sie und bestätigte damit seine Vermutung, dass sie jene Steffie war, von der Amalie von Bervelde ihm oft erzählt hatte. »Bei der hatten Sie einen Stein im Brett, und ich war einfach neugierig auf Sie. Ja, ich bin Stephanie von Bervelde.«
Sie ist hübsch, dachte er, aber sie sieht ein bisschen streng aus. Sehr beherrscht. Wahrscheinlich hat sie sich immer hundertprozentig unter Kontrolle. Er erinnerte sich an das, was Sofia und Friedrich von Kant über sie gesagt hatten und verstand deren Beschreibung nun. Ja, Stephanie wirkte korrekt und ordentlich, daran konnte es keinen Zweifel geben. Aber wie passte diese junge Frau zu seiner warmherzigen und fröhlich übersprudelnden Tante Amalie? Oder war Stephanie in ihrer Gegenwart lockerer gewesen? Sicherlich, beantwortete er sich seine Frage gleich selbst. Amalie hatte die wunderbare Gabe gehabt, die Herzen der Menschen zu öffnen …
»Warum sehen Sie mich so an?«, fragte Stephanie misstrauisch. »Habe ich zwei Nasen? Oder Marmelade im Gesicht?«
»Entschuldigen Sie bitte«, erwiderte er lächelnd, »natürlich nicht. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennengelernt haben.«
Ihr Blick blieb skeptisch. »Wieso sind Sie in Deutschland?«, fragte sie.
»Ich habe hier einiges zu erledigen«, erklärte er. »Außerdem wollte ich Amalies Grab besuchen. Und Sie standen auch auf meiner Liste – sie hat Sie gern gehabt, deshalb wollte ich Sie kennenlernen.«
Sie zögerte, offenbar wusste sie nicht, was sie sagen sollte. Jonathan half ihr. »Wollen wir zusammen irgendwo eine Kleinigkeit essen?«, fragte er. »Es wäre schön, wenn Sie mir etwas über die letzten Jahre Ihrer Großmutter erzählen würden. Einiges weiß ich ja, aber ich fürchte, vieles ist mir entgangen.«
Sie warf einen Blick auf ihre Uhr. »Von mir aus«, sagte sie nach einem kleinen Zögern. »Viel Zeit habe ich allerdings nicht, ich muss heute Abend noch einiges erledigen.«
»Dann schlagen Sie mal was vor«, bat er. »Am besten gehen wir gleich, wenn Sie ohnehin unter Zeitdruck stehen …«
»Ich bin doch gerade erst gekommen«, wies sie ihn zurecht. »Und ich habe meine Blumen noch nicht einmal abgestellt. Nur weil Sie jetzt so plötzlich aufgetaucht sind, werde ich den Besuch bei meiner Oma nicht abkürzen, bilden Sie sich das bloß nicht ein. Außerdem muss ich noch ein bisschen Unkraut jäten, da hinten, neben dem Stein, breitet es sich schon wieder aus.«
Meine Güte, dachte Jonathan, sie ist wirklich pedantisch. Als ob dieses Unkraut nicht noch ein bisschen warten könnte! Aber das sagte er natürlich nicht laut. Stattdessen erklärte er: »Ich setze mich dann wieder unter die Kastanie, bis Sie fertig sind.«
Sie nickte nur, wobei sie die Lippen aufeinanderpresste. Als er sich setzte, war sie bereits in Aktion: Sie stellte ihre Rosen zu seinen in die Vase und ging dann in die Knie, um das von ihr ausgemachte Unkraut zu entfernen. Nicht einmal sah sie zu ihm herüber während dieser Zeit, und er ertappte sich dabei, dass er es beinahe bedauerte, nun noch mit ihr essen zu müssen.
Das würde ein mühsamer Abend werden!
*
Olivia wusste selbst nicht, warum sie den Weg zu Michaelas Modeladen einschlug. Sie hatte einen ganzen Arbeitstag in der Bank hinter sich – er war schrecklich gewesen, wie immer. Wenn Steffie ihr nicht wieder einmal geholfen hätte, wäre er mit Sicherheit noch viel schrecklicher geworden. Normalerweise fühlte sie sich müde und zerschlagen, wenn sie die Bank verließ, aber der Gedanke an die Boutique weckte ungeahnte Kräfte in ihr. Sie bog in die Straße ein, in der das Geschäft lag und steuerte direkt darauf zu. Schon von draußen sah sie, dass sich mehrere Kundinnen eingefunden hatten und dass Michaela von Zitzewitz einen gehetzten Eindruck machte.
Ohne zu zögern öffnete sie die Tür, rief: »Guten Abend« und rauschte an der verblüfften Michaela vorbei in den hinteren abgetrennten Teil, wo sie ihre Tasche abstellte, den strengen Haarknoten löste, so dass ihre Haare ihr locker bis auf die Schulter fielen. Danach zog sie sich die Lippen nach, tuschte die Wimpern noch einmal und erschien wieder im Verkaufsraum, wo sie sich umgehend an eine Kundin wandte, die ein wenig ratlos in den Spiegel sah. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie. »Oder kommen Sie allein zurecht?«
»Steht mir das?«, fragte die Dame, die die Vierzig bereits überschritten und sich in eine superenge weiße Hose gezwängt hatte.
»Sie müssen sich darin wohlfühlen, das ist die Hauptsache«, erklärte Olivia diplomatisch.
»Bitte, sagen Sie mir Ihre ehrliche Meinung!«
»Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen?«, fragte Olivia.
Die Kundin nickte.
Olivia brachte ihr eine andere Hose, ebenfalls in Weiß. »Probieren Sie die an – ich schätze, in der fühlen Sie sich wohl. Mir persönlich gefällt die enge Hose an Ihnen nicht besonders gut, wenn ich das sagen darf.«
Die Dame kaufte die andere Hose und noch einen dazu passenden Blazer.
Erst eine Dreiviertelstunde später waren Michaela und Olivia allein im Laden. »Wieso bist du gekommen?«, fragte Michaela. »War das eine Art Eingebung, dass ich heute unbedingt Hilfe brauchen würde?«
»Ich hatte einfach Lust«, erklärte Olivia. »Außerdem war es in der Bank wieder so furchtbar, dass ich unbedingt noch ein Erfolgserlebnis für den heutigen Tag brauchte.«
»Du hast mich gerettet«, seufzte Michaela und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Stöhnend legte sie die Füße hoch. »Ich weiß auch nicht, was heute los war, aber ich hatte kaum Zeit, zwischendurch etwas zu essen.«
»Freu dich doch, dass der Laden so gut läuft.«
»Ich freue mich ja, aber ich müsste dringend neue Ware bestellen – das wollte ich eigentlich heute in den ruhigen Morgenstunden erledigen. Aber war ja nix mit Ruhe.«
»Mach es jetzt«, schlug Olivia vor. »Ich bleibe, bis du schließt.«
Sie hatte den Satz kaum beendet, als die nächste Kundin zur Tür hereinkam. Olivia begrüßte sie mit strahlendem Lächeln, und Michaela verschwand an ihrem winzigen Schreibtisch, um endlich zu tun, wozu sie bisher nicht gekommen war.
Zwischendurch beobachtete sie Olivia nachdenklich. Je eher Stephanies Kollegin bei der Bank kündigte und zu ihr kam, desto besser, das wurde ihr immer klarer.
Später lud sie Olivia zum Essen ein und erkundigte sich eingehend nach den Hindernissen, die einem Jobwechsel im Wege stehen würden. »Ich habe schon verstanden, dass deine Eltern dagegen wären – aber was ist mit dir? Du bist doch erwachsen und kannst selbst entscheiden, was du tun willst.«
»Klar kann ich das. Aber meine Eltern haben mir die Ausbildung bezahlt, sie wollen, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe – und ich habe bisher immer gedacht, ich bin es ihnen schuldig, in der Bank zu bleiben. Sie sind …, wie soll ich das ausdrücken – sie sind ein bisschen traditionell. Für sie ist eine Stelle in einer Bank gut, in einem Geschäft, das Mode verkauft, aber eher schlecht. Das ist riskant, den Job verliert man leicht – und in ihren Augen ist das auch nicht so seriös wie in einer Bank.«
»Stimmt sicher auch«, meinte Michaela unbekümmert. »Aber was nützt das alles, wenn du unglücklich bist? Hast du ihnen diese Frage schon mal gestellt?«
»Nein, aber ich weiß die Antwort, die ich bekäme, auch so: Sie würden sagen, dass ich übertreibe und nicht weiß, was Unglück bedeutet. Und sie würden sagen, dass ich auch an die Zukunft denken muss, dass ich nicht leichtsinnig einen guten Job aufgeben darf, nur weil es mir jetzt so vorkommt, als sei es viel schöner, bei dir zu arbeiten.«
»Du bist begabt für die Arbeit bei mir«, stellte Michaela fest. »Die macht auch nicht immer Freude, das kann ich dir versichern. Wenn man an eine zickige Kundin gerät, könnte man manchmal aus der Haut fahren – aber das kommt zum Glück nicht so furchtbar oft vor.«
»Es gibt sicherlich keinen Beruf, an dem man nur Freude hat«, meinte Olivia. »Aber weißt du, es gibt ja noch etwas, was dagegen spricht, dass ich bei der Bank kündige: Das habe ich immerhin gelernt. Wenn ich bei dir anfange, bin ich eine ungelernte Aushilfe.«
»Das muss nicht sein«, widersprach Michaela. »Ich könnte dich ausbilden. Du gehst bei mir ganz ordentlich in die Lehre – und die Sache mit der Bezahlung regeln wir irgendwie anders. Zum Beispiel könnten wir ausmachen, dass du während deiner Lehrzeit nichts für deine Kleidung bezahlen musst – denn natürlich ist es unerlässlich, dass du die Sachen trägst, die wir verkaufen. Aber es fallen uns sicherlich noch andere Möglichkeiten ein, so dass du finanziell keine Einbußen hättest. Ich hätte dich wirklich gern bei mir im Laden, Olivia – und wer weiß, vielleicht könntest du irgendwann als Partnerin einsteigen.«
Olivia war sprachlos.
»Solche Gedanken hast du dir gemacht?«
»Solche und noch einige mehr«, erklärte Michaela vergnügt. »Du musst nur wollen, Olivia.«
Olivia war ganz blass geworden. »Wenn das ginge, Micky, wenn das wirklich ginge …«
»Es geht!«, stellte Michaela fest. »Es liegt ganz bei dir!«
*
Stephanie stocherte in ihrem Salat herum, während sie Jonathan ab und zu einen verstohlenen Blick zuwarf. Sie wurde nicht klug aus diesem verwegen aussehenden Mann. Er entsprach so überhaupt nicht den Vorstellungen, die sie sich von ihm gemacht hatte, dass sie noch immer Mühe hatte, den Jonathan, der vor ihr saß mit demjenigen ihrer Fantasie zusammenzubringen.
Seine Kleidung war natürlich unmöglich – nicht einmal als Freizeitkleidung konnte man sie akzeptieren. Er hatte ein sehr gutes Restaurant vorgeschlagen, in dem er sich mit der größten Selbstverständlichkeit bewegte. Ihr fiel auf, dass die Kellner und auch der Besitzer des Restaurants, der sie begrüßte, keinen Anstoß an seinem Äußeren zu nehmen schienen. Sie fand es dennoch unpassend und fühlte sich unbehaglich.