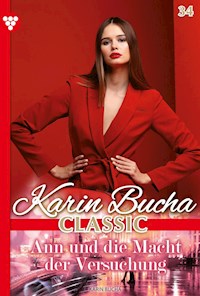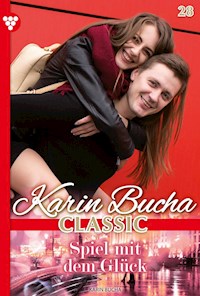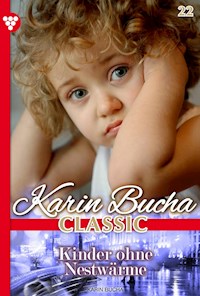14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Box
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. E-Book 47: Niemals darf es zu spät sein E-Book 48: Geliebte, bezaubernde Amelie E-Book 49: Schritt in die Vergangenheit E-Book 50: Und Lieb wird ewig sein E-Book 51: Es brach ein Herz entzwei E-Book 52: Wie du bist, so lieb' ich dich E-Book 1: Niemals darf es zu spät sein E-Book 2: Geliebte, bezaubernde Amelie E-Book 3: Schritt in die Vergangenheit E-Book 4: Und Lieb wird ewig sein E-Book 5: Es brach ein Herz entzwei E-Book 6: Wie du bist, so lieb' ich dich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1144
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Niemals darf es zu spät sein
Geliebte, bezaubernde Amelie
Schritt in die Vergangenheit
Und Lieb wird ewig sein
Es brach ein Herz entzwei
Wie du bist, so lieb’ ich dich
Karin Bucha – Jubiläumsbox 9 –E-Book: 47 - 52
Karin Bucha
Niemals darf es zu spät sein
Als Cornelia um ihr Glück bangen mußte
Roman von Karin Bucha
Rudolf Hermann hat noch nie einen Chauffeur benötigt. Auch jetzt steuert er den schweren Wagen durch die Toreinfahrt, hält vor dem langgestreckten Gebäude, in dem seine Geschäftsräume untergebracht sind, und ehe er aussteigt, verharrt er eine Weile regungslos hinter dem Lenkrad.
Der Mann, der immer in Bewegung ist, von dem man nur rastloses Schaffen gewohnt ist, sitzt zusammengeduckt hinter der Windschutzscheibe und starrt aus brennenden, todernsten Augen ins Leere. Eine grenzenlose Gleichgültigkeit ist über ihn gekommen, und nur der eine Wunsch beherrscht ihn, einmal die Augen zu schließen, nichts denken zu müssen und ruhen – ruhen.
Aber da sind Gedanken wie tausend Ameisen, die sein Gehirn durchwühlen. Immer wieder laufen sie auf das eine zu: Ich bin erledigt! Ich bin restlos fertig! Alles Schaffen, das aufreibende Schuften war umsonst. Es ist zu Ende mit mir.
Er schließt die Augen. Jetzt müßte ein Mensch neben ihm stehen, der ihm sanft über die heiße Stirn streift. Kühle, wohltuende Hände müßten da sein. Ein weicher Mund müßte gute, sanfte Worte zu ihm sagen und ihm bestätigen, daß er nichts versäumt hat, daß er schuldlos ist an diesem geschäftlichen Zusammenbruch.
Ja – und dieser Mensch mußte Stefanie, seine Frau, sein, die er doch als blutjunger, unerfahrener Mensch geheiratet hat, weil er sie sinnlos liebte.
Nur für sie und für die rasch aufeinander folgenden Kinder hat er geschuftet. Ihnen hat er ein sorgloses Leben bieten wollen. Alles, was er einst als Sohn eines Maurerpoliers entbehren mußte, hat er seiner Frau und den Kindern geschaffen. Er hat schweigend zugesehen, wie sie das Geld sinnlos zum Fenster hinauswarfen, weil er spürte, daß sie nur dann glücklich waren. Und er hat in dieser seltsamen Ehe das Lachen immer mehr verlernt.
Langsam steigt er die Stufen zum Eingang empor, geht den langen Korridor und an den Glastüren vorüber. Schemenhaft sieht er helle und dunkle Köpfe über Schreibmaschinen und Schreibtisch gebeugt. Sonst hat er freundlich hier und da gegrüßt. Heute geht er mit zusammengepreßten Lippen und todernsten Augen vorüber, die nichts sehen. Die nichts sehen wollen.
Grußlos durchquert er das Zimmer seiner Sekretärin und verschwindet in seinem Zimmer. Stöhnend, noch im leichten Sommermantel, läßt er sich am Schreibtisch nieder. Seine Hand zuckt vorwärts und bleibt zögernd in der Luft hängen.
Sekunden vergehen, dann drückt er einen der Knöpfe, und wenig später klopft es an seine Tür.
Emil Weber, sein Prokurist und Freund, tritt ein. Er ist zehn Jahre älter als Hermann. Sie waren als junge Menschen zusammen bei einer Firma. Hermann als Maurer und Weber als junger Angestellter. Als er dann von Stefanies Geld das Bauunternehmen gründete, holte er ihn in sein junges Unternehmen und hat es nie zu bereuen brauchen.
»Nun?« Lautlos tritt Emil Weber näher. Er trägt ein Bündel Akten unter dem Arm und betrachtet das mutlose Gesicht seines Chefs und Freundes besorgt. »Hat es geklappt?«
Hermann macht eine leichte Handbewegung, dann birgt er stöhnend das Gesicht in den Händen. Emil Weber weiß alles. Ihm ist ganz elend zumute. Er spürt einen Schmerz in sich wie damals, als ihn die gute, geliebte Frau für immer verließ. Ganz schnell, aus einem stillen, aber großen Glück hat der Tod sie herausgerissen. Seither hat er sich dem Unternehmen mit Haut und Haaren verschrieben.
»Es ist aus«, reißt Hermanns rauhe Stimme ihn aus seinen schmerzlichen Gedanken. »Alles vorbei. Wir müssen das Objekt weitergeben und werden alles Geld bis auf einen winzigen Rest verlieren.«
Weber tritt näher an den Schreibtisch heran. Seine Hand ruht auf der Schulter Hermanns. Wenn sie unter sich sind, sagen sie »du« zueinander.
»Wir werden mit dem Rest, und sei er noch so klein, von vorn beginnen«, tröstet er begütigend.
Hermann fährt herum. Er starrt den Freund und Vertrauten an. Dann lacht er bitter auf.
»Auf den Rest wartet bereits meine Frau. Sie braucht das Geld. Sie kann und will nicht verzichten, wie sie sagt.« Er stöhnt abermals auf. »Ich bin ein entsetzlicher Feigling. Ich kann es ihr nicht sagen, daß sie mir damit die letzte, die allerletzte Chance nimmt, das Unternehmen zu retten.«
»Dann werde ich es ihr sagen!« Durch die hagere Gestalt Webers geht es wie ein Ruck. »Du warst bisher viel zu gutmütig deiner Familie gegenüber.«
»Ich weiß es ja, Emil«, unterbricht Hermann ihn verzweifelt. »Ich brachte es niemals übers Herz, ihnen nur einen Wunsch abzuschlagen. Ich bin ja an allem schuld.«
»Natürlich bist du schuld«, sagt Weber bitter. »Du hast gearbeitet wie ein Pferd, du hast nur an das Wohl und Wehe deiner Frau, deiner Kinder gedacht. Du hast nicht einmal Dankbarkeit gefordert. Es war eine Selbstverständlichkeit für dich, bescheiden zu leben, während die anderen, ach…« Er macht eine ziellose Bewegung mit der Hand durch die Luft. »Und nun quälst du dich noch mit den Gedanken herum, alles verschuldet zu haben. Sprich noch einmal mit deiner Frau. Sie wird es einsehen und dir helfen. Menschenskind, man kann doch eine Firma, die nahezu fünfundzwanzig Jahre besteht, nicht einfach vor die Hunde gehen lassen, Rudolf! So viel Vernunft muß doch wohl deine Frau haben.«
Hermann wirft einen schmerzlichen Blick zu Weber auf. Lieber, guter Freund, sinnt er hinter dessen Worten her. Was weißt du von meiner Frau? Etwas wohl – aber nicht alles. Was weißt du von dem aufreibenden Leben, das ich an Stefanies Seite geführt habe. Du hast sie erkannt, aber nur zu einem kleinen Teil. Du kennst nicht ihre Habgier und den Götzen Geld, dem allein sie huldigt.
Langsam erhebt er sich, löst den Gürtel seines Mantels und wirft ihn über den nächsten Sessel.
»Es ist sinnlos, mit Stefanie zu reden«, sagt er kurz und entschlossen. »Laß uns noch einmal rechnen. Vielleicht langt es nicht einmal, um Stefanie das zurückzugeben, was sie mit in die Ehe gebracht hat.«
Hermann geht zum Fenster hinüber. Er schweigt, und Weber wagt ihn nicht in seinen Gedanken zu stören.
»Rudolf«, sagt er mit aller Wärme, »was auch kommen mag, auf mich kannst du jederzeit rechnen. Ich bin dein Freund. Wir werden das Kommende gemeinsam tragen.«
Hermann schluckt, dann dreht er sich um. Er blickt dem Freund stumm in die Augen.
»Danke«, würgt er hervor, und sich fangend setzt er hinzu: »Laß uns noch einmal die Bücher durchgehen.«
*
Die Räume der Angestellten liegen in Dunkelheit. Nur in Rudolf Hermanns Zimmer brennt bis tief in die Nacht hinein das Licht. Sie sind beide todmüde und haben Schatten unter den Augen. Vielleicht kommt es auch von der entsetzlichen Gewißheit. Hermann wird gerade noch das Geld für seine Frau aufbringen können. Er ist arm, bettelarm.
Als der Fernsprecher anschlägt, zucken sie beide zusammen. Emil Weber nimmt den Hörer ab und meldet sich. Er wird noch einen Schein bleicher und wirft einen scheuen Blick auf Hermann, der, den Kopf in der Hand gestützt, Zahlen auf das Papier malt.
»Du wirst verlangt, Rudolf«, sagt er endlich.
»Stefanie?« flüstert Hermann.
»Nein«, preßt Weber hervor, »das Städtische Krankenhaus – es ist – du sollst –«
Hermann nimmt dem völlig verstörten Mann den Hörer aus der Hand und meldet sich. Eine Frauenstimme, kühl und unpersönlich, spricht zu ihm.
Ein Schauer überläuft ihn. Sein Mund öffnet sich und zittert hilflos, dann hängt er langsam an.
»Lothar«, stößt er hervor, »verunglückt – es steht schlimm um ihn. Man erwartet – mich.«
Wortlos geht Emil Weber zu dem Sessel, wo immer noch Hermanns Mantel liegt, und trägt ihn herbei. »Ich begleite dich selbstverständlich«, sagt er.
Wenig später verlassen sie das Büro und fahren durch die Nacht. Schweigen herrscht zwischen ihnen. Manchmal kommt ein Laut wie tiefes Stöhnen aus Rudolf Hermanns Brust, dann wieder ist nichts als das Summen des Motors zu hören.
Nie wird Rudolf Hermann diese Fahrt zum Krankenhaus vergessen. Zu den sonstigen Vorwürfen, die er sich macht, kommt noch die Erkenntnis: Ich habe mich zu wenig um meine Kinder gekümmert! Ich habe sie völlig dem Einfluß ihrer Mutter überlassen. Es mußte ja einmal mit Lothar so kommen. Von einer Party zur anderen, berauscht und in toller Fahrt dann heimwärts. Was hat er auf seine Vorhaltungen zur Antwort bekommen? Nur ein gleichgültiges Achselzucken. »Das verstehst du nicht, Vater«, war der immer wiederkehrende Reim.
Und nun liegt sein Ältester schwerverletzt im Krankenhaus. Wieder dieses tiefe, qualvolle Stöhnen. Sacht legt Emil Weber seine Hand auf die Hermanns, die das Steuerrad führt, trotz aller Verzweiflung ruhig und sicher.
»Noch lebt Lothar, und wo Leben ist, ist auch Hoffnung«, raunt er leise.
Im Krankenhaus ist man auf Hermanns Besuch schon vorbereitet. Eine Schwester geleitet sie über einen schwach erhellten Korridor, an hohen weißen Türen vorbei.
Der Gang macht eine Biegung. Schon von weitem hört er unbeherrschtes Weinen. Er kennt dieses Weinen, das sich von Minute zu Minute steigern kann. Es ist ein hysterisches Weinen, das auf die Nerven wirkt.
»Stefanie!« Er legt seine Hand auf die Schulter der Frau, die auf der weißen Bank hockt. Ein Kopf ruckt empor. Die Tränen haben eine verheerende Wirkung auf diesem Frauengesicht angerichtet. Tusche und Schminke haben sich gelöst und das Gesicht verschmiert.
Die Augen sind dick verquollen. Als sie den Gatten erkennt, fährt sie mit einem schrillen Schrei empor.
»Psst!« mahnt die Schwester. Sie schüttelt leise den Kopf. Selten hat sie eine so unbeherrschte Frau und Mutter an einem Krankenbett erlebt.
»Sie lassen mich nicht zu ihm, Rudolf. Nimm mich mit, ich werde sonst verrückt. Ich bin die Mutter, ich gehöre an die Seite meines Sohnes.«
Ratlos sieht Rudolf Hermann sich nach dem abseits stehenden Arzt um, der wohl auf ihn gewartet hat. Er tritt etwas heran.
»Es tut mir leid, gnädige Frau«, sagt er bestimmt. »In diesem Zustand kann ich Sie nicht zu dem Kranken lassen. Es sei denn, Sie verhalten sich äußerst ruhig.«
»Ja, ja, alles was Sie wollen, tue ich«, stammelt die Frau und klammert sich an den Gatten.
Gemeinsam betreten sie das schmale, stille Zimmer. Seit Jahren erstmals wieder Seite an Seite, aber es schwingt nichts zwischen ihnen, keine Wärme, keine Liebe. Im Augenblick verbindet sie nur die gemeinsame Sorge um den Sohn.
Rudolf Hermann stutzt, als er das wächserne, von Verbänden umhüllte Gesicht seines Sohnes in den Kissen gewahrt. Eine Schwester erhebt sich und tritt bescheiden seitwärts.
Stefanie Hermann will wieder in lautes Weinen ausbrechen. Da fühlt sie die Hand des Gatten auf ihrem Mund.
»Sei still«, herrscht er sie an, mit rauher, ihm selbst fremd vorkommender Stimme. Da sinkt sie auf den Stuhl und jammert. »Mir wird schlecht, Rudolf.«
Im Nu ist die Schwester neben ihr, nimmt ihren Arm und führt die Wankende hinaus.
Rudolf Hermann ist mit seinem Sohn allein. Lieber Gott, laß ihn nicht sterben! geht es ihm unaufhörlich durch den Kopf. Seine Hand tastet sich vor, legt sich behutsam auf den Arm, das einzige unverletzte Glied, das nicht in Gips liegt und bandagiert ist.
»Lothar, mein Junge!« flüstert er. Die breiten Schultern des einsamen Mannes zucken. Wie sehr er ihn liebt, seinen Ältesten. Jetzt erst kommt ihm das richtig zum Bewußtsein, jetzt, da der Todesengel um das Bett schleicht und die Hände nach dem jungen, blühenden Leben ausstreckt.
Verzeih mir, Lothar, ich war ein Schwächling. Ich habe dich und auch deine Geschwister deiner Mutter überlassen. Sie hat euch zu dem gemacht, was ihr geworden seid.
Schlag noch einmal die Augen auf, Lothar. Sag mir, daß ich nicht alles falsch gemacht habe. Wenn du willst und wenn du mir erhalten bleibst, dann, mein Junge, will ich dir der beste Freund sein.
»Sie dürfen hierbleiben!«
Rudolf Hermann schreckte empor. Tief in den Höhlen liegen seine Augen. Doktor Rauher hat schon oft in so tief verzweifelte Vateraugen geblickt. Aber ihm ist, als liege eine ganz besondere Tragik in diesen Augen.
»Wie lange?« flüstert Hermann. Der Arzt lächelt gütig.
»Solange Sie wollen, bis – bis der Kranke aus der Narkose erwacht.«
Und meine Frau – will Hermann fragen – doch er unterläßt es. Es ist so wundersam, den Sohn einmal ganz für sich allein zu haben, ohne Gezeter, ohne Gekreische und ohne dieses nerventötende, hysterische Weinen. Nur der Anlaß müßte ein anderer sein, nicht so tieftraurig, so hoffnungslos.
In diesen stillen Nachtstunden am Krankenbett seines Sohnes, das Herz von Vorwürfen und Verzweiflung zerrissen, zieht sein Leben in bunten, immer wechselnden Bildern an seinem geistigen Auge vorüber.
Er sieht sich als jungen, verliebten Bräutigam an der Seite der schönen blonden lebenslustigen Stefanie wieder. Er hört die Worte seines verehrten Schwiegervaters, der so bald schon nach der Hochzeit starb: »In deinen Händen weiß ich Stefanies Geld gut aufgehoben, mein Junge.« Und er hatte von Stunde an gearbeitet, um sich dieses geschenkten Vertrauens würdig zu erweisen.
Die Kinder waren gekommen, zuerst Lothar, das schöne dunkelhaarige Kind. Dann kam Cornelia, das anmutige, zarte und bezaubernde Mädchen mit den rotbraunen Locken. Später wurden die Zwillinge geboren, Christian und Christine. Er hat sie selten gesehen, seine Kinder. Selbst nachts, wenn er todmüde in sein Haus zurückkehrte, durfte er den Kleinen nicht über das Haar streichen. »Die Kinder brauchen ihre Nachtruhe«, hatte Stefanie ihn hart angefahren, und er wußte genau, sie nahm am allerwenigsten auf die Kinder Rücksicht, ihr ging es nur darum, ihn zu kränken.
Immer fremder wurden sie sich, immer kälter ihr Verhältnis zueinander. Um den sich immer mehr zuspitzenden Auseinandersetzungen zu entgehen, war er zu seiner Arbeit geflohen. Seine innerliche Vereinsamung wurde immer größer.
Liebten seine Kinder ihn eigentlich? Er weiß es nicht! Manchmal hat er sogar das Gefühl gehabt, daß sie ihn haßten, weil er ihre Lebensführung nicht billigte. Hatte Stefanie Haß in den Kindern großgezogen? Haß gegen ihn, den Vater?
Wie wird es weitergehen, wenn Stefanie erst erfährt, daß er vor dem Nichts steht?
Er ahnt, daß es eine schreckliche Auseinandersetzung geben wird, denn er wird ihr diesmal schonungslos die Wahrheit sagen. Nach ihrem Verhalten wird er die Entscheidung treffen.
Während dieser Erwägungen hält er die unverletzte Hand des Sohnes warm umschlossen. Er sieht nicht, daß hinter den hellen Vorhängen ein neuer Tag graut und sein fahles Licht in das schmale Krankenzimmer wirft.
Er spürt nur plötzlich, wie die Hand in seinen kraftvollen Fingern zu zucken beginnt.
»Lothar!« Tief neigt er sich über das wächserne Gesicht des Sohnes.
Maßlose Angst umklammert sein Herz. Ist das Gesicht nicht bereits vom Tod gezeichnet? Er will sich erheben und zur Klingel greifen, aber er ist wie gelähmt.
Die umschatteten Lider heben sich. Lothars helle Augen blicken verständnislos zur Decke empor. Sein Mund verzieht sich schmerzhaft. Ganz wenig versucht er den Kopf zu drehen und sinkt mit geschlossenen Augen wieder zurück.
Rudolf Hermann hält den Atem an. Er hört das Stöhnen, langanhaltend und qualvoll.
Lothar versucht ein zweites Mal die Augen zu öffnen und den Kopf zu bewegen. Groß sind die hellen Augen auf das gespannte Gesicht des Vaters gerichtet. Die beiden Augenpaare halten einander fest.
»Vater«, flüstert der Kranke erschüttert, »lieber Vater!«
»Sei still, mein Junge«, ganz tief neigt Hermann sich zu dem Kranken hinab. »Hast du große Schmerzen? Soll ich nach dem Arzt klingeln?«
Leichtes Kopfschütteln. Voll Glück spürt Herrmann, wie sich Lothars Finger fest um seine schlingen. Stumm, die Augen wieder geschlossen, liegt Lothar auf seinem Bett.
Die Zeit verrinnt. Regungslos verharrt Hermann und bewacht den leichten Schlummer seines Sohnes.
Herrgott, erhalte ihn mir – fleht Hermann innerlich – vielleicht wird alles noch gut.
Er fährt schreckhaft zusammen, als der Arzt neben ihm steht, gefolgt von der Schwester.
Hermann erhebt sich, taumelt und zieht sich in den Hintergrund des Zimmers zurück. Er hört den Arzt leise mit dem Verletzten sprechen und wie er der Schwester einige Anweisungen gibt.
»Herr Doktor!« Rudolf Hermann hascht nach dem Arm des Arztes, als dieser an ihm vorbeigeht, um das Zimmer zu verlassen. Doktor Rauher macht eine Kopfbewegung, und Hermann folgt ihm. Draußen stehen sie sich gegenüber. »Wird er es überstehen?«
Es ist immer dieselbe Frage, die man ihm, dem Arzt, stellt, und er kann zunächst nie etwas Genaues sagen. »Ich will es hoffen«, weicht er aus. Und als er die Verzweiflung in den hellen Augen des Mannes sieht, erklärt er: »Die Knochenbrüche werden heilen. Natürlich kann man Komplikationen nie voraussehen. Aber ich muß Ihren Sohn noch einmal röntgen wegen innerer Verletzungen.«
»Und wann – wann werden Sie Gewißheit haben?«
»In einer Stunde«, erwidert der Arzt. »Sie dürfen warten, wenn Sie wollen.«
Er geht den Weg wieder zurück und setzt sich auf die Bank, auf der er in der Nacht Stefanie angetroffen hat. Er sieht, wie man seinen Sohn aus dem Zimmer und zum Fahrstuhl rollt. Kein Laut kommt von der fahrbaren Trage. Man hat ihm wohl eine schmerzstillende Spritze verabreicht.
Hermann fröstelt. Ihm ist, als würde er alle Schmerzen erleiden, durch die sich sein Sohn hindurchkämpfen muß.
Er hat sich vornübergebeugt. Die Hände läßt er zwischen den Knien baumeln. Er hat plötzlich Zeit, so viel Zeit. Was augenblicklich zu tun ist, wird von Emil Weber bestens erledigt. Das weiß er.
Sein ganzes Denken gilt seinem Sohn und dem heißen Wunsch nach Gewißheit, damit die furchtbare Angst von ihm genommen wird.
Er fährt empor, als Doktor Rauher vor ihm steht. Im Nu springt er auf die Beine.
»Nun?«
Nie wird Hermann das Lächeln des Arztes vergessen, der ihm gleich sympathisch war. Es ist beruhigend und begütigend zugleich.
»Keine inneren Verletzungen«, sagt er hoffnungsvoll und greift schnell zu, denn die kraftvolle Gestalt Hermanns gerät ins Taumeln.
»Hoppla, hoppla«, lacht Doktor Rauher leise auf. »Sie wollen doch nicht schlappmachen?« Schon lange hat er bemerkt, wie elend der Mann aussieht.
Hermann hat sich schnell gefangen. »Also dürfen wir hoffen?« stammelt er, und Doktor Rauher nickt. »Gehen Sie zu ihm. Er ist bei Bewußtsein.«
Und wieder sitzt Rudolf Hermann neben Lothar, und wieder finden sich ihrer beiden Hände. Schweigen herrscht zwischen ihnen. Wie eine Insel des Friedens, zumal der Kranke augenblicklich schmerzfrei ist unter der Wirkung der Spritze, so erscheint Hermann dieses Zimmer.
Und dann wird dieses beglückende Schweigen zwischen Vater und Sohn jäh unterbrochen.
Es beginnt mit dem harten Aufsetzen hoher Hacken auf den Fliesen draußen vor der Tür, die geräuschvoll aufgerissen wird, und Stefanie Hermann stürzt ins Zimmer.
Rudolf Hermann zuckt zusammen. Solange er sich zurückerinnert, ist Stefanie immer geräuschvoll aufgetreten.
»Lothar, mein Junge«, weint sie auf. »Wie konnte das nur geschehen? Mein Gott, was habe ich diese Nacht durchgemacht. Bald gestorben bin ich vor Schreck und Aufregungen. Hast du Schmerzen? Warum verziehst du den Mund so?« Und sie neigt sich über das noch blasser gewordene Gesicht des Kranken und beginnt es mit Küssen zu bedecken.
»Du sagst doch gar nichts, Liebling?« jammert Stefanie Hermann. »Bist du hier auch gut aufgehoben? Gefällt dir das Zimmer? Oder soll ich mit dem Arzt sprechen, daß man dir einen anderen Raum einräumt?«
»Mama, bitte«, fleht Lothar, und seine Augen suchen den Blick seines Vaters.
»Du hast mir meine Fragen gar nicht beantwortet, Lothar«, drängte Stefanie Hermann abermals. »Gefällt es dir hier nicht?«
Hermann macht diesem einseitig geführten Gespräch ein Ende.
»Siehst du nicht, wie sehr Lothar leidet?« raunt er ihr erbittert zu, und seine Hand zwingt sie zum Stillsitzen.
Entsetzt hängen die schönen, aber kühlen blauen Augen der Frau an dem harten Gesicht des Gatten.
»Ich meine es doch nur gut mit ihm«, beginnt sie abermals zu schluchzen. »Das ist doch kein Zimmer für meinen Sohn. Ich werde sofort veranlassen, daß er umgebettet wird.«
»Du wirst dich ganz still verhalten, hörst du? Lothar leidet große Schmerzen. Wenn es der Arzt gestattet und wenn es Lothars Wunsch ist, dann meinetwegen. Jetzt laß den Jungen in Ruhe.«
»Mama, bitte, geh«, kommt es schwach aus den Kissen.
Stefanie Hermann läßt die Tränen abermals fließen.
»Hörst du das?« stößt sie beleidigt hervor. »Wir sollen gehen.«
»Nein, Vater soll bei mir bleiben«, bittet der Kranke und dreht das Gesicht ein wenig der Wand zu.
»Lothar!« Das ist ein einziger empörter Aufschrei.
»Gnädige Frau, darf ich Sie hinausbegleiten?« Verstört sieht die Frau empor. Keiner hat den Arzt kommen hören, aber er war Zeuge der für ihn sehr inhaltsreichen Unterhaltung.
Willenlos gehorcht sie. An der Tür wirft sie noch einen Blick nach dem Bett zurück. Aber Lothar hält die Augen geschlossen. Sie schluchzt noch einmal auf und läßt sich dann davonführen.
Stefanies Tränen sind schnell versiegt; eine unbändige Wut beherrscht sie. Man hat sie regelrecht hinausgeschmissen. Vom Krankenbett des Sohnes verjagt. Das wird sie Rudolf heimzahlen.
»Nach Hause«, herrscht sie vor dem Portal den Chauffeur an und klettert in den Wagen, der eigens zu ihrer Verfügung steht, samt Fahrer. In steifer Haltung sitzt sie allein im Fond. Ihre Gedanken überschlagen sich hinter der Stirn.
Tausend Qualen durchlebt Rudolf Hermann. Aber in ihm ist eine winzige Hoffnung. Vielleicht wird Lothar leben.
Er ist selbst am Ende seiner Kraft. Die Aufregungen, die durcharbeitete Nacht, dann der Schock über das Unglück seines Sohnes, die durchgrübelte Nacht am Krankenbett und nun die langen einsamen Stunden als treuer Wächter haben ihm arg zugesetzt.
»Ich glaube, Sie müssen nun einmal an sich denken.« Doktor Rauher neigt sich flüsternd Hermann zu. »Die Nachtschwester übernimmt Ihr Amt. Sie haben Schlaf ebenfalls nötig.«
Mühsam hält Hermann die Augen offen. Er nickt. Noch einen liebevollen Blick wirft er auf den Kranken, der vor sich hin dämmert und nicht viel davon weiß, was um ihn herum vor sich geht.
»Morgen komme ich wieder«, flüstert Hermann zurück und verläßt das Krankenhaus.
*
Mit einer Taxe fährt Rudolf Hermann vor dem Grundstück vor, das er seiner Familie geschaffen hat. Ein weiter Park, gut gepflegt mit breiten, kiesbestreuten Wegen, Blumenrabatten und blühenden Büschen.
Hinter hohen Bäumen versteckt das Wohnhaus, im englischen Landhausstil erbaut und mit allem Komfort der Neuzeit eingerichtet. Langsam, den Hut in der Hand, geht er die breite Auffahrt hinauf. Der Abendwind spielt mit seinem Haar, das so dicht wie früher und nur an den Schläfen schlohweiß ist.
Er atmet die würzige Luft in tiefen Zügen. Er hat sich vorbereitet auf das, was geschehen muß.
Die Halle, mit der breiten Treppe, die nach oben führt und ein gewundenes Geländer trägt, ist schwach erleuchtet. Keiner der Angestellten ist sichtbar.
Er bleibt ein paar Minuten lauschend stehen, dann steigt er in das erste Stockwerk empor, geht über den jeden Laut dämpfenden Teppich und klopft an die Tür zum Schlafzimmer seiner Frau an.
»Wer ist da? Hat man denn keine Minute Ruhe in diesem Haus?«
»Ich bin es – Rudolf«, sagt er, seine Stimme zur Festigkeit zwingend.
Eine gewisse Zeit vergeht. Er hört Geräusche hinter der Tür, tapsende Schritte, und dann öffnet seine Frau.
»Mein Gott«, sagt sie ärgerlich. »So spät suchst du mich auf?«
Er sieht sie ernst und eindringlich an. Keine Frage nach dem Jungen. Sie sieht gepflegt wie immer aus.
»Was starrst du mich so an?«
»Ich habe mit dir zu reden, Stefanie, und erwarte dich in meinem Arbeitszimmer.«
»Du lieber Gott.« Stefanie Hermann hält mit beiden Händen den seidenen Morgenrock über der Brust zusammen. »Hat das nicht Zeit bis morgen?«
»Nein! Es muß jetzt sein, jetzt sofort.« Das klingt unnachgiebig, und erstmals versucht sie nicht ihren Willen durchzusetzen.
»Ich komme«, erwidert sie kurz und schlägt ihm die Tür vor der Nase zu.
Er wandert den Weg wieder zurück und sucht sein Arbeitszimmer auf. Ruhelos schreitet er hin und her. Ja, es ist ein bedächtiges, langsames Schreiten.
»Nun, was gibt es so Welterschütterndes?« hört er hinter sich die Stimme Stefanies.
»Weißt du eigentlich, wie das Unglück mit Lothar geschah?« fragt er ruhig.
»Ungefähr ja, Steffen Gregor hat es mir am Telefon erklärt«, sagt sie und weicht seinen hellen Augen aus. »Sie waren bei Schöllers eingeladen. Ein Haufen gleichaltriger Freunde und Freundinnen. Sie haben getrunken, und dann haben sie eine blödsinnige Wette abgeschlossen, dabei ist Lothar an einen Baum gefahren. Der Wagen ist natürlich total kaputt, aber die Versicherung ersetzt ihn.«
Hermann lächelt bitter.
»Daß unser Sohn dabei das Leben verlieren konnte, daran denkst du wohl nicht?«
»Mein Gott, ich habe mir doch schon bald die Augen aus dem Kopf geweint«, klagt sie weinerlich. »Damit kann ich das Unglück auch nicht ungeschehen machen.«
»Nein – das kannst du nicht.« Er richtet sich steil auf. »Aber du hast dafür gesorgt, daß Lothar niemals an ernste Arbeit dachte, immer nur an sein Vergnügen. Hältst du das für richtig?«
Empört fährt sie auf. »Soll das ein Verhör sein?«
»Vielleicht eine – Abrechnung«, sagt er betont langsam.
»Eine – was –?«
»Jawohl«, fährt er unbeirrt fort, »eine Abrechnung. Ich bin schuld an diesem Unglück.«
»Du –?« Ihre Augen werden kugelrund. »Hast du etwa den – den Wagen gesteuert?«
»Natürlich nicht.« Beinahe hätte er herausgelacht. Es wäre ein unnatürliches Lachen geworden. »Du wirst das niemals verstehen und wenn ich mit Engelszungen redete. Du hast es mir sehr schwer gemacht, meine väterliche Autorität den Kindern gegenüber geltend zu machen. Und ich habe resigniert. Das ist schlimm. Schlimm vor allem für die Kinder –«
»Du bist verrückt«, entfährt es ihr ärgerlich. »Um mir das zu sagen, bringst du mich um den Nachtschlaf?«
Hermann möchte ihr sagen, daß er zum Umfallen müde ist, daß er seit vielen Stunden keinen Schlaf gefunden hat. Aber er unterläßt es.
»Nein«, spricht er weiter. »Das wollte ich dir nicht nur sagen. Es geht noch um andere Dinge.«
Und er beginnt mit einer Stimme, die ihm selbst fremd vorkommt, die eintönig und monoton klingt und das, was er sagt, wie etwas Auswendiggelerntes. Daß er für das Projekt, fünfzig Siedlungshäuser für die Konservenfabrik Warta A.-G., infolge Geldknappheit die nötigen Maschinen nicht anschaffen konnte, da sie sich damals geweigert hatte, ihm von dem bereits zurückgezahlten Geld ihrer Mitgift einen Teil zur Verfügung zu stellen. Daß er die Häuser termingemäß nicht fertigstellen kann und das Projekt einer anderen Baufirma übergeben muß, wenn er nicht etwas retten will. Mit einem Wort, daß er am Ende ist.
»Und dafür willst du mich verantwortlich machen?« schreit sie ihm entsetzt entgegen. »War es nicht mein gutes Recht, mein Geld für die Kinder zu sichern?«
Er macht eine ziellose Handbewegung durch die Luft.
»Darum geht es auch nicht mehr. Das ist jetzt auch zu spät. Alle Schritte sind eingeleitet. Das Hermann’sche Bauunternehmen hat aufgehört zu existieren.«
Leichenblaß sinkt sie tiefer in den Sessel. »Nein, Rudolf«, keucht sie. »Das ist doch unmöglich. Diese Schande kannst du uns doch nicht antun? Nein, das überlebe ich nicht. Du, pleite –?«
Sie läßt die Hände sinken. Ihre Augen funkeln ihn feindselig an.
»Was soll denn aus uns werden? Man wird uns meiden wie die Pest. Man wird mit Fingern auf uns zeigen. Ach, hätte ich damals auf meine Mutter gehört…«
»Ich habe mir alles reiflich überlegt, Stefanie«, sagt er mit geradezu unheimlicher Ruhe. »Wenn das letzte Geschäft abgewickelt ist, dann wirst du den Rest deines Geldes überschrieben bekommen. Soviel springt dabei gerade heraus. Das Haus und was dazu gehört überlasse ich dir ebenfalls. Es soll dir gehören.« Er schöpft tief Atem und setzt ruhig hinzu: »Wir werden uns trennen.«
»Trennen?«
»Ja!« Langsam lösen seine Hände sich von der Sessellehne. Er beginnt in dem kostbar eingerichteten Raum umherzuwandern. »Ich habe mich in diesem Haus immer nur als Gast betrachtet, dafür hast du gesorgt. Ich will es nicht mehr sehen. Ich beginne von vorn, ganz von vorn.«
»Und – was soll ich den Kindern sagen?« Ihre Stimme zittert vor Erregung. Endlich zeigt sie eine Gemütsbewegung.
»Ich selbst werde mit den Kindern sprechen – außer mit Lothar«, entscheidet er. »Von Lothar muß alles ferngehalten werden, was ihn aufregen könnte.«
»Was – was werden die Leute dazu sagen?« wirft sie kläglich ein.
Seine Mundwinkel ziehen sich verächtlich herab. »Wenn du wüßtest, wie gleichgültig mir das ist. Du bist ja nie verlegen um Worte. Dir wird schon das Richtige einfallen. Jedenfalls war mein Leben an deiner Seite alles andere als schön. Selbst die Kinder hast du mir entzogen. Jetzt kann ich nicht mehr. Jeder Mensch hat Anspruch auf ein wenig Glück. Ich werde es in der Arbeit suchen –«
»Und die Kinder –?«
»Sie werden sich entscheiden müssen. Gott allein weiß, wie sehr ich sie liebe. Ich bin überzeugt, sie werden bei dir bleiben. Sie lieben mich nicht.«
Wortlos erhebt Stefanie sich und strebt der Tür zu. Von dorther sagt sie kalt: »Dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen.«
»Wir hatten uns nie viel zu sagen«, entgegnet er spöttisch, dabei fühlt er einen rasenden Schmerz in der Brust.
Er erschrickt förmlich, als er nochmals ihre Stimme hört.
»Du willst das Haus also für immer verlassen? Und wann?«
»Sobald ich die Unterredung mit den Kindern hinter mir habe«, erwidert er gleichgültig und wendet sich von ihr ab.
Die Tür fällt hinter ihr ins Schloß. Vor dem breiten Schreibtisch läßt er sich nieder, birgt das Gesicht in den Händen und verharrt regungslos.
Grenzenlose Leere ist in ihm – und um ihn!
*
»Sind meine Kinder schon im Frühstückszimmer?« fragt Rudolf Hermann Susanne, das Hausmädchen, und diese nickt eifrig.
»Nur die gnädige Frau ist noch in ihrem Zimmer.«
»Danke!«
Mit festen Schritten sucht Hermann das sonnige Terrassenzimmer auf. Vor dem tiefen Fenster ist der Frühstückstisch wie immer gedeckt.
Cornelia, seine zwanzigjährige Tochter, eine zarte, bezaubernde Erscheinung mit unwahrscheinlich hellen Augen unter dichten Wimpern und einer rotbraunen Lockenfülle lehnt am Fenster. Sie ist die verschlossenste von seinen Kindern, unnahbar.
Christian und Christiane, die Zwillinge, sitzen wie verschüchterte Hühner auf dem Ecksofa und flüstern aufgeregt miteinander.
Beim Eintritt des Vaters verstummen sie schlagartig. Auch Cornelia dreht sich um.
»Guten Morgen«, grüßt sie und geht auf ihren Platz zu. »Mama kommt später. Sie hat ihre Migräne. Kein Wunder bei den Aufregungen.«
Rudolf Hermann läßt seine Augen zwischen seinen Kindern hin und her wandern. Wie reizend Christiane aussieht, mit dem dunklen Haar und den dunklen Augen. Ein Erbteil seiner verstorbenen Mutter. Christian sieht noch sehr unreif und unfertig aus. Er verspricht ein gutaussehender Mann zu werden.
»Ich habe mit euch zu sprechen«, beginnt er, und er spürt, wie ihm seine Stimme nicht gehorchen will.
»Können wir nicht erst das Frühstück einnehmen?« fragt Cornelia ruhig. Ihre Stimme schwankt ein wenig. »Oder – oder willst du uns etwas über Lothar sagen? Wie geht es ihm? Ist er schwer verletzt?«
»Warst du auch auf der Party?« erkundigt Hermann sich.
»Nein, ich bin einmal früh schlafen gegangen«, erwidert sie. Er sieht, wie sie die schmalen Finger ineinander schlingt. »Wäre ich doch mitgegangen. Vielleicht hätte ich das Unglück verhindern können!«
Ihre Schultern zucken plötzlich, und Hermann geht auf sie zu, legt ihr die Hand auf das schimmernde Haar. »Es mußte wohl alles so kommen, Cornelia. Quäle dich nicht mit Vorwürfen herum.«
Sie richtet die hellen Augen erstaunt auf den Vater.
»Vielleicht bringen sie Lothar durch«, sagt er kummervoll. »Man muß abwarten.« Er läßt eine kurze Pause eintreten, bemerkt, wie sie erleichtert aufatmet und sich ihre Züge erhellen. Die Zwillinge fassen sich an den Händen. Irgendwie rührt dieses Bild Hermann.
Er schaut schnell weg. Wie sehr er sie liebt! Was wird ihm die nächste Stunde bringen? Wird er sie verlieren? Alle drei verlieren?
»Ich habe etwas sehr Ernstes mit euch zu besprechen. Ihr seid alt genug, um das zu verstehen.« Kurze Pause. Drei Augenpaare hängen gespannt an seinem Mund.
»Zunächst muß ich euch sagen, daß wir bettelarm sind, das heißt – ich! Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Die Gründe dazu brauche ich euch wohl nicht auseinanderzusetzen, ihr würdet dafür kaum Verständnis haben.«
»Doch, Papa«, läßt Cornelia sich vernehmen. »Ich würde mich bemühen, es zu verstehen.«
Lange sieht er seine älteste Tochter an. »Gut«, entscheidet er, »dann sollst du es wissen.«
Und er breitet abermals die Zusammenhänge, die zu seinem Zusammenbruch geführt haben, vor einem Menschen aus, diesmal vor seinen Kindern. Nichts beschönigt er. Er gibt sich bei allem selbst die Schuld. Stumm hören die Kinder ihm zu.
»Und wenn Mama dir das Geld gegeben hätte, dann wäre das alles zu verhindern gewesen?« wirft Cornelia in einer Atempause ein.
»Ja«, sagt er kurz, mehr nicht. Aber dieses eine Wort hängt wie ein Verhängnis in der Luft.
Hermann fährt fort. »Mama und ich trennen uns. Ich kann ihr ein Zusammenleben mit mir nicht mehr zumuten. Sie ist einen großzügigen Lebensstil gewohnt, den ich ihr nicht mehr bieten kann. Das seht ihr wohl ein. Nun liegt es an euch.« Seine Stimme wird unsicher. Es würgt in seinem Hals, als säße da ein Kloß. »Ich liebe euch. Ich liebe euch mehr als ihr denkt. Wenn ihr bei eurer Mutter bleiben wollt, ich nehme es euch nicht übel. Ich kann euch nichts bieten. Mutter dagegen hat ihr ganzes Geld. Auch das Haus soll sie haben. Ihr braucht euch nicht sofort zu entscheiden. Ich lasse euch Zeit, bis – bis ich das Haus für immer verlasse. Ihr findet mich in meinem Zimmer«, setzt Rudolf Hermann abschließend hinzu und ohne etwas zu sich zu nehmen, geht er aus dem Raum. Eine bedrückende Stille läßt er hinter sich.
»Wie kann Vater uns in eine solche Lage bringen«, bricht Christian zuerst das Schweigen.
»Sei still«, herrscht Cornelia ihn an und versinkt in grüblerisches Nachdenken.
»Wie schrecklich das alles ist«, weint Christiane auf. »Was sollen wir bloß machen?«
Der Schimmer eines Lächelns huscht über Cornelias Lippen. Es ist kein gutes Lächeln.
»Wie ich euch kenne, werdet ihr bei Mama bleiben.«
»Wir können Mama unmöglich allein lassen«, fährt Christian mit einem Anflug von Energie auf.
»Natürlich könnt ihr das nicht.« Cornelia stürzen Tränen der Wut aus den Augen. »Mama ist ja so hilfsbedürftig. Sie hat auch keinen Pfennig Geld. Ihr werdet für sie arbeiten.« Sie springt auf. »Ach, ihr seid erbärmlich«, stößt sie hervor und stürzt aus dem Zimmer. Die Zwillinge sehen ihr aus verstörten Augen nach. Sie scheinen gar nicht zu begreifen, was eigentlich gespielt wird.
Cornelia stürzt mit vor Tränen blinden Augen vorwärts, direkt in Rudolf Hermanns Arbeitsraum hinein. Keuchend verhält sie den Schritt, lehnt am Türrahmen.
Hochaufgerichtet, mit Augen, in denen sich alles Leid der Welt zu spiegeln scheint, sieht er seiner Tochter entgegen.
»Papa!«
Sie stolpert vorwärts, direkt in des Vaters Arme hinein. Sie schlingt die Arme um seinen Hals und preßt ihr tränennasses Gesicht gegen seinen Hals.
»Papa, lieber Papa. Ich bleibe bei dir. Du bist wundervoll«, stammelt sie, von Schluchzen geschüttelt, und sie fühlt, wie der Vater sie fest an sich drückt.
»Kind!« Ganz fest preßt Hermann seine Tochter an sich. Dann hält er sie eine Armlänge von sich ab, forscht eindringlich in ihren Augen. »Hast du dir alles reiflich überlegt? Ich bin ein armer Mann. Nichts kann ich dir mehr bieten, nichts, was bisher dein Leben ausfüllte. Ich könnte dich nur mit Liebe verwöhnen, dir ein guter Vater und Freund sein.«
Cornelia weint hemmungslos und klammert sich wieder an ihn. Beruhigend streicht er ihr über das Haar.
»Du kannst mich nicht umstimmen, Papa. Ich will dir helfen, soweit es mir möglich ist.«
»Gut, Cornelia.« Hermann drückt ihr einen Kuß auf die Stirn und führt sie zu einem Sessel. Gehorsam schmiegt sie sich hinein. Die Augen hat sie groß zu ihm emporgehoben. Sie hängen an seinem Mund. »Du hast dich entschieden.«
Sekundenlang bedeckt er seine Augen mit der Hand, wie immer, wenn er sehr bewegt ist. »Du glaubst nicht, was du mir schenkst, mein Kind. Beruhige dich und weine nicht mehr.« Er beugt sich über sie. »Liebe kleine Cornelia.« Ein schwaches, aber glückliches Lächeln verschönt seine Züge. »Heute bist du mir zum zweiten Mal geboren.«
*
Rudolf Hermann geht abermals durch die Toreinfahrt und dem langgestreckten Geschäftsgebäude zu. Er hat seinen Wagen nicht wieder benutzt. Ich muß mich daran gewöhnen zu Fuß zu gehen, hat er Cornelia auf ihre Frage erwidert.
»Auch ich werde mich daran gewöhnen, in Zukunft zu Fuß zu gehen.«
Er steigt die Stufen empor, geht den Flur entlang, an den Türen mit den Glasscheiben vorbei, durch die man die Geschäftszimmer übersehen kann.
In seinem Zimmer sitzt Emil Weber hinter dem Schreibtisch. Beim Eintritt Hermanns richtet er sich auf und betrachtet forschend den Freund, der langsam näherkommt, die Hände auf die Tischplatte stützt und sich erkundigt.
»Nun, alter Freund, wie steht es? Was hast du inzwischen zusammengerechnet?«
Weber sucht vergeblich nach Worten. Sind wirklich erst Stunden vergangen, da Rudolf, ein dem seelischen Zusammenbruch nahestehender Mann, vor ihm gestanden? Was ist inzwischen geschehen?
»Was – was ist los mit dir, Rudolf?« fragt er und versucht ein verunglücktes Lächeln.
»Ja, mein lieber Emil. Manchmal kann eine einzige Stunde das Leben eines Menschen verändern«, spricht Hermann ruhig und gelassen wie immer. »Eine einzige, armselige Stunde«, wiederholt er sinnend.
»Hat – hat deine Frau dir endlich geholfen?« Weber gerät in Erregung und schiebt die Bücher etwas zur Seite.
»Geschäftlich hat sich nichts geändert, Emil«. gibt Rudolf Hermann mit fester Stimme Auskunft. »Aber
sonst –« Jetzt gerät er ins Stocken. »Ich habe mich von Stefanie getrennt – für immer und Cornelia, meine kleine, schöne Cornelia hält zu mir.«
Er verstummt, und das Leuchten seiner Augen wird tiefer. Weber hat sofort begriffen.
Er senkt den Kopf, öffnet das Hauptbuch und erklärt mit geschäftsmäßigem Ton.
»Wenn du das Geld an deine Frau zurückgezahlt hast, verbleibt dir ein kleiner Rest zu einem neuen Anfang. Viel ist es nicht, Rudolf, aber wie ich dich kenne, genügt es dir. Die Baufirma wird hier den ganzen Betrieb mitsamt den Angestellten übernehmen, so daß keiner arbeitslos wird. Das habe ich erreicht.«
Hermanns Brust hebt sich in einem tiefen Atemzug. »Gottlob, darüber habe ich mir viel Sorgen gemacht. Man übernimmt sie also. Wie schön von Stefan Rietberg. Es freut mich um deinetwillen ganz besonders –«
»Um meinetwillen –?« wiederholt Weber erstaunt. »Was habe ich denn damit zu tun?«
»Du gehörst doch zu dem Stab meiner Mitarbeiter – ich meine – meiner ehemaligen Mitarbeiter.«
»Ich gehöre zu dir, Rudolf«, sagt Weber ärgerlich und schlägt das Buch energisch zu. »Denkst du, ich verlasse dich? Kann man die Jahre unserer Zusammenarbeit, die unsere Freundschaft vertieft haben, einfach wegwischen? So einfach auslöschen wie einen Kreidestrich?«
»Weber, Menschenskind, man bietet dir eine Chance. Du bist nicht mehr der Jüngste!« Hermann gerät in helle Bestürzung. Seine Rede ist voll Eindringlichkeit, sie ruft nur ein abwehrendes Lächeln auf Webers unrasiertem Gesicht hervor.
»Red keinen Unsinn!« Die hagere Gestalt richtet sich aus Rudolf Hermanns Sessel empor. »Das wäre eine traurige Freundschaft, wollte sie diesen Sturm nicht überdauern. Mein Entschluß steht fest –« Er blinzelt den Freund beinahe verschmitzt an.
»Emil!« Hermann ist wie vor den Kopf geschlagen. Er preßt die Lippen zusammen.
Zuerst Cornelia – sinnt er – nein, zuerst war es Lothar, der schwer verletzte Lothar, der ihn an seinem Bett haben wollte. »Vater, lieber Vater«, hat er gesagt und dann hat Cornelia an seinem Hals gestammelt, daß sie ihn liebt und nun Weber, der es für eine Selbstverständlichkeit hält, bei ihm zu bleiben.
»Wie geht es Lothar?« Wie aus weiter Ferne schlägt diese Frage an Hermanns Ohr. Sie bringt ihn in die Gegenwart zurück. Nur nicht viele Worte machen, das ist Webers Prinzip. Er dreht sich um, angelt sich einen Stuhl heran und setzt sich schwerfällig. »Ja, der Junge, Emil, er wird wohl durchkommen, wie der Arzt meinte. Aber man weiß nicht, ob er seine Glieder wird ordentlich wieder gebrauchen können. Man muß Geduld haben, Emil. Ich habe großes Vertrauen zu diesem jungen Arzt. Doktor Rauher heißt er.«
Weber lächelt erfreut. Er hüstelt und meint dann: »Übrigens, Rudolf, du kannst dich um deinen kranken Sohn kümmern. Ich bringe hier die Sache ganz allein in Ordnung. Stefan Rietberg ist ein grundanständiger Kerl. Alle Achtung! Er bedauert
tief –«
Hermann macht eine rasche Handbewegung, die Weber verstummen läßt. Er überlegt kurz, dann erhebt er sich. »Gut, Emil, dann will ich mal wieder gehen. Du findest mich heute noch in meinem Haus. Ich erwarte dich sogar. Wir haben, wenn hier alles erledigt ist, über unsere Zukunft zu sprechen.«
Bedächtig setzt er seinen Hut auf und langsam läßt er seine Augen in dem Raum, in dem er ein halbes Menschenleben gearbeitet hat, umhergleiten.
Von der Tür her sagt er mit belegter Stimme: »Überhaupt habe ich vergessen, dir zu danken, Emil. Zunächst für deine Treue –«
Weber fegt mit der Hand durch die Luft, und Hermann lächelt schwach. »Ich weiß, von Dank willst du nichts wissen. Weißt du, Emil, wenn ich es recht bedenke, dann sind wir eigentlich gar nicht arm, nicht wahr?«
*
In dem Frühstückszimmer in Rudolf Hermanns schönem, geschmackvollem Haus hat sich wenig geändert.
Die Zwillinge sitzen immer noch verstört und dicht zusammengedrängt auf dem Sofa. Cornelia lehnt an der Anrichte, und ihre hellen Augen verfolgen die immer noch jugendliche Gestalt der Mutter, die im Zimmer umherrast.
»Das kann doch nicht möglich sein, Cornelia. So undankbar kann doch kein Kind sein.« Am ganzen Leibe zitternd bleibt Stefanie Hermann vor ihrer Tochter stehen. »Du kennst das Leben nur von der besten Seite. Du bist verwöhnt, du kennst nur Luxus. Ich kann dir deine Wünsche auch weiterhin erfüllen. Was kann dir schon dein Vater bieten, dieser – dieser –«
»Mama!« Entsetzt streckt Cornelia beide Hände vor. »Sprich das häßliche Wort nicht aus. Papa hat das niemals um uns verdient.«
»Sei still«, herrscht Stefanie die Tochter an. »Du weißt nicht, was du sprichst.«
Cornelia streckt sich. »Aber ich weiß, was ich will«, sagt sie unbeugsam.
»Was denn?« höhnt Stefanie.
»Arbeiten, Mama. Ich werde arbeiten wie jeder andere auch und nicht auf Papas Tasche liegen.«
»Da würdest du auch ziemlich hart liegen, denn die ist schmal«, meint Stefanie boshaft, und ihre Augen werden ganz schmal.
Cornelia hebt ratlos die Schultern. »Es tut mir leid, Mama«, flüstert sie kaum hörbar. »Ich liebe dich und auch Papa, aber Papa –«
»Ich weiß, ich weiß«, unterbricht Stefanie außer sich, »aber Papa liebst du mehr. Du wirst es noch bereuen, und wie du es bereuen wirst.«
»– aber Papa braucht jetzt einen Menschen neben sich, wenn er nicht verzweifeln soll«, spricht Cornelia unbeachtet des Einwurfes weiter.
Abermals fegt Stefanie mit dem schleppenden Morgenrock über den Teppich. »Und ihr?« faucht sie die Zwillinge an.
»Wir bleiben selbstverständlich bei dir, Mama«, läßt Christian sich vernehmen und legt dabei den Arm um die Schwester. »Nicht wahr, Christiane, wir können Mama nicht allein lassen?«
Christiane nickt heftig. »Und Lothar?« flüstert sie.
Stefanie kneift die Lippen zusammen und bleibt nachdenklich stehen. Sie murmelt: »Lothar, natürlich, Lothar muß sich auch entscheiden. Wir werden zu ihm fahren, jetzt gleich, und ihr kommt mit«, befiehlt sie den Zwillingen.
Cornelia stellt sich Stefanie in den Weg. Ihre Augen sind vor Schreck weit geöffnet. »Du willst doch jetzt nicht zu Lothar fahren, Mama, um von ihm eine Entscheidung zu erzwingen? Er weiß doch noch von nichts.«
Stefanie schiebt die Tochter verächtlich beiseite. »Dann wird es Zeit, daß er es endlich erfährt.«
Sie hastet aus dem Zimmer, und der Morgenrock raschelt hinter ihr her.
Cornelia sinkt in einen Sessel, und die Zwillinge schleichen sich an ihr vorbei. Armer Papa! – denkt Cornelia – wie blind bin ich gewesen.
Noch nie hat Cornelia gewußt, wie sehr man um einen Menschen bangen kann. Bisher kannte sie nur ihre eigene Person und ihre Wünsche. Auf einmal ist das alles ganz anders.
Rudolf Hermann wacht am Bett seines Sohnes. Es geht ihm sehr schlecht. Schwestern und Ärzte gehen abwechselnd ein und aus, messen den Puls und unterhalten sich flüsternd.
Als Doktor Rauher mit Schwester Monika aus dem Zimmer tritt, begegnet er auf dem langen Flur Stefanie Hermann und den beiden Zwillingen. Er begrüßt die elegante Frau, die in eine süßliche Duftwolke eingehüllt ist, und die beiden jungen Menschen.
»Ich möchte zu meinem Sohn«, sagt Stefanie nach einer kühlhöflichen Begrüßung fordernd, und Doktor Rauher bereitet es irgendwie eine Genugtuung, ganz als Arzt sprechen zu dürfen.
»Es tut mir sehr leid, gnädige Frau. Aber Besuche sind augenblicklich nicht gestattet.«
»Aber warum denn nicht?« funkelt sie den Arzt an. »Ich bin doch die Mutter.«
»Gewiß, gnädige Frau.« Der Arzt verliert seine Ruhe nicht. »Sie könnten höchstens einen Blick durch die Tür werfen. Sprechen können Sie ihn sowieso nicht. Er hat Fieber und erkennt niemanden. Es genügt, wenn Ihr Gatte bei ihm ist.«
»Mein – was?« Ihr ist, als habe sie einen Schlag empfangen. »Mein Mann ist bei ihm? Und mich wollen Sie nur durch den Türspalt sehen lassen. Ich bitte Sie –« Ihre Stimme überschlägt sich vor Empörung.
»Es geht ihm nicht gut, und er braucht äußerste Ruhe. Verstehen Sie das nicht, gnädige Frau?«
»Ich werde mich äußerst ruhig verhalten.« Auf einmal kann sie auch sanft sprechen.
Sie fährt rasch herum. Christiane hat sie am Arm gezupft.
»Laß uns doch nur durch die Tür sehen, Mama«, bittet sie mit ihren großen Kinderaugen. »Wenn der Herr Doktor doch meint –?«
Ein kleines Lächeln schwingt um den ausdrucksvollen Mund des Arztes. Er geht voran und öffnet behutsam die Tür.
Das Gesicht Lothars ist kaum zu erkennen, so verändert hat es sich, eingefallen und wächsern, daß ihr ein heißer Schreck zum Herzen zuckt.
»Lothar, mein Junge«, flüstert sie und macht Anstalten, sich in den Raum zu stürzen. »Er stirbt, mein Gott, er stirbt.«
Doktor Rauhers Hand hält sie eisern fest. »Er stirbt nicht, gnädige Frau.« Er drängt sie zur Seite, und lautlos zieht er die Tür ins Schloß.
Unter Tränen sieht sie zu dem undurchdringlichen Gesicht des Arztes auf. Rudolf ist bei Lothar, und mich läßt man nicht zu ihm. Brüsk macht sie kehrt. »Kommt«, sagt sie kurz, und von den Zwillingen gefolgt, rauscht sie davon.
Kopfschüttelnd sieht Doktor Rauher hinter ihr her, dann geht er in entgegengesetzter Richtung den Flur hinunter.
Kurz danach steht er vor Cornelia Hermann. Er ist tief beeindruckt von der Schönheit des jungen Mädchens.
»Man hat mich an Sie verwiesen, Herr Doktor«, hört er eine dunkle schwingende Stimme, die ihn gefangen nimmt. »Ich möchte so gern meinen Bruder Lothar Hermann sehen. Würden Sie es mir gestatten, Herr Doktor, bitte, nur einen kurzen Blick.«
Merkwürdig, sinnt er, wie verschiedenartig die Kinder einer Mutter sind.
»Bitte, Herr Doktor«, flüstert es vor ihm. Da hat er sich entschlossen.
»Kommen Sie, Fräulein Hermann«, sagt er ruhig, und sie folgt ihm mit einem prüfenden Blick, der über seine hohe Gestalt im weißen Kittel läuft. Er hat gütige Augen. Ich glaube, seine Kranken können Vertrauen zu ihm haben, denkt sie, und dann steht sie in dem schmalen Zimmer.
»Papa!« sagt sie leise, und Hermann ruckt empor, erkennt Cornelia mit den ängstlich aufgerissenen Augen und dem blassen Gesicht und strahlt. »Kind, du?«
Wie selbstverständlich überläßt er ihr den Platz neben dem Bett und stellt sich neben sie.
Cornelia preßt das Taschentuch fest an die Lippen. Wie verändert Lothar aussieht mit dem gänzlich verzerrten Mund, dem schmalgewordenen Gesicht, in dessen Züge der Schmerz tiefe Furchen gegraben hat.
Oh, Lothar, denkt sie voll Erbarmen, wie mußt du leiden. Sie hebt den Kopf und begegnet des Vaters Augen. Er nickt ihr beruhigend zu.
»Eben ist er eingeschlummert, Cornelia. Er trägt seine Schmerzen sehr tapfer. Lassen wir ihn schlafen. Komm!«
Ganz sacht, ganz sanft streicht sie über die unverletzte Hand, die still auf der Decke ruht, und erhebt sich dann gehorsam.
Draußen nimmt Hermann den Arm seiner Tochter und führt sie zu der weißen Bank.
»Wird er leben?« fragt sie zitternd, und er nickt ihr zu.
»Im Augenblick können wir nichts für Lothar tun«, spricht Hermann leise auf sie ein. »Er hat jede Minute Schlaf dringend nötig. Willst du mit mir kommen, Kind?«
»Ja!«
Arm in Arm gehen sie, der Mann mit den breiten Schultern und das junge Mädchen mit der grazilen Gestalt.
Wieder läuft ihnen Doktor Rauher in den Weg, diesmal absichtlich. Er muß dieses schöne blasse Geschöpf noch einmal sehen.
»Vielen Dank, Herr Doktor«, sagt sie und streckt ihm die Hand entgegen, die wie etwas Kostbares von ihm aufgenommen wird.
»Sie dürfen jederzeit wiederkommen, Fräulein Hermann«, spricht er, und dabei lächeln seine Augen.
»Werden Sie mich anrufen, wenn sich etwas ändern sollte?« fragt Rudolf Hermann, und der Arzt neigt zustimmend den Kopf.
»Selbstverständlich, Herr Hermann.« Dr. Rauher lächelt. Es ist sehr einnehmend, dieses Lächeln, und es nimmt auch Cornelia gefangen. Sie atmet auf, als er hinzusetzt: »Ich bin überzeugt, daß ich Sie deshalb nicht anzurufen brauche.«
Draußen, im strahlenden Sonnenschein, trocknet Cornelia sich hastig die Tränen ab. Immer noch geht sie am Arm ihres Vaters, und sie fühlt sich geborgen wie noch nie, seit sie erwachsen ist.
»Wohin?« fragt Rudolf Hermann, und Cornelia zuckt ein wenig. »Ich habe jetzt so viel Zeit, Kind. Wollen wir einmal zusammen eine Tasse Kaffee trinken.«
»Gern, Papa!«
Heimlich forscht sie von der Seite in seinen Zügen. Sie sucht nach Bitterkeit darin, aber er macht einen zufriedenen Eindruck.
Sie sitzen unter einem Sonnenschirm, und der Strom der Passanten fließt an ihnen vorüber. Sie lehnen sich tief in ihre Sessel zurück und lassen sich Mokka servieren.
Tiefernst sieht er seine Tochter an. »Ich habe alles falsch gemacht, Kind. Nun ist es zu spät.«
»Niemals kann es zu spät sein!«
Er schüttelt den Kopf. »Liebes Kind, ich möchte dir in dieser ruhigen Stunde so viel sagen. Aber wie könnte ich dir gegenüber deine Mutter anklagen? Ich bin trotz allem so glücklich wie selten in meinem Leben.«
Plötzlich fällt ein Schatten über ihren Tisch. Rasch zieht Cornelia ihre Hand weg.
»Es ist reiner Zufall, daß ich hier vorüberging«, sagt ein hochgewachsener dunkelhaariger Mann, der den Hut in der Hand trägt und sich ehrerbietig vor ihr und dann vor ihrem Vater verneigt. »Darf ich Ihnen einen guten Tag wünschen?«
»Meine Tochter«, sagt Hermann stolz und weist auf den freien Stuhl. Und an Cornelia gewandt: »Das ist Stefan Rietberg, der mein Unternehmen weiterführen wird.«
Cornelias eben noch aufgeschlossene Züge werden herb und abweisend. Aus ihren hellen Augen spricht Feindseligkeit. Stefan Rietberg nimmt es sofort wahr. Er läßt sich neben Hermann nieder und sieht gedankenvoll vor sich hin.
»Konnten Sie meinem Vater nicht helfen?« platzt Cornelia atemlos heraus. Rudolf Hermann macht eine beschwichtigende Bewegung, und Rietberg antwortet mit einem beinahe traurig zu nennenden Lächeln.
»Ich bin der einzige, zu dem Ihr Herr Vater nicht gekommen ist. Mir wurde der Auftrag übergeben, ohne daß ich die Gründe hierfür kannte. Dann hat er abgelehnt.«
Cornelia sinkt auf ihren Platz zurück. Sie sieht die Verlegenheit, die sich in den Zügen ihres Vaters spiegelt.
»Mir hat einmal ein Mensch geholfen«, sagt er hart. »Das genügt mir.«
Ein peinliches Schweigen entsteht. Der Ober nähert sich, und Rietberg bestellt sich ein Getränk.
»Sie sollen nur wissen, lieber Hermann«, nimmt Rietberg den Faden wieder auf, »daß ich Ihnen gern helfen möchte.«
»Danke, sehr liebenswürdig«, wehrt Hermann mit dem Anflug eines Lächelns ab. »Aber ich helfe mir selbst. Ich beginne ganz von vorn, und ich fühle mich stark genug dazu.«
»Und ich helfe dir, Papa«, setzt Cornelia abschließend hinzu und legt ihre Finger wieder auf die Hand des Vaters.
Wie schön sie ist, wie wunderschön – sinnt Rietberg – und er wundert sich, daß er ihr noch nie begegnet ist.
Cornelia lehnt sich weit zurück. Sie hält die Lider halb geschlossen. Aber sie betrachtet eingehend das interessante Gesicht ihres Gegenübers.
Rietberg spürt den prüfenden Blick, und erstmals passiert es ihm, daß er verlegen wird. Hastig erhebt er sich und greift zu seinem Hut. »Entschuldigen Sie mich, ich muß weiter«, sagt er und reicht zuerst Cornelia und dann Rudolf Hermann die Hand. Cornelia legt nur die Fingerspitzen hinein. »Ich hoffe, Sie bald einmal wiederzusehen.«
Cornelia sieht hinter ihm her. Hat er nun sie oder Papa gemeint?
»Die Liebe ist ein gar zartes Kraut, Kind«, hört sie des Vaters zögernd gesprochene, wie aus tiefem Sinnen kommenden Worte. »Es bedarf hingebungsvollster Pflege, damit sie gedeiht und wächst, bis sie ganz stark geworden ist.«
Verwirrt sieht sie ihn an. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Papa«, gibt sie ehrlich zu. »Ich habe überhaupt sehr wenig nachgedacht, über das Leben und seinen Sinn. Ja, auch über mich selbst habe ich nicht nachgedacht, am allerwenigsten über die Liebe.«
Liebevoll betrachtet er ihr zartes, jetzt so nachdenkliches Gesicht.
»Ach, Papa«, seufzt sie leise. »Jetzt kommt es mir vor, als hätte ich bisher ein Traumleben geführt, weit entfernt von der Wirklichkeit. Es war ein ewiges Gehetze, vom Friseur zur Schneiderin, nachmittags zu Tanztees, immer Betrieb um mich herum. Abends zu irgendeiner Einladung, bis in die Nacht hinein getanzt, todmüde ins Bett, bis in den hellen Tag hinein geschlafen. Da kam ich nicht zum Nachdenken.«
»Also Übersättigung«, wirft Hermann kurz ein.
»Übersättigung?« Sie sinnt hinter dem Wort her. Sie sieht ernsthaft und grüblerisch und dann wieder wie ein kleines Mädchen aus, das kleine Sünden zu beichten hat. »Vielleicht sollte man es so nennen – oder auch nicht? Bis zu dem Augenblick, da ich Einblick in deine Sorgen, in unser trauriges Familienleben gewann, hat es mir ganz gut gefallen. Aber jetzt…« Sie schüttelt sich wie ein nasser Hund. »Jetzt könnte ich nicht mehr in dieser Gedankenlosigkeit leben. Auch Lothars Unglück hat dazu beigetragen. Siehst du, die jungen Menschen aus wohlhabendem Hause haben ja immerfort die blödsinnigsten Ideen, weil ihnen keiner die Sinnlosigkeit ihres Tuns klargemacht hat. Das war eben alles in Ordnung. Was Lothar passiert ist, kann morgen einem anderen der jungen Menschen passieren. Heute jung und gesund – morgen ein Krüppel.«
Sie sieht ihn mit ängstlichen Augen an. »Lothar wird doch wohl kein Krüppel werden?«
»Wir wollen es nicht hoffen, Kind. Außer dem linken Arm hat er ja alle Glieder gebrochen. Er wird mit sich selbst viel Geduld haben müssen. Es wird ein langer Heilungsprozeß werden.«
»Eigentlich machen wir dir nichts als Kummer, Papa«, bemerkt sie schmerzlich berührt.
»Kummer?« wiederholt er mit einem nachsichtigen Lächeln. »Ich meine eher, wir setzen zuviel Hoffnungen in unsere Kinder, und wenn es dann nicht so ausläuft, wie man es sich wünscht, ist man enttäuscht. Man soll nicht mehr in einen Menschen hineinlegen, als drin ist.«
Als er ihr vorschlägt zu gehen, ist sie sofort bereit. Arm in Arm schlendern sie im Strome der Passanten dahin. Eigentlich ist es wunderbar, einmal Zeit zu haben, für mich selbst und für mein Kind – sinnt er – und er ist glücklich und vergißt, wie grau die Zukunft vor ihm liegt.
*
Im Hause trennen sie sich. Cornelia verschwindet über die Treppe, und er sucht sein Zimmer auf.
Über den Schreibtisch gebeugt, sieht er das Foto von Stefanie.
Wie hat er nur die vielen Jahre neben dieser egoistischen Frau leben können? War er mit Blindheit geschlagen? Oder war es Resignation? Noch ist er mit seinen Überlegungen zu keinem Ende gekommen, als sich die Zwillinge durch die Tür schieben.
»Verzeih, Papa.« Er hebt die Augen und geht ihnen entgegen. »Wir hatten angeklopft.«
»Nett, daß ihr zu mir kommt«, sagt er und legt die Arme um sie. Er findet sie reizend, seine beiden Jüngsten.
»Wir – wir wollten dir nur sagen –«, beginnt Christian stockend und wirft Christiane einen hilfeflehenden Blick zu, den sie sofort versteht.
»Du sollst uns nicht böse sein, Papa. Aber wir wollen bei Mama bleiben«, kommt Christiane ihm zu Hilfe.
»Das kann ich verstehen, Kinder«, sagt er mit einem kleinen traurigen Lächeln. »Ihr wollt Mama nicht allein lassen.«
»Sie will mir einen Modesalon einrichten«, fällt Christian ihm in die Rede, hastig und übereifrig.
»Das kann ich allerdings nicht, Christian«, gibt er unumwunden zu. »Bis dahin mußt du aber noch fleißig lernen.«
Er macht eine großartige Handbewegung. »Mama meint, das sei gar nicht nötig. Man engagiert sich tüchtige Leute –«
»– und spielt den Chef, den jungen, unerfahrenen Chef«, versetzt er spöttisch.
»Natürlich, Papa, dann bin ich der Chef. Mama meint –«
Er atmet tief. »Ja, mein Junge, Mama meint es sicher sehr gut mit dir. Dann darf ich dir nur Glück wünschen.«
Er wendet sich an Christiane. »Und du?«
»Mama meint, ich hätte eine gute Figur, ich könnte kostbare Kleider vorführen und bei den Modeschauen mithelfen.«
»Soso«, macht er nur, und er fühlt einen Stich in der Brust. Wie sehr die beiden unter dem Einfluß der Mutter stehen. Was sie sagt, ist Evangelium für sie. Ob sie jemals eine eigene Meinung haben werden?
*
Ratlos, hilflos und verstört sitzt Cornelia auf einem Koffer in der kleinen Wohnung, die er für sie gemietet hat. Es sind zwei schmale Zimmer, eins für sie und eins für den Vater, und dann ist eine geräumige Veranda da, wie ein Zimmer, mit Glasfenstern, hell und sonnig.
Sie seufzt und erhebt sich. Wohin nur mit dem vielen Gepäck? Sie schleppt ihre Koffer in ihr Zimmer und findet auch da die liebevolle Hand des Vaters. Es ist bestimmt nicht groß, aber es ist zweckmäßig.
So nimmt sie langsam Besitz von der kleinen Wohnung, die ihr winzig, wie ein Puppenstübchen, vorkommt.
Langsam kehrt sie in ihr Zimmer zurück, beginnt auszupacken und ihr Eigentum zu verstauen. Sie muß feststellen, daß sie es gar nicht unterbringen kann. Die Kleider finden keinen Platz in dem schmalen Schrank. Auch die Wäschefächer reichen nicht aus. So läßt sie den Rest in den Koffern.
Ein Blick auf die Uhr. Du lieber Himmel! Sie muß ja für etwas Eßbares sorgen. Sie holt ihre Handtasche herbei und zählt ihre Barschaft.
Drei Fünfzigeuroscheine, zwei Zehner und einiges Kleingeld. Sie dünkt sich unendlich reich. Ein Glück, daß sie diesen Monat keine großen Ausgaben gehabt hat.
Sie eilt von Geschäft zu Geschäft. Sie kauft ein, was ihr gefällt und wovon sie glaubt, daß es dem Vater Freude machen wird.
Als sie, zu Hause angekommen, ihre Einkäufe überprüft, kommt es ihr ziemlich üppig vor.
Als sie in der Veranda den Tisch gedeckt hat, nimmt sie abwartend Platz. Tee wird sie erst aufbrühen, wenn der Vater heimgekehrt ist.
Ganz verloren kommt sie sich in der noch fremd wirkenden Wohnung vor, einsam und verlassen. In der Villa wird jetzt die Abendtafel gedeckt. Hildegard wird servieren. Die Mutter wird mit eisigem Gesicht und in einem kostbaren Kleid den Zwillingen gegenübersitzen. Sie werden voller Hast essen, denn irgendwohin wird Mama die beiden bestimmt schleppen.
»Wie nett du das gemacht hast.« Sie schreckt zusammen. Sie hat den Vater weder die Tür aufschließen noch kommen hören. Sie lächelt ihn schwach an, zweifelnd, und hält den Kopf etwas schräg dabei.
»Wirklich, Papa? Gefällt es dir?«
»Aber sehr, Kind«, bestätigt er.
»Ich mache uns schnell Tee, Papa«, sagt sie eilig.
Rudolf Hermann schaut sich um. Ob es für ihn ein wirkliches Zuhause werden wird? Für ihn und Cornelia?
Gedankenvoll legt er seinen Arm um ihre Schulter. »Ab morgen werde ich nur zu den Mahlzeiten heimkommen. Wirst du dich allein zurechtfinden?«
»Sind deine Pläne schon fertig?«
»Ja! Sie waren schon fertig, als ich dich hierherbrachte, liebes Kind. So ganz ins Ungewisse konnte ich dich doch nicht führen. Ich wünsche wirklich sehr, daß du dich bei mir wohl fühlst. Ich weiß, es wird dir zuerst sehr schwerfallen, der Haushalt, die ungewohnte Arbeit. Doch vorläufig kann ich keine Hilfe für dich halten, nicht wahr, das siehst du ein?«
»Es ist gar nicht so schwer, Papa, glaube mir. Und etwas habe ich bei Madame Etienne doch gelernt. Ich werde alles tun, damit du zufrieden mit mir bist.«
»Liebes Kind, meine Cornelia«, sagt er so weich, wie sie ihn noch nie gehört hat. Sie glaubt das erste Mal in ihrem bisherigen Leben richtig glücklich zu sein, weil sie weiß, wie sehr sie gebraucht wird.
*
Die Zeit geht dahin. Mit ihr der Sommer. Auf der Hauptstraße ist ein neuer Modesalon eröffnet. In großen Buchstaben steht darüber:
»Salon Christian«.
Er ist äußerst modern eingerichtet. Man sieht sofort, daß nicht gespart worden ist.
Stefanie Hermann hat zur Eröffnung Einladungen an alle Bekannten verschickt, und sie sind alle gekommen, teils aus Neugier, teils aus alter Anhänglichkeit.
Christian spielt den Chef. Er küßt die Hände der Damen, macht Komplimente am laufenden Band und fühlt sich ganz in seinem Element.
Christiane, mit ihrem verwuschelten Haarschopf, den feuchtglänzenden Augen, in ein bauschiges kleines Abendkleid gehüllt, bewegt sich wie eine kleine Prinzessin zwischen den geladenen Gästen.
Alles scheint eitel Glück und Sonnenschein. Auch Cornelia hat eine Einladung erhalten, und häufig gleiten Stefanies Augen zum Eingang. Wie attraktiv würde ihre schöne Tochter in diesen Räumen wirken. Es kränkt ihre Eitelkeit, daß sie gerade heute mit Cornelias seltsamer Schönheit nicht glänzen kann.
Seufzend widmet sie sich weiterhin ihren Pflichten. Sie beobachtet dabei aus den Augenwinkeln scharf Christian. Sie ist zufrieden.
Christian geht von einer Dame zur anderen. Alles Bekannte, die er häufig im Salon seiner Mutter begrüßt hat. Er verschwendet sich förmlich mit seinen im Grunde nichtssagenden Redewendungen und Komplimenten.
In hauchdünnen, kostbaren Tassen wird Mokka gereicht, dazu feines Gebäck und ein leichter Wein. Mädchen in dezenten schwarzen Kleidern tragen die Tabletts herum und kommen den Wünschen der Anwesenden flink nach.
Eine Dreimann-Kapelle spielt im Hintergrund, und ein eigens dazu engagierter Conferencier ergeht sich in witzigen Bemerkungen über das Gezeigte und noch Kommende.
»Großartig, Mama«, flüstert Christian seiner Mutter einmal zu und tupft sich die Schweißperlen von der Stirn. Er denkt an die Bestellungen, die gemacht worden sind.