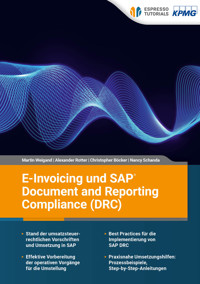
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Espresso Tutorials
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Für jedes Unternehmen wird die Umstellung auf die elektronische Rechnungsstellung – das sogenannte E-Invoicing – in den nächsten Jahren zu einer Herausforderung werden. In einigen Ländern ist sie für bestimmte Geschäftsvorgänge bereits verpflichtend, in der EU wurden Standards und Zeitpläne für ihre schrittweise allgemeine Einführung festgelegt. SAP bietet mit der Lösung Document and Reporting Compliance (DRC) ein wertvolles Werkzeug zur Umsetzung der behördlichen Vorgaben – und gleichzeitig die Chance, die Geschäftsvorgänge bei der Rechnungsverarbeitung zu standardisieren und sie so effizienter und weniger fehleranfällig zu gestalten.
Dieses Buch führt Sie sowohl in die juristische als auch in die technische Seite des E-Invoicing ein. Die Autoren geben einen Überblick über die einschlägigen Bestimmungen, und erläutern Ihnen die Bedeutung von Stammdaten und dem korrekten Umgang damit im Zusammenhang mit E-Invoicing. Sie erfahren, was SAP DRC für Sie leisten kann. Ein Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei auf den einzelnen Schritten, die Sie zur Systemvorbereitung für den Einsatz von SAP DRC, die Implementierung und Einrichtung gehen müssen. Außerdem lernen Sie das eDocument Cockpit und andere Tools für die Verarbeitung elektronischer Dokumente kennen. Am Ende haben Sie den Schlüssel dazu in der Hand, Ihre Abläufe rund um die Rechnungserstellung und -verarbeitung so zu gestalten, dass Sie Fehler und Compliance-Risiken effektiv vermeiden.
- Stand der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften und Umsetzung in SAP
- Effektive Vorbereitung der operativen Vorgänge für die Umstellung
- Best Practices für die Implementierung von SAP DRC
- Praxisnahe Umsetzungshilfen: Prozessbeispiele, Step-by-Step-Anleitungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Martin Weigand, Alexander Rotter, Christopher Böcker, Nancy Schanda
E-Invoicing und SAP® Document and Reporting Compliance (DRC)
Martin Weigand, Alexander Rotter, Christopher Böcker, Nancy Schanda E-Invoicing und SAP® Document and Reporting Compliance (DRC)
ISBN:978-3-960124-76-4 (E-Book)
Lektorat:Bernhard Edlmann, Sarah Trenca
Korrektorat:Sarah Trenca, Bernhard Edlmann, Johann-Christian Hanke
Coverdesign:Philip Esch, Olesia Donchenko
Coverfoto:© iStockphoto.com | innni No. 1475714756
Satz & Layout:Johann-Christian Hanke
Alle Rechte vorbehalten
1. Aufl. 2025
© Espresso Tutorials GmbH, Gleichen 2025
URL:www.espresso-tutorials.de
Das vorliegende Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und der Vervielfältigung. Espresso Tutorials GmbH, Bahnhofstr. 2, 37130 Gleichen, Deutschland.
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text und Abbildungen verwendet wurde, können weder der Verlag noch Autoren oder Herausgeber für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Feedback:Wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen jeglicher Art. Bitte senden Sie diese an: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Willkommen bei Espresso Tutorials!
Unser Ziel ist es, SAP-Wissen wie einen Espresso zu servieren: Auf das Wesentliche verdichtete Informationen anstelle langatmiger Kompendien – für ein effektives Lernen an konkreten Fallbeispielen. Viele unserer Bücher enthalten zusätzlich Videos, mit denen Sie Schritt für Schritt die vermittelten Inhalte nachvollziehen können. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal mit einer umfangreichen Auswahl frei zugänglicher Videos: https://www.youtube.com/user/EspressoTutorials.
Kennen Sie schon unser Forum? Hier erhalten Sie stets aktuelle Informationen zu Entwicklungen der SAP-Software, Hilfe zu Ihren Fragen und die Gelegenheit, mit anderen Anwendern zu diskutieren: https://forum.espresso-tutorials.com/.
Eine Auswahl weiterer Bücher von Espresso Tutorials:
Janet Salmon:
Schnelleinstieg in SAP S/4HANA
®
Finance
– 2., erweiterte Auflage
Karlheinz Weber, Christine Frühwirth:
Praxishandbuch Kreditorenbuchhaltung in SAP S/4HANA
®
Marc Müller:
Praxishandbuch SAP
®
-Zahllauf
– 2., erweiterte Auflage
Christoph Theis, Stefan Eifler:
Werteflüsse in die SAP
®
-Ergebnisrechnung (CO-PA) unter S/4HANA
®
Heinz Hesse, Renata Munzel:
SAP S/4HANA
®
– Customizing fü
r die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Prof. Dr. Peter Preuss, Martin Schmidt:
Konzernreporting mit SAP S/4HANA
®
Finance for Group Reporting
Vorwort
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung steht die elektronische Rechnungsstellung – das sogenannte E-Invoicing – im Zentrum einer umfassenden Transformation von Wirtschaft und Verwaltung. Mit dem E-Rechnungsgesetz und der E-Rechnungsverordnung wurden 2017 die ersten verbindlichen Regelungen hierzu geschaffen. Ziel ist es, durch die Einführung der E-Rechnung und eines darauf aufbauenden transaktionsbasierten Meldesystems mittelfristig die Effizienz und Transparenz im Rechnungswesen zu steigern und den Mehrwertsteuerbetrug wirksam zu bekämpfen.
Mit SAP Document and Reporting Compliance (DRC) steht Unternehmen ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, um die komplexen Anforderungen der E-Rechnungspflicht und der steuerlichen Meldungen effizient umzusetzen.
Das vorliegende Werk beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Einführung der E-Rechnungspflicht und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Automatisierung von Rechnungsdatenextraktion, -verarbeitung und -erstellung sowie dem Zusammenspiel zwischen den im SAP ERP-System vorliegenden Daten und deren Nutzung in SAP DRC zur effizienten und gesetzeskonformen Rechnungsstellung und richtet sich damit insbesondere an Mitarbeitende im Finance-Bereich.
Ziel ist es, Sie auf die anstehenden Veränderungen vorzubereiten und Ihnen praxisnahe Lösungsansätze für eine erfolgreiche Umsetzung von E-Invoicing mit SAP DRC sowie für die optimale Nutzung der im SAP ERP-System vorhandenen Daten an die Hand zu geben.
Auf einen speziellen Punkt möchten wir dabei besonders intensiv eingehen: auf die Anforderungen an das SAP-System, um die Funktionen von SAP DRC nutzbar zu machen. Dass wir darauf so großen Wert legen, hat zwei Gründe: Zum einen lassen sich so die länderspezifisch zu implementierenden SAP-Hinweise in den allermeisten Fällen drastisch verringern. Zum anderen gibt es durchaus schon Anleitungen zu einer länderspezifischen Umsetzung der E-Rechnung in SAP DRC – dort finden aber die angedeuteten Anforderungen an das System allenfalls nebensächlich Erwähnung. Diese Lücke möchte dieses Buch füllen.
Im Text verwenden wir Kästen, um wichtige Informationen besonders hervorzuheben. Jeder Kasten ist zusätzlich mit einem Piktogramm versehen, das diesen genauer klassifiziert:
Hinweis
Hinweise bieten praktische Tipps zum Umgang mit dem jeweiligen Thema.
Beispiel
Beispiele dienen dazu, ein Thema besser zu illustrieren.
Achtung
Warnungen weisen auf mögliche Fehlerquellen oder Stolpersteine im Zusammenhang mit einem Thema hin.
Die Form der Anrede
Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, verwenden wir im vorliegenden Buch bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen zwar nur die gewohnte männliche Sprachform, meinen aber gleichermaßen Personen weiblichen und diversen Geschlechts.
Hinweis zum Urheberrecht
Zum Abschluss des Vorworts noch ein Hinweis zum Urheberrecht: Sämtliche in diesem Buch abgedruckten Screenshots unterliegen dem Copyright der SAP SE. Alle Rechte an den Screenshots hält die SAP SE. Der Einfachheit halber haben wir im Rest des Buches darauf verzichtet, dies unter jedem Screenshot gesondert auszuweisen.
1 Überblick über die Anforderungen aus steuerrechtlicher Sicht
Dieses Kapitel bietet einen kompakten Überblick über die steuerrechtlichen Anforderungen, die im Zuge der Einführung der elektronischen Rechnung auf Unternehmen in Deutschland zukommen. Wir stellen Ihnen zunächst die neuen nationalen Regelungen zur E-Rechnung vor, sodann gehen wir auf das geplante transaktionale Meldesystem und die angestrebte Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union ein. Abschließend werden die wichtigsten Rechtsquellen und praxisrelevante Hilfsmittel zur Umsetzung der E-Rechnungspflichten aufgezeigt.
1.1 Die neuen deutschen Regelungen zur E-Rechnung
Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen in der Lage sein, elektronische Rechnungen für inländische Geschäfte zwischen Unternehmen (Business-to-Business, B2B) zu empfangen. Unter einer E-Rechnung versteht der Gesetzgeber grundsätzlich eine Rechnung, welche die europäische Norm EN 16931 erfüllt und einer von zwei zulässigen sog. Syntaxen (UBL oder CII) entspricht, welche in Teil 3 der Norm detailliert dargestellt werden (siehe auch: Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 der Kommission vom 16. Oktober 2017). Nach dieser Definition liegt eine E-Rechnung nur dann vor, wenn die Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Das Format einer elektronischen Rechnung muss entweder der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung EN 16931 und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen entsprechen – oder aber sie kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden. Voraussetzung für eine solche Vereinbarung ist jedoch, dass das verwendete Format die richtige und vollständige Extraktion der nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben aus der E-Rechnung in ein Format ermöglicht, das der EN 16931 entspricht oder mit dieser interoperabel ist (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 UStG). Rechnungen, die als PDF ausgestellt und per E-Mail versendet werden, erfüllen diese Voraussetzungen daher nicht mehr.
Für Unternehmen bedeutet die Umstellung auf elektronische Rechnungen einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Effizienz: Die vollständige Automatisierung der Rechnungsprozesse – von der Datenextraktion über die Verarbeitung bis hin zur Erstellung – minimiert Fehlerquellen, beschleunigt Transaktionen und senkt Betriebskosten. Im Vergleich zu herkömmlichen, oft fehleranfälligen OCR-Lösungen sorgt das standardisierte, strukturierte Format der E-Rechnung für eine deutlich höhere Datengenauigkeit und Zuverlässigkeit.
Auch im Kampf gegen Mehrwertsteuerbetrug nimmt die elektronische Rechnungsstellung eine zentrale Rolle ein: Innerhalb der Europäischen Union wurde für das Jahr 2020 eine Mehrwertsteuerlücke von 93 Milliarden Euro geschätzt, wovon mehr als 10 Milliarden Euro auf Deutschland entfallen. In Italien konnte diese Lücke nach Einführung der elektronischen Rechnungsstellung um geschätzte 2,2 bis 2,6 Milliarden Euro reduziert werden. Deutschland verfolgt das Ziel, diesen Erfolg zu wiederholen, indem durch die E-Rechnung und das später darauf aufsetzende elektronische Meldesystem eine genaue Steuerberichterstattung ermöglicht und die Einhaltung der Steuervorschriften konsequent sichergestellt wird. Dies soll nicht nur den Steuerbetrug eindämmen, sondern auch den fairen Wettbewerb fördern. Die Einführung der E-Rechnungspflicht in Deutschland wird in drei aufeinanderfolgenden Schritten stattfinden, die Unternehmen ausreichend Zeit zur Anpassung an die neuen Anforderungen geben.
Mit dem 1. Januar 2025 hat die Umstellung mit einem sogenannten »Soft Start« begonnen: Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind und am Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (Business-to-Business, B2B) teilnehmen, müssen seit diesem Zeitpunkt in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Die Verpflichtung zur Ausstellung und zum Versand von E-Rechnungen besteht aktuell jedoch noch nicht. Bis einschließlich 31. Dezember 2026 dürfen weiterhin Papierrechnungen ohne Zustimmung des Empfängers versendet werden. Mit Zustimmung des Empfängers können auch andere elektronische Formate, wie etwa PDF-Dateien, verwendet werden. Das bedeutet: E-Rechnungen und Papierrechnungen dürfen ohne Zustimmung des Empfängers verschickt werden, während für alle anderen Rechnungsformate die Zustimmung des Empfängers erforderlich ist.
Der zweite Schritt folgt ab dem 1. Januar 2027: Nun sind Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 Euro verpflichtet, für inländische B2B-Transaktionen elektronische Rechnungen auszustellen und zu versenden. Kleinere Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 Euro erhalten eine verlängerte Übergangsfrist und dürfen bis zum 31. Dezember 2027 weiterhin Papierrechnungen oder andere nicht EN-16931-konforme Formate nutzen. Darüber hinaus bestehen Ausnahmen für umsatzsteuerbefreite Transaktionen, Fahrkarten sowie vereinfachte Rechnungen bis zu einem Betrag von 250 Euro.
Ab dem 1. Januar 2028 tritt die dritte Stufe in Kraft: Die Pflicht zur Ausstellung und zum Versand von E-Rechnungen gilt nun für alle Unternehmen im B2B-Bereich, mit Ausnahme von Kleinunternehmern. Das im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses häufig diskutierte Electronic-Data-Interchange(EDI)-Verfahren bleibt auch über 2028 hinaus zulässig, sofern aus der im Rahmen des EDI-Verfahrens erzeugten Rechnung ein Meldedatensatz gemäß den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes korrekt, vollständig und ohne Informationsverlust extrahiert werden kann.
Die Regelungen zur verpflichtenden E-Rechnung gelten nur, wenn überhaupt eine umsatzsteuerliche Pflicht zur Ausstellung einer Rechnung besteht. Daher gelten die Regelungen nicht bei Rechnungen an umsatzsteuerliche Nichtunternehmer, insbesondere an Endverbraucher (sogenannte B2C-Umsätze), und für steuerfreie Umsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen (nach § 4 Nummer 8 bis 29 UStG, z.B. steuerfreie Finanzdienstleistungen, steuerfreie Grundstücksvermietungen etc.).
In diesen Fällen ist die Ausstellung einer Rechnung aus umsatzsteuerlicher Sicht freiwillig.
Selbst wenn eine umsatzsteuerliche Pflicht zur Rechnungsausstellung besteht, gibt es bestimmte Ausnahmen, bei denen keine elektronische Rechnung erforderlich ist. So können beispielsweise bei Kleinbetragsrechnungen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 250 Euro (gemäß § 33 UStDV), bei Fahrausweisen, die als Rechnungen anerkannt werden (§ 34 UStDV) sowie bei Rechnungen von Kleinunternehmern (§ 34a UStDV) weiterhin alternative Formate wie Papier- oder PDF-Rechnungen verwendet werden.
Gleiches gilt für Leistungen an juristische Personen, die nicht als Unternehmer auftreten – etwa nicht unternehmerisch tätige Vereine oder staatliche Einrichtungen – sowie für bestimmte Leistungen an Privatpersonen im Zusammenhang mit Grundstücken. In diesen Fällen ist es zulässig, eine sogenannte sonstige Rechnung auszustellen, also eine Rechnung, die nicht den Anforderungen an eine elektronische Rechnung entspricht.
Zu beachten ist außerdem, dass Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (Business-to-Government, B2G) grundsätzlich nicht unter die neuen umsatzsteuerlichen Vorschriften zur verpflichtenden E-Rechnung fallen, es sei denn, die öffentliche Verwaltung agiert als umsatzsteuerlicher Unternehmer. Unabhängig davon besteht für Lieferanten und Dienstleister bereits seit dem 27. November 2020 auf Basis der E-Rechnungsverordnung (E-RechV) die Pflicht, elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber des Bundes zu übermitteln. Diese Vorgaben für den Bereich B2G gelten parallel zu den neuen Regelungen für den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B) und sind entsprechend zu berücksichtigen.
Für die Ausstellung elektronischer Rechnungen ist die Einhaltung technischer Standards, wie der europäischen Norm EN 16931, erforderlich. Bei sonstigen Rechnungsformaten entfällt diese Anforderung.
Die Regelungen für den B2B-Bereich gelten für im Inland ansässige umsatzsteuerliche Unternehmer. Als Unternehmer gilt, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt (§ 2 UStG). Darunter fallen z.B. auch Freiberufler oder Personen, die selbst ausschließlich steuerfreie Umsätze erbringen, wie etwa Ärzte oder Vermieter von Wohnungen.
Umsätze zwischen im Inland ansässigen Unternehmern liegen vor, wenn sowohl der leistende Unternehmer als auch der Leistungsempfänger im Inland oder in Gebieten ansässig sind, die gemäß § 1 Absatz 3 UStG gleich wie Gebiete im Inland behandelt werden. Grenzüberschreitende Warenbewegungen und Leistungen können somit unter deutsches E-Invoicing fallen, wenn beide Vertragspartner in Deutschland ansässig sind.
Diese Fallkonstellationen müssen von der systemtechnischen Lösung der Unternehmen erkannt werden können. Hierzu sind Geschäftspartnerstammdaten und konkrete Transaktionsdaten im System heranzuziehen. Bei den Geschäftspartnerstammdaten ist die »Ansässigkeit« ein entscheidendes Merkmal. Diese kann über die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder z.B. die neu vergebene Wirtschaftsidentifikationsnummer abgeleitet werden.
Im Hinblick auf das Format ist festzuhalten, dass die in Deutschland üblichen Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0.1 (mit Ausnahme der Profile MINIMUM und BASIC WL) der oben genannten europäischen Norm EN 16931 entsprechen und somit die umsatzsteuerlichen Voraussetzungen für eine E-Rechnung erfüllen.
Dabei handelt es sich bei der XRechnung um ein strukturiertes XML-Format, das die Anforderungen der EU-Richtlinie für elektronische Rechnungen im öffentlichen Auftragswesen erfüllt und umsatzsteuerrechtlich die Pflichtangaben gemäß UStG vollständig maschinenlesbar bereitstellt.
Bei ZUGFeRD wird ein menschenlesbares PDF/A-3-Dokument mit einer eingebetteten XML-Datei (Hybridformat) kombiniert. Dies kann außer im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung auch im B2B-Bereich genutzt werden; umsatzsteuerliche Pflichtangaben sind ebenfalls enthalten, jedoch liegt der technische Fokus auf der gleichzeitigen Nutzung durch Mensch und Maschine.
Auch ausländische Rechnungsformate sind in Deutschland zulässig, sofern sie mit der EN 16931 konform gehen, beispielsweise die sog. Peppol-BIS-Rechnung. Die Empfangsfähigkeit der technischen Lösung ist mithin im Hinblick auf alle zulässigen Formate sicherzustellen und nicht nur in Bezug auf die deutschen Formate XRechnung und ZUGFeRD.
Außerdem kann das Format einer E-Rechnung auch zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden und somit von der europäischen Norm EN 16931 abweichen. Voraussetzung für eine solche Vereinbarung ist allerdings, dass das verwendete Format die richtige und vollständige Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der E-Rechnung ermöglicht (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 UStG). Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, können dadurch z.B. EDI-Verfahren unter der Nutzung anderer Rechnungsformate (z.B. EDIFACT) weiter für den Austausch von E-Rechnungen genutzt werden.
Im Hinblick auf den Inhalt der elektronischen Rechnung ist zu beachten, dass diese im strukturierten Teil alle Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG enthalten muss; ergänzende Angaben können in einen Anhang (z.B. PDF-Anhang) aufgenommen werden. Bei den Pflichtangaben handelt es sich u.a. um:
den vollständigen Namen und die Anschrift von Leistungserbringer und Leistungsempfänger,
die Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers,
das Ausstellungsdatum,
eine fortlaufende Rechnungsnummer,
die Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände bzw. Art und Umfang der Leistung,
oder auch den Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung (oder der Vereinnahmung des Entgelts bei Vorauszahlungen),
das Nettoentgelt, den Steuersatz und den Steuerbetrag je Steuersatz sowie ggf. die Steuerbefreiung mit Rechtsgrundlage sowie
im Voraus vereinbarte Minderungen des Entgelts (z.B. Skonti, Boni, Rabatte), sofern nicht bereits im Entgelt berücksichtigt, und
den Hinweis auf Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge) oder Sonderregelungen nach § 14a UStG, falls einschlägig.





























