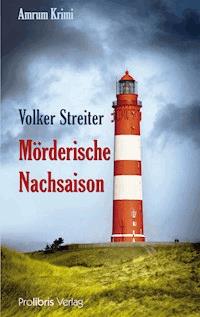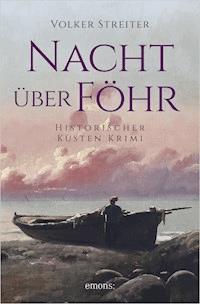Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer Küstenkrimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eiderstedt 1846: Dina Martensen soll nach dem Verbleib einer jungen Milchmagd forschen, von der jede Spur fehlt. Die Gendarmerie nimmt den Fall zunächst nicht ernst, doch dann wird eine Frauenleiche in der Marsch gefunden, gefesselt und geschändet. Ist die Tote die Vermisste? Als wenig später ein Knecht vergraben im Deich entdeckt wird, beginnt für Dina ein Wettlauf gegen die Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Streiter, geboren im westfälischen Soest, kam nach der Polizeiausbildung nach Köln und ließ sich dort nieder. Als Polizist streifte er durch Trabantenstädte wie Millionärshäuser, war Einsatztrainer und ist Teil der »Stadtteilpolizei«. In seiner Freizeit lässt er aus Spaß am Schreiben und der Faszination für die Natur in schönen Gegenden morden.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: privat Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Susanne Bartel eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-008-9 Historischer Küsten Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter
Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und wovor mir graute, hat mich getroffen.
Hiob 3,25
PERSONENVERZEICHNIS
Amrum
Dina Martensen– Amrumer Deern, ermittelt heimlich
Immke Simons– vermisste Magd vom Ehsterhof
Auguste und Hinrich Simons– Immkes Eltern und Dorfwirtspaar
Pastor Mechlenburg– historische Person, Inselpfarrer, 1799–1875
Husum
Hans Theodor Woldsen Storm– historische Person, Schriftsteller, 1817–1888
St.Peter
Pastor Wolf und Familie– historische Personen gemäß Volkszählungsliste von 1845
Anna Heller– historische Person, Dienstbotin beim Pastor
Edlef Gerkens– historische Person, Knecht beim Pastor
Knochenhans– Totengräber, Schreiner, Händler
Ording
Bernhard Albert Rose– Dorflehrer
Catharina und Heinrich Jansen– Eltern der Thea Jansen
Caroline und Titus Heller– Eltern der Anna Heller
Tönning
Hans Thomsen– historische Person, Physikus/Amtsarzt, 1810–1888
Dähnhardt– historische Person, Vorname unbekannt, Bürgermeister von 1844–1847
Garding
Staller Justizrat Johann Gottlieb Ingwersen– historische Person, seit 1828 Amtmann auf Eiderstedt, 1794–1885
Cornelius Asmus– Leutnant der Gendarmerie
Schwarzer Hof
Friedrich Besthorn und Gattin Amalie– Viehbauern
Adam Kummerwie– Viehhändler und Besthorns Schwiegervater
Jans Gosch und Sohn Claus– Handlanger
Sinnert Runge– Knecht
Ehsterhof
Julius Hirsch und Gattin Luise– Viehbauern
Hedwig– Magd
Antje– Milchmagd
Vierfinger-Focke– Knecht
Wilko
GOLDENES HAAR
Die Uhr der Laurentiuskirche schlug mit kaltem, stumpfem Ton zwölf, als der Junge das Geschäft betrat. Eine goldblonde Haarsträhne sah aus dem fleckigen Tuchbündel in seiner Hand hervor. Zögernd setzte er seine schmutzstarrenden Füße auf die Fliesen und ging auf die Ladentheke zu. Sein Blick fiel auf Seidenbänder, geschmückte Damenhüte und -hauben. Hier und da ergänzten elegant gelockte Haarteile die Kopfbedeckungen. Bald stand er einer ältlichen Dame gegenüber, die auf ihn herabsah.
Trotz der sommerlichen Temperaturen trug sie ein hochgeschlossenes Kleid. Sie presste ihre farblosen Lippen aufeinander, rümpfte die Nase und rieb ihre von unzähligen verheilten Nadelstichen verhärteten Fingerspitzen aneinander, dann schaute sie prüfend von der abgerissenen Gestalt zur Tür und hinaus auf den sonnenüberfluteten Marktplatz von Tönning und klopfte energisch auf die Theke. »Nun, was bringst du mir? Du kannst von Glück sagen, dass ich gerade keine Kundin habe, sonst hätte ich dich hinausgejagt. So unappetitlich, wie du aussiehst.«
Zaghaft legte der Junge sein Bündel ab und trat einen Schritt zurück. Seine Augen verfolgten jede Regung der Frau.
Die Putzmacherin zog mit spitzen Fingern das Stoffbündel auseinander, griff dann aber mit einem Lächeln in das volle, schimmernde Haar, das sie vor sich ausbreitete. »Daraus könnte man was Schönes machen«, lobte sie, fuhr durch die langen Strähnen und hielt sie ins Licht. »Wo hast du das her?«
»Von meiner Schwester.« Der Junge blickte zu Boden. »Vater sagt, wir brauchen das Geld. Die Kartoffelpest hat die ganze Ernte vernichtet.«
Die Dame nickte. »Davon hab ich gehört. Und wie heißt deine Schwester?« Sie stutzte und strich über eine Strähne, die rötlich befleckt war. »Mir scheint, das Haar ist nicht ganz sauber. Das hier ist getrocknetes Blut.«
Der Junge riss die Augen auf und blickte auf das Haar. »Sie hat sich gestoßen«, platzte es aus ihm heraus, dann hielt er inne und überlegte kurz. »Die Anna hat sich an einem Türbalken böse wehgetan«, setzte er hastig nach, trat entschlossen an die Theke und hielt der Dame seine kindlich schmale, aber schon zerfurchte Hand hin. »Wie viel bekommen wir dafür?«
»Soso, gestoßen«, wiederholte die Geschäftsfrau und zuckte die Achseln. »Was man mir hier alles für Geschichten auftischt. Aber nun gut. Die Länge ist ordentlich, der Perückenmacher wird damit arbeiten können. Trotzdem ist das Haar schmutzig.« Sie legte die blonden Strähnen auf die Theke, öffnete ihre Registrierkasse und entnahm ihr einige Schillinge. »Mehr darfst du nicht erwarten.« Einzeln zählte sie dem Jungen die Münzen in die Hand. »Wenn du das nächste Mal mit sauberem Haar kommst, kann ich dir etwas mehr geben. Aber du hast immer noch nicht verraten, woher du bist.«
Der Junge hielt das Geld umklammert und sprang zur Tür. »Wir sind aus St.Peter, ganz nahe vom Deich.« Damit lief er aus dem Geschäft und von der hohen Kirche weg, die auf dieser Seite des Platzes stand. Er folgte der sandigen Straße, als eine Gestalt aus einem der Hauseingänge hervorschoss und ihn packte.
Es war ein mittelgroß gewachsener Mann von hagerer Statur. Sein Gesicht war mit kleinen Narben überzogen. »Gib schon her!«, herrschte er den Jungen an, griff nach seinen Händen und bog die Finger auf. »Was hat sie dir gegeben?«
»Das ist alles, was ich bekommen habe«, stammelte der Knabe und hielt dem Mann das Geld hin. »Weil Blut dran war. Die Madame hat gesagt, wenn es beim nächsten Mal sauber ist, kann sie mir auch mehr geben.« Mit eingezogenem Kopf starrte der Junge den Mann ängstlich an, der nach den Münzen griff und sie in eine Tasche seiner abgetragenen Weste steckte.
Knurrend stieß der das Kind weg und hob seine Kappe, um sich durch die fettigen Haare zu fahren. »Soso«, brummte er, »hat die feine Dame also das bisschen Blut gestört? Und beim nächsten Mal zahlt sie mehr, wenn es sauber ist?«
Der Junge nickte heftig.
BEUNRUHIGENDER BRIEF
Erste Sonnenstrahlen vertrieben den feuchten Dunst, der über der nordfriesischen Insel Amrum lag. Ein leichter Wind wirbelte das Herbstlaub durch den Garten des reetgedeckten Hauses. Dina Martensen, die ihre Ziegen und die einzige Kuh gemolken hatte, trat aus dem angrenzenden Stall, stellte beide Eimer ab und zog hinter sich die Tür zu. Zufrieden blinzelte sie in die Sonne und sog die frische Meeresluft ein. Es schien ein schöner Herbsttag zu werden.
Die strohblonde, gerade gewachsene Friesin war in ihrem neunundzwanzigsten Jahr. Unter einer bestickten Haube lugten einige Haarsträhnen hervor, über ihrem Hauskleid trug sie eine Schürze. Die Schultern bedeckte ein über der Brust gekreuztes Tuch, die Füße steckten in Holzschuhen.
In einem Monat würde ihr Bruder wieder für wenige Wochen sein Schiff verlassen und durch die Gässchen von Nebel streifen, seinem Heimatdorf. In seiner Abwesenheit führte sie die Hauswirtschaft, besorgte die Ernte und versorgte das Vieh. Solange die Geschwister unverheiratet waren, behalfen sie sich mit diesem zufriedenstellenden Arrangement. Ohnehin war Amrum in der meisten Zeit des Jahres eine Fraueninsel, da die Männer monatelang auf See waren. Sie verdingten sich als Matrose, Steuermann oder Kapitän oder fuhren als Robbenschläger in den Norden. Dinas Bruder steuerte die »Apollo«, eigentlich ein Frachtschiff, deren jährliche Fahrten mit den aufziehenden Herbst- und Winterstürmen endeten. Erst im Spätwinter stach die »Apollo« wieder gen Grönland in See. Im ewigen Eis wurden Robben erschlagen, Felle und Tran der Tiere waren begehrt. Zuvor hatte jahrhundertelang der Walfang der Insel zu Reichtum verholfen. Doch seit den Bedrückungen des Napoleonischen Krieges und der damit verbundenen Kontinentalsperre war das einträgliche Geschäft für die Amrumer Seeleute Vergangenheit. Seit gut vierzig Jahren suchten sie ihr Glück nun schon anderweitig.
Dina freute sich auf ihren Bruder und die schönen, fremden Dinge, die er ihr jedes Mal aus den Häfen der Welt mitbrachte. Aber mehr noch genoss sie seine Geschichten, die er zu erzählen wusste. Doch bis Boy Jonas wieder zu Hause sein würde, hielten Haus und Land sie zur Arbeit an.
Sie wollte die Milcheimer in die Küche schleppen, da sie laut ihren Namen hörte. Von der Dorfstraße her winkte eine füllige Frau. Sie trug ein Kleid aus grobem Stoff und schien sich ihr Kopftuch schnell übergeworfen zu haben. Für den frischen Wind war sie nicht ausreichend bekleidet und wirkte, als habe sie überhastet das Haus verlassen. In der Hand hielt sie einen Brief.
Dina erkannte sogleich Auguste, die mit dem Wirt des Norddorfer Dorfkrugs verheiratet war. Sie wird doch wohl nicht den ganzen Weg hierher gelaufen sein, nur um mir die Post zu bringen?, dachte sie.
Ohne zu zögern kam die Besucherin auf sie zu.
Dina blickte in das wettergegerbte Gesicht der Frau, sah, wie sich deren Augen mit Tränen füllten, und hörte das Beben in der Stimme, als Auguste sprach.
»Dina, ach, Dina, wir haben eine schreckliche Nachricht erhalten und sind in großer Sorge. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir helfen soll. Hinrich meint, wir sollten den Strandvogt um Hilfe bitten, aber ich glaube nicht daran, dass die Herrschaft sich ernstlich um solche wie uns sorgt. Und ich weiß ja, dass du…«
Dina legte ihre Hände auf die Schultern der aufgeregten Frau und sah sie mitfühlend an. Der Brief war also nicht für sie. »Moin, Auguste! Du bist ja ganz durcheinander. Komm erst mal rein und wärm dich auf. Und dann erzählst du mir die Geschichte von Anfang an, damit ich auch verstehe, worum es geht.« Sie griff die Milcheimer und trug sie durch den Flur in die nach hinten gelegene Küche. »Geh schon mal in die Stube!«, rief sie Auguste zu und schürte das Feuer auf der Herdstelle. Nachdem sie einige vertrocknete Heidepflanzen und Strandholz nachgelegt hatte, warfen die tanzenden Flammen ihr Licht auf Eisenpfannen und irdene Tiegel. Die gusseiserne Takenplatte des Herdes würde die Wärme schnell aufnehmen und den hinter der Küche liegenden Raum erwärmen.
Gespannt trat Dina in die Stube und sah sich prüfend um. Das glänzende Messingpendel der Wanduhr schwenkte gemächlich hin und her, und die blau-weißen Delfter Kacheln waren frei von Staub. Die taubenblaue Tür zu ihrem Alkoven war geschlossen, das Bettzeug dahinter nicht zu sehen. Wie schnell war man unter den Hausfrauen der Insel als liederlich verschrien, wenn Ordnung und Sauberkeit im Haushalt zu wünschen übrig ließen. Doch trotz des überraschenden Besuches schien sie diesem Urteil entkommen zu sein. Beruhigt atmete sie auf und wies auf einen der Stühle, die am Tisch nahe dem Fenster standen.
Auguste legte ihr Kopftuch ab, setzte sich unsicher und schob Dina schluchzend den Brief zu. Schnell zückte sie ein mit nur wenig Spitze besetztes Taschentüchlein aus ihrem Ärmel, trocknete ihre Tränen und schnäuzte sich. »Der Postläufer hat ihn gestern gebracht. Er muss schon einige Tage auf der Post in Wyk auf Föhr gelegen haben.«
Der Brief war ein grobes Stück Papier, gefaltet und zuvor mit etwas Wachs verschlossen gewesen. »Hinrich Simons, Dorfkrug Norddorf auf Amrum«, stand dort mit Bleistift in einer Schrift aus akkuraten Spitzen und Bögen geschrieben.
Dina drehte den Brief herum. »Von wem ist er?«, wollte sie wissen.
»Von Anna Heller, Hinrichs Nichte. Sie arbeitet als Magd beim Pastor von St.Peter auf der Halbinsel Eiderstedt. Ihre Familie lebt nicht weit davon in Ording. Einfache Leute. Anna schreibt, sie habe unsere Tochter Immke nun schon…« Wieder schluchzte die Wirtsfrau auf und wies auf den Brief. »Lies doch selbst.«
Dina konzentrierte sich auf die Zeilen.
St.Peter, den 21.September 1846
Lieber Onkel, liebe Tante,
ich hoffe, Ihr seid wohlauf. Es ist viel Zeit vergangen, seitdem ich Euch das letzte Mal geschrieben habe. Das war wohl, da Ihr um einen Verding für Eure Tochter, meine liebe Cousine Immke, nachgefragt hattet. Damals konnte ich dank der Hilfe unseres Pastors Wolf ganz in der Nähe von St.Peter eine Stelle für sie finden. Nun bete ich zu Gott, dass ihr dort kein Unbill widerfahren und sie wohlauf ist. Denn, lieber Onkel, liebe Tante, es schmerzt mich ungeheuer, das zu berichten, aber das letzte Mal, da ich Immke sah, war am 19.August dieses Jahres auf dem Tönninger Pferdemarkt, der für das Gesinde der Gegend immer eine schöne Gelegenheit zum lustigen Beisammensein ist. Das nächste Mal, da ich sie hätte sehen sollen, wäre in der dritten Septemberwoche gewesen, wenn man dort den Viehmarkt abhält. Doch habe ich vergeblich auf sie gewartet, und überhaupt scheint sie wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Leute vom Hof waren ratlos, als ich sie um Immkes Verbleib befragte. Sie sagten, auch sie hätten meine liebe Cousine zuletzt beim Tönninger Pferdemarkt gesehen. Danach sei ihre Schlafstatt von einem Tag auf den andern leer gewesen, von ihr fehle jede Spur. Allein eins ihrer schönsten Kleider hatte sie einer anderen Magd geliehen, das sollte wohl noch da sein. Es ist das grün-rot gestreifte mit der grünen Weste. Der Bauer habe nach ihrem Verschwinden nur die Schultern gezuckt und sich nicht weiter um ihren Verbleib geschert. Vermutungen gibt es, dass ihr die Arbeit nicht mehr gefallen und sie sich davongestohlen habe. Aber das kann ich nun gar nicht glauben, war sie doch immer wohlgemut und verrichtete ihr Tagwerk gerne.
Ich mache mir gehörige Sorgen, ja, Vorwürfe sogar, und bin außerordentlich ratlos, was mit ihr geschehen ist. Nun schreibe ich in der Hoffnung, dass Immke sich zu Euch begeben hat. Bitte erlöst mich und gebt mir umgehend eine, wie ich zu hoffen wage, gute Nachricht. Sollte, was Gott verhindern möge, meine liebe Cousine weiterhin verschollen bleiben, so schreibt mir, was ich zu tun habe. Soll ich mich an die hiesigen Autoritäten wenden? In großer Ungeduld erwarte ich eine Antwort und grüße Euch sorgenvoll.
Eure Anna
Nachdenklich faltete Dina das Papier zusammen, den Blick auf die Tischplatte gerichtet. Erst als sie der besorgten Mutter den Brief zurückgab, sah sie in deren Augen. Angst lag darin, aber auch so etwas wie eine flehende Bitte. »Das sind wirklich keine guten Neuigkeiten, Auguste. Wo kann deine Tochter nur sein? Warum ist sie nicht mehr bei ihrer Arbeit?«
Die Dorfkrugwirtin hob wimmernd die Schultern und brachte kein Wort heraus.
Dina atmete tief durch und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Was also denkst du, was ich für dich tun kann? Eiderstedt ist weit, ich wüsste niemanden, den ich dort um Hilfe bitten könnte. Am besten zeigst du Pastor und Amtmann an, dass du deine Tochter vermisst, und drängst auf obrigkeitlichen Beistand. Es kann nicht angehen, dass eine junge Frau über Nacht spurlos vom Angesicht der Erde verschwindet.«
Bei diesen Worten bedeckte Auguste ihr tränennasses Gesicht mit den Händen und wimmerte noch lauter. »Aber der Hinrich und ich«, schluchzte sie, »wollen mehr tun, als nur einen Brief aufsetzen. Wir waren so froh, dass unsere Immke auf dem großen Milchhof im Eiderstedter Land eine Stellung gefunden hatte. Und es war so tröstlich, zu wissen, dass ihre Cousine ganz in der Nähe war. So war sie in der Fremde doch nicht allein. Leider hat sie uns nur selten von sich berichtet, das Schreiben liegt ihr wenig. Bisher war das ja auch nicht nötig.Und Anna, diese treffliche Deern, ist erst zwanzig Jahre alt. Wir wollen ihr nicht noch mehr zusetzen, als ihre Sorgen es ohnehin schon tun.« Sie wischte sich mit dem Handrücken die Augen trocken, betupfte mit ihrem Tüchlein das Gesicht und räusperte sich. »Hinrich meinte, jemand solle vor Ort nach dem Rechten sehen. Jemand, dem wir vertrauen und der etwas Mut mitbringt.«
Dina schwante bereits, was jetzt kommen würde, und richtete sich auf ihrem Stuhl kerzengerade auf.
»Wir bitten dich, nach unserer Tochter zu suchen«, sagte die besorgte Mutter nun in einem sehr viel entschiedeneren Ton als zuvor. »Nachdem du im vergangenen Jahr so klug und mutig geholfen hast, den Tod des armen Postläufers aufzuklären, kam uns dein Name in den Sinn. Einerseits ist so etwas keine Sache für uns Frauen, doch andererseits werden unsere Fähigkeiten allzu häufig unterschätzt, nicht wahr? Geht ein Mann umher und stellt Fragen, misstraut man ihm schnell. Dem weiblichen Geschlecht dagegen wird man wohl eher eine schwatzhafte und neugierige Natur unterstellen. Lästig, aber harmlos. Für die Zeit deiner Abwesenheit würde einer unserer Hausknechte die Sorge für dein Vieh übernehmen.« Beherzt griff Auguste mit ihren fleischigen Händen nach Dinas Arm und drückte ihn kräftig. »Du musst uns helfen!«, rief sie.
Dina bedauerte die Verzweiflung der Frau, noch mehr aber setzte ihr die Heftigkeit zu, mit der sie sie bedrängte. Immerhin galt es, in einem unbekannten Landstrich und unter fremden Menschen nach der vermissten Amrumerin zu suchen. Im vergangenen Jahr hatte die Jagd nach einem Mörder ihr Tage voller Spannung beschert, sie aber auch in Lebensgefahr gebracht. Doch das Verschwinden der Immke Simons auf Eiderstedt war etwas anderes. Dieser Landstrich war ihr fremd, und bis auf Anna Heller, die zwanzigjährige Cousine der Verschwundenen, hätte sie dort keinen vertrauensvollen Kontakt.
Nachdenklich erhob sich Dina, schritt zur Anrichte und entnahm ihr zwei Likörgläser, die sie vor die erstaunte Auguste stellte. Ohne sich weiter zu erklären, verließ sie die Stube und holte aus der Speisekammer neben der Küche eine Flasche Rum. Im Kopf ging sie dabei die Arbeiten durch, die im Garten, auf dem Feld und im Stall noch zu erledigen waren, bevor der Winter kam: Ein Teil des Obstes musste gepflückt und eingemacht werden, ein halber Kartoffelacker war noch abzuernten.
Zurück in der Stube füllte Dina die Gläser mit dem süßlich riechenden Alkohol und schob eins davon vor ihre Besucherin. Als beide Frauen anstießen, fiel ein Strahl der Herbstsonne durch das Fenster und ließ den Rum in warmen Goldtönen funkeln.
ABGETRAGENES ZEUG
Abseits vom belebten Eiderhafen, am nordöstlichen Stadtrand von Tönning, drängten sich windschiefe Katen aneinander. Rinnsale durchzogen die morastigen Gassen. Hier wohnten Tagelöhner und Matrosen mit ihren Familien, aber auch das Kleingewerbe fand sein Auskommen: Kesselflicker, Spengler, Schneider, Flickschuster und Leineweber. Vereinzelt saßen neben den Eingängen Frauen auf Bänken und lasen mit ihren krummen, geschundenen Händen Erbsen aus. Schmuddelige Kinder, denen es sichtbar an Nahrung mangelte, spielten zwischen den Häusern. Das milchige Herbstlicht tauchte die Szenerie in Trostlosigkeit.
Der hagere Mann, der durch den Morast schritt, trug unter dem Arm seiner abgewetzten braunen Jacke ein Kleiderbündel. Sein Gesicht war narbig, seine dunkle Kniebundhose fleckig. Müde und in leicht gebeugter Haltung sah er die Reihe der Katen entlang, als suche er etwas. Die wenigen Menschen in der Gasse nahmen von dem groben Kerl kaum Notiz. In einer Hafenstadt wie Tönning waren sie fremdes Volk gewohnt und scherten sich nicht um dessen Kommen und Gehen. Der Mann blieb vor der Tür eines niedrigen Hauses stehen. Neben dem Eingang hingen einige Schürzen und Hosen zum Verkauf. Er blickte kurz die Gasse entlang, duckte sich dann schnell und trat ein. Muffiger Geruch schlug ihm entgegen. Er entstieg den Haufen getragener Kleidungsstücke, die im dunklen Flur der Kate lagerten. Auch im angrenzenden Raum konnte sich der Mann nur mühsam zwischen den übereinandergestapelten Frauenkleidern, Arbeitsschürzen, Männerhosen, Schultertüchern und Westen bewegen. Suchend sah er sich im Halbdunkel um und zuckte zusammen, als ein trockenes Husten aus der dunkelsten Ecke die Stille zerriss.
»Moin, was führt den werten Herrn zu mir? Will Er verkaufen oder kaufen?« Der kleine Ladenbesitzer löste sich von der hintersten Wand und kam dem Gast entgegen. Er lüpfte seinen Zylinder, den er wohl auch in Räumen zu tragen pflegte. Mit stechendem Blick sah er sein Gegenüber an, kein Lächeln war in seinem Gesicht auszumachen. »Bei meiner letzten Fahrt über Land konnte ich einige schöne Stücke erwerben und wäre bereit, sie Ihm für einen guten Preis zu überlassen.«
Der vermeintliche Kunde brummte unwirsch und hielt dem Händler das mitgebrachte Bündel hin. Aufmerksam beobachtete er, wie der Kleidertrödler die Stoffe auseinanderzog und sie prüfend durch seine Finger gleiten ließ.
»Das Hemd einer Deern, feines weißes Linnen, Halbarm mit schmalem Rüschenbesatz.« Er deutete auf dunkle Flecken und schnupperte am Stoff. »Allerdings arg verschmutzt. Ruß, will ich meinen.« Er legte das Hemd beiseite und widmete sich dem zweiten Kleidungsstück. »Ein ärmelloses Baumwollkleid, dunkelblau mit dünnen weißen Streifen, der Stoff eher robust als erlesen und leider auch nicht sauber.« Er kniff ein Auge zusammen, hielt den Kopf schief. »Ist die Deern hingefallen?«, murmelte er für sich und rieb an den lehmigen Flecken, die sich leicht entfernen ließen. »Ein Schultertuch aus roter Wolle, mit blauen und grünen Blumen bedruckt«, fuhr er fort und ging damit zum Fenster. In dem schwachen Licht, das in seinen Laden fiel, zupfte er ein Haar von dem Stoff und stieß einen leisen Pfiff aus. »Von goldenem Blond und wunderbar lang«, kommentierte er seinen Fund und ließ ihn los. Langsam schwebte das Haar zu Boden, zu den Flusen und dem Staub der Kleider, die hier auf ein neues Leben warteten. »Wie alt ist die letzte Trägerin? Sie wird doch nicht schon unter der Haube sein?– Nun, die Sachen entsprechen gewiss nicht der neuesten Mode und sind verdreckt«, begann er das Feilschen und wies auf das Paar flacher schwarzer Schuhe, das ebenfalls in dem Bündel steckte. »Und die hier sind für viele meiner Kundinnen zu schmal. Zudem sieht man ihnen deutlich an, dass sie eher auf Planken und auf Schotterwegen als in einem Ballsaal getragen wurden. Nein, viel werde ich Ihm dafür nicht geben können.«
Wortlos ging der Mann auf den Kleidertrödler zu und machte Anstalten, das Mitgebrachte wieder an sich zu nehmen.
Sofort steckte der Händler die Hände in seine Hosentasche und brachte einige Schillinge zum Vorschein. Einzeln zählte er sie dem hageren Mann in die Hand. Als er fertig war, hielt er inne.
Sein Kunde verzog den Mund und wies auf die Münzen.
Der Händler lachte. »Ja nun, der Herr scheint ein harter Geschäftsmann zu sein«, lobte er sein Gegenüber und legte zwei weitere Schillinge nach. »Und ein schweigsamer dazu. Aber mehr kann ich Ihm beim besten Willen nicht geben, es soll ja auch für mich ein Geschäft sein. Das Zeug gehörte sicher keiner reichen Deern und wird wohl auch zu keiner kommen. Da muss ich kleine Preise machen und sehen, wo ich bleibe.«
Noch immer hielt die hagere Gestalt beharrlich die Hand auf und machte keine Anstalten, zu gehen.
»Ich kann Ihm ein Kopftuch dazugeben, so eins, wie man es auf den Halligen trägt. Oder dieses schöne Hutband aus Seide«, bot der Händler an und zeigte auf die Textilien.
Doch der andere antwortete auf das Angebot mit einem Kopfschütteln und deutete auf einen Gürtel mit einer glänzenden Messingschnalle, deren Oberflächenstruktur der eines Hanfseils nachempfunden war.
»Nun gut, dann lege ich das noch drauf«, gab der Trödler seufzend nach und drückte dem Kunden das gute Stück in die Hand. »Aber das ist mein allerletztes Wort, werter Herr. So wollen wir den Handel beschließen oder ihn lassen.«
Der Verkäufer ließ die Münzen in seine Jackentasche gleiten, legte den Gürtel um und tippte mit den Fingern seiner rechten Hand an seine Kappe, bevor er wortlos den Laden verließ. Inzwischen war die Dämmerung hereingebrochen. Schon nach wenigen Augenblicken war nicht mehr auszumachen, wohin der Mann sich begab.
Am Abend desselben Tages betrat Dina Martensen auf Amrum den Norddorfer Dorfkrug. Die Tabakluft brannte in ihren Augen. Einige Männer saßen in Gruppen zusammen, tranken aus Zinnbechern und spielten Karten.
Die Amrumerin hatte den Tag wie jeden anderen mit der Versorgung ihrer Tiere und auf dem Feld verbracht, doch ihre Gedanken hatten sich fast ausschließlich um das Verschwinden der Immke Simons gedreht. Sie sah sich im verrauchten Schankraum um und ging direkt auf Auguste zu, die gerade einen Tisch mit einem Lappen schwungvoll sauber rieb. »Moin«, grüßte Dina und trat einen Schritt zurück, als die füllige Frau sich ihr zudrehte.
Als Auguste Dina erkannte, hellten sich ihre Gesichtszüge auf. »Moin, Dina. Das ist aber schön, dass du den Weg zu uns findest. Bringst du gute Nachricht?«
Dina zog zwei versiegelte Briefe aus der Tasche ihres Kleides und lächelte verschmitzt. »Ich will gerne zugeben, dass mich das Schicksal eurer Tochter Immke beschäftigt. Also bin ich zu Pastor Mechlenburg gegangen und habe mit ihm gesprochen. Du kannst dir vorstellen, dass er nicht davon begeistert war, dass ich mich auf die Suche im Eiderstedter Land mache und mich vielleicht sogar in Gefahr begebe. ›Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit; und meiden das Böse, das ist Verstand.‹ So hat er aus dem Buch Hiob zitiert. Ich habe ihn dann daran erinnert, dass uns das Böse auch schon heimgesucht hat und es nur durch Handeln verschwunden ist. Nicht durch bloßes Wegsehen. Da hat er stumm genickt.«
Auguste setzte sich an den Tisch und winkte ihren Mann, den Wirt, herbei.
»Zusammen haben der Pastor und ich diese Briefe aufgesetzt. In einem bescheinigt er mir eine verfaulte Kartoffelernte und allerlei andere Misslichkeiten. Er beklagt, dass ich auf Amrum niemanden habe, der mich durch den Winter bringt, und lobt meinen Fleiß und meine Ausdauer. Mit diesem Schreiben empfiehlt er mich einem gnädigen Arbeitgeber.«
Die Wirtsleute sahen sich fragend an.
»Ich werde diesen Brief dem Prediger von St.
GRAUE STADT AM MEER
Am frühen Abend des darauffolgenden Tages erreichte Dina Martensen auf dem Austernfischer das schmale Hafenbecken Husums. Müde und durchgefroren stand sie an der Reling und blickte auf die dunklen Silhouetten der eng stehenden Häuser. Das Licht, das durch ihre Sprossenfenster nach draußen drang, versprach Gemütlichkeit und Wärme.
Sie band ihr Kopftuch neu, hob ihren Rock an und sprang etwas schwerfällig von Bord. Ihre Reisetasche wurde ihr vom Fischer zugeworfen. Er würde die Nacht auf seinem Schiff verbringen, dergleichen Unannehmlichkeiten war er gewohnt. Dina winkte ihm dankbar zum Abschied und verließ den Hafen über eine gepflasterte Straße in nördliche Richtung. In der Dunkelheit der anbrechenden Nacht waren nur noch wenige Menschen unterwegs. Sorgsam zählte sie die Quergassen und bog bald nach links ab. Nach ein paar Schritten hielt sie vor einem weiß getünchten Ziegelbau, dessen Eingang etwas zurückversetzt lag. Vergeblich suchte sie nach einem Türklopfer und schlug zuerst zaghaft, dann entschlossener mit der Faust gegen die Tür. Die Klaviermusik, die von drinnen erklang, brach ab, und wenige Augenblicke später wurde die Haustür geöffnet.
Dina sah sich einem Mann von nicht ganz dreißig Jahren gegenüber, der sie durch seine Nickelbrille musterte. Wie sie da im Halbdunkel vor dem Eingang stand, das Haar, das unter dem Kopftuch hervorschaute, zerzaust und in einem einfachen, derben Kleid, machte sie wohl einen wenig vertrauenswürdigen Eindruck. Und mit ihrer Reisetasche musste sie wirken wie eine Hausiererin.
Der Herr zog die Augenbrauen zusammen und sah fragend zu ihr hinunter. Unsicher nestelte er an der kleinen Seitentasche seiner Weste, dann fuhr er sich über seinen dunklen Schnurrbart. »Was gibt es? Um diese Uhrzeit empfangen wir für gewöhnlich keine Händlerinnen.«
Dina sah an ihm vorbei in den schwach beleuchteten Hausflur. Eine Frau mit Häubchen und weißer Schürze gesellte sich neugierig zu einer anderen, besser gekleideten Dame. Beide blickten misstrauisch in ihre Richtung.
Der Hausherr drehte sich kurz zu ihnen um. »Es ist nichts, meine Liebe, ich bin gleich wieder bei dir«, sagte er und war bereits im Begriff, die Tür zu schließen.
»Sind Sie Herr Storm, Herr Rechtsanwalt Theodor Storm?«, fragte Dina schnell. »Ich bringe eine Nachricht von Pastor Mechlenburg auf Amrum. Es ist dringend.« Ohne eine Antwort abzuwarten, zog sie den Brief aus ihrer Kleidertasche und hielt ihn wie ein Beweisstück in die Höhe.
Der Herr zog die Stirn in Falten, machte aber einen Schritt beiseite und lud sie schließlich mit einer Handbewegung ein, in den Flur zu treten. »Von Mechlenburg, sagen Sie? Und Sie sind nur wegen dieser Nachricht hier? Das muss ja eine lange Fahrt über die See gewesen sein, und das bei diesem Herbstwind. Berta«, wandte er sich an die Haushilfe in der weißen Schürze, »haben wir für…?«
»Dina Martensen aus Nebel auf Amrum«, stellte sich Dina vor und wagte einen unbeholfenen Knicks. Auf derlei bürgerliche Umgangsformen verzichteten die Inselfriesen nur allzu gerne, kamen aber auch nur selten in die Verlegenheit. »Ich bin auf der Durchreise.« Damit übergab sie dem Hausherren den Brief.
Storm griff nach ihm mit einer leichten Verbeugung und wandte sich Richtung Salon um, wo mehrere Öllichter für mehr Helligkeit sorgten. »Nun, Berta«, sagte er im Gehen und blätterte den Brief auf, »dann sei so gut und versorg Fräulein Martensen mit einer Suppe oder etwas ähnlich Wärmendem. Es wird doch sicher noch etwas da sein.« Er hielt inne und musterte Dina erneut. Sein Blick glitt über ihre Kleidung und blieb an ihren angestoßenen schwarzen Schnürstiefeln hängen. »Wenn Sie unserer Berta in die Küche folgen wollen, meine Liebe? Dort ist es gewiss wärmer als im Salon.« Er wedelte mit dem Brief. »Ich werde eben ein Auge auf die Zeilen meines verehrten Brieffreundes werfen, dann sehen wir weiter.«
Dina löste ihr Kopftuch und folgte der Haushilfe. Während sie ihre Reisetasche im Hausflur stehen ließ, bemerkte sie aus dem Augenwinkel, wie der Hausherr gegenüber der Dame im Salon in einer Geste der Ratlosigkeit die Schultern zuckte und die Arme hob.
Mit einer kurzen Handbewegung und einem Brummen wies die Haushilfe Dina einen Platz an dem langen Küchentisch zu. Kaum hatte sich diese mit einem wohligen Stöhnen gesetzt, wurde ihr auch schon ein Teller mit dampfend heißer Gemüsesuppe vorgesetzt. Mit Schwung und lautem Scheppern ließ Berta den Löffel mehr auf den Tisch fallen, als dass sie ihn legte.
»Ich danke Ihnen sehr«, sprach Dina und lächelte Berta an. »Es ist nicht meine Art, abends in fremden Häusern vorzusprechen und zu erwarten, verköstigt zu werden. Es wäre mir unangenehm, wenn ich stören sollte.« Sie nahm einen Löffel voll, blies auf die Suppe und musste schmunzeln. Der Herr Rechtsanwalt und vermutlich seine Gattin sind doch erkennbar ratlos, wie sie mit mir umgehen sollen, dachte sie. Für den feinen Herrn und die junge Frau im hochgeschlossenen Seidenkleid bin ich wohl etwas zwischen Hausmagd und Marketenderin.
Dina blickte sich in der Küche um. Das Kochgeschirr aus goldenem Kupfer glänzte. Bei ihr auf Amrum war es aus dunklem Eisen. Hier gab es weißes Porzellan und nur wenige bräunliche Tontiegel, bei ihr verhielt es sich umgekehrt. Der schwarz-weiß gekachelte Fußboden strahlte gediegene Eleganz aus. Da bin ich wohl in bessere Gesellschaft geraten, dachte sie und fühlte sich mit einem Mal seltsam eingeschüchtert.
»Nun, normalerweise räume ich um diese Uhrzeit schon die Küche auf«, unterbrach Berta ihre Gedanken und fuhr mit dem Trockentuch über einige Teller. »Und was die Herrschaft über Ihren Besuch wirklich denkt, das lässt sich nicht sagen. Die beiden haben erst vor Monaten in Segeberg geheiratet. Dabei ist sie noch so jung, gerade einmal einundzwanzig Jahre alt. Doch sie scheinen froh, Zeit für sich zu haben und dem Trubel großer Gesellschaften entgehen zu können. Aber ich glaube nicht, dass Sie stören.« Berta stellte den letzten Teller ab und gesellte sich zu Dina an den Tisch. »Brot dazu?«
Dina schüttelte den Kopf.
»Kennen tun sich die beiden jedoch schon lange. Sie müssen wissen, die Madame ist die Cousine vom Herrn Rechtsanwalt. Er ist eine so feinfühlige Seele«, schwärmte die Haushilfe und wischte in Gedanken versunken mit ihrer Hand über die Tischplatte. »Er dichtet und schreibt Geschichten.« Dieser Information verlieh sie mit einem heftigen Nicken Nachdruck.
Ach, sieh an, dachte Dina. Daher vermutlich die Bekanntschaft mit Pastor Mechlenburg, der ein ausgesprochenes Interesse für Sprachen und friesische Märchen hegte.
In diesem Augenblick wurde die Tür zur Küche aufgestoßen, und der Hausherr betrat den Raum. »Mein liebes Fräulein Martensen«, begann er und rieb sich die Hände, »ich hoffe, das frugale Abendessen lässt Sie nicht allzu schlecht von uns denken. Pastor Mechlenburg lobt Sie ja in den höchsten Tönen, was Ihr Wirken auf seiner Insel betrifft. Das haben Sie uns sträflich verschwiegen. Hätten wir das gleich gewusst, wäre unser Empfang mit Sicherheit gastlicher ausgefallen. Glauben Sie mir, meine Frau Constanze macht mir diesbezüglich bereits größte Vorhaltungen. Dürfen wir Sie also, sobald Sie sich gestärkt haben, in den Salon bitten? Constanze ist ganz begierig darauf, etwas mehr über Ihre Mission und Ihre Heimat, die wilde Düneninsel, zu erfahren. Und selbstverständlich verbringen Sie die Nacht hier, nicht wahr? Berta wird Ihnen ein Zimmer richten.« Er nickte der Haushilfe zu, die den Mund verzog. »Schön, schön!«, rief er und klatschte in die Hände. »Dann werde ich mal einen Rheingauer öffnen. Sie mögen doch Rheinwein?«
Nachdem die Suppe sie gewärmt hatte, stieg Dina in eine Dachkammer hinauf, in der Berta ein Bett für sie bezog. Als sie alleine war, richtete sie ihren Haarknoten und suchte aus den wenigen Kleidungsstücken, die sich in ihrer Tasche befanden, einen Schal aus violetter Seide aus. Den feinen Stoff legte sie sich in lockeren Falten um Hals und Schultern und betrachtete sich im kleinen Spiegel an der Kammerwand. Ein von Sonne und Wetter gerötetes Gesicht blickte ihr entgegen. Der Teint der Stadtdamen war sehr viel blasser, aber Puder, um ihre Haut aufzuhellen, hatte sie nicht. Schließlich war sie unterwegs, um sich in der Landschaft Eiderstedt unter das einfache Volk zu mischen und sich auf einem der Höfe zu verdingen, nicht um in der Stadt à la mode zu wandeln. Das Seidentuch war das einzig elegante Stück in ihrem Gepäck, und sie freute sich, es schon an diesem Abend tragen zu können.
Das durch ihre Ankunft unterbrochene Klavierspiel setzte wieder ein. Schon auf der Treppe klang ihr eine Schubert-Weise entgegen. Auf Amrum war Hausmusik so gut wie unbekannt. Da wurde nur sonntags die Orgel von St.Clemens gespielt.
Dina betrat den erleuchteten Salon, in dem Constanze Storm am Pianoforte saß und mit einem Lächeln auf den Lippen die Tasten des Instrumentes bediente. Ihr Mann stand hinter ihr, um die Notenseiten umzublättern. Beide waren so in die Musik vertieft, dass Dina sich von ihnen unbemerkt auf einen der Salonstühle niederließ und aufmerksam lauschte. Als die letzten Töne hell verklangen, sah sich das Paar in die Augen, und Herr Storm streichelte seiner Gattin über die Wange. Plötzlich, als würden sie der Anwesenheit ihres Gastes gewahr, drehten sich beide gleichzeitig um. Constanze Storm erhob sich, strich über ihr Seidenkleid und ging auf Dina zu, die ebenfalls aufstand.
Die junge Hausherrin gab ihr die Hand und lächelte verlegen. »Liebes Fräulein Martensen, nun will auch ich Sie willkommen heißen in unserer grauen Stadt am Meer, wie mein Mann Husum zu nennen pflegt. Ich hoffe, Sie fühlen sich in unserem Hause wohl und leisten uns an diesem Abend noch etwas Gesellschaft.« Sie wies auf das mit feinem Stoff bespannte Kanapee, wartete, bis Dina sich gesetzt hatte, und nahm dann neben ihr Platz. »Theodor, sei so gut und schenk uns nun von deinem Rheinwein ein«, bat sie ihren Gatten.
Storm kam der Bitte sogleich nach und füllte drei geschliffene Weingläser aus einer hohen grünen Flasche.
Seine Frau reichte Dina ein Glas, und die Damen stießen miteinander an. »Herzlich willkommen in Husum!« Die Hausherrin nippte und stellte den Wein neben sich auf dem Tisch ab.
Theodor Storm ließ sich auf einem der Polsterstühle mit elegant geschwungenen Rückenlehnen nieder, die zusammen mit dem runden, einbeinigen Tisch und dem Kanapee die Sitzgruppe des Salons bildeten. »Sagen Sie, Fräulein Martensen, waren Sie schon einmal auf der Halbinsel Eiderstedt?« Er nahm einen Schluck Rheinwein, dem er einen kurzen Augenblick mit geschlossenen Augen hinterherschmeckte. Als Dina verneinte, nickte er und schien dabei zu überlegen. »Die Landschaft und die Leute sind wohl deutlich anders als auf den Nordfriesischen Inseln«, sprach er leise. »Für die meisten Eiderstedter ist die Seefahrt nicht von Belang, sie leben von der Viehhaltung und vom Ackerbau. Anders als auf Amrum durchziehen Entwässerungsgräben und Siele das flache Land. Dünen gibt es nur selten. Allerdings gilt dies nicht für den Westen Eiderstedts. In Ording mussten sie die Kirche schon zweimal versetzen, weil der Sand das Gotteshaus sonst aufgefressen hätte. Aber nicht nur in dieser Hinsicht gibt es Unterschiede. Auch der Menschenschlag ist ein anderer, die Bewohner Eiderstedts erscheinen mir weniger egalitär als die der Inseln. Großbauern spielen hier eine wichtige Rolle.« Storm hatte sich erhoben und ging nun mit seinem Glas in der Hand auf und ab. »Die Landschaft Eiderstedt, wobei der Begriff ›Landschaft‹ eine Art Amtsbezirk bezeichnet«, führte er aus, »kennt eine gewisse Selbstverwaltung. Doch nur die, die viel besitzen, dürfen bei der Wahl des Stallers mitentscheiden.«
»Des Stallers?«, wiederholte Dina mit fragendem Blick.
»Ein traditionsreicher Ausdruck«, erklärte Storm. »Man könnte auch Amtmann sagen. Der Staller regelt das Leben der Bewohner der Landschaft. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe präsentieren die reichen Lehnsmänner dem König sechs Kandidaten, von denen Seine Majestät einen auswählt und allerhöchst ernennt.«
Constanze Storm unterbrach den Verwaltungsvortrag ihres Mannes durch ein Hüsteln. »Hans Theodor Woldsen Storm!«, sagte sie vorwurfsvoll. »Du darfst unseren Gast doch nicht mit einem so sperrigen Thema langweilen. Wer möchte schon wissen, wie ein Staller in Amt und Würden kommt? Für Fräulein Martensen wird viel mehr von Interesse sein, wo sie auf ihrer Reise ein bequemes Quartier finden und wie sie Räuberbanden und anderen Gefahren entgehen kann.« Sie wandte sich Dina zu und ergriff ihre Hand. »Nicht wahr, liebes Fräulein, wir Frauen müssen in einer von Männern beherrschten Welt auf uns achtgeben. Aber was genau ist denn nun der Grund dafür, dass Sie Ihre Insel verlassen und sich auf den Weg nach Eiderstedt gemacht haben?«
Dina räusperte sich und blickte den Hausherrn an. Was von dem Briefinhalt hatte er seiner Frau erzählt? »Freunde haben mich gebeten, nach ihrer Tochter zu sehen, die sich in der Nähe von St.Peter auf einem großen Hof als Milchmagd verdingt hat. Das Mädchen ist spurlos verschwunden.«
»Dass Sie als Frau sich nach der Vermissten umsehen, ist ein durchaus geschickter Schachzug«, befand Theodor Storm und setzte sich wieder. »Sie sind selbstverständlich unauffälliger als ein Mann, der in der Landschaft Fragen stellt. Ihre Neugier wird man gewiss als Eigenschaft verstehen, die dem weiblichen Geschlecht nun mal innewohnt, und keinen Argwohn hegen. Zudem sind Sie, wie Mechlenburg andeutet, in dergleichen Nachforschungen in gewisser Weise erfahren. Meine liebe Constanze, ich fürchte, die Zukunft ist nicht aufzuhalten. Bald werden Frauen auch die gefährlichsten Berufe ergreifen und uns Männern beweisen, dass wir nicht immer das stärkere Geschlecht sind.«
»Ich frage mich, an wen von der Obrigkeit ich mich wenden kann, wenn ich auf der Halbinsel Hilfe benötige«, überlegte Dina laut. »Auf Amrum sind wir es gewohnt, die Dinge unter uns zu regeln. Polizei und Gericht sind weit weg.«
»Wie schon gesagt, der Staller hat alles unter sich. Der Bürgermeister von Tönning ist wiederum auch örtlicher Polizeimeister. In der Hafenstadt an der Eider sitzt zudem die Kriminalgerichtsbarkeit«, erklärte Rechtsanwalt Storm. Er schien einen Hang zum Dozieren zu haben. »Wie Sie vielleicht wissen, betreten Sie mit dem Land an der Eider den südlichsten Teil des Herzogtums Schleswig. Schon das andere Flussufer gehört zum Herzogtum Holstein und ist deutsches Land. Es wird zwar ebenfalls vom dänischen König regiert, dieser ist hier aber der Herzog von Holstein und damit Mitglied im Deutschen Bund. Deshalb haben wir eine verwirrende, doch durchaus interessante staatsrechtliche Situation. Bereits zu Zeiten Karls des Großen trennte die Eider sein Reich von dem des dänischen Wikingerkönigs Hemming.« Storm hob sein Glas zu einem Trinkspruch. »Eidora Romani Terminus Imperii! Gemeinhin übersetzt mit: Bis zur Eider und nicht weiter.« Er nahm einen kräftigen Schluck und stellte das Weinglas ab. »Somit befinden wir uns heute auf dänischem Boden. Allerdings besteht ein gewisser Vertrag von Ripen aus dem Jahr 1460. Demnach sollen die Herzogtümer Schleswig und Holstein up ewig ungedeelt bleiben, wie es so schön heißt. Das lässt sich aber wohl nur gestalten, wenn Schleswig nicht mehr zum dänischen Reich gehört. Und so gibt es unter der deutschen Bevölkerung Schleswigs Bestrebungen, das Herzogtum aus dem dänischen Reichskörper herauszulösen und mit Holstein zu vereinen. Das Ziel ist ein eigener Staat Schleswig-Holstein, Mitglied im Deutschen Bund. Ein Ansinnen, das unserem König Christian natürlich nicht gefallen kann.«
Dina schwirrte der Kopf von so vielen neuen Informationen. Sie gaben ihr nicht wirklich das Gefühl, in Eiderstedt Hilfe zu bekommen, sollte sie sie benötigen.
Constanze Storm erhob sich kopfschüttelnd vom Kanapee. »Du und deine Politik«, schimpfte sie ihren Mann. »Zumindest ist durch deinen Vortrag deutlich geworden, dass man sich in Eiderstedt in ein Grenzgebiet und damit in die Nähe all der dunklen Gestalten und Unwägbarkeiten begibt, die jede Grenze mit sich bringt.« Sie ging zum Pianoforte. Aus den Notenblättern suchte sie ein Stück heraus, stellte die Partitur auf und setzte sich auf den kleinen Hocker. Gefühlvoll drückte sie die elfenbeinernen Tasten des Instrumentes, und eine warme Melodie erfüllte den Raum. »Als Antwort auf die trockenen Worte meines Mannes über Politik und Verwaltung bleibt mir nur eine scharfe Waffe: die ›Mondscheinsonate‹.« Sie wandte sich Dina lächelnd zu. »Sie mögen doch Beethoven?«
ÜBER LAND
Am anderen Morgen erwachte Dina Martensen im Dämmerlicht des frühen Tages. Über Nacht hatte die klamme Herbstluft ihre Gastkammer deutlich ausgekühlt. Fröstelnd zog sie sich an und trat ins Treppenhaus. Der belebende Duft frisch gebrühten Kaffees stieg ihr bereits in die Nase. Sie zog ihr Schultertuch enger und ging leise ins Erdgeschoss. Im Hausflur stieß sie auf die Haushilfe Berta, die ihr wortlos die Reisetasche aus der Hand nahm und sie in das Speisezimmer führte. Das Geschirr auf dem fein gedeckten Tisch zierten blau-weiße Blumen.
»Moin!– Ich meine natürlich, guten Morgen«, verbesserte sich Dina schnell. »Bin ich zu früh?«
»Moin, aber woher denn«, antwortete Berta lächelnd. »Die Herrschaften müssen jeden Augenblick erscheinen. Der Herr Rechtsanwalt ist Frühaufsteher, und seine junge Frau weiß, dass er ohne sie den Tag nicht beginnen mag. Möchten Sie Kaffee?«
Dina nickte und nahm am Tisch Platz. Die Informationen des gestrigen Abends gingen ihr nicht aus dem Kopf. Worauf hatte sie sich da nur eingelassen? Ihr war klar, dass ihr so auf sich gestellt die Nachforschungen zu Immke Simons’ Verschwinden nicht gelingen würden. Aber wer sollte ihr dabei helfen? Während sie ihren Gedanken nachhing, erschien Berta neben ihr mit einer großen Kanne und goss ihr Kaffee ein.
»Draußen wartet schon der Karl«, sagte sie. »Ein etwas wunderlicher Geselle, er erledigt für den Herrn Rechtsanwalt Botengänge. Er traut sich nur dann ins Haus, wenn es kälter ist oder regnet. Vor der Gelehrsamkeit und den feinen Leuten hat er eine gewisse Scheu. Jedenfalls wird er Sie gleich nach dem Frühstück zur Postkutsche bringen.«
Die Geräusche von sich schließenden Türen und schnellen Schritten ließen die beiden Frauen aufblicken.
Theodor Storm stand auf der Schwelle zum Speisezimmer, deutete eine Verbeugung an und trat an den Tisch. Er trug eine bequeme Hausjacke und nestelte an seinem steifen Hemdkragen, bevor er sich setzte. »Guten Morgen, liebes Fräulein. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, denn heute steht Ihnen eine anstrengende Landpartie bevor. Meine Frau wird sich jeden Augenblick zu uns gesellen.« Er hielt Berta seine Tasse hin. »Ist Karl schon da?«, fragte er sie. »Und weiß er Bescheid?«
Berta nickte zweimal und verschwand in der Küche, um warmes Brot zu holen.
»Ah, Kaffee«, murmelte Constanze Storm, während sie den Raum betrat und mit einer schnellen Handbewegung den Sitz ihres Haares prüfte.
Ihr Gatte erhob sich, um sich sodann mit ihr wieder zu setzen.
»Sie haben wohl geruht?«, fragte sie Dina, die mit einem dankbaren Lächeln antwortete. »Sie müssen wissen«, fuhr Madame Storm fort, »dass dies eigentlich noch ein Junggesellenhaus ist. Erst seit unserer Hochzeit hält hier langsam weibliche Heimeligkeit Einzug. Ihre Dachkammer, nun, die muss zum Beispiel noch etwas wohnlicher gestaltet werden. Bisher haben in ihr nur Literaturfreunde meines Mannes gehaust, für die der Komfort gereicht haben mag.« Sie tätschelte Storm beschwichtigend die Hand, der wohl gerade zu einem Protest ansetzen wollte.
»Aber verehrte Madame Storm, ich bin Ihnen und Ihrem Gatten außerordentlich dankbar für die überaus herzliche Gastfreundschaft. Darauf hat Pastor Mechlenburg gewiss nicht zu hoffen gewagt, als er mich Ihnen empfahl. Aber nun sollte ich doch bald aufbrechen, um eine möglichst frühe Kutsche zu nehmen. Die Reise wird gewiss länger dauern.«
»Sie waren uns sehr willkommen«, sagte Theodor Storm, »und als echte Friesin einer sturmerprobten Insel eine wahre Inspiration.« Sinnierend lehnte er sich zurück und blickte an die Decke.
»Graues Geflügel huschet
neben dem Wasser her;
wie Träume liegen die Inseln
im Nebel auf dem Meer.«
Mit gewissem Stolz blickte er sich um.
»Ist das neu?«, fragte seine Frau und bestrich ein Stück Brot mit Konfitüre. »Meinem Mann fallen zu allen erdenklichen Gelegenheiten wie aus dem Nichts hübsche Verse ein«, erklärte sie Dina. »Gedichte und Romane sind seine wirkliche Passion.«
»Ich habe gerade an den Meeresstrand der Nordsee gedacht«, sprach Storm. »Oder, wie die Menschen hier mit ihrer recht provinziellen Sichtweise sagen, der Westsee.«
»Westsee?«, wunderte sich Dina.
»Das ist an der Küste der geläufige Begriff für das Meer vor unserer Haustür. Betrachtet man nur einen kleinen Ausschnitt der Küstenkarte, so befinden wir uns im Westen. Ist man jedoch ein Amerika- oder Grönlandfahrer mit einem Blick für das Große und Ganze, so ändert sich diese Sicht, und unsere Gestade liegen eher im Norden. Alles eine Frage des Horizontes und der Perspektive, will ich meinen.– Aber nun, Fräulein Martensen, lassen Sie uns über Ihre Reise sprechen. Ich habe nachgedacht, ob ich auf der Halbinsel jemanden kenne, dem ich Sie anvertrauen kann, und mir ist Pastor Wolf, der Prediger von St.Peter, eingefallen. Wenn ich nicht irre, ist das Dorf ohnehin Ihr Ziel? Der Mann ist von ganz vorzüglichem Charakter, er steht auf der Seite der Schleswiger Freiheit. Ich habe bereits ein oder zwei Briefe mit ihm gewechselt. Menschliche Schicksale wie das Ihrer verschwundenen Landsmännin werden ihn gewiss anrühren.«
Als Storm den Namen des Pastors nannte, erschrak Dina erst, spürte aber dann Erleichterung. Der Prediger von St.Peter war ohnehin ihr Ziel. Eine glückliche Fügung, dass sie ihn jetzt auch noch mit der Empfehlung des Rechtsanwaltes aufsuchen konnte.
»Berta!«, rief Storm in die Küche. »Ist der Reiseproviant für unseren Gast gerichtet? Fräulein Martensen muss sich bald auf den Weg machen, die Postkutschen warten nicht.«
Dina verabschiedete sich vom Ehepaar Storm mit einem kräftigen Händedruck und einem linkischen Knicks.
Karl, der draußen in der Kälte vor dem Haus gewartet hatte, zog seine Kappe, griff Dinas Tasche und humpelte voran. Auf direktem Weg brachte er sie zum Markt, auf dem vor der Marienkirche eine Postkutsche wartete.
Um ganz sicherzugehen, auch die richtige Verbindung zu nehmen, nannte Dina dem stämmigen Kutscher ihr Ziel. »Ich möchte nach St.Peter.«
»Was denn, in diese verlassene Gegend?«, brummte der und verstaute ihre Reisetasche auf dem Kutschdach. »Wir transportieren nur bis Tönning, von dort müssen Sie anders weiter«, sagte er und ließ die Münzen, die Dina für die Reise bezahlte, sogleich in einem Geldbeutel verschwinden. »Steigen Sie ein, wir fahren gleich los.«
So rollte die Kutsche zuerst über die gepflasterten Straßen Husums, um schon bald auf buckligen und schlammigen Wegen die Südermarsch gen Friedrichstadt zu durchqueren. Dina, die mit sieben weiteren Passagieren eng beieinandersaß, versuchte, durch die Fenster in den Kutschentüren einen Blick auf die Landschaft zu erhaschen. Sie wollte sich ablenken, denn schon jetzt mischten sich die schweißigen Ausdünstungen einiger schlecht gewaschener Reisender mit dem Geruch lang getragener Kleidung. Der feine Duft von Puder und Eau de Cologne, der eine andere Mitreisende umwehte, ging darin unter wie der einer zarten Blume auf einem Misthaufen.
Nur mühsam durchbrach die Sonne den Nebel, der über grünen Weiden und abgeernteten Feldern lag. Herden von Rindern und Milchkühen grasten, hier und da drang das Blöken von Schafen in die Kutschkabine. Wassergräben durchzogen den Landstrich, und nur selten passierte das Gefährt einzelne Gehöfte.
Dinas Sitznachbar war ein älterer Herr. Er trug einen knielangen Rock aus blauem Tuch mit einer Reihe goldfarbener Knöpfe, darunter spannte sich eine violett-gelb gestreifte Seidenweste über seinem mächtigen Bauch. Aus einer kleinen Tasche seiner sandfarbenen Kniebundhose baumelte eine massiv silberne Uhrenkette, mit der seine feisten Finger spielten. Seidenstrümpfe bedeckten die im Kontrast zum Leib dünnen Waden, die Füße steckten in schwarzen Schuhen mit Silberschnallen. Seinen hohen Hut aus hellem Stoff hatte er an einen Haken an der Kutschwand gehängt. Er strich sich über das schüttere weiße Haar und blickte auf die dahinschaukelnde Gruppe in sich gekehrter Mitreisender. Wohl um sich abzulenken, begann er eine Unterhaltung, indem er sich nach dem Woher und Wohin der anderen erkundigte. Ungefragt teilte er diesen mit, dass er unterwegs sei, seine Tochter zu besuchen. Sie sei mit einem Großbauern verheiratet, das Gut liege in der Nähe von Garding.
Weil die Kutsche immer wieder in verschiedene Himmelsrichtungen fuhr, wunderte Dina sich laut über den Zickzackkurs. Einige der Mitreisenden lachten ob ihrer Unwissenheit kurz auf.
»Ja nun, min Deern, Sie waren also noch nie in dieser Gegend?«, fragte der ältere Herr und nestelte an seinem Halstuch. »In der Landschaft Eiderstedt fehlt es an guten Überlandstraßen. Stattdessen zuckeln wir von Kreuzung zu Kreuzung, umrunden eingedeichte Köge und tiefe Wassergräben. Leider wird die Situation zur Küste hin nicht besser, ganz im Gegenteil. Schließlich nimmt die Bevölkerung in diesem Landstrich auch immer stärker ab. Aber nun steuern wir erst einmal Friedrichstadt an, und danach geht es am Deich entlang weiter gen Tönning.«
Dina blickte nach draußen. Gerade kreuzten sie eine Allee, die zu einem imposanten Gebäude führte. Es besaß ein enormes Dach aus Reet, und Dina konnte die mit hohen Giebeln verzierten Seiten des Hauses erkennen.
Der ältere Herr hatte sie beobachtet und grinste. »Eine Augenweide, nicht wahr?« Sein Blick glitt unverhohlen auf ihre Brust. »Haubarge wie dieser sind typisch für Eiderstedt. Einige von diesen Bauernhöfen sind sogar größer als Kirchen. Ihre Bauart, den ganzen Hofbetrieb unter einem Dach zu vereinen, soll aus dem Holländischen kommen.«
»Und was bedeutet Haubarg?«, fragte Dina, obwohl sie sich den unangenehmen Herrn weit wegwünschte.
»Der Name stammt vom Wort ›Heuberg‹, denke ich wohl«, erklärte der. »Vom Boden bis hoch zur Spitze wird Heu oder Korn gelagert. Darum herum befinden sich die Räume für die Familie, das Vieh, das Gesinde und die Dreschtenne. Manche Bauern ziehen die Milchwirtschaft dem Getreide vor und machen auch Käse. Eine gute Entscheidung, als Viehhändler verstehe ich etwas davon. Aber inzwischen habe ich mich aus dem Geschäft zurückgezogen und zolle meinem Alter Tribut.– Meine Tochter hat mit ihrem Mann auch so ein Gehöft. Ich kann nicht sagen, dass es ihnen schlecht geht.«
Den letzten Satz quittierten die übrigen Reisenden mit unwirschem Brummen oder leisem Lachen. »Natürlich nicht«, empörte sich ein jüngerer Herr in einem abgetragenen grauen Rock. Die langen Hosen, in denen seine dünnen Beine steckten, waren aus demselben Stoff und liefen nach unten hin schmaler aus. Ein markanter, geölter Seitenscheitel teilte sein Haupthaar in zwei enorme Wellen. Der Stoff des Zylinders, den er in der Hand hielt, war an den Rändern deutlich ausgefranst. »Wer einen Haubarg unterhalten kann, dem mag es wohl gut gehen, lässt er doch zahlreiche Leute für sich arbeiten und nennt auch fünfzig bis hundert Demath Land sein Eigen. Aber dieses Glück ist nicht jedem beschieden. Zu viele Menschen in der Landschaft fristen ihr Dasein als Tagelöhner oder leben mehr schlecht als recht von dem, was Strand und Watt ihnen schenken.«
»Der Herr kennt sich wohl aus bei den kleinen Leuten?«, höhnte der ausstaffierte Alte und ließ seine Uhrenkette durch die Finger gleiten. »Mein Schwiegersohn sagt immer, wenn Gott ihm anrechnen würde, wie viel von dem arbeitsscheuen Gesinde er durchfüttert, so hätte er Anrecht auf gleich zwei Plätze im Himmel. Gerade vor gut acht Wochen habe ich ihn das letzte Mal so reden hören. Die Mägde können besonders liederlich sein. Für das vage Versprechen auf ewige Liebe lassen sie ihre Arbeit im Stich und geben sich romantischen Träumen hin. Dabei kommt nur der zu was, der sein Tagwerk fleißig verrichtet, das sag ich Ihnen.«
»Oder man heiratet einen Haubargbauern«, ätzte der Jüngere und schlug in unterdrückter Wut den Zylinder gegen sein Bein.
»Friedrichstadt!«, rief der Kutscher. Wenige Augenblicke später hielt die Gesellschaft am Ufer eines Flusses. Die Reisenden stiegen aus und blickten zu der Stadt mit ihren Häusern hinüber, deren stattliche Fassaden stufige Giebel prägten. Die ersten Passagiere verließen die Gruppe, an ihrer statt kamen neue hinzu, und der Kutscher verstaute ihr Gepäck. Dina machte einige Schritte entlang des Wassers und bemerkte, dass es ihr der streitbare jüngere Herr gleichtat. Korrekterweise trug er nun seinen Hut.
»Sagen Sie, ist das hier die Eider?«, wollte sie wissen.
»Nein, meine Dame, das ist die Treene. Sie mündet gleich dort drüben in die Eider, deren Verlauf wir ab jetzt folgen werden.« Er deutete in die entsprechende Richtung. »Und jenseits des Flusses…«
»…endet das Herzogtum Schleswig«, schloss Dina den Satz und lächelte.
»Sieh an, sieh an. Ganz so ahnungslos, wie Sie sich eben gaben, scheinen Sie ja doch nicht zu sein«, freute sich der Herr, zog seinen Zylinder und verbeugte sich. »Wenn ich mich vorstellen darf: Bernhard Albert Rose, Schulmeister auf dem Weg zu einer neuen Anstellung.«
»Dina Martensen von der Insel Amrum.« Sie deutete einen Knicks an. »Auch ich bin auf dem Weg zu einem neuen Verding. Wohin genau wird es Sie verschlagen?«
»In den Flecken Ording«, antwortete Rose lächelnd. »Und Sie?«
»In die Nähe von St.Peter«, sagte Dina leise und war sich unsicher, ob sie noch mehr preisgeben sollte. »Alles Weitere wird sich erst vor Ort ergeben«, fügte sie schließlich hinzu.
Als der Kutscher laut zum Aufbruch mahnte, gingen beide zu den übrigen Wartenden zurück.
»Da sind wir dann ja nah beieinander«, murmelte der Dorflehrer und sah Dina von der Seite an. »Wenn ich Sie noch um etwas bitten dürfte«, flüsterte er in einem Ton von Heimlichkeit. »Behalten Sie meine zukünftige Verwendung für sich. Da ich mich eben im Gespräch hinreißen ließ, muss ich nun befürchten, mit meiner kritischen Haltung den reichen Großbauern gegenüber als wenig geeignet zu erscheinen, Untertanen zu erziehen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing: Auf dem Land ist die Idee noch stärker verbreitet als in der Stadt. Und diese Leute meinen ja wirklich, ihnen gehöre die Halbinsel.«
»Seien Sie unbesorgt«, beruhigte ihn Dina, »ich kann schweigen.«
Damit bestiegen sie wieder die Postkutsche und rollten über den Damm in westlicher Richtung.
Dina blickte aus dem linken Kutschenfenster, erhaschte aber nur anfänglich den einen oder anderen Blick auf den breiten Fluss. Ein grasbewachsener Erdwall bildete den Horizont. Der Deich sollte das Marschland schützen, das nahe der Eidermündung und dem Meer lag. Die weitere Landschaft bestand aus niedrigeren Bodenerhebungen, die auf weiter Fläche große Weiden und Felder umsäumten.
Eine schläfrige Ruhe hatte sich auf die Passagiere gelegt. Auch der stolze Schwiegervater des Haubargbauern hielt die Lider geschlossen und atmete tief und regelmäßig. Schulmeister Rose, der Dina gegenübersaß, beobachtete sie beim Betrachten des grünen Landes.
Sie wandte sich ihm zu, traf seinen Blick und lächelte. Seine blauen Augen stehen ihm gut, dachte sie. Und seine Art, sich für die weniger Begünstigten einzusetzen, gefiel ihr auch. Nur die geölten und gescheitelten Haare kamen ihr doch allzu modisch vor.
»So etwas werden Sie von Amrum her nicht kennen«, störte er ihre Gedanken. »Ein eingedeichtes Landstück nennt man Koog. Manche Köge sind so groß, dass ganze Dörfer hineinpassen. Das Land wurde vor Generationen dem Meer abgetrotzt. Es ist immer noch sehr feucht.«
»Daher auch die Wassergräben«, erkannte Dina, und der Schulmeister nickte.
In diesem Augenblick passierten sie erneut einen imposanten Haubarg, der etwas zurückversetzt an der Straße lag. Ihm folgten weitere Höfe links und rechts des Weges, länglich gebaut und weniger beeindruckend.
»Das muss der Süderfriedrichskoog sein«, vermutete Bernhard Rose. »Also sind wir kurz vor Tönning.« Als hätten die Reisenden nur auf diese Worte gewartet, kam auch schon Leben in die müden Gesichter, und die Passagiere regten sich, soweit es die enge Kabine zuließ.
»Tönning, Endstation!«, rief denn auch schon der Mann auf dem Bock.