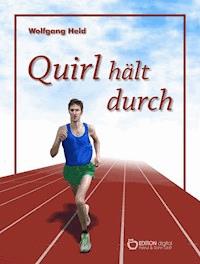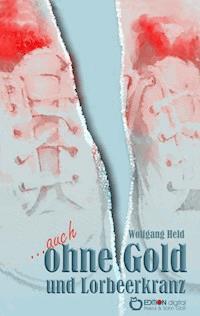8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die „Sachsenburg" ist mit eiliger Ladung auf dem Weg nach Chittagong. Als den Kapitän auf hoher See die Nachricht erreicht, dass er die Fahrt unterbrechen soll, ahnt er nichts von den Komplikationen, die diese Order nach sich zieht. Die in Conakry übernommene Solidaritätsfracht für die Befreiungsfront in Mocambique erweist sich als eine geschickt gestellte Falle. Das Schiff wird in einem von portugiesischen Kolonialtruppen kontrollierten Hafen festgehalten; Quarantäne und die Entführung zweier Besatzungsmitglieder und eines Passagiers liefern dafür den äußeren Vorwand. Der Termin für das rechtzeitige Eintreffen in Chittagong gerät von Tag zu Tag mehr in Gefahr. Wenn es den Seeleuten nicht gelingt, die Pläne des Gegners zu durchkreuzen, droht dem Außenhandel der DDR ein großer Verlust. Das spannende Buch erschien erstmals 1982 beim Militärverlag der DDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Eilfracht via Chittagong
ISBN 978-3-86394-807-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1982 beim Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Vergleiche mit tatsächlichen Geschehnissen liegen im Ermessen des fantasiebegabten Lesers.
I. Kapitel
Außenhandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ein wichtiges Instrument in der Auseinandersetzung mit jenen starken Kräften, die unversöhnlich und erdweit zu unserer totalen Ablösung angetreten sind -eine Waffe also in einem Kampf auf Leben und Tod!
(Henry Clinton am 12. März 1972 in New York vor dem Aufsichtsrat der BEC)
1.
Die schwarze achtzylindrige Lincoln-Limousine fährt im Achtzig-Meilen-Tempo nordwärts. Über dem Asphalt flimmert Hitze. Die breite Fernstraße, makellos wie ein dunkles Geschmeide, verbindet New York City über die amerikanisch-kanadische Grenze hinweg mit Montreal. In beiden Fahrtrichtungen fließt pausenlos ein bunter, dröhnender, trompetender, übel riechender Strom aus Blech, Glas, Chrom und Gummi. Keine der großen Automarken fehlt.
Das Ziel des Mannes, der im Fond des schweren Wagens sitzt, liegt abseits des Highways. Henry Clinton will in die Adirondack Mountains. Die Stelle, die er auf einer ziemlich genauen Karte dieser Gegend angekreuzt hat, trägt keinen Namen. Der Mann aus dem Top-Management der Breakwood Electric Corporation Ltd. hat einige Zeit gebraucht, um diesen Platz ausfindig zu machen.
"Applestones Whiskey Bourbon macht, dass ihr von innen leuchtet!", behauptet ein Slogan an der Rückseite des Trucks, der, einem rollenden Hochhaus gleich, dem Fahrer der Lincoln-Limousine seit einiger Zeit die Sicht nach vorn versperrt. Die fugenlos besetzte Überholspur erlaubt kein Vorbeikommen. Längst hat sich der Mann am Lenkrad geschworen, nie im Leben auch nur einen Tropfen aus den Fässern der Applestone-Leute anzurühren.
Zwischen dem Fahrer und dem Mann im Fond gibt es eine schalldichte Wand aus Glas. Henry Clinton drückt auf die Taste. "Die nächste Abfahrt!", befiehlt er.
"Okay, Sir!" klingt die Stimme des Fahrers aus dem Lautsprecher. Das Mikrofon vor ihm am Armaturenbrett kann nur vom hinten sitzenden Fahrgast ein- oder ausgeschaltet werden.
Die Limousine verlässt den Highway. Hinter einer Unterführung wird die Straße schmal. Ein unübersehbares gelbes Hinweisschild verrät, dass dieser Weg nach Indian Lake führt.
Enge Kurven zwingen zu niedrigerem Tempo. Beiderseits der sanft ansteigenden Fahrbahn glänzt der Wald in allen grünen und braunen Farbnuancen. Würziger Harzgeruch dringt bis ins Wageninnere. Käfer klatschen gegen die getönte Frontscheibe und verenden als schmutzig-schleimige Kleckse.
Henry Clinton hält die Karte auf den Knien. Wenn er sitzt, breitschultrig und mit dem Brustumfang eines ausgewachsenen Gorillas, bemerkt man das wunderliche Verhältnis seiner Körpermaße kaum. Aufgerichtet fordert seine Erscheinung zum respektlosen Vergleich mit einem Bauwerk heraus, das bis zu halber Höhe als Minarett hochgezogen und dann in einem Anfall von architektonischem Wahnwitz als Kathedrale vollendet wurde. Die Stenotypistinnen in der sechsunddreißigsten Etage des New-Yorker Breakwood-Buildings, wo Clinton residiert, nennen ihn heimlich das Nashorn. Seine engeren Mitarbeiter müssten freilich sinnlos betrunken oder in selbstmörderischer Kündigungsstimmung sein, um diesen Spitznamen über die Lippen zu bringen. Der Marketing-Direktor verfügt über die Humorlosigkeit eines Trappisten-Abtes, das weiß bei der Breakwood Electric Corporation jeder, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates angefangen bis hinunter zum jüngsten Botenjungen. Dazu kommt, dass der Name des Dickhäuters auch für die ihm nachgesagte Bösartigkeit und Rachsucht steht. Trotzdem verschaffen geschäftliche Leistungen diesem Mann in dem großen Unternehmen immer wieder Anerkennung.
Man sagt Henry Clinton nach, dass er seinen unbestritten brillanten Verstand wie eine Raubtierpranke einsetzt. Für jeden Zipfel mehr Marktanteil. Für einen günstigen Vertragsabschluß oder auch nur für die Aussicht auf eine um Prozentbruchteile höhere Profitrate. Gebt dem Nashorn drei Monate Zeit, sagt man im Führungskreis der BEC, und jeder zweite Taubstumme in der zivilisierten Welt kauft sich einen von unseren neuen Telefonapparaten.
"Passen Sie jetzt auf", schnarrt Henry Clintons Stimme vor dem Fahrer aus dem Lautsprecher. "Irgendwo dort vorn muss gleich eine Abzweigung nach links kommen!"
Ohne den Hinweis seines Chefs hätte der Mann die schmale, unmarkierte Einmündung vermutlich gar nicht zur Kenntnis genommen. Er drosselt die Geschwindigkeit, schaltet auf einen kleineren Gang und sitzt jetzt sehr gerade. Im Rückspiegel sieht er eine dichte Staubwolke. Schon nach wenigen hundert Metern nimmt der Wagen die volle Breite des unbefestigten Waldweges ein. Aus dem Boden ragende Steinbuckel und zahlreiche, von Sturzbächen ausgespülte Rinnen strapazieren die watteweiche Federung.
"Damned!", flucht der Mann am Lenkrad leise. "Der letzte, der vor uns hier langgekommen ist, muss Buffalo Bill gewesen sein!"
"Wir hätten in Albany einen Jeep nehmen sollen", gibt Henry Clinton seinem Angestellten Recht, doch er lässt dabei die Sprechtaste unberührt, so dass ihn der Mann vorn gar nicht hört.
Der Weg schlängelt sich jetzt steil bergan. Immer häufiger kracht die schaukelnde Karosserie gegen den felsigen Untergrund. Funken stieben. Der Fahrer kneift jedes Mal schmerzhaft die Lider zusammen. Es scheint so, als würde er von Krämpfen gepeinigt. Sein Wagen ist für ihn wie ein empfindlicher Teil seines Körpers, doch gleichzeitig mit dem Ärger über die Widrigkeiten der Strecke wächst seine Neugier. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet er für diesen BEC-Direktor und erlebt nun zum ersten Mal, dass das Nashorn jemandem hinterherfahren muss. Demütig wie ein stellungsloser Buchhalter über Fünfzig! Ein Mann, der Senatoren und Gouverneure vor seinen Schreibtisch rufen kann! Was mag das für ein Kerl sein, der sich nicht von einem BEC-Telegramm nach New York beordern lässt? Wie sieht ein Sterblicher aus, der es fertig bringt, einen Henry Clinton über die New-Yorker Stadtgrenze hinauszulocken? Das hat nicht mal der Präsident mit seiner Einladung zum Neujahrsempfang in Washington geschafft. Soviel steht fest: Hier geht es um das nackte Leben oder ums ganz große Geld!
Auf der Strecke wächst die Zahl der Barrieren für einen Lincoln-Achtzylinder. Manchmal scheint es sogar, als würde der erbärmliche Weg auf den nächsten Metern endgültig zwischen Tannen und Felsen versickern. Das Manövrieren des schweren Straßenkreuzers erfordert die Routine eines erfahrenen Rallye-Spezialisten. Obwohl das Luxusauto mit einer tadellos funktionierenden Klimaanlage ausgerüstet ist, treten dem Fahrer Schweißperlen auf die Stirn. Er atmet auf, als sich endlich der Wald lichtet.
Einige Gebäude werden sichtbar. Ein Bergbach eilt quirlig über die weiträumige Lichtung talwärts. Nirgendwo eine Brücke oder auch nur ein Steg. Der an verschiedenen Stellen vom Gras überwucherte Weg führt quer durch das wadentiefe Bachbett zu den Hütten.
Zögernd nimmt der Fahrer den Fuß vom Pedal.
"Halten Sie bei den Holzbuden!," erklingt sofort Clintons scharfe Anweisung. Keinen vermeidbaren Schritt zu Fuß. Gewicht macht träge, besonders wenn es in einem Direktorensessel gewachsen ist.
"Wie Sie befehlen, Sir!", brummt der Fahrer. Er gibt wieder Gas.
Die Limousine rumpelt über das Hindernis. Klares Wasser spritzt hoch. Ölwanne und Auspuff reißen Steine und Erdbrocken aus dem weichen Boden.
Der Marketing-Direktor fliegt auf dem Polster hin und her, aber er verzieht keine Miene. Seine Aufmerksamkeit gilt allein der kleinen, abgelegenen Ansiedlung.
Am Waldrand stehen drei aus starken Baumstämmen zusammengefügte Blockhäuser und eine windschiefe Bretterscheune. Auf der Wiese weiden zwei angepflockte Ziegen. Im Schatten der Bäume kann man ein Gehege erkennen, in dem ein paar Hausschweine vor sich hin dösen. Laut gackernd flüchten Hühner vor dem heranrollenden schwarzen, chromblitzenden Ungetüm. Hinter der Scheune kommen drei langmähnige Kinder hervor. Man sieht ihnen nicht sofort an, ob es Jungen oder Mädchen sind. Sie mögen ungefähr gleichaltrig sein, etwa zwischen fünf und sechs Jahren. Neugierig rennen sie auf das fremde Auto zu, verharren dann aber, fast wie auf Kommando, in angemessener Entfernung und beobachten zurückhaltend das Aussteigen der Ankömmlinge.
Aus dem Inneren der kleinsten von den drei Blockhütten taucht eine füllige Frau auf. Offensichtlich bei häuslicher Arbeit gestört, bleibt sie auf der Türschwelle stehen, reibt zwei rote, dickliche Hände an der bunten Kittelschürze trocken und blickt unfreundlich herüber. Sie muss Anfang Sechzig sein, aber um ihr langes, dichtes und tiefschwarzes Haar, in das sich nur wenige Silberfäden mischen, würde sie gewiss noch manches junge Mädchen beneiden.
Kein elektrisches Licht, kein Telefon, kein Fernsehen, stellt der Fahrer mit schnellem Blick beim Verlassen des Wagens fest.
Henry Clinton geht bereits auf die dicke Frau zu. Bis zum nächsten Supermarkt sind es mindestens zwanzig Meilen, denkt er. Und ob ein Mann aus dem CIA-Stall dort auch etwas für seine spezielleren fleischlichen Bedürfnisse findet, ist fraglich. Da muss einer tatsächlich einen mächtigen Seelenknacks oder jede Menge Dreck an den Stiefeln haben, wenn er sich ausgerechnet in diese gottverlassene Gegend verkriecht.
"Ich suche Mister Bronx", erklärt Henry Clinton der schwergewichtigen Bewohnerin des Blockhauses, die ihn misstrauisch mustert. Die Körperfülle macht sie einander ähnlich. "Ich weiß, dass er hier zu finden sein muss. Epheser Dablju Bronx, wo kann ich ihn treffen?"
"Wer sind Sie, Mister?", fragt die Frau. Ihre dunklen Augen glitzern hinter wimperlosen, leicht zusammengekniffenen Lidern. Sie schaut zu der Limousine. Der Fahrer ist dabei, die Schäden an Karosserie und Wagenunterseite zu untersuchen.
"Ein Freund", erwidert das Nashorn ruhig. "Die Sache ist wichtig!"
"Wichtig für ihn oder für Sie?"
"Für uns beide!"
Die Frau überlegt, kratzt dabei eine Seite ihrer speckschweren Hüften und winkt dann eines der Kinder herbei. Ein rotblonder Knirps gehorcht der Geste. Zögernd schlurft er heran, macht einen kaum merklichen Bogen um den Fremden und sucht die Nähe der Dicken. Interessiert betrachtet er die ungewöhnliche Gestalt des Besuchers.
"Kennst du diesen Mister?", fragt die Frau.
Der Junge schüttelt seine kupferfarbigen Locken. Amüsiertes Grinsen macht sich auf seinem sommersprossigen Kindergesicht breit.
"Das ist Crumby", sagt die Frau. "Mister Bronx' Sohn."
"Ich wusste nicht, dass er Kinder hat", gesteht Henry Clinton leicht ungeduldig. Instinktiv schaut er auf seine Armbanduhr. "Sagen Sie mir endlich, wie ich zu ihm komme!"
"Es ist sein Einziger", erläutert die Frau und legt ihre Hand auf die Schulter des Jungen. "Das einzige, was ihm der Herrgott auf dieser sündigen Welt gelassen hat. - Willst du diesen Mister zu den Männern bringen, Crumby?"
Crumby nickt und grinst weiter.
"Sie arbeiten in diesem Monat auf der anderen Seite des Berges", sagt die Frau. "Eine reichliche Stunde von hier, wenn Sie gut zu Fuß sind. Der Wagen muss stehen bleiben."
"Und wenn ich hier warte?"
"Das kommt darauf an, wie viel Zeit Sie haben, Mister. Falls das Wetter so bleibt, werden sie gut vorankommen, dann sind sie morgen Abend wieder hier."
"Nein", sagt Henry Clinton entschieden. Er wirft einen Blick auf den Berg, lockert seine Krawatte und öffnet den Kragenknopf. Dann wendet er sich an den Jungen: "Gehen wir?" *
Crumby nickt, doch schon nach wenigen Schritten bleibt er stehen. "Wenn Sie Daddy wieder zurück in die Stadt holen wollen, Mister, dann können wir gleich hier bleiben. Wir gehen nicht weg aus den Bergen. Wir brauchen unsere Ruhe, mein Daddy und ich!"
"Was hast du gegen Eiscreme und Kino und Swimmingpools?"
Crumby starrt den Marketing-Direktor verdutzt an. Offenbar wecken die Worte süße Erinnerungen. "Eigentlich... Na ja!", !äußert er sich unbestimmt und wandert mit dem merkwürdig gewachsenen Mann weiter auf dem schwach erkennbaren Pfad, der an der Scheune vorbei am oberen Ende der Lichtung in den Wald führt.
Ich werd verrückt, denkt der Fahrer, der den beiden nachschaut. Unser Nashorn in Lackschuhen auf Gebirgstour! Das glaubt mir im Breakwood-Building keine Seele!
2.
Der mehr als einen Kilometer lange Hang bietet bis ins Tal hinab einen chaotischen Anblick. Dichter Wald hat hier mit dem Sturm gekämpft und die Schlacht verloren. Eine vernichtende Niederlage. Hunderte von Jahrzehnte alten, bis zu achtzig Meter hohen Silbertannen sind aus dem Boden gerissen oder wie Streichhölzer zerbrochen und gleich den Stäbchen eines Mikadospiels durcheinander geworfen worden.
Fünf Männer schuften mit handlichen, aber Kräfte zehrenden Motorbandsägen, langstieligen Äxten und Schäleisen. Sie haben den Windbruch in unsichtbare Streifen aufgeteilt. Jeder Abschnitt ein Wochenprogramm. Alle sechs Tage erscheinen unten im Tal Spezialfahrzeuge und transportieren das Langholz zum Sägewerk nach Utica.
Metallisches Kreischen der Motorsägen übertönt alle Vogelstimmen. Das Zirpen des Grillenchores und die Flüche der Holzfäller ebenso wie jenes in der Sonnenglut anhaltende, geheimnisvolle Knistern und Rascheln aus zundertrockenen Baumrinden, dürrem Reisig und dem knöcheltiefen, ausgedörrten Nadelteppich.
Während der alte Mattagan das Schäleisen stößt und seine beiden älteren Söhne die Äste, Kronen und Wurzelstöcke von den gefällten Tannen trennen, arbeitet der jüngste mit dem Pferdegespann. Zwei feiste, kraftstrotzende Kaltblüter zerren lange, glatt behauene Stämme an eisernen Ketten und Haken zum Ladeplatz.
Epheser W. Bronx und sein Sohn Crumby leben seit fünf Wochen bei der Holzfällerfamilie. Anfangs sollte es nur eine besondere Art von Urlaub in erholsamer Abgeschiedenheit werden, doch schon wenige Tage fernab der städtischen Hektik änderten diese Absicht. Der grauhaarige Gast, der wie ein Baseballprofi aussieht, überließ seinen Sohn der warmherzigen Obhut von Frau Mattagan und begleitete seitdem die vier Männer zum Windbruchgebiet. Nicht als Zuschauer, wie sich schnell herausstellte. Die Mattagans haben inzwischen längst erkannt, dass ihr Helfer keiner von den samtpfötigen Stadtaffen ist, für die nach dem ersten Liter Schweiß die Lust an jedem weiteren Handschlag erlischt. Bronx ertrug stumm, dass die Männer ihm Leinenlappen um die wunden Hände wickelten, damit er die Axt festhalten konnte. Nach der ersten Woche gaben sie ihm eine der Motorsägen und schrieben seither auch seinen Namen in die Lohnliste. Sie erfuhren von ihm, dass er ein paar Monate zuvor Witwer geworden war, als Offizier in Korea und Vietnam gekämpft und später in Washington für die Regierung gearbeitet hatte. Wie er weiter verriet, war er bald nach dem tödlichen Autounfall seiner Frau Mary im September 1971 aus dem Staatsdienst entlassen worden und fest entschlossen, niemals wieder freiwillig ein Regierungsgebäude zu betreten. Bis zu Crumbys Einschulung wollte er sich mit dem Jungen an einen Platz zurückziehen, wo es weder einen Postboten noch einen Telefonanschluß gibt. Die Blockhütten der Mattagans waren also genau das, was er sich vorgestellt hatte.
Der Holzfällerfamilie leuchteten die Überlegungen des Stadtmenschen einigermaßen ein. Der alte Mattagan hatte irgendwann mal von einem reichen Viehhändler gehört, der seiner Siamkatze Goldzähne einsetzen ließ. Weshalb sollte also ein Mann mit Collegebildung nicht die Idee haben, für eine Weile wie ein Grizzlybär zu leben! Bitte sehr, an uns Mattagans soll es nicht scheitern! Jeder Mensch muss sich seinen Himmel selbst zusammenbasteln. Aus Sehnsüchten, aus Träumen oder auch aus verrückten Einfällen.
Der jüngste Mattagan-Sohn treibt sein Gespann bergan. Zwei massige Gäule schleudern Schaum von den Mäulern. Hinter ihnen tanzen die Kettenglieder klirrend über den Boden. Epheser W. Bronx hält einen bockenden Jungstier an den Hörnern. Jedenfalls kommt es ihm so vor, wenn er die Motorsäge rattern lässt. Alle paar Minuten muss er seinen arg strapazierten Muskeln eine kurze Ruhepause gönnen. Seine Schultern schmerzen wie von Knüppeln getroffen. Er schaltet das Gerät aus und reckt den steifen Rücken. Übermorgen gehe ich mit dem Jungen zum Angeln, nimmt er sich vor. Crumby soll endlich seinen ersten Fisch fangen...
Nach einem Schluck aus der Kaffeeflasche will Epheser W. Bronx wieder nach der Säge greifen, doch er stockt mitten in der Bewegung. Zwischen den über fünfzig Meter hoch aufragenden Stämmen der Douglastannen am anderen Ende der Lichtung bewegt sich etwas. Ein Tier? Der alte Mattagan behauptet steif und fest, dass hier noch ein paar Schwarzbären umherstreifen sollen. Kreuzgefährliche Biester! Freilich hat außer ihm noch niemand auch nur einen Tatzenabdruck zu Gesicht bekommen. Doch wenn tatsächlich etwas dran ist und Crumby davon erfährt, muss ich ihn an die Leine legen, denkt Epheser W. Bronx und staunt nicht schlecht, als er gleich darauf einen Fremden erblickt.
Aus dem Wald löst sich die kuriose Gestalt des BEC-Direktors Henry Clinton. Er hat seine Jacke ausgezogen und die Krawatte abgenommen. Sein Hemd klafft bis zum Nabel auf und entblößt eine schweißnasse, dunkelbehaarte Brust. Neben dem Nashorn springt Crumby munter einher. Dem Knirps hat der lange Fußmarsch anscheinend nicht das Geringste ausgemacht.
Epheser W. Bronx runzelt die Stirn. Er kennt den schnaufend näher kommenden Mann nicht, da ist er völlig sicher, aber ein unbestimmtes Gefühl sagt ihm, dass es nun vorbei ist mit dem Leben hinter den sieben Bergen. Er zweifelt keine Sekunde daran, dass der Besucher zu ihm will. Wäre es anders, hätte Mutter Mattagan anstelle von Crumby eines der bei ihr lebenden beiden Enkelkinder mit auf den Weg um den Berg geschickt.
3.
Sie lagern am Rand der geräumten Fläche im Baumschatten. Im Dickicht des Windbruches knattern wieder die Motorsägen. Von den Mattagans befindet sich nur noch der Alte im Blickfeld der beiden Männer. Er trennt Rinde von einem zurechtgeschnittenen Stamm und schenkt den Städtern keine Beachtung.
Nur ein paar Schritte von seinem Vater entfernt dirigiert Crumby mit einem Tannenzweig zwei Tausendfüßler über eine Hindernisstrecke. Epheser W. Bronx behält seinen Sohn im Auge. "Tut mir leid für Sie, Mister Clinton, vermutlich sind Sie bei mir an der falschen Adresse", sagt er. Unbewusst pult er Harzklümpchen von seinen Fingern. Obwohl ihm bisher noch keine Sekunde lang in den Sinn gekommen ist, schon vor dem ersten Schultag seines Sohnes wieder ins Stadtleben zurückzukehren, empfindet er das überraschende Auftauchen des Marketing-Direktors und die damit verbundene Abwechslung gar nicht mehr als so unangenehm. Er fühlt sich sogar, ganz gegen seinen Willen, geschmeichelt. Ein Mann wie Clinton bückt sich nicht nach einem welken Blatt!
Die Breakwood Electric Corporation gilt bei jedermann an der Ostküste als solides, kapitalstarkes Unternehmen. Das Netz der Zweigwerke reicht bis hinunter nach Georgia. Epheser W. Bronx hat gehört, dass die Gesamtbelegschaft auf sechzig- bis siebzigtausend Mitarbeiter geschätzt wird. Werbeslogans der BEC flimmern täglich über Millionen Bildschirme. Ganzseitige Reklameanzeigen für Produkte des Konzerns fehlen in keiner der großen Zeitschriften. Die BEC ist eine Macht, das weiß Crumbys Vater.
"Ich verstehe nicht die Spur von Computern und ähnlichem Kram", gesteht er. Elektronik lässt ihn gleichgültig wie irgendeine neue Säuglingsnahrung oder die belanglosen Rekorde gefeierter, hormonell stimulierter Sportneurotiker.
"Fernsprechanlagen", korrigiert Henry Clinton. Er fährt mit dem Taschentuch über sein schweißnasses Gesicht. "Relaiszentralen, Modulationseinrichtungen, Telefone..."
"Für mich ist da kein Unterschied. Mir genügt, dass ich weiß, wie eine Nummer gewählt wird."
"In jedem Menschen steckt der Funke zu irgendeinem großen Feuer", entgegnet das Nashorn. "Führungsqualität erweist sich in der Fähigkeit, bei möglichst vielen Individuen das richtige Zündschloss zu finden."
Epheser W. Bronx legt den Kopf schief, betrachtet den schwitzenden Besucher und lächelt. "Soll ich das so verstehen, dass Sie den weiten Weg zu mir gemacht haben, um mich für die BEC ins Lodern zu bringen? Da brennt nichts, Mister Clinton. Tut mir leid, aber diesmal passt der Zündschlüssel nicht."
"Sie dürfen uns nicht unterschätzen. Ich säße jetzt bei einem kalten Drink in meinem Büro, wenn ich auch nur den leisesten Zweifel am Zustandekommen unserer Zusammenarbeit hätte... Sie sind für uns ein offenes Buch!"
"Tatsächlich?" Epheser W. Bronx lächelt immer noch. Sein Blick wandert zu Crumby, der sein Starterfeld inzwischen auf drei Tausendfüßler vergrößert hat.
"Geboren am neunten Juli neunzehnhundertdreißig in Kearny, Nebraska. Vater Maschinensetzer, Mutter neunzehnhundertsechsundfünfzig gestorben, Klassenbester, Stipendium des Cola-Konzerns für das Harvad-Studium, Juristische Fakultät, nach dem Examen Armeedienst. Zuletzt Offizier in einem Aufklärungsbataillon und Auszeichnung mit dem Silver Star für den Koreaeinsatz... Korrekt?"
Epheser W. Bronx nickt. Bis dahin habt ihr nicht viel Arbeit gehabt, denkt er.
Was Henry Clinton aufzählt, sind nur ein paar Sätze aus dem Vorwort zum Hauptkapitel. Über das meiste, was nach dem Silver Star passiert ist, weiß nicht einmal Epheser W. Bronx' Vater Bescheid.
"Neunzehnhundertneunundfünfzig im Anschluss an den Armeedienst Einstieg in die Central Intelligence Agency", fährt Henry Clinton fort und macht eine kleine, das Gewicht des Satzes unterstreichende Pause.
"Aha", äußert Epheser W. Bronx ganz ungewollt.
Dass die BEC-Schnüffler die Zugehörigkeit des Silver-Star-Trägers zur CIA herausgefunden haben, überrascht ihn nicht. Aber es macht ihn neugierig. Er ist gespannt, ob der Einfluss der Breakwood Electric Corporation wirklich bis zu den streng geheim gehaltenen Fakten seines Lebens reicht.
"Neunzehnhundertzweiundsechzig Heirat mit Mary Flunt, einzige Tochter eines bekannten Anwalts in Manhattan. Sie kam im September des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben. Ich muss zugeben, dass die Existenz des Jungen aus meinen Unterlagen nicht ersichtlich ist..."
Da fehlt noch eine Menge mehr, schätzt Epheser W. Bronx, doch der Direktor belehrt ihn schon im nächsten Augenblick darüber, dass es für die Breakwood Electric Corporation zwischen New York und San Francisco keine unzugänglichen Archive gibt.
"Dafür stimmen mit Sicherheit die Fakten, auf die es für uns ankommt", sagt Henry Clinton. "Zum Beispiel Ihre Mitarbeit am Operationsplan für die Brigade zweitausendfünfhundertsechs. Ich nehme an, Sie erinnern sich, Mister Bronx."
Und wie, denkt Epheser W. Bronx, doch er sagt kein Wort. Seine Miene behält jenen kühlen Ausdruck von Gleichgültigkeit, den er einstudiert hat wie ein Schauspieler seine Lieblingsrolle. Körperbeherrschung beginnt damit, die eigenen Gesichtszüge in jeder Situation unter Kontrolle zu behalten, so ist es ihm in Fort William, einer der CIA-Ausbildungsstätten des Ressorts für geheime Tätigkeit, beigebracht worden. Nagel des Zeigefingers unauffällig und schneidend in die innere Ecke des Daumennagelbetts pressen. Völlig auf den dadurch erzeugten Schmerz konzentrieren... Er bedurfte solcher Tricks längst nicht mehr.
"Es war Ihr erster großer Einsatz bei der CIA", behauptet Henry Clinton. "Sie saßen sogar am vierten April einundsechzig mit hinter den verschlossenen Türen."
Obwohl das Datum über elf Jahre zurückliegt, begreift Epheser W. Bronx sofort, worauf Clinton anspielt.
An jenem Frühlingstag hatte im US-Außenministerium eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates unter Vorsitz des damaligen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy stattgefunden. Außer CIA-Chef Allen Dulles, seinem Stellvertreter Richard Bissel und dem CIA-General Charles P. Cabell waren auch einige namenlose Mitarbeiter der "Company", wie man das außerhalb jeder parlamentarischen Kontrolle operierende Führungsorgan aller NATO-Geheimdienste nannte, hinzugezogen worden. Es ging um die Vorbereitung der Aktion Schweinebucht. Pläne, an deren Ausarbeitung Epheser W. Bronx mitgearbeitet hatte, fanden Kennedys Zustimmung. Die Invasion wurde beschlossen. Am 17. April erfolgte die Landung von rund 1500 Exilkubanern, die als Brigade 2506 monatelang für dieses Unternehmen ausgebildet worden waren. Epheser W. Bronx hatte zu den Männern gehört, die zweiundsiebzig Stunden schlaflos im Operationsstab verfolgten, wie Fidel Castros Kämpfer alle Pläne durchkreuzten. Anfangs hatte keiner der mit dieser Aktion befassten CIA-Mitarbeiter ernsthaft befürchtet, dass die peinliche Schlappe der Company auch personelle Konsequenzen haben würde. Die scharfe Reaktion des Präsidenten traf alle Beteiligten völlig überraschend. Kennedy verletzte damit, vermutlich unbedacht, bei einigen Dutzend zum Teil langjähriger und bewährter Geheimdienstler das existentielle Gefühl einer vermeintlich vom Staat zugestandenen Unantastbarkeit. Der Präsident eröffnete Dulles, Bissel und Cabell mit ungeschminkter Offenheit: Gemäß englischer Sitte müsste ich nach einer derartigen internationalen Blamage gehen, aber wir leben nun mal im gelobten Amerika, und hier, so fürchte ich, werden Sie diejenigen sein, welche das Feld zu räumen haben! Diese neue Spielregel blieb gültig!
Gemeinsam mit den drei Spitzen der CIA gerieten auch sämtliche niedrigen Chargen, die in die Kuba-Affäre verwickelt waren, in den Strudel nach unten. Epheser W. Bronx landete auf einem bedeutungslosen Drehstuhl im Amt für Nachrichtendienstliche Übersichten. Er musste stumpfsinnige Schreibarbeiten erledigen. Monatelang brütete er grollend. Wir sind der kranke Köter vor der Tür des Weißen Hauses, erklärte er einmal seinem jüngeren Kollegen am Schreibtisch gegenüber. Jeder aus der Präsidenten-Crew kann uns einen Tritt geben und dabei sicher sein, dass wir niemals zurückbeißen!
Sein Ärger trieb ihn damals jedoch noch nicht so weit, dass er die Company verließ. Nach der Hochzeit mit Mary Flunt und dem Einzug in das kleine, schön gelegene Haus an der Peripherie von Richmond gab es sogar Wochen, in denen er seinem Schicksal dankbar für den abwechslungslosen Bürojob war.
In den Jahren nach der Kuba-Schlappe der CIA fiel niemandem auf, dass die Seele des Epheser W. Bronx einen Knacks bekommen hatte. In ihm war einer der winzigen, noch unerforschten Pulsare aller dem Menschen innewohnenden Gefühle, Leidenschaften, psychischen und physischen Energien erloschen. Nicht die Niederlage deprimierte ihn, sondern die Tatsache, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten aus Mangel an Courage und verlogenem politischem Kalkül verdienstvolle Diener des Staates für eine auf höchster Ebene getroffene Fehlentscheidung in den Keller schickte und die Regierungshände in Unschuld wusch. Er verbarg seinen Unmut gekonnt. Selbst Mary hatte nichts davon gespürt. Nun, nach vielen Jahren, taucht dieser BEC-Direktor auf und redet, als wäre Epheser W. Bronx' Leben ein problemlos zusammengefügtes Puzzlebild.
"Man hat Sie bei der Company trotz Ihrer erwiesenermaßen exzellenten Fähigkeiten nicht wieder aus der Drecklinie zurückgeholt", erklärt Henry Clinton. "Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass Sie bei solchen Demütigungen die Schmutzarbeit in Vietnam noch bis neunzehnhundertsiebzig ausgehalten haben. Das Phönix-Programm zum Beispiel."
Die Breakwood Electric Corporation muss einen Mann ganz oben in der Company haben, registriert Epheser W. Bronx. Nur wenige Leute kannten den Decknamen für die Idee, im Süden Vietnams falsche Partisanenabteilungen operieren zu lassen, die mit Mord, Brandschatzung und Vergewaltigung überall Hass gegen die Vietcong säen sollten. Er war einer der CIA-Berater gewesen, die jenes Unternehmen leiteten.
"Sie wissen, dass ich an dieser Station ausgestiegen bin", sagt Epheser W. Bronx. Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung.
"Ja", bestätigt Henry Clinton. "Weil Sie schneller als andere begriffen haben, dass man die Kommunisten nicht mit Blut ersticken kann."
"Jede Gallone, die wir ihnen abzapfen, macht sie um zwei Gallonen stärker, nicht nur in Vietnam."
"Wir verstehen uns."
"Sind Sie da sicher?"
"Völlig! Soll ich noch davon sprechen, wie Sie mit heiler Haut aus der Company herausgekommen sind?"
"Wozu?" meint Epheser W. Bronx. Er zweifelt jetzt nicht mehr daran, dass die BEC-Leute sogar erkundet haben, was selbst den Verantwortlichen im CIA-Sektor Personal und Organisation verborgen geblieben ist.
Henry Clinton faltet das feuchte Taschentuch sorgfältig zusammen, bevor er es in die Hosentasche schiebt. Er schwitzt nicht mehr. Schweigend beobachtet er den kleinen Crumby, der sich ein paar Meter von seinem vorherigen Platz entfernt hat.
Der Junge hockt neben einem Baumstumpf und starrt gebannt auf einen Vorgang am Boden. Die beiden Männer können nicht erkennen, was vor den Füßen des Kleinen passiert.
"Wir brauchen Sie, Bronx", erklärt der Marketing-Direktor nach einer Weile. "Unser Land kann es sich nicht leisten, einen Mann Ihres Formats im Wald leben zu lassen."
"Sie sagen Amerika und meinen die Breakwood Electric Corporation", entgegnet Epheser W. Bronx ruhig. Er lässt sich nicht anmerken, dass es dem Besucher gelungen ist, Interesse zu wecken.
"Wo ist da der Unterschied?", fragt Henry Clinton gelassen. "Was für die Vereinigten Staaten gut ist, ist gut für die BEC und umgekehrt!"
"Große Worte. Ich hoffe, Sie sind damit nicht auf der Suche nach einem Mann für schmutzige Arbeit."
"Kanalarbeiter beschafft meine Sekretärin mit einem Telefongespräch." Henry Clinton schmunzelt, wird aber sofort wieder ernst. "Nein, Mister Bronx, hier geht es um mehr. Um ein Stück Zukunft, wenn Sie so wollen."
"Ich glaube nicht, dass ich mich dafür interessiere", sagt Epheser W. Bronx. Er steht auf und geht zu Crumby. Ein vorgetäuschter Rückzug ist oft wirkungsvoller als übereilte Zustimmung, das hat ihn seine Erfahrung im Umgang mit Leuten gelehrt, die etwas von ihm wollten.
Der Junge kauert vor einem Ameisenhaufen. Brodelndes Insektengewimmel. Ein Kampf tobt. Beißwütig attackieren ganze Heerscharen die drei Tausendfüßler, die Crumby Bronx in die Schlacht getrieben hat.
4.
Heinz Hageneier spielt auf seinem Cello.
Nur mit Turnhemd und -hose bekleidet, sitzt er mitten in der Messe auf einem Stuhl, den kräftigen Oberkörper leicht nach vorn über das zwischen seine gespreizten Knie gestellte Instrument gebeugt. Angeblich ein wertvolles Exemplar, hergestellt in der Werkstatt des Stradivari-Schülers Guarneri. Ein Gelegenheitskauf. Vor vier Jahren hat er fast sein gesamtes Erspartes dafür gegeben, obwohl er damals noch nicht einmal wusste, wie man den Streichbogen anfassen muss.
Seitdem ist kein Tag ohne Übung vergangen. In jedem Urlaub gibt er eine Menge Geld für Musikunterricht aus. Dennoch hört er immer wieder zum Teil sehr taktvolle, aber auch ganz unverblümte Anspielungen auf seine musikalische Talentlosigkeit. Er nimmt solche Urteile gelassen hin. Seine Freude am Musizieren bleibt ungetrübt. Er tut so, als bemerke er die neidvoll-gequälten Blicke gar nicht, mit denen zuweilen Experten das Instrument in seinen Händen betrachten.
Die leisen, weichen Klänge einer Sonate von Viotti umhüllen Heinz Hageneier auch in dieser Stunde mit jener Glückseligkeit, die sich allein Menschen offenbart, denen die wunderbare Fähigkeit eigen ist, ihre Phantasie in stillen Stunden wie Segel auszuspannen und so in Regionen zu enteilen, die einem nüchternen Realisten ewig verriegelt bleiben. Der Fünfundvierzigjährige braucht für sein Lieblingsstück keine Noten. Während er den Bogen sanft über die Saiten streicht, hält er die Augen geschlossen. Kurze, klobige Finger liebkosen das Cello erstaunlich behutsam. Seine Andächtigkeit wird in keiner Weise verletzt, wenn Klänge wie von berstendem, morschem Holz oder von kreischenden Eisenbahnbremsen die zarte Melodie sekundenlang strangulieren. Er spielt über solche Fehler hinweg, ohne eine Miene zu verziehen. Es ist, als gelängen diese Missklänge ebenso wenig an sein Ohr wie die rostigen Schreie der Möwen, die draußen vor den Fenstern das Schiff begleiten.
Der 10000-Tonnen-Schnellfrachter "Sachsenburg" hat Hoek van Holland vor anderthalb Stunden passiert und fährt nun auf Südwestkurs mit voller Maschinenkraft unter fast wolkenlosem Sommerhimmel in den Kanal ein. Schwacher Nordnordost treibt flache Wellenbuckel in die Meerenge zwischen Dover und Calais. Das schlanke Schiff liegt tief im Wasser. Randvolle Laderäume bergen Millionenwerte. Nachrichtentechnik und Elektronik. Verplombte Container. Einzelheiten sind den meisten Besatzungsmitgliedern gleichgültig. Eilfracht für Punahquan via Chittagong, allein das zählt. Eine weite, monatelange Reise, bedingt durch die Blockierung des Suezkanals, die zur zeitraubenden Route um das Kap der Guten Hoffnung zwingt.
Die Uhren zeigen 12.52 Uhr Greenwicher Zeit.
Während Kapitän Hageneier in der Messe noch ganz vom eigenen Cellospiel gefangen ist, hockt der Funkoffizier Ritter vor dem Empfangsgerät. Seine Miene verrät Besorgnis. Er notiert in fliegender Hast eine ganz und gar nicht erfreuliche Wettermeldung.
Zur selben Zeit braut der Schiffskoch Jochen Wurzel aus Leipzig in seiner Kombüse einen höchst seltsamen Trunk. Andächtig, als vollziehe er eine heilige Handlung, mischt er mehrere rohe Eier mit Traubenzucker, dem Saft von Orangen und Zitronen, einem Viertelliter Rotwein und einigen Prisen exotischer Gewürze, darunter auch eine Messerspitze voll gemahlene Yohimberinde, die er bei einem sachkundigen Spezereienhändler in Abidjan erstanden hat und seitdem wie ein Kleinod hütet. Vorsichtig berührt seine Zungenspitze die zementfarbene, schillernd schäumende Kreation, die er "Storchenbecher" nennt. Er nickt zufrieden, füllt das dickflüssige Getränk in ein Halbliterglas und macht sich damit auf den Weg zu einer der wenigen Passagierkabinen, mit denen der Frachter ausgestattet ist.
Neben der selteneren Beförderung von zahlenden Fahrgästen dienen drei kleine, behaglich eingerichtete Kammern oft mitreisenden Ehefrauen von Besatzungsmitgliedern der "Sachsenburg" als Unterkunft. Die Erlaubnis dazu wird von den meisten der verheirateten Seeleute als begehrenswerte Auszeichnung betrachtet.
Die seit Reisebeginn täglich von Jochen Wurzel gemixten "Storchenbecher" sind einem Mann des Maschinenpersonals zugedacht. Holger Sensenbeck fährt im vierten Jahr unter dem Kommando von Kapitän Hageneier auf der "Sachsenburg". Seit etwas mehr als zwei Jahren ist er mit der Kindergärtnerin Jutta aus Bad Doberan verheiratet, doch im bisherigen Verlauf ihrer Ehe füllen gemeinsame Tage und Nächte insgesamt weniger als drei Monate aus.
Die von der Reederei für die Sensenbecks eingeräumte Möglichkeit, während dieser Reise täglich beisammen sein zu können, hat das junge Paar zu einem sehr vertraulichen Vorhaben bewogen. Einem Dritten gegenüber ist ihnen davon keine einzige Silbe über die Lippen gekommen, trotzdem kennt jemand das Geheimnis.
An Bord der "Sachsenburg" wäre es eher denkbar, einen ausgewachsenen Elefanten vor der rastlosen Neugier des Kochs zu verbergen, als seinem Spürsinn irgendetwas Privates vorzuenthalten. Glücklicherweise paart sich der Schnüffeltrieb des Leipzigers in keiner Weise mit Geschwätzigkeit. Was Jochen Wurzel auskundschaftet, bleibt bei ihm verschlossen wie in einem Banktresor.
Erst nach mehrfachem, freilich ziemlich scheuem Anklopfen wird die Kammertür einen Spalt weit geöffnet. Verschlafen blinzelt ein helläugiger, junger Mann durch den Schlitz. Sein aschblondes Haar hängt zerzaust und strähnig auf die nackten Schultern herab: Er rümpft die spitze, für das Gesicht um reichlich anderthalb Nummern zu groß geratene Nase, als er das Glas sieht, das ihm der Koch strahlend entgegenstreckt.
"Was denn, schon wieder?", mault er.
"Prost!", wünscht Jochen Wurzel. Er reckt den Hals, doch es gelingt ihm nicht, an dem Maschinenassistenten vorbei ins Innere des kleinen Raumes zu blicken. "Und bitte ex, ja? Ich will das Glas gleich wieder mitnehmen!" Offensichtlich liegt ihm viel daran, dem jungen Mann keine Chance zu lassen, um den dubiosen Trank herumzukommen. Unzufrieden beobachtet er, wie Holger Sensenbeck zögernd zu schlucken beginnt. "Schmeckt doch, oder?"
Die Worte des Kochs klingen wie eine Warnung.
"Immer!" Der junge Ehemann wischt mit dem Handrücken über die Lippen. Sein Fuß blockiert die Tür. "Verglichen mit Rostschutzmittel, ein Hochgenuss!"
"Wirst mir noch dankbar sein, Junge... Aber was anderes. Ich hab gerade den Ritter getroffen. Marschrichtung Paganini. Kannst deine Taube schon mal langsam vorbereiten. In der Biskaya wird's rauschen. Gewaltig sogar."
"Hat Ritter was gesagt?"
"Nee, aber geguckt wie 'n Dackel aus der Wäscheschleuder. Kannst mir glauben, Junge, da kenne ich mich aus. Ritter gehört selbst zu der Sorte, die nie immun wird. Ich höre ihn jetzt schon an der Reling kälbern... Nun trink endlich leer. Mann!"
Hinter Holger Sensenbeck ertönt leises, wohliges Seufzen. Jemand rekelt sich genüsslich. Ein weibliches Wesen, wie unschwer zu erraten ist. Eilig schlingt der Maschinenassistent den breiigen Rest hinunter, drückt dem Koch das Glas in die Hand und schließt die Tür.
Der Schlüssel knackt im Schloss.
Jochen Wurzel steht noch einen Augenblick schmunzelnd und denkt an einen Campingplatz am Balaton. Sein Ältester geht nun schon in die Lehre. Sie haben ihn Laszlo genannt. Zur Erinnerung. Inzwischen hat der Junge vier Geschwister, und von Camping ist bei den Wurzels längst keine Rede mehr.
Auf dem Rückweg zur Kombüse nimmt der Koch wahr, dass Kapitän Hageneier, auf allen Schiffen der Reederei unter dem Spitznamen Paganini bekannt, das Cellospiel abgebrochen hat. Na also, wusste ich's doch, registriert Wurzel selbstgefällig. Bald knistert's unterm Kiel!
Nachdem der Funker die Messe wieder verlassen hat, verstaut Kapitän Hageneier zuerst sorgfältig sein Instrument, bevor er die Jacke anzieht und sich auf die Kommandobrücke begibt. Die Sturmwarnung macht ihm Sorgen. Er fürchtet weniger für die Sicherheit des Schiffes als für den Zeitplan. Die "Sachsenburg" muss ihre Seetüchtigkeit nicht mehr beweisen. Der Frachter und seine Besatzung sind mit Orkanen fertig geworden, die an Stärke kaum übertroffen werden können. Obwohl Heinz Hageneier Biskayastürme keineswegs unterschätzt, beunruhigt ihn hauptsächlich die Gefahr, wegen des schlimmen Wetters wertvolle Zeit zu verlieren. Niemand an Bord weiß so gut wie er, mwas auf dem Spiel steht.
5.
Zwischen den grell blendenden Strahlen der in kurzen Abständen entgegenkommenden Fahrzeuge schlagen die starken Halogenscheinwerfer der schwarzen Lincoln-Limousine einen weiten Lichtkanal in die Dunkelheit.
Im Gepäckraum des Wagens liegen zwei von Epheser W. Bronx in Eile gepackte Koffer.
Der kleine Crumby brabbelt und schmatzt im Schlaf. Sein Kopf ruht auf dem väterlichen Schoß. Die bestrumpften Kinderfüße knuffen das Nashorn alle paar Minuten in die Seite. Der BEC-Direktor erduldet die Stöße erstaunlich dickfellig.
"Wenn Sie erst ein paar Stunden Schlaf brauchen, setze ich Sie am Hotel ab", erwägt Henry Clinton. "Viel Zeit zum Ausruhen bleibt uns allerdings nicht."
"Ein Schlummerwinkel in Sichtweite für meinen Jungen und ein anständiger Kaffee für mich, das genügt vorläufig", erwidert Epheser W. Bronx. Er streicht sanft eine dünne Haarsträhne aus der Stirn seines Sohnes.
Wieso lasse ich mich auf diese unappetitliche Geschichte ein, anstatt friedlich mit Crumby unterm Dach der Mattagans zu liegen, fragt er sich erneut. Ist es vielleicht nur die heimliche Lust, endlich wieder die glatte, warme Haut einer Frau zu fühlen? Sehnsucht nach Straßenlärm, nach einer Speisenkarte mit zwölf eng bedruckten Seiten, nach einem Streifzug mit Crumby durch die bunten, lauten Freuden eines Vergnügungsparkes voller Karusselle, Popkornbuden, Autoskooter und Achterbahnen? Oder kann ich tatsächlich nicht leben wie die Mattagans? Bin ich zeitlebens verloren für das Dasein eines Advokaten in Scheidungs- und Alimentensachen? Will Gott, dass ich ewig ein Jäger bleibe?
Die Fragen quälen. Epheser W. Bronx muss an die Vernehmungszelle im Zentralgefängnis von Chi Hoa denken. Die Männer vom Abwehrteam der Ersten US-Marine-Division hatten ihn aufgefordert, an einem Verhör teilzunehmen. Es ging um Ling Thuy, eine zweiundzwanzigjährige, in Los Angeles geborene Vietnamesin, die als Dolmetscherin für ihn arbeitete. Nach Ansicht der Marines konspirierte sie mit den Vietcong. Er bezweifelte diese Anschuldigung. Hinter einer verspiegelten Glasscheibe ließen ihn die Marines zusehen, wie sie dem zierlichen Mädchen einen Holzpflock in den Gehörgang hämmerten. Die Schreie schreckten ihn noch nach Monaten manche Nacht aus dem Schlaf. Bevor sie starb, gestand Ling Thuy und gab auch ihren Mittelsmann preis. Ihr letzter Satz bestärkte den CIA-Mitarbeiter, nach einem Weg aus der Company zu suchen. "Unser Blut, das ihr fließen lasst, wird euch am Ende ersticken", hatte sie vorausgesagt. Die Ergebnisse des Phönix-Programms, bei dem er als Berater mitwirkte, bestätigten diese Prophezeiung längst. Allein in seinem Bereich waren innerhalb weniger Monate fast dreihundert Männer, Frauen und Kinder umgebracht worden, ohne dass von einer Schwächung der Vietnamesischen Befreiungsfront die Rede sein konnte.
Epheser W. Bronx hasste Kommunisten. Für ihn waren es Menschen, von Machthunger besessen und vergiftet vom Neid auf die Reichtümer einer Gesellschaft, in der dem Tüchtigen die Unantastbarkeit seines ererbten und erworbenen Besitzes garantiert ist. Gottlose. Feinde einer Freiheit, die dem Individuum alleiniges Entscheidungsrecht über die Gestaltung des privaten Daseins einräumt. Er sah und sieht in ihnen die gefährlichste Bedrohung für Amerika und die westliche Welt, aber nach den Erfahrungen in Vietnam hält er brutale Gewalt nicht länger für ein geeignetes Mittel, sie zu stoppen. Nach seiner Überzeugung müsste die westliche Welt ihr Wirtschaftspotential noch stärker ausspielen. Neubauwohnungen, Kühlschränke, Waschmaschinen und Farbfernseher beeindrucken mehr als Stückzahlen von Atomraketen. Hinzu kam der Tod seiner Frau. Plötzlich brachte er Verständnis für US-Soldaten auf, die in Heroin-Träume flüchteten. Vielleicht hätte er ebenfalls nach der Droge gegriffen, wenn Crumby nicht gewesen wäre.
Mit Hilfe eines befreundeten Arztes war Epheser W. Bronx sauber aus der CIA herausgekommen. Sauber heißt soviel wie "im besten Einvernehmen und ehrenhaft". Derartiges kam bei der Company nicht sehr oft vor. Normalerweise endete das Arbeitsverhältnis bei dieser Institution durch altersbedingtes Ausscheiden, durch Rausschmiss wegen nachgewiesener Unfähigkeit, was für den weiteren Lebensweg ganz erhebliche Nachteile zur Folge hatte, oder -im Falle von sicherheitsproblematischem Gesinnungswandel eines CIA-Mitarbeiters - mit einem tödlichen Unfall. Das hieb- und stichfeste Attest eines bekannten Mediziners und der Silver Star aus dem Koreakrieg halfen Epheser W. Bronx, unbehaftet vom Argwohn der Company ins Zivilleben zurückzukehren, wo ihn ein gutbezahlter Posten im New-Yorker Anwaltsbüro seines Schwiegervaters erwartete. Er wollte die Arbeit dort an Crumbys erstem Schultag aufnehmen. Bis dahin sollten ihnen noch ein paar gemeinsame Monate bleiben, fernab von den Ärgernissen des Zeitgeschehens.
Vielleicht hat Clinton Recht, und es ist tatsächlich keinem anständigen Menschen erlaubt wegzulaufen, solange dem Haus Feuer droht, überlegt Epheser W. Bronx. Und die BEC-Leute wissen genug über mich, um mir keinen Job als Krümelzähler anzubieten.
"Wir sind da", verkündet Henry Clinton.
Verdutzt fährt Epheser W. Bronx hoch und begreift, dass er eingeschlafen ist. Er blickt hinaus. Hochhäuser zu beiden Seiten. Ein Fahrzeug der Straßenreinigung kriecht an parkenden Wagen entlang. Er mustert Henry Clinton. Der Marketing-Direktor sieht nicht so aus, als habe er während der stundenlangen Fahrt ein Auge zugetan. Blässe lagert in den feisten Zügen. Unter den Lidern hängen Tränensäcke.
Der Fahrer hat ein steinernes Gesicht. Er lenkt die Limousine in eine Tiefgarage, hilft dem Nashorn beim Aussteigen und bietet sich an, den Jungen zu tragen, der auf den Armen seines Vaters noch immer schläft. Epheser W. Bronx lehnt das freundliche Angebot ab.
Der Lift bringt den Direktor, seinen Gast und den schlafenden Jungen lautlos hinauf in die sechsunddreißigste Etage. Sie wandern durch einen langen, neonbeleuchteten und menschenleeren Korridor. Trotz der frühen Stunde klappern hinter einer der Türen Fernschreiber. Aus einem anderen Zimmer klingt Männerlachen wie Ziegengemecker. Für Henry Clintons Arbeitsfeld bleibt der Wechsel von Tag und Nacht ohne Bedeutung. Bei ihm entscheiden allein geschäftliche Erfordernisse über die Länge der Arbeitszeit. Das gilt selbstverständlich auch für jeden seiner Mitarbeiter. Er verlangt, dass auf seinen Knopfdruck rund um die Uhr reagiert wird. Dafür gibt es in den Chefetagen der BEC Spitzengehälter, verbunden mit dem strikten Verbot, irgendeiner Gewerkschaft anzugehören.
Der Kaffee, den ein übernächtiger junger Mann bringt, hat die Stärke eines doppelten Mokkas. Clinton blättert während des Trinkens in einer Mappe. Epheser W. Bronx erkennt, dass es sich bei den Papieren um Seiten aus einem Fernschreiber handelt. Crumby liegt zusammengerollt, die kleine Nase fast zwischen den angezogenen Knien, in der Ecke einer Ledercouch. Vor den großflächigen Fenstern sind Jalousien herabgelassen. Durch die schmalen Schlitze schimmern die leuchtenden Farben des klaren Morgens. Die völlig geräuschlos arbeitende Klimaanlage sorgt mit einem ausgeklügelten Verhältnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für eine wohlige Atmosphäre.
"Ein wenig göttliche Fügung, und Ihre Arbeit ist beendet, noch ehe Sie damit begonnen haben", erklärt Henry Clinton. Er stellt die Tasse beiseite und lässt den Zeigefinger vom Daumen her gegen ein Papier schnippen. "Der Kahn steckt mitten in einem Orkan. Biskaya. Windgeschwindigkeiten zwischen achtundzwanzig und dreißig Metern in der Sekunde, wenn Ihnen das etwas sagt. Zwei andere Schiffe senden bereits Notsignale..."
"Auf den Herrgott ist selbst dann kein Verlass, wenn es gegen Atheisten geht", meint Epheser W. Bronx. Sein Blick überfliegt das Blatt. "Was hat das Schiff eigentlich an Bord?"
"Alles, was nötig ist, um ein komplettes Fernmeldenetz aufzubauen. Kein Schräubchen, das nicht auch von der BEC produziert wird."
"Wenn ich Sie richtig verstehe, sind die Leute tatsächlich konkurrenzfähig geworden."
"Lästig! Lästig sind sie geworden", erwidert Henry Clinton. Er reibt beidseitig und heftig sein Gesicht, als könne er damit die Müdigkeit verscheuchen. Der Ärger macht seine Stimme bissig. "Wir sind mit unseren Preisen bis nahe an die Selbstkosten gegangen, aber die Kerle haben uns noch unterboten."
"Dann überlassen Sie ihnen doch diesen Zipfel vom Markt. Das BEC-Imperium wird davon nicht gleich zusammenbrechen."
"Von wegen! Überlegen Sie mal, Bronx. Punahquan ist zwar ein kleines Land, das stimmt. Knapp eine Million Einwohner, von denen die meisten noch nie ein richtiges Telefon gesehen haben. Vor zwei Jahren hat dort noch ein Maharadscha geschaltet und gewaltet wie der liebe Herrgott, bis ihn die eignen Söhne in die Ecke gestellt haben. Zwei junge Burschen, die in Paris und Oxford offenbar mehr, als gut für sie war, in Büchern von Marx und Lenin geblättert haben. Jetzt ist aus der autokratischen Erbmonarchie eine Republik geworden. Heute das erste Parlament, morgen der Sprung von der Dampfmaschine zum Atomreaktor, so ähnlich stellt man sich das dort vor. Und wer den Leuten jetzt Telefone verkauft, der bleibt für die nächsten Jahre automatisch Lieferant für alles, was mit Nachrichtentechnik zu tun hat. Rundfunkstationen, Fernsehsender, Telegrafie -ein Milliardenmarkt auf lange Sicht... Trinken Sie noch eine Tasse? Bedienen Sie sich!"
"Vorausgesetzt, der Kunde ist zahlungskräftig", schränkt Epheser W. Bronx ein und füllt seine Tasse erneut.
"Ist er, Bronx, ist er! Blei, Kupfer, Zink, wobei die Geologen den größten Teil des Gebietes noch nicht einmal unter die Lupe genommen haben. Spektralaufnahmen der NASA aus Satelliten lassen sogar Erdöl vermuten!"
"Öl?" Epheser W. Bronx hebt ein wenig das Kinn. Erdöl ist ein Wort, das nicht nur Industrielle hellwach macht.
"Und womöglich noch Uran! Dämmert es bei Ihnen? Glauben Sie mir, auch unsere Konkurrenz aus dem Osten hat nichts zu verschenken. Ihre marktwirtschaftlichen Methoden sind strategisch konzipiert. Sie zielen auf die Rohstoffquellen." Henry Clinton drückt eine Taste des Sprechgerätes und beordert einen Mitarbeiter herbei. Dann schaut er seinen Gast an und lächelt. "Aber sie haben uns unterschätzt. Oder, wie schon des Öfteren, die eigenen Möglichkeiten überbewertet, was auf das gleiche herauskommt. Wir konnten den Kunden zwar nicht zum Vertragsabschluß bewegen, aber es ist uns gelungen, ihn unsicher zu machen, was die Zuverlässigkeit von Comecon-Partnern angeht. Ergebnis: Eine Schlinge im Kontrakt, die jetzt nur noch zugezogen werden muss."
"Die Lieferzeit, wenn ich richtig vermute."
"Ich sagte ja bereits, dass der Wald kein Platz für Sie ist." Henry Clinton nickt zufrieden. "Ganz recht, die Lieferzeit. Am dreißigsten Mai muss die gesamte Ladung in Chittagong zum Weitertransport nach Punahquan sein, oder das Geschäft platzt. Ab Mitte Juni macht die Regenzeit alle Zufahrtsstraßen für Schwertransporte in die Himalajaregion unpassierbar."
Epheser W. Bronx wirft einen Blick auf die Datumsanzeige seiner Uhr. "Noch mehr als vier Wochen", stellt er fest. "Das würden sie sogar mit einem Raddampfer schaffen."
"Die Burschen haben den Vertrag natürlich auch gelesen."
"Und die BEC hat abgewartet?"
"Jetzt kränken Sie mich, Bronx. Für uns war leicht nachzurechnen, dass die Konkurrenz eine Reservezeit von rund sechs Wochen einkalkuliert hat. Sie wollte ganz sichergehen. Aber Barry Donald, den Sie nachher kennen lernen werden, ist kein schlechter Mann. Chef unserer Informationsabteilung. Er hat nicht geschlafen oder die Daumen gedreht. Das Kombinat in Ostdeutschland musste auf Kupferdrahtimporte warten. Unsere Regie! Leider rochen sie den Braten schnell und disponierten um. Die Schweden lieferten kurzfristig im Gegengeschäft für erstklassige Auslegerkräne. Danach bescherten wir ihnen eine Falschlieferung von bestellten Transistoren, aber was passierte? Einen Teil schafften sie aus der eigenen Produktion, den Rest besorgten sie sich aus der Sowjetunion und aus Ungarn..."
"Ihr Barry Donald hatte eine Pechsträhne, wie mir scheint."
"Immerhin haben wir ihnen fast drei Wochen abgenommen."
"Und weshalb holen Sie mich dann noch?" Epheser W. Bronx schaut zu Crumby, der sich im Schlaf bewegt und vor sich hin murmelt.
"Es war nicht nur meine Entscheidung", verrät Henry Clinton. "Auch Barry Donald stimmte zu, nachdem sein Vorschlag vom Aufsichtsrat abgelehnt worden war."
"Er hatte einen Vorschlag?"
"Ja." Auch Henry Clinton beobachtet jetzt den allmählich erwachenden Jungen auf der Ledercouch. "Wäre es nach Donald gegangen, hätte die 'Sachsenburg' Rotterdam mit einer Zeitbombe unter der Wasserlinie verlassen. Froschmänner waren schon zur Stelle."
"Ein Schiffsunglück bei schwerem Sturm in der Biskaya, was könnte das Problem denn besser lösen?"
"Ein 10000-Tonner ist keine Nussschale. Und der Kapitän hat das Format, den Kasten auch noch mit einem Riesenleck in den nächsten Hafen zu bringen. Wir leben nicht mehr in den sechziger Jahren, Bronx. Jetzt sind die Meister der feinen Nadel gefragt. - Guten Morgen, Cowboy!"
Crumby blinzelt gegen die Jalousien, fährt dann jäh hoch und blickt sich verdutzt um. "Mama Mattagan, ist die auch hier?", fragt er und schaut besorgt seinen Vater an.
6.
Sturm und Meer kämpfen vereint gegen die "Sachsenburg". Wütend. Erbarmungslos. Stunde um Stunde.
Tosende Naturkräfte, die den stählernen Splitter Menschenwerk auseinander reißen, jedes Teil davon zerschmettern und in die dunkelsten Tiefen stoßen wollen.
Unerträgliches Gebrüll wie aus Höllenschlünden erfüllt die Luft.
"Neuer Kurs zwohundertfünfundfünfzig Grad!", befiehlt Heinz Hageneier lautstark ohne jeden erkennbaren Anflug von Erregung. Er steht steifbeinig auf der Kommandobrücke neben dem Ersten Offizier, der den flimmernden Radarschirm nicht aus dem Auge lässt, und blickt hinaus in das Toben.
Weiße, undurchdringlich scheinende Wände umzingeln das Schiff. Das Vordeck bleibt hinter Schaum und Gischt verschwunden. Der Frachter bockt wild, schlägt krachend in Wassergrüfte, wird auf haushohe Wellenberge geschleudert, Sekunden später von der See begraben und ihrem tödlichen Schlund gleich darauf wieder mit der gewaltigen Kraft der Dieselmotoren entrissen.
Die Männer auf der Brücke verharren an ihren Plätzen wie festgezurrt. Das Schiff gehorcht dem Willen der Menschen, bietet den entfesselten Elementen Widerstand und stößt seinen bulligen Wulstbug gleich einer riesigen Faust in die Wogen.
Nichts deutet darauf hin, dass die "Sachsenburg" in diesem Gefecht unterliegen könnte, und dennoch kriecht heimliche Angst durch das Schiff, erreicht jede lebende Seele und nistet sich ein.
Aus dem Maschinenraum telefoniert der Chief alle halbe Stunde mit der Brücke und erkundigt sich nach den Aussichten für ein Abflauen des Orkans.
Der Maschinenassistent Sensenbeck hat Freiwache. Er kniet in der Passagierkabine neben der Koje und hält die zuckenden Schultern seiner Frau. Todesfurcht schüttelt Jutta Sensenbeck. Ihr Mann hat sie noch nie so von Sinnen und taub für jedes besänftigende Wort erlebt. Auch ein starkes Beruhigungsmittel, das der Chef Steward gebracht hat, richtet wenig aus.
Wenn ich wieder in den Maschinenraum klettere, muss ein anderer bei ihr bleiben. Eine von unseren zwei Stewardessen oder Jochen Wurzel, geht es ihm durch den Kopf. Allein kann Jutta jedenfalls nicht bleiben in diesem Zustand. Mädchen, was habe ich dir mit dieser Reise bloß zugemutet!
Auf der Brücke fordert Kapitän Hageneier über Bordtelefon beim Funker die jüngsten Wettermeldungen an. Er muss mehrmals rufen, bevor er Antwort erhält. Franz Ritter leidet in seiner Funkbude schlimme Qualen. Sein Magen rebelliert. Er hängt mit grünem Gesicht über einem Plasteimer, den er vorsorglich gleich nach Eintreffen der Sturmwarnung in einer Ecke des kleinen Raumes befestigt hat. Erst das dritte Signal von der Brücke dringt ihm ins Bewusstsein. Er taumelt zum Sprechgerät und beschafft wenig später über Funk die neueste Wettermeldung.
"Zwohundertfünfundfünfzig Grad behalten wir bei!", bestimmt der Kapitän eine Viertelstunde danach.
Die "Sachsenburg" bleibt weiterhin erheblich abseits des ursprünglich vorgesehenen Kurses. Draußen ist noch nichts von einem Abflauen des Unwetters zu spüren. Vielmehr scheint es, als wüchsen die Wassergebirge sogar noch höher. Zweimal krängt der Frachter derart nach Backbord, dass selbst den erprobtesten Fahrensleuten der Atem stockt. Kentert das Schiff? Schlägt es leck und reißt Menschen wie Ladung mit in die Tiefe? So was hat es gegeben! Das passiert immer wieder und nicht nur mit einem Seelenverkäufer! Minutenlang halten die meisten Besatzungsmitglieder eine Katastrophe für nahezu unausweichlich, doch die "Sachsenburg" richtet sich auch ein drittes und viertes Mal wieder auf.
Verstohlen forschen die Männer auf der Kommandobrücke im Mienenspiel des Kapitäns nach Zeichen von Unsicherheit oder Besorgnis. Sie suchen Ermutigung und werden nicht enttäuscht. Heinz Hageneier zeigt sich besonnen, kühl und wortkarg wie eh und je. Auch wer ihn länger kennt, hat ihn während gefahrvoller Stunden nie anders erlebt. Seine Anwesenheit bewirkt auch jetzt bei der Besatzung das sichere Gefühl, aus der tosenden Hölle mit heiler Haut herauszukommen. Jeder leise Fluch klingt von seinen Lippen eher aufmunternd als ärgerlich. Wo er bei seinen Männern Furcht wittert, verliert er keine leeren Sprüche. Ein Blick von ihm, ein paar Sekunden länger als üblich, ein kaum merkliches Zuzwinkern, mehr braucht er nicht, um jemandem Mut zu machen. Jeder Hauch von Geringschätzung ist dabei ausgeschlossen.