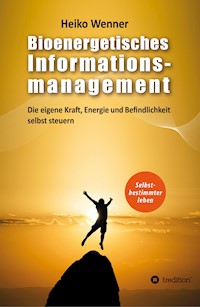3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
"Wenn auf der Pazifikinsel Togo ein Kind geboren wird, führen die Frauen des Dorfes mit der Mutter zusammen ein Ritual aus. Sie nehmen ihr Baby mit in den Wald und versammeln sich um das soeben angekommene Wesen. Sie sitzen bei dem Kind, spüren den einzigartigen Spirit des Neugeborenen und in einem bestimmten Moment produziert eine der Frauen einen Ton. Eine andere Frau fügt einen Ton hinzu, eine weitere schließt sich den beiden ersten an, und so entwickelt sich unter den Versammelten allmählich ein Lied, das völlig einzigartig und nur für das Baby bestimmt ist. Solange das Kind lebt, an seinen Geburtstagen und anlässlich anderer, rituell wichtiger Zeitpunkte versammeln sich die Frauen und singen das Lied. Und wenn das Kind etwas Böses tut oder krank ist, wird es nicht bestraft oder medizinisch behandelt, sondern die Frauen versammeln sich bei ihm und singen das Lied, um es daran zu erinnern, wer es ist. Auf diese Weise wird der Verlauf des Lebens dieses Wesens während seines ganzen Lebens mithilfe seines Liedes unterstützt. Und stirbt dieser Mensch, singt die Gemeinschaft, in der er gelebt hat, sein Lied ein letztes Mal, und danach wird es nie mehr gesungen." (aus dem Buch: "Die Heldenreise", Stephen Gilligan und Robert Dilts) Dies ist eine wunderschöne Zeremonie, die mich nachdenklich stimmte, denn seit dem ich mich erinnere, pfeife oder singe ich zu gewissen Gelegenheiten eine von mir erfundene Melodie still und leise vor mich hin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Heiko Wenner
Nur für einen selbst bestimmt.
© 2020 Heiko Wenner
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-11244-5
Hardcover:
978-3-347-11245-2
e-Book:
978-3-347-11246-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ein einzigartiges Lied
Nur für einen selbst bestimmt.
Heiko Wenner
Vorwort
„Wenn auf der Pazifikinsel Togo ein Kind geboren wird, führen die Frauen des Dorfes mit der Mutter zusammen ein Ritual aus. Sie nehmen ihr Baby mit in den Wald und versammeln sich um das soeben angekommene Wesen. Sie sitzen bei dem Kind, spüren den einzigartigen Spirit des Neugeborenen und in einem bestimmten Moment produziert eine der Frauen einen Ton. Eine andere Frau fügt einen Ton hinzu, eine weitere schließt sich den beiden ersten an, und so entwickelt sich unter den Versammelten allmählich ein Lied, das völlig einzigartig und nur für das Baby bestimmt ist.
Solange das Kind lebt, an seinen Geburtstagen und anlässlich anderer, rituell wichtiger Zeitpunkte versammeln sich die Frauen und singen das Lied. Und wenn das Kind etwas Böses tut oder krank wird, wird es nicht bestraft oder medizinisch behandelt, sondern die Frauen versammeln sich bei ihm und singen das Lied, um es daran zu erinnern, wer es ist. Auf diese Weise wird der Verlauf des Lebens dieses Wesens während seines ganzen Lebens mithilfe seines Liedes unterstützt.
Und stirbt dieser Mensch, singt die Gemeinschaft, in der er gelebt hat, sein Lied ein letztes Mal, und danach wird es nie mehr gesungen.“
(aus dem Buch:
„Die Heldenreise“, Stephen Gilligan und Robert Dilts)
Dies ist eine wunderschöne Zeremonie, die mich nachdenklich stimmte, denn seit dem ich mich erinnern kann, pfeife oder singe ich zu gewissen Gelegenheiten eine von mir erfundene Melodie still und leise vor mich hin.
Wer bin ich?
Diese Frage hatte ich mir schon als kleines Kind sehr häufig gestellt und bekam weder von meinen Eltern, noch von meinen Großeltern eine ausreichende Antwort.
Bestimmt braucht es auch seine Zeit und eine gewisse Reife und Offenheit, um auf die tiefgehende Frage über den Sinn seiner Existenz eine Antwort zu finden.
Eines Tages stellte ich mir während einer Meditation genau diese Frage „Wer bist du?“ und bekam darauf folgende Antwort:
Ich bin das Leben, ich bin der Tod.
Ich bin die Freude, ich bin die Trauer.
Ich bin die Liebe, ich bin die Gleichgültigkeit.
Ich bin das Licht, ich bin die Dunkelheit.
Ich bin die Wärme, ich bin die Kälte.
Ich bin die Stille, ich bin das Getöse.
Ich bin das Sanfte, ich bin das Aggressive.
Ich bin die Freiheit, ich bin die Abhängigkeit.
Ich bin der Richter, ich bin der Kläger.
Ich bin das Gute, ich bin das Böse.
Ich bin der Frieden, ich bin der Krieg.
Ich bin die Macht, ich bin die Ohnmacht.
Ich bin die Kraft, ich bin die Schwäche.
Ich bin der Erfolg, ich bin das Versagen.
Ich bin die Wahrheit, ich bin die Lüge.
Ich bin die Treue, ich bin die Untreue.
Ich bin die Güte, ich bin die Strenge.
Ich bin die Lösung, ich bin das Hindernis.
Ich bin die Gegenwart, ich bin die Abwesenheit.
Ich bin der Makrokosmos, ich bin der Mikrokosmos.
Ich bin überall, ich bin nirgendwo.
Ich bin „Alles“, und ich bin „Garnichts“.
Das sind meine Erkenntnisse aus einer göttlichen Eingebung im September 2017. (Heiko Wenner)
Die Prägejahre
Meine Schulzeit
Der Beginn der Lehrzeit
Meine Zeit bei der Luftwaffe
Mein Leben als Projektkoordinator in Zentralbosnien
Wieder zurück in der Heimat
Der Weg zur Bestimmung
Heiko Wenner
Höchst im Odenwald, Im Februar 2019
Teil 1
Die Prägejahre
Die Prägejahre
Mein Name ist Heiko Wenner und viele kennen mich unter meinem Pseudonym „Der Schamane aus dem Odenwald“.
Ich wurde am 22.06.1960 um 05:05 Uhr im Marien-Hospital in Darmstadt als uneheliches Kind geboren. Meine Mutter, Erika Grube gab mir die Vornamen Heiko Gottfried Ernst.
Der Geburtsurkunde wurde folgender Text nachträglich handschriftlich hinzugefügt:
„Darmstadt, den 18. Oktober 1960. Der Kraftfahrer Ernst Wenner, geboren am 24. Mai 1938 in Biebesheim, Landkreis Groß-Gerau, wohnhaft in Biebesheim, Gernsheimer Weg 13, deutscher Staatsangehöriger, hat am 1. Juli 1960 vor dem Standesamt Biebesheim (Nr. 23/1960) die Ehe mit der Mutter des Kindes geschlossen. Das Kind ist laut rechtskräftigem Beschluss des Amtsgerichts Groß-Gerau vom 15. Juli 1960 (4 VII G 475/60) ehelich geworden. Der Standesbeamte. I.V. Manneschmidt.“
Gemäß den Aussagen meiner Großmutter Rosa Grube wusste keiner aus der Familie etwas über die Schwangerschaft meiner Mutter, noch über meine Geburt. Ich wurde sozusagen verheimlicht und bis zu meinem weltlichen Erscheinen totgeschwiegen. Mein Dank gilt meiner Mutter, die trotz der damals schweren Bedingungen und schlechten Voraussetzungen, mir das Leben schenkte.
Mein Vater hat sich erst später zu mir bekannt, indem er meine Mutter heiratete. Er war zum damaligen Zeitpunkt bei der Baufirma Schäfer als Kraftfahrer und Maschinist beschäftigt.
Meine Eltern wohnten zunächst auf engstem Raum in einem ausgebauten Schuppen im Hinterhof meiner Großeltern. Am 18.09.1961 kam dann mein Bruder Thorsten zur Welt. Wie ich später von meinem Vater erfuhr, hätte sich meine Mutter ihr Leben etwas anders vorgestellt. Sie wollte ursprünglich einen gebildeten, studierten Mann mit viel Geld heiraten und hatte nun einen ungebildeten, hart schuftenden Bauarbeiter zum Ehemann und dazu noch zwei Kinder am Hals.
Ich bekam den Frust meiner Mutter sehr zu spüren. Das Kinderzimmer grenzte direkt an die Küche an. Mein Vater arbeitete schwer und kam abends erst spät nach Hause, so dass wir zu dieser Zeit meist schon im Bett lagen. Meine Mutter war wohl mit unserer Erziehung total überfordert und so kam es, dass Sie den Tagesablauf und damit hauptsächlich auch die Dinge, die nicht so gut liefen, meinem Vater erzählten. So lange das Licht noch unter der Zimmertür durchschimmerte lag ich wach im Bett und warteten darauf, Dresche zu bekommen. Erst wenn das Licht aus war, konnte ich beruhigt die Augen schließen. Wie schrecklich das für mich war, konnte sich meine Mutter mit Sicherheit in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen. Sie war zu diesem Zeitpunkt mein größter Feind. Eine Mutter, die eigentlich ihre Kinder schützen sollte, entpuppte sich als Verräterin.
Und weil dem so war, hielt ich mich sehr häufig tagsüber bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof auf. Hier hatte ich meine Ruhe und meine Großmutter Elisabeth war sehr gutmütig und geduldig mit mir.
Meine Großmutter Rosa, die auch eine sehr gütige und ausgeglichene Frau war, erzählte mir, dass meine Mutter mich oft zu Arztbesuchen und zu Gelegenheiten, wo Sie schon vorher wusste, dass Sie lange Wartezeiten in Kauf nehmen musste, mitnahm. Wenn Sie die Wartezeit verkürzen wollte, dann kniff sie mir so lange in den Hintern, bis ich anfing aus Leibeskräften zu schreien. Schreiende Kinder mag man nicht, sie nerven. So kam es, dass sie regelmäßig vorgelassen wurde. Ich war also in dieser Angelegenheit ihr Mittel zum Zweck.
Als ich dann schon etwas älter war, drohten mir meine Eltern auch des Öfteren mit den Worten „Wenn du nicht lieb und brav bist, dann kommst du ins Kinderheim“. Gesagt getan, am Mittagstisch war es dann mal wieder so weit. Meine Eltern meinten, ich wäre ungezogen gewesen und müsse jetzt ins Kinderheim. Ich war damals zwischen 4 und 5 Jahre alt und beschloss in mein Zimmer zu gehen, um mein Köfferchen zu packen. Erwartungsvoll mit den Worten „Ich möchte jetzt ins Kinderheim“ stand ich mit gepacktem Koffer vor ihnen. Erstaunt blickten sie mich an, ließen mich aber geschickt mit den Worten „wir lassen noch einmal Gnade vor Recht ergehen, aber nächstes Mal ist es dann so weit“ in der Küche stehen. Als ich hartnäckig darauf drängte jetzt ins Kinderheim gehen zu dürfen, bekam ich eine Ohrfeige und musste auf mein Zimmer gehen.
Natürlich erkannte ich damals schon ihre Strategie über unangenehme Dinge nicht reden zu wollen und sie gar zu verdrängen, denn ein Problem was man nicht sah, gab es halt nicht und man musste sich diesem Problem auch nicht stellen oder gar über eine Lösung nachdenken. Diese Begebenheit blieb mir bis heute in guter Erinnerung.
Auf dem Bad-Dürkheimer Wurstmarkt spielte sich beim Abendessen in einem Restaurant eine tragische Geschichte ab, die meinem Bruder und mir bis heute nachhaltig in schrecklicher Erinnerung blieb.
In den 60er Jahren gab es noch viele Menschen, die vom Krieg gezeichnet waren. Ein kleiner Mann auf Stümpfen kroch durch das Restaurant und bettelte um Geld. Mein Bruder sah dies und fragte meinen Vater, warum dieser Mann so klein wäre und nicht richtig laufen könne. Mein Vater entgegnete meinem Bruder: „Lügen haben kurze Beine“ und wenn du lügst, dann wird es dir wie diesem Mann ergehen. Mein Bruder bekam daraufhin einen entsetzlichen Weinkrampf und mein Vater begann lauthals zu lachen. Diese schreckliche Geschichte erzählt mein Vater heute noch oft in geselliger Runde und freut sich dabei herzlich über seine gelungene Tat. Meinem Vater ist bis zum heutigen Tag nicht bewusst, was er damit angerichtet hatte. Meinem Bruder und blieb dieses traumatische Erlebnis bis heute in schlechter Erinnerung.
Am Nikolaustag kam zu uns immer Knecht Ruprecht, gespielt von meinem Onkel Georg. Er kam mit Ketten und Stricken und knebelte uns erst einmal am Küchentisch fest, bevor er die Frage stellte, ob wir denn schön brav gewesen wären. Diese Frage hatte sich eigentlich mit seiner Knebelveranstaltung schon erübrigt und uns blieb gar keine andere Wahl, die ein oder andere unangenehme Geschichte mit weinerlicher Miene zu erzählen.
Das Knebeln und Festbinden war auch bei meinem Vater eine gängige Sache. Im Sommer nahm er mich mit zur Kiesgrube, bei der seine Firma Schäfer die Schürfrechte hatte. Ich war damals 4 oder 5 Jahre alt. Mein Vater musste dort arbeiten und hatte wohl Angst, dass ich ins Wasser fallen könnte, denn ich konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwimmen. So steckte er mich bei glühender Hitze in eine Wellblechhütte, die als Lager diente und knebelte mich sicherheitshalber noch mit einem Strick an einem Balken fest, so dass ich nicht in der Lage war, mich zu befreien. Ich konnte mich kaum bewegen und war schweißgebadet, als er mich wieder endknebelte. Ich dürfte so 3 bis 4 Stunden in dieser schrecklichen Position verbracht haben. Es war eine schier endlose Qual für mich, aber ich lies mir nichts anmerken.
Solche und ähnliche Situationen formten mich und zählten zu meinem täglichen Überlebenskampf. Ich entwickelte zunehmend die Überlebensstrategie alles erst einmal hinzunehmen, denn sich dagegen zu wehren, machte die Situation meist noch schlimmer. Ich ließ mir keine Schmerzen anmerken, schrie und weinte nicht, wenn mein Vater mich verprügelte. Diese Jahre prägten mich sehr und ich entwickelte mich innerlich unweigerlich immer mehr zum Rebellen, Einzel- und Widerstandskämpfer.
Urlaub in Thann 1965(Ich mit meinem Bruder rechts)
Ab und zu hatte ich während dieser Zeit des Nachts Träume von Menschen die ich kannte und die vom weltlichen Geschehen abschied nahmen. Einmal erzählte ich meinen Eltern von einem Mann namens Sihorsch. Er betrieb mit seiner Familie einen Bauernhof in der Nähe von München wo wir oft Urlaub machten. Ich sah in dieser Nacht wie er starb. Meine Eltern lachten darüber und nahmen mich wie immer nicht ernst, waren aber sehr überrascht, als sie nach einer Woche die Nachricht erhielten, dass dieser Mann genau in dieser Nacht verstorben war.
Ich, im Kindergarten
Ich war als Kind sehr oft alleine und hatte auch kein großes Interesse mit anderen Kindern zu spielen. Meine Mutter arbeitete mittlerweile als Erzieherin im evangelischen Kindergarten in Biebesheim. Zwangsläufig musste ich mit in den Kindergarten und an den langweiligen Geschehnissen teilnehmen. Viel lieber wäre ich bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof geblieben. Mit den Tieren hatte ich viel Spaß und manchmal durfte ich auch mit aufs Feld und den Traktor fahren. Die Kindergartenzeit ging glücklicherweise schnell vorbei. Es blieb mir nur ein Ereignis in Erinnerung. Es war zur Nikolauszeit und abends stand bei uns zu Hause wieder die Knecht-Ruprecht-Nummer an. Ein gleichaltriges Kind erzählte im Kindergarten am Vormittag vor dem abendlichen Ereignis, dass es gar keinen Nikolaus gäbe und dass alles gelogen wäre. Ich glaubte ihm nicht und rannte weinend zu meiner Mutter. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was eine Lüge war und dass ein Mensch einen anderen Menschen belügen konnte.
Meine Großmutter Rosa
Das abendliche Ereignis nahm seinen Lauf. Knecht Ruprecht kam, aber dieses Mal übernahm meine Großmutter Rosa die Rolle, da mein Onkel Georg wegen Krankheit ausfiel.
Meine schon damals herzkranke Großmutter versagte an diesem Abend kläglich. Der angeklebte Bart fiel ihr vom Gesicht und somit flog das ganze Schauspiel auf. Ich schaute meine Großmutter wohl mit großen verwunderten Augen an. Die Aktion musste daraufhin sofort abgebrochen werden, da meine Oma bei dieser Darbietung einen Herzanfall erlitt. Sie musste gestützt von meinen Eltern nach Hause gebracht und vom Arzt versorgt werden.
Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, was eine Lüge und ein Vertrauensbruch war.
Zu Ostern bekamen wir immer auch einige Schokoladenosterhasen geschenkt. Mein Vater machte nach den Osterfeiertagen ein richtiges Schlachtritual daraus. Er packte einen Osterhasen nach dem anderen aus, nahm ein scharfes Messer und setzte dieses an der Kehle des Schokoosterhasen an. Dann schrie er aus Leibeskräften und schnitt dabei den Kopf des Hasen ab. Danach war mir der Appetit auf Schokolade vergangen, denn bildlich sah ich in diesem Moment des Abschlachtens einen richtigen Hasen vor meinem geistigen Auge.
Mit meinem Bruder verstand ich mich im Allgemeinen ganz gut. Wir spielten oft zusammen in unserem kleinen Kinderzimmer. Eines Tages ärgerte er mich so maßlos und brachte mich so in Rage, dass ich meinen Bleistift, den ich gerade zum Malen in der Hand hielt in seine Kniescheibe rammte. Unglücklicherweise brach die Spitze dann auch noch ab und blieb im Knie stecken. Erst Jahre später bekam er dieses Andenken an mich während seiner Bundeswehrzeit herausoperiert.
Sage mir mit wem Du gehst und ich sage Dir wer Du bist
Ich hatte damals einen Freund namens Norbert, mit dem ich gut spielen konnte. Eines Tages erklärten mir meine Eltern, dass es nicht gut wäre mit Norbert zusammen zu sein. Die Familie wäre wegen der vielen Kinder asozial und Norbert kein guter Umgang für mich. Mit den Worten: „Sage mir mit wem du gehst und ich sage dir wer du bist“, beendeten meine Eltern mein Missfallen und ich durfte von dieser Minute an nicht mehr mit Norbert spielen. Ich begriff lange nicht warum meine Eltern so handelten und musste über diese traurige Nachricht oft weinen. Erst später erkannte ich, welche Auswirkungen diese Floskel auf mein Leben haben sollte. Dieser Satz prägte sich so in mein Gedächtnis ein, dass ich ihn bis zum heutigen Tag nicht vergessen konnte. Immer wenn ich damals jemanden zum Spielen mit nach Hause bringen wollte, fragte ich vorher meine Eltern, ob derjenige denn recht genug für sie wäre und ich ihn nach Hause mitbringen dürfe. Auch bei meinen ersten Beziehungen spielte dieser Satz eine wesentliche Rolle. Ich checkte immer im Vorfeld schon ab, ob dieses Mädchen denn für meine Eltern und erst zu guter Letzt für mich, die richtige sein würde. Erst Jahre später erkannte ich, in welche fatale Falle ich da getappt war. Ich entschied bislang nicht für mich, sondern in erster Linie im Sinne des Wohlgefallens meiner Eltern.
Ab diesem Zeitpunkt entschied ich, alles anders zu machen und jeden Menschen gleich zu behandeln. Dies blieb bis heute so. Ob reich oder arm, alle werden bei mir nach dem Gleichbehandlungsprinzip behandelt.
Teil 2
Meine Schulzeit
Meine Schulzeit
Im Herbst 1966 wurde ich dann eingeschult. Meine Klassenlehrerin war Frau Vogelsang. Sie war oft bei meiner Mutter und hat sich darüber beklagt, dass ich am Unterricht nicht so regsam teilnahm und auch in den Pausen nicht mit meinen Klassenkameraden spielte. Ich zog es vor, mich alleine zu beschäftigten. Ich fand die Schule sehr langweilig und sah keinen Sinn darin, etwas auswendig zu lernen zu müssen, dass ich nicht lernen wollte.
Meine Einschulung im Herbst 1966
So kam es, dass ich irgendwann keine Lust mehr auf Schule hatte und des Abends starke Bauchschmerzen vortäuschte. Unsere Hausärztin Frau Dr. Brand kam, um mich zu untersuchen. Ich täuschte ihr Schmerzen in der rechten Leistengegend vor, worauf sie eine eventuelle Blinddarmreizung diagnostizierte. Aus Sicherheitsgründen wurde ich in das Kreiskrankenhaus nach Groß-Gerau verlegt, wo man mich über 5 Tage lang beobachtete, um mich dann letztendlich zu operieren. Ich hatte mein Ziel erreicht und durfte natürlich über 14 Tage lang nicht zur Schule gehen.
Hinter dieser Strategie steckte zu diesem Zeitpunkt die Kernaussage, dass ich in meinem Leben alles erdenkliche Tun würde und solle es mein eigenes Leben kosten, um nicht das machen zu müssen, was ich nicht machen will.
Nun gut, zur Schule musste ich wieder aber ich lies mich nicht formen und gegen meinen Willen erziehen.
Die Entwicklung von Möglichkeiten und Lösungen
Als Kind hatte mein Bruder und ich kaum Spielzeug, also bastelte ich aus der Not heraus meine Spiele selbst. So hatten wir beispielsweise einen selbst gebastelten Pfeil und Bogen und schossen auf eine Plastikscheibe. Als uns das zu langweilig war, benutzen wir die Scheibe als Flugobjekt und warfen uns diese zu. Mein Bruder konnte die Scheibe nicht richtig fangen, sie zerschmetterte die große Wohnzimmerscheibe hinter ihm und die Glasvitrine des Wohnzimmerschrankes noch dazu. Meine Mutter hörte das laute Klirren des Glases und forderte mich nach der Begutachtung des Schadens auf, sofort meinen Vater von nebenan aus der Firma zu holen. Nach einer Tracht Prügel verlangte er von mir, bis abends dafür zu sorgen, dass die Wohnzimmerscheibe ersetzt würde, sonst wären die Folgen weitaus schlimmer. Ich setzte alles daran und ging zu einem Glaser, der ein Freund meines Vaters war und der seine Launen von Kindesbeinen an kannte. Verzweifelt weinend flehte ich ihn an, die Scheibe zu ersetzen. Er konnte wohl meinem tränenüberströmten Gesicht nicht widerstehen und reparierte die Glasscheibe nach seinem Feierabend.
Mutter vor Glasscheibe
Der Vorfall hätte eine spätere Entdeckung vorwegnehmen können, aber mein Vater hat das nicht erkannt und damit eine Riesenchance vergeben. Mein Bruder und ich hatten nämlich an diesem Tag die Wurfscheibe als Flugobjekt entdeckt, die später als „Frisbee-Scheibe“ millionenfach verkauft wurde. Wir hätten für den Rest unseres Lebens ausgesorgt gehabt.
Es ging zu dieser Zeit schon einiges zu Bruch. Einmal lief ich mit voller Wucht durch die Glasscheibe der Haustüre, ein anderes Mal ging beim Fußball spielen im Schlafzimmer der Spiegelschrank kaputt. Ich blieb dabei glücklicherweise immer unversehrt, musste aber die Konsequenzen tragen, die sich durch die harten Schläge mit einem Rohrstock durch Striemen auf meinem Körper augenfällig zeigten.
Der Ball und die Eier
Mein Bruder wurde einmal von meiner Mutter zum Eier holen geschickt. Die Nachbarn hatten viele Hühner und verkauften die Eier. Er sollte 20 Eier holen und diese in einer Schüssel nach Hause transportieren. Ich lauerte ihm auf und schoss genau in dem Moment, wo er zum Hoftor hereinkam einen Stoffball direkt auf die Schüssel mit den Eiern. Die Schüssel flog über den Kopf meines Bruders und die Eier gingen alle zu Bruch. Die gelbe Flüssigkeit der Eidotter lief ihm über die Haare ins Gesicht hinunter und war auf seinen Klamotten verteilt. Allein der Anblick war mir die daraus resultierende Tracht Prügel wert. Dies hatte ich im Vorfeld schon einkalkuliert und ertrug sie auch ohne zu zucken und zu mucken. Schade, dass ich damals noch keinen Fotoapparat besaß.
Die Zeit verging, als eines Sonntags meine Mutter, meinem Vater beichtete, dass sie schwanger wäre. Mein Vater fing an zu toben und beschimpfte meine Mutter. Es war eine gute Zeit für mich, denn meine Eltern hatten jetzt erst einmal mit sich zu tun und ließen mich in Ruhe. Ich war damals 11 Jahre alt und war von der Schule nicht gerade begeistert und meine Eltern von meiner Leistung natürlich auch nicht.
Die gefälschte Unterschrift und ihre Konsequenzen
Einmal hatte ich wieder eine Fünf im Diktat und ich wusste genau, wenn dies mein Vater erfuhr, dass es wieder Prügel gab. Bei uns zu Hause wurde der Lernstoff bei schlechten Leistungen eingedroschen und gute oder gar sehr gute Leistungen gar nicht oder nur selten gelobt, denn diese waren selbstverständlich.
Um diesen Prügeln erst einmal zu entkommen, kam mir der Gedanke einfach den Unterschriftenstempel meiner Mutter für die Abzeichnung zu verwenden, denn bei meiner Lehrerin, musste jede schriftliche Prüfung von einem Elternteil unterschrieben werden. Natürlich flog dieses Täuschungsmanöver auf, woraufhin meine Lehrerin bei meiner Mutter vorsprach. Dieser Abend war kein guter Abend für mich. Seelisch und moralisch vorbereitet gab ich mich den Schlägen meines Vaters hin. Er versohlte mich mit seinem Rohrstock so stark, dass ich mich über zwei Wochen nicht richtig bewegen konnte. Ich war am ganzen Körper grün und blau geschlagen. Das schlimmste war aber, dass er mir während der Prozedur den Mund zu hielt, so dass ich Angst hatte zu ersticken. Ich weinte nicht, ich schrie nicht, ich gab mich den Schlägen einfach hin und versuchte irgendwie mich vor dem Ersticken zu retten, indem ich seine Hand von meinem Kehlkopf wegdrückte, um immer, wenn ich es schaffte, tief Luft für die nächste Attacke zu holen. Irgendwann war auch er erschöpft und hatte keine Lust oder Kraft mehr. Ich bekam dann noch für vier Wochen Hausarrest und Fernsehverbot. Im November 1971 kam dann meine Schwester Nicole zur Welt. Zwischenzeitlich hatte ich meine Auffassung von Lernen drastisch geändert und tat alles, um von dieser Grund- und Hauptschule in Biebesheim, zur Realschule nach Gernsheim zu wechseln. Dazu musste ich einige Prüfungen ablegen, um dort aufgenommen zu werden, denn in der Grundschule stand ich mit zwei Fünfen im Zeugnis auf der Kippe, überhaupt in die nächste Klasse versetzt zu werden. Ich schaffte alle Prüfungen mit Bravour und durfte ab dem Herbst 1971 in die Realschule gehen. Ab diesem Zeitpunkt ging es mit den Noten nur noch bergauf. Ich hatte richtig Freude am Lernen und mein Klassenlehrer Herr Fiedler, verstand es mir den Lernstoff spannend zu vermitteln. Nur meine Eltern waren mit meinem Notendurchschnitt nicht zu frieden. Sie wollten nur noch Bestleistungen und „Einsen“ sehen.
Die zerbrochene Angelausrüstung
Neben der Schule und den flexiblen Einsätzen auf dem Bauernhof meiner Großeltern, ging ich mit meinem Freund Ernst am Rhein angeln. Er besaß einen Angelschein und ich durfte oft mit ihm fischen gehen. Nachdem ich das richtig beherrschte, kaufte ich mir von meinem eigenen Geld ein komplettes Angel-Set.
Die von meinen Eltern erhofften schulischen Bestleistungen hielten sich in Grenzen. Ich fand mich, gegenüber den Leistungen, die ich in der Grundschule brachte, jetzt richtig gut. Meine Eltern konnten meine Euphorie, was die Zeugnisnoten betraf, nicht mit mir teilen. Als mein Vater das Jahreszeugnis sah, lief er wütend in den Stall, wo ich meine Angelausrüstung aufbewahrte und zerbrach die Angelruten in drei Teile, zertrat den Angelkasten und warf ihn mit dem gesamten Inhalt in den Mülleimer. Mit den Worten „Ich zeig Dir, wie man angelt“, bekam ich dann wieder eine gehörige Portion Prügel und die gesamten Sommerferien über Hausarrest und Fernsehverbot.
Als zusätzliche Strafe dachte sich mein Vater noch eine besondere Zugabe aus. Ich sollte jeden Tag 50 Seiten aus einem von ihm ausgewählten Buch lesen und ihm abends den Inhalt des gelesenen Stoffes vortragen. Mein Vater war hier seiner Zeit voraus. Heute gibt es hierfür Hörkassetten oder Hörbücher. Ich war für ihn im altherkömmlichen Sinne ein moderner Tonträger.
Ich versuchte ihn zu täuschen, indem ich den Text nicht las und ihm abends einfach eine selbsterfundene Geschichte aus dem Buch „Fury“ erzählte. Das klappte genau zwei Mal und danach hatte ich ein wirkliches Problem. Mein Vater hatte sich in der Tat am Vorabend die Zeit genommen und die Geschichte, die er mir am nächsten Tag als Lesestoff auftrug, gelesen. Er hörte sich aufmerksam meinen Vortrag an, holte den Rohrstock hinter dem Radio hervor und schlug auf mich ein. Meine Aufgabe bestand ab diesem Zeitpunkt darin, 100 Seiten jeden Tag vortragen zu müssen. Das war für mich als langsamer Leser eine wahre Meisterleistung, die mich mehr als einen halben Tag meiner Freizeit kostete.
Der Pudel und die Zahnspange
Irgendwann kamen meine Eltern auf die Idee, sich noch einen Hund anzuschaffen. Es war ein silbergrauer Zwergpudel mit dem Namen „Terry“, der nun der Schoßhund meiner Mutter war. Das Ausführen von Terry überließ meine Mutter natürlich uns. Dieses Tier war total verwöhnt und bekam nur die besten Leckerlis zu fressen. Zu dieser Zeit musste ich oft zum Zahnarzt. Da mein Kiefer zu eng war, wurden mir vier gesunde Zähne gezogen und ich musste eine Spange tragen. Unser Zahnarzt stand damals schon kurz vor dem Rentenalter und es schien mir, dass er seit der Eröffnung seiner Praxis seine Geräte nie erneuert hatte. Der Bohrer wurde noch über Fußpedale angetrieben. Da die Türen zum Wartezimmer nicht Schalldicht waren, konnte ich die leidenden Schreie der Behandelten draußen miterleben. Ich war schon psychisch fertig, bevor ich überhaupt auf dem museumsreifen Behandlungsstuhl Platz nehmen konnte. Auch die Zangen schienen direkt aus der Nachkriegszeit zu stammen. Es war für mich schon ein Horror, wenn der nächste Zahnarzttermin anstand. Die Räume glichen einer Folterkammer.
Thorsten mit Terry
Hinzu kam, dass mein Vater immer darauf bedacht war, Geld einzusparen. Nach dem Motto „viel hilft viel“ justierte er meine Spange. Anstatt, wie vom Arzt empfohlen, im zweiwöchigen Abstand die Drähte um eine halbe Umdrehung enger zu stellen, machte er drei ganze Umläufe. Die Schmerzen konnte ich anfangs kaum ertragen. Meine Spange legte ich tagsüber immer an die gleiche Stelle auf der Fensterbank in der Küche ab. Eines Tages war sie verschwunden. Ich suchte sie überall und konnte sie zunächst nicht finden. Erst als ich bemerkte, dass unser verwöhnter Pudel anfing zu winseln und zu würgen, hatte ich eine Ahnung, was geschehen war. Terry hatte meine Spange im Maul und bekam sie nicht mehr raus. Es war für mein Vater auch nicht leicht, diesem vor Angst knurrenden und wehrhaften Hund, die Spange aus seinem Kiefer wieder zu entfernen. Nach mehreren Anläufen schaffte er es dann. Die Spange wurde kurz abgespült und mir zum Tragen übergeben. Nach den Ferien meldete mich meine Mutter im Fußballverein an. Das tat sie auf Empfehlung von Herrn Waigel, ein Diakon unserer evangelischen Kirchengemeinde. Er trainierte die Jugendmannschaft des KSV Biebesheim. Im Training mussten wir immer mit dem Ball auf einen mit Steinen gefüllten Koffer hin trippeln und diesen dann aus einer Entfernung von 3 Metern versuchen zu treffen. Samstags waren dann meistens Spiele gegen andere Mannschaften des Kreises, die wir häufig in zweistelliger Höhe verloren.
Meine bislang größte menschliche Enttäuschung
Meine schulischen Leistungen wurden zusehends besser und ich bekam immer mehr Spaß und Interesse mir mehr Wissen als erforderlich anzueignen. Mit meinem Freund Holger Buchhaupt ging ich oft nach der Schule an die Kiesgruben der näheren Umgebung. Dort wurde Kies geschürft. Auf langen Förderbändern wurde der aus der Tiefe geschürfte Sand und Kies in große Silos befördert. Vorher wurde er durch mehrere Siebe geleitet, so dass zu große Steine und Gegenstände ausgeworfen und zu einer separaten Halde durch ein Fördersystem transportiert wurden. Das war unser Eldorado, denn dort fanden wir versteinertes Holz, Mahl- und Stoßzähne von Mammuts und einmal sogar den Schädel eines Urpferdchens. Holger wusste genau, wo es was zu finden gab und so fuhren wir oft auch nach Gernsheim zu den Baugebieten, wo die Bagger zum auskoffern der Keller noch zu Gange waren. In Gernsheim bestand zu Römerzeiten eine Römersiedlung und wir haben dort großartige Funde, von Tontöpfen bis zu Münzen nach Hause gebracht. Meine Schätze bewahrte ich in dem Kellerraum meiner Großmutter Rosa auf. Holger wurde sogar von seinen Eltern unterstützt und er durfte den Großteil der elterlichen Kellerräume zur Aufbewahrung seiner Funde nutzen. Diese waren in Glasvitrinen gelagert. Holger sammelt heute noch und hat eines der größten privaten prähistorischen Sammlungen Hessens.
Holger sammelte auch Munition und er wusste, wo sich die versteckten Lager der US-Amerikanischen Streitkräfte befanden. Im Gernsheimer Wald gab es einige von diesen Depots aus dem 2. Weltkrieg. Einmal suchte die Polizei nach einem Schüler, der mit einer Panzerfaust auf dem Gepäckträger seines Mofas auf der Strecke von Gernsheim nach Biebesheim gesehen wurde. Es war mein Freund Holger. Glücklicherweise war ich an diesem Tag nicht dabei, sonst hätte ich auch hier wieder mein blaues Wunder erlebt. Die Zeit meiner Sammelleidenschaft wurde schlagartig durch eine unerwartete Aufräumaktion meines Vaters beendet. In einer Nacht- und Nebelaktion räumte mein Vater während meiner Abwesenheit den Kellerraum auf, wo ich meine Schätze aufbewahrte. Er warf alles in die Mülltonne, die unglücklicherweise noch am gleichen Tag geleert wurde. Ich hatte keine Chance auch nur einen kleinen Teil davon zu retten, um sie Holger zu schenken oder zur Aufbewahrung zu geben.
Ich war entsetzt und kann es bis zum heutigen Tag nicht glauben, warum ein Mensch so etwas tun konnte. Noch heute überkommt mich noch Wut, Zorn, Hass und eine sehr große menschliche Enttäuschung gegenüber meinem Vater, wenn ich an diese Aktion auch nur ansatzweise denke. Mit der Bemerkung „was willst du mit dem alten Dreck“ war die Sache für ihn erledigt.
Meine Eltern hatten zu dieser Zeit sehr viel Stress. Mein Großvater Ernst ging auf die 70 zu und wollte ein Großteil seines Vermögens auf meinem Vater testamentarisch schon vor seinem Ableben übertragen. Die landwirtschaftlichen Geräte sollte mein Patenonkel Gottfried bekommen, der im Nebenerwerb eine kleine Landwirtschaft in Stockstadt a. Rh. betrieb und sich die Geräte ohnehin schon auslieh. Meine Großeltern väterlicherseits hatten neun Kinder und irgendwie bekamen meine Tanten und Onkel heraus, dass gerade mein Vater den größten Teil des Vermögens erben sollte. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch Ärger innerhalb der Familie Wenner.
Mein Großvater lud zu seinem 70en Geburtstag alle seine Kinder nach Hause zu einer Feier ein. Der Großteil der Familie kam noch nicht einmal, um ihm zu seinem Geburtstag zu gratulieren, geschweige denn mit ihm zu feiern. Das war ihr persönlicher Protest gegen die Erbentscheidung. Kurzer Hand entschloss sich mein Großvater am nächsten Tag alle landwirtschaftlichen Geräte zu verkaufen. Zwei Tage später starb er im Krankenwagen auf dem Transport ins Kreiskrankenhaus an Herzversagen.
Jetzt ging der Erbschaftsstreit erst richtig los. Die Rechtsanwälte verdienten viel Geld. Mein Vater musste seine Geschwister ausbezahlen, was wiederum bedeutete, dass meine Mutter mit ihrem zugeteilten Haushaltsgeld sehr sparsam umgehen musste. Die Schlussfolgerung daraus war, dass sie Fleisch und Wurst nicht mehr beim direkt gegenüberliegenden Metzger einkaufte, sondern beim ALDI. Eines Tages fragte während des Mittagessens mein Vater, woher denn das Fleisch stamme. Meine Mutter entgegnete, dass sie das Fleisch beim Metzger Alex Rothermel eingekauft hätte. Ohne zu zögern nahm mein Vater seinen mit Essen gefüllten Teller und warf ihn durch die Küche mit der Bemerkung „ das können die Schweine fressen“. Er hatte natürlich den Unterschied geschmeckt und meine Mutter entlarvt.
Mein Vater war, was das Essen betraf sehr penibel. Aufgewärmtes Essen vom Vortag aß er nicht. Das Essen musste für ihn immer frisch serviert werden. Es gab zu dieser Zeit häufig Streit über Geldangelegenheiten und über das Thema Sparsamkeit zwischen meinen Eltern.
Mein erstes Mofa
Mein verstorbener Großvater hatte an mich gedacht und mir sein Mofa vermacht. Ab diesem Zeitpunkt fuhr ich morgens dann immer ganz stolz mit dem Mofa nach Gernsheim zur Schule und nicht mehr mit dem Fahrrad. Ich hatte Glück gehabt. Mein Großvater war ein Tyrann und warf in seinen besten Zeiten mit der Axt oder der Mistgabel hinter einem her, wenn es nicht so lief, wie er es sich vorstellte. Da war er bei mir ja an der richtigen Adresse. Einmal, als ich nicht seinem Willen folgte, nahm es seine Mistgabel und rannte hinter mir her. Als er merkte, dass er mir nicht folgen konnte, setzte er an und warf mir die vierzinkige Gabel wie ein Speerwerfer nach. Glücklicherweise konnte ich gerade noch einen Sprung über den Gatterzaun machen, sonst wäre die Gabel nicht im Holz, sondern in meinem Rücken stecken geblieben. Ich entkam und ließ mich nach dieser lebensgefährlichen Attacke meines Großvaters sicherheitshalber nicht mehr auf dem Hof meiner Großeltern blicken. Mein Großvater kam dann irgendwann zu mir als wäre nichts geschehen. Er brauchte mich während der Erntezeit zum Kartoffelausmachen und fragte mich, ob ich den Traktor fahren könnte.
Ich auf meinem Mofa
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und bewusst Verantwortung übernehmen
Schon während meiner Kindheit und Jugend musste ich meine Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit unter Beweis stellen, denn meine Arbeitskraft wurde auf dem Bauernhof meiner Großeltern eingefordert. Bei ihnen galt das Prinzip: „Wer morgens nicht spätestens um 5 Uhr pünktlich auf der Matte steht, ist ein Faulenzer!“. Menschen, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht arbeitsam waren, galten als Drückeberger und Nichtsnutze. Das Tageswerk musste am Abend bei meinem Großvater sichtbar sein, sonst war es kein guter Tag. Studenten, Beamte und Menschen, die geistige Arbeit verrichteten, waren für ihn nichts wert. Meine Ferien musste ich nach diesem Motto auf dem Hof arbeitend verbringen. Ich quälte mich jeden Morgen aus dem Bett heraus und fiel abends wie ein nasser Sack wieder hinein. Im Nachhinein weiß ich die harte Arbeit meiner Großeltern zu schätzen. Ich bewundere bis heute deren Disziplin, Durchhaltevermögen und den liebevollen Umgang mit ihren Tieren. Die Tiere bekamen als Allererste etwas zu fressen, bevor sich meine Großeltern selbst an den Essenstisch setzten. Das Wort Urlaub kannte keiner von ihnen. Die Verantwortung für die Tiere und die Bewirtschaftung der Felder standen im Vordergrund. Jeden Sonntag ging mein Großvater über die bepflanzten Felder und betete dabei für eine gute Ernte zu Gott. Die Felder waren seine Kirche, weit entfernt von den eigentlichen kirchlichen Bauten. Er sprach mit den Pflanzen, die ihm letztendlich eine reiche Ernte bescheren sollten. Manchmal durfte ich an diesem besonderen Ritual teilnehmen. Es war für mich immer wieder sehr eindrucksvoll, dabei sein zu dürfen. Ich erkannte, was Demut und Dankbarkeit bedeuten, und dass letztendlich der Ernteerfolg von den Gesetzen der Natur abhängig ist, denn ich habe miterlebt, wie ein Gewitter mit Hagel innerhalb von wenigen Minuten die halbe Ernte zu Nichte machte. Ich hatte verstanden, was es bedeutet, die Verantwortung für Tier und Mensch zu tragen, und wie wichtig es ist, pünktlich und zuverlässig jeden Tag seine Arbeit zu verrichten. Ich bekam eine Ahnung, wie schwer es für meine Großeltern mit zunehmenden Alter sein musste, alltäglich diese Arbeit zu leisten und spürte plötzlich in mir ein Pflichtgefühl und eine Art von Dankbarkeit, ihnen ein Teil von ihrer schweren Arbeit abnehmen zu dürfen. Während dieser Zeit entdeckte ich meine Fähigkeiten, Tieren und Menschen, die gesundheitliche Probleme hatten, energetisch zu helfen. Eines Tages, ich war gerade beim Ausmisten des Kuhstalls, kam ein Kalb auf mich zu und leckte meine Hand. Danach drehte es sich so lange vor mir herum, bis meine Hand an einer Stelle war, an der es sich offensichtlich verletzt hatte. Das Kalb verharrte in dieser Position geschätzte drei Minuten, bis es schließlich dankbar nochmals meine Hand leckte und wegging. Tiere haben ein sehr gutes intuitives Gespür für Menschen, die ihnen gut gesonnen sind. Auch mein Vater entdeckte meine Fähigkeiten und bat mich oft, wenn er einen schweren Arbeitstag hinter sich hatte, meine Hände auf seine Schultern zu legen, was ihm sehr wohl tat. Im Laufe der Zeit wurde ich neugierig und begriff, dass ich offenbar eine besondere Fähigkeit besaß. Ich begann zu experimentieren, kaufte mir Fachliteratur und verstand immer besser, dass ich Heilungsenergie entwickeln und weitergeben konnte.
Erst viele Jahre später erkannte ich, wie wertvoll es damals war, auf dem Bauernhof meiner Großeltern gearbeitet zu haben, denn dort wurde der Grundstein für mein späteres Leben als „Baubiologischer Gesundheitsberater, Energiearbeiter und Erfinder des „Bioenergetischen Informationsmanagements“ gelegt. Meine Erlebnisse und Erfahrungen haben im Laufe der Zeit enorm dazu beigetragen, dass ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin.
Meine Großmutter vertraute mir kurz vor ihrem Tot an, dass sie die Zeit richtig genossen hätte, nachdem mein Großvater tot war, ja es wäre sogar die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie erzählte mir eine Geschichte, die den Charakter meines Großvaters in seinen vollen Zügen widerspiegelte. Meine Großeltern mussten zum Führen ihres landwirtschaftlichen Betriebes die gesetzlichen Grundlagen erfüllen und auch mehrere Prüfungen als Befähigungsnachweis bestehen. Die Existenz des Betriebes war irgendwann bedroht, da sich mein Großvater keineswegs darum scherte, die Auflagen zu erfüllen. Wochenlang lag ein Mahnschreiben auf dem Küchenschrank in dem von der Landwirtschaftskammer gefordert wurde, die erforderlichen Nachweise zum Führen eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Milchwirtschaft bis zu einem gewissen Stichtag zu erbringen, oder den Betrieb einzustellen.
Meine Großmutter nahm sich schließlich der Sache an und klemmte sich dahinter. Zum vorgegebenen Prüfungstermin fuhr sie mit dem Zug nach Darmstadt, um diese Prüfungen abzulegen. Sie war damals die älteste Prüfungsteilnehmerin, bestand aber auf Grund ihrer bereits jahrelangen Erfahrung die Tests und mündliche Prüfung auf Anhieb. Sie hatte mit ihrem Einsatz die Existenz und Fortführung des Betriebes gesichert und klopfte sich selbst stolz auf die Schultern, da es ja sonst keiner machte und von der Familie alles was sie tat als selbstverständlich angesehen wurde. Sie wollte sich für das Gelingen etwas Gutes tun und bedankte sich für ihre großartige Leistung mit einem Speiseeis. Sie verlor dabei die Zeit aus ihren Augen und verpasste den Zug, so dass sie erst zwei Stunden später als erwartet zu Hause ankam.
Großmutter Elisabeth
Was nun geschehen würde, konnte sie sich im Vorfeld schon ausmalen. Sie erhielt von meinem Großvater eine ordentliche Standpauke und zur Strafe für ihr zu Spätkommen durfte sie den Rest des Abends noch im Kuhstall mit Kühe melken verbringen. Als ich diese Geschichte hörte, wurde mir klar, dass es ihr nach dem Tod meines Großvaters wesentlich besser erging. Meine Oma hatte einen Lieblingssong, der, wenn ich ihn manchmal heute im Radio höre, mich an sie erinnern lässt. Der Text war von Camillo Felgen und lautet:
Ich Hab‘ Ehrfurcht vor Schneeweißen Haaren
Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren,
sie verschönern der Mutter Gesicht.
Und sie krönen die Arbeit von Jahren,
und ein Leben in Treue und Pflicht.
Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren,
vor den Falten von Sorge und Leid.
Ich will helfen, aus den letzten Jahren,
zu machen ihre glücklichste Zeit.
Für die lieben alten Menschen,
die das Leben nie verwöhnt.
Hat mein Herz ein warmes Plätzchen,
dass sie mit der Welt versöhnt.
Weil sie in den vielen Jahren
weit mehr Leid als Glück erlebt.
Haben Sie heut‘ weiße Haare
und ein Lächeln das versteht.
Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Harren,
sie verschönern der Mutter Gesicht.
Und sie krönen die Arbeit von Jahren,
und ein Leben in Treue und Pflicht.
Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren,
vor den Falten von Sorge und Leid.
Ich will helfen, aus den letzten Jahren,
zu machen ihre glücklichste Zeit.
Ich konnte mich noch daran erinnern, dass meine Großmutter in der Küche zwei Teller mit Sprüchen an der Wand hängen hatte. Sie waren meinem Großvater gemünzt, der es noch nicht einmal bemerkte, was meine Oma damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Auf dem einen stand „Die Ruhe sei dem Menschen heilig, denn nur Verrückte habens eilig“. Bei meinem Opa musste alles schnell gehen. Er rannte wie eine wild gewordener Stier durch die Gegend, wenn etwas nicht nach seinem Plan lief. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich sicherheitshalber schnell aus seinem Dunstkreis entfernte, um schlimmeren Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Auf dem anderen Teller stand „Wer andere Jagd, wird selbst mal müde.“ Das bekamen tagtäglich die Menschen zu spüren, die mit ihm zusammenarbeiten mussten. Es waren glücklicherweise nicht viele.
Die Erkenntnisse aus meiner Kindheit
Mein Vater wuchs in dieser von Gewalt und Herrschsucht geprägten Familienstruktur auf und kannte nur diese Art von Erziehung, wie er sie erleben durfte, um sie später selbst an mir zu praktizieren. Für ihn war das alles richtig, wie er uns als Kinder erzog. Mit der Einstellung „eine Tracht Prügel oder ein Schlag auf den Hinterkopf hat noch keinem geschadet und trägt zur Steigerung des Wohlbefindens bei“, bewiesen meine Eltern ihre Unfähigkeit uns zu erziehen.
Für mich zählt heute nicht die Ausrede „ich wusste es nicht anders“, denn es steckt in jedem Menschen ein wenig Mitgefühl und Gerechtigkeitssinn. Deshalb kann und will ich meinen Eltern für ihre psychisch und physischen Foltermethoden nicht verzeihen und vergeben. Was geschehen war kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ich kann mich bemühen, darüber nachzudenken und zu philosophieren, warum es so war, wie es war. Es macht jedoch keinen Sinn und ist vergebene Liebesmühe, alles Alte aufzurollen.
Die Erkenntnis für mich liegt darin, dass der wohl lohnendste Weg nur der sein kann, selbst die Probleme, die dazu geführt hatten, zu erkennen, um es selbst besser machen zu dürfen.
Als Kind war ich machtlos und konnte mich nur selten gegen die Gewalt meines Vaters wehren. Ich entwickelte während dieser Zeit meinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich erkannte auch sehr schnell die betrügerischen Methoden, die seitens meines Vaters sehr markant waren. Er hatte seine eigenen Strategien, an Geld zu kommen entwickelt und ich musste als Mitglied der Familie mitmachen, funktionieren und den Mund halten.
Mein Vater war als Lagerverwalter auch für die Bestellungen von Waren zuständig. Handelsvertreter liefen ihm während der Hochkonjunkturphase im Baugewerbe die Bude ein. Oft schenkten sie ihm ganze Werkzeugkisten, gefüllt mit hochwertigen Werkzeug, um im Geschäft zu bleiben und wer dies nicht tat, der war so gut wie aus dem Geschäft.
Er nutzte seine Position regelrecht aus. Er verlieh häufig an Wochenenden Werkzeuge aus der Firma an Freunde und Bekannte, aber wenn er dies machte, hatte er immer einkalkuliert und war darauf bedacht, dass er diesen Freundschaftsdienst doppelt und dreifach an Wert wieder zurückbekam.
Mein Vater konnte auch ein sehr geselliger und spaßiger Mensch sein, machte sich aber oft auf Kosten von anderen Menschen lustig. Einmal kam ein Mitarbeiter mit Schnupfen zu ihm. Es ging ihm sichtlich nicht gut. Mein Vater meinte er hätte ein sehr gutes Mittel für ihn und versprach ihm, dass seine Nase danach wieder frei wäre. Mein Vater öffnete den Kanister gefüllt mit Salzsäure und bat ihn erst ein Nasenloch mit dem Finger zu schließen und durch das andere tief Luft einzuatmen. Vertrauensvoll tat er dies, bückte sich über den Kanister und atmete tief durch. Was dann geschah, kann sich jeder denken. Er verätzte sich die Nasenschleimhäute und aus seinen Augen, die herausquollen wie bei einem Frosch, rannen dicke Tränen. Mein Vater lachte lauthals und war sich den Folgen seines Tuns gar nicht bewusst.
Eine weitere Geschichte hätte noch schlimmere Folgen haben können. Die Firma Schäfer hatte den Auftrag den Altrheinarm zwischen Erfelden und Stockstadt mit einem Saugbagger tiefer zu legen, denn der Altrhein drohte in diesem Abschnitt zu versanden. Mein Onkel Herbert hatte mit zwei anderen Kollegen über Jahre hinweg an dieser Baustelle zu tun. Mein Vater war der Vorarbeiter und schaute das ein oder andere Mal unangemeldet nach dem Rechten. So kam es, dass mein Onkel im Herbst am nebelverhangenen Altrhein im Morgengrauen seinen Kontrollgang machte. Mein Vater wusste dies und lauerte ihn auf einem Baum, unter dem er darunter vorbeikommen musste auf. Als mein Onkel unter ihm war, griff er ihm von oben am Kragen seiner Jacke und schrie so laut er konnte. Mein Onkel erschrak so stark und sprang so weit weg, dass er Bob Beamen bei seinem Weitsprungweltrekord wohl übertroffen hätte. Er rannte um sein Leben und kam erst 200 m später zum Stehen. Mein Vater lachte lauthals und war sich auch hier seines Handelns nicht bewusst.
Die Entwicklung meiner Wachsamkeit
Menschen mit schwachen Nerven und Herzen waren in der Umgebung meines Vaters gefährdet und mussten immer auf der Hut sein.
Ich wusste dies und war immer besonders wachsam, wenn ich mit meinem Vater arbeitete. Einmal, als wir gerade beim Holzmachen waren, flog eine brennende Kettensäge über meinen Kopf hinweg und landete 2 Meter neben mir auf dem Boden. Der Motor lief noch. Mein Vater hatte sie weggeworfen, als sie zu brennen begann. Glücklicherweise hatte ich blitzschnell reagiert und mich geduckt, um nicht verletzt zu werden. Dies war nur eine von vielen Aktionen, bei denen ich auf der Hut sein musste.
Wie man die Fasanen rupft
Ich Spätherbst kaufte mein Vater alljährlich von den Jägern zwischen 15 bis 20 erlegte Fasanen und übergab diese meiner Großmutter zur Weiterverarbeitung. Ich musste ihr beim Ausnehmen, Abbrühen und Federnrupfen behilflich sein. Am Ende wurden die nackten Viecher über das lodernde Feuer des Holzofens gehalten, um die restlichen Federn abzusengen. Dabei entwickelte sich ein bestialischer Gestank, der mich zum Würgen brachte. Es war so unerträglich dass ich diesen Geruch bis heute in Erinnerung behielt. Im Winter gab es ausnahmslos bis ins Frühjahr hinein an jedem Wochenende Fasan mit Blaukraut und Klößen. Ich wurde zum Fasanenexperten und wusste am Ende bereits schon vorher, wo sich die Schrotkugeln verbargen. Wie ein Chirurg trennte ich die Kugeln aus dem teilweise sehr zähen Fleisch und positionierte sie provokativ auf dem Tellerrand. Wenn mir heute in einem Gourmettempel ein Fasanengericht angeboten wird, so lehne ich dies mit einer würgenden Erinnerung an meine Vergangenheit, dankend ab.
Konfirmation
Mein erstes Schweige-Retreat
Im Herbst 1974 traten mein Bruder und ich als jüngste Mitglieder dem Männergesangverein in Biebesheim bei. Es brachte uns sehr viel Spaß und wir waren mit großer Leidenschaft bei allen Veranstaltungen dabei. Einmal sollten wir im Rahmen einer feierlichen Weihung einer über 300 Jahre alten Eiche im Biebesheimer Wald, ein Gedicht aufsagen. Jeder sollte die Hälfte des Gedichtes lernen und im Rahmen der Feierlichkeiten vor den Gästen vortragen. Ich war zuerst dran und trug lauthals und mit kräftiger Stimme meinen Teil vor. Dann sollte mein Bruder den zweiten Teil übernehmen. Es kam aber nichts. Er hatte vor lauter Angst seinen Part vergessen und so lauschten ungefähr einhundert geladene Gäste über angenommene zwei Minuten dem Schweige-Retreat meines Bruders. Danach wurden noch ein paar Lieder gesungen und die Feierstunde nach der Ansprache des Bürgermeisters für beendet erklärt. Meine Eltern versanken vor Scham im Erdboden und machten mich Verantwortlich für das Versagen meines Bruders. Mit den Worten „ich hätte den zweiten Teil des Gedichtes auch noch auswendig lernen müssen“ war dieser Tag auch für mich gelaufen.
Der akute Schiefhals
Im Frühjahr 1975 wurden wir in der evangelischen Kirche zu Biebesheim konfirmiert. Mein Konfi-Spruch passte wie die Faust aufs Auge zu meiner Situation.
Konfirmationsspruch
Der Sommer 1976 blieb mir bis heute in unvergesslicher Erinnerung. Meine Eltern waren mit meiner Schwester Nicole für 14 Tage in Frankreich. Mein Bruder wollte mich morgens wecken und sprang mir mit beiden Knien auf die Brust. Ich verdrehte meinen Kopf in diesem Moment so unglücklich, dass ich ihn nicht mehr bewegen konnte. Der Arzt diagnostizierte einen akuten Schiefhals und verordnete mir eine Halskrause. Bei durchschnittlichen Temperaturen von über 30° Celsius war dies zu meiner körperlichen Einschränkung zusätzlich sehr belastend und schrecklich unangenehm. Kurz bevor meine Eltern wieder aus dem Urlaub zurückkamen, nahm ich gegen die Empfehlungen des Arztes die Halskrause wieder ab, so dass sie nichts merkten und bis zum heutigen Tag nichts davon wussten.
Die Folgen eines Wandermarathons
Im Herbst des gleichen Jahres machten meine Eltern im bayerischen Wald Urlaub. Mein Bruder und ich blieben zu Hause und nahmen mit einem Freund zusammen an einem Wandermarathon am Donnersberg teil. Mir ging es an diesem Tag nicht so gut und ich musste des Öfteren längere Pausen einlegen. Ich bat meinen Bruder mit seinem Freund schon vorzugehen. Unterwegs erbrach ich mich, machte aber trotzdem weiter und erreichte auch das Ziel. Mein Bruder und sein Freund lachten zunächst über mein schlechtes Abschneiden. Zu Hause angekommen, ging es mir am Abend sichtlich schlechter. Ich musste stark husten und röcheln. Dazu kamen dann noch starke Schmerzen im Brustbereich. Meine Tante Berta alarmierte die Ärztin, die mich sofort ins Kreiskrankenhaus nach Groß-Gerau überwies. Der dortige Notfallarzt diagnostizierte eine doppelseitige Lungen- und Rippenfellentzündung. Meine Eltern wurden gegen meinen Willen aus ihrem Urlaub zurückgeholt. Sie beschimpften mich und ich weiß bis heute nicht weshalb. Wahrscheinlich hatten sie sich ihren Urlaub anders vorgestellt, als mich zu Hause weiter zu pflegen.
Meine ersten Einblicke in die Arbeitswelt
In den Ferien verdiente ich mir etwas Geld bei der Baufirma Schäfer. Ich half dabei das Lager aufzuräumen, die Autos der Firmeninhaber zu reinigen und kam auch schon als Hilfsarbeiter auf diversen Baustellen zum Einsatz. Damals wurde auf den Baustellen noch viel Alkohol konsumiert und ich hatte alle Hand voll zu tun, die Versorgung sicherzustellen. Einige Kollegen waren vor 11 Uhr morgens gar nicht ansprechbar oder sehr schlecht gelaunt. Erst nachdem Sie ihre Promilledosis erreicht hatten, liefen sie zur Hochform auf. Meine Hauptaufgabe bestand als damals 15 jähriger darin, genügend Bier und Schnaps heranzuschleppen und für das leibliche Wohl zu sorgen. Am Abend fuhren die Kollegen dann zufrieden von der Baustelle zurück auf zum Bauhof. So ging es Tag für Tag und ich fragte mich, ob da, nach all dem Alkoholkonsum und dem Essen nach Tagesende noch etwas Geld für die Familie übrig blieb.
Teil 3
Der Beginn der Lehrzeit
Der Beginn der Lehrzeit
Die Schulzeit ging nun langsam zu Ende und ich begann, mich an verschiedenen Stellen zu bewerben. Da meine Noten recht gut waren, hatte ich keine Bedenken, eine Lehrstelle zu bekommen. Meine Eltern rieten mir, mich bei einer Behörde zu bewerben, denn als Beamter würde ich mich nicht zu Tode arbeiten, hätte mein geregeltes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz auf Lebenszeit.
Prompt bekam ich eine Lehrstelle beim Finanzamt Groß-Gerau, die ich am 01.08.1977 als Steueranwärter antrat.
Ausbildungsvertrag
Schnell merkte ich, dass dieser Verwaltungskram absolut nichts für mich war. Ich musste zwei Mal die Woche zur Verwaltungsschule nach Wiesbaden. Im Frühjahr 1978 standen die ersten Prüfungen an und ich hatte keinerlei Lust und Freude daran, mich intensiv darauf vorzubereiten. Innerlich hatte ich schon beschlossen nicht weiter zu machen. Es war die Zeit, wo mein Vater mir sehr häufig mit zu verstehen gab, dass ich zu tun hätte, was er für richtig hält. Diese Floskel „So lange Du Deine Füße unter meinen Tisch streckst, machst Du gefälligst das, was ich Dir sage“ war an der Tagesordnung. Ich überlegte mir dann schon immer, wie ich meine Füße unter diesem Tisch so schnell es ginge wegbekäme. Mein Entschluss stand fest, die Lehre beim Finanzamt abzubrechen und das Elternhaus schnellstmöglich zu verlassen. Ich plante meinen Ausstieg auf meine Art.
Mein Ausstieg nach Kanada
Ich hatte den Plan nach Kanada zu gehen und begann diese Idee akribisch vorzubereiten. Kanada war zu diesem Zeitpunkt faszinierend für mich und dieses Land „der unbegrenzten Möglichkeiten“ zog mich förmlich in seinen Bann. Im April 1978 war es dann so weit. Ich ließ mir bei meinen Eltern nichts anmerken. Absolut niemandem hatte ich von meinem Vorhaben erzählt. Nur einem guten Arbeitskollegen schwärmte ich mehrmals von Kanada vor.
Am Morgen vor meinem Abflug verabschiedete ich mich wie immer, als würde ich normal zur Arbeit gehen von meiner Mutter. Meine Arbeitstasche versteckte ich im Holzstall meiner Großmutter, wo ich meinen Rucksack mit den wichtigsten Utensilien schon Tage zuvor deponiert hatte. Neben meinem Reisepass hatte ich neben Geld auch meine 10 Dollar Silbermünzen von den olympischen Spielen, die 1976 in Kanada stattfanden, im Gepäck. Diese Gedenkmünzen galten in Kanada auch als offizielles Zahlungsmittel. Am Flughafen in Frankfurt angekommen, kaufte ich mir ein Hin-Flugticket nach Montreal, denn ich wollte ja in Kanada bleiben. Alles lief perfekt wie am Schnürchen, bis ich in Montreal durch die Passkontrolle musste. Es gingen alle Sirenen an. Zwei in deutscher Zolluniform gekleidete Beamte kamen auf mich zu und nahmen mich erst einmal mit. Sie filzten mich regelrecht, entleerten meinen Rucksack und ich musste mich bis auf die Unterhosen ausziehen. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir geschah und es erklärte mir auch erst einmal niemand, warum sie das mit mir anstellten. Erst nachdem sie nichts Auffälliges außer meinen Münzen fanden, erklärten sie mir, dass ich für die Einreise nach Kanada ein Visum benötige. Nach der Klärung weiterer unangenehmer Fragen drückten sie mir dann einen Stempel in meinen Reisepass, der mir eine Aufenthaltsdauer von zunächst einmal acht Wochen in Kanada garantierte. Immerhin, ich hatte es geschafft, nach Kanada einzureisen. Ich beschloss zunächst einmal für 3 bis 4 Tage in Montreal zu verbringen, um meine Ausrüstung für die Wildnis zu komplettieren. Neben einem Jagdgewehr, einer Leuchtpistole, entsprechender Munition, einer Axt, einem Zelt und Schlafsack, kaufte ich mir noch ein paar Klamotten, blieb dann noch zwei Tage in Montreal und machte mich dann zunächst mit dem Bus auf den Weg in Richtung Norden. Ich blieb in der Provinz Quebec und stieg in Rawdon aus. Es war Anfang April, in den Wäldern lag noch verbreitet Schnee und ein Großteil der Flüsse und Seen waren noch zugefroren. Ich suchte mir vor Anbruch der Dunkelheit einen geeigneten Platz zum Übernachten. Ich schlug mein Zelt auf und unterfütterte meinen Schlafplatz mit viel Moos, um weich und nicht direkt auf dem noch frostigen Waldboden in meinem viel zu dünnen Schlafsack zu liegen. Am nächsten Tag zog ich weiter und kam zu einer verlassenen Hütte. Die Tür stand offen und so suchte ich hier erst einmal für die nächsten Tage Unterschlupf. Am nächsten Tag hörte ich das Geräusch von Maschinen im Wald. Ich ging der Sache nach und machte Bekanntschaft mit einem französisch sprechenden Waldarbeiter. Mein Schulfranzösisch reichte, um mit ihm ein wenig reden zu können. Ihm gehörte das Waldgebiet und er lebte von dem Holz, das er verkaufte. Ich fragte ihn, ob er mich als Arbeitskraft gebrauchen könne. Er entgegnete mir, wenn Du eine Arbeitserlaubnis und Papiere hast, dann ja, ohne diese Erlaubnis, nein. Natürlich hatte ich keine gültigen Papiere und somit wurde mein Traum vom Arbeiten in Kanada mit einem Mal zu Nichte gemacht.
Nach dieser Absage war ich sehr niedergeschlagen und ich hatte das Gefühl, dass die Welt für mich abrupt zusammenbricht. Seit Tagen hatte ich nur wenig gegessen und mein Gemütszustand war auf dem Tiefpunkt angelangt. Ich fühlte mich als Versager und Verlierer. Ich wusste, dass meine Mission gescheitert war. An diesem Tag beschloss ich mir das Leben zu nehmen. Ich holte mein Jagdgewehr, das ich bisher noch nicht benutzt hatte, legte eine Patrone in den Lauf und nahm die Mündung des Gewehres in meinen Mund. Ich drückte ab. Stille und Ruhe umsäumte mich. War ich nun tot? Nein, der Abzug klemmte. Ich versuchte das Gewehr zu reparieren und stellte fest, dass die Verriegelungskammer nicht richtig schloss. Das Gewehr war defekt und für mich unbrauchbar.
Heute, über 40 Jahre später bin ich dankbar dafür, dass meine Schutzengel diesen Selbsttötungsversuch verhindern konnten. Was hätte ich alles versäumt. Mein geschriebenes Buch war zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht zu Ende.
Am nächsten Tag besuchte ich den Waldarbeiter, teilte ihm mit, dass ich nach Montreal gehen würde und schenkte ihm mein Gewehr. Verzweifelt ging ich zur nächsten Polizeistation und bat dort um Hilfe. Die Polizisten schauten mich erstaunt an, begutachteten meinen Reisepass und teilten mir mit, dass sie nichts für mich tun könnten, denn ich hätte ja ein gültiges Visum, welches erst in 5 Wochen auslaufen würde. Dann könne ich gerne wieder kommen.
Verwirrt über die Situation streifte ich ziellos durch Montreal. In einer Einkaufspassage sprach mich ein Mann mittleren Alters in englischer Sprache an und fragte mich, ob er mir helfen könne. Ich erklärte ihm meine Lage