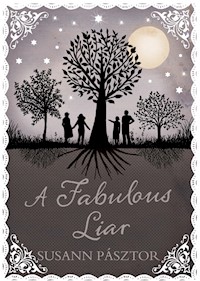7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Geheimnis eines Mannes, an dessen Totenbett drei Frauen weinten Joschi Molnár bleibt ein Rätsel. Der famose Fabulierer hat seinen Kindern ein Vermächtnis aus phantastischen Geschichten, tragischen Verstrickungen und faustdicken Lügen hinterlassen.Als sich die Halbgeschwister Hannah, Marika und Gabor in Weimar treffen, um Joschis hundertsten Geburtstag zu feiern, prallen Welten aufeinander. In rasanten Dialogen und skurrilen Szenen nähern sie sich der Wahrheit – und finden zueinander. Während Hannah sich leidenschaftlich mit ihren jüdischen Wurzeln identifiziert und von einem Happy End in Israel träumt, hadert Gabor mit seiner Kindheit. Marika gibt die tapfere Alleinerziehende – und überlässt das Erzählen ihrer Tochter Lily. Überhaupt Lily: Die 16-Jährige hat sich eigentlich für ein Referat über Buchenwald gemeldet und erzählt stattdessen diese bezaubernde Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Susann Pásztor
Ein fabelhafter Lügner
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Susann Pásztor
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Susann Pásztor
Susann Pásztor, geboren 1957, lebt in Berlin und hat nach ihrem Studium zuerst als Kinderbuchillustratorin gearbeitet, bevor sie zu schreiben begann. Seit 1991 arbeitet sie als freie Journalistin, Autorin, Texterin und Übersetzerin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Joschi Molnár hatte fünf Kinder mit fünf verschiedenen Frauen, verlor zwei Kinder und seine zweite Frau in Auschwitz, war Häftling in Buchenwald – und hinterließ ein Vermächtnis aus phantastischen Geschichten, tragischen Verstrickungen und faustdicken Lügen. Dreißig Jahre nach seinem Tod bringt sein Geburtstag die Geschwister zum ersten Mal zusammen. Ganz unterschiedliche Vaterbilder kommen zum Vorschein: der Verräter. Der Abwesende. Der Geschichtenerzähler – und: der Tausendsassa mit Witz und Ideen.
Während Hannah sich leidenschaftlich mit ihren jüdischen Wurzeln identifiziert und von einem Happy End in Israel träumt, hadert Gabor mit seiner Kindheit und bezweifelt Joschis jüdische Herkunft. Marika gibt die tapfere Alleinerziehende, verehrt Joschi für seinen Einfallsreichtum – und überlässt das Erzählen ihrer Tochter Lily. Überhaupt Lily: Die 16-jährige hat sich eigentlich für ein Referat über Buchenwald gemeldet und erzählt stattdessen diese bezaubernde Geschichte.
Was folgt, ist ein Wochenende voller Überraschungen, Missverständnisse, Streitereien, Geständnisse und Gelächter. Als Lily einen illegalen nächtlichen Festakt zu Joschis Ehren durchsetzt, ist der entscheidende Schritt zur Versöhnung getan – auch wenn der erst mal auf eine Polizeiwache in Weimar führt.
Mit feiner Beobachtungsgabe, großem Einfühlungsvermögen und viel Humor erzählt Susann Pásztor eine Familiengeschichte, in der das Tragische und das Komische ganz eng beieinanderliegen.
»Einfühlsam und respektlos, ernst und komisch. Und bei alledem mit hinreißender Leichtfüßigkeit.« WDR 5
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2010, 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Christoph Eberle – aus der plainpicture Kollektion Rauschen
ISBN978-3-462-30171-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Danke
Prolog
An einem sonnigen Herbstmorgen im September 1959 schickte József Molnár sich an, seinem Leben ein Ende zu setzen. Schon am Abend zuvor hatte er in einer Bahnhofsgaststätte nach passenden Abschiedsworten für seine Liebsten gesucht und die drei Briefe eingeworfen. Er nahm sich ein Zimmer in einem Stundenhotel, das sich in einem ehemaligen Luftschutzkeller im Zentrum der Stadt befand und ihm von früheren Besuchen vertraut war. Nachdem er mehrere Schlaftabletten mit etwas Wasser hinuntergewürgt hatte, legte er sich auf den ehemals rosafarbenen Bettüberwurf, betrachtete die Stockflecken und den abblätternden Putz an der Decke, lauschte dem tropfenden Wasserhahn und dem Verkehr, der über ihn hinwegrollte, und wartete auf den Tod.
Doch das, was er fürs Sterben hielt, war nur ein weiterer Anfang vom Ende, und anstelle des Todes erschien der Wirt und später dann ein ruppiger Notarzt, denn József hatte nur für zwei Stunden bezahlen können, und das reichte nicht zum Sterben. Und so kam es, dass sich am Tag darauf drei Menschen um ein anderes Bett versammelten – ein Krankenhausbett diesmal mit sauberen weißen Laken – und ihre Augen besorgt auf Józsefs blasses, erschöpftes Gesicht richteten. (Er hatte allen Grund, blass und erschöpft auszusehen. Magenauspumpen ist keine Kleinigkeit und ein gescheiterter Selbstmord ebenso wenig, zumal dessen Anlass auch noch nicht aus der Welt geschafft war.)
Drei Frauen waren es, die sich über ihn beugten und dabei sorgfältig darauf bedacht waren, Abstand voneinander zu halten. Zwei von ihnen waren einander noch nie begegnet und würden es auch nie wieder tun. Sie waren beide schwanger. Eine stand kurz vor der Niederkunft, während die andere erst seit ein paar Tagen wusste, dass sie guter Hoffnung war, und guter Hoffnung war sie, weil es nichts auf der Welt gab, das sie mehr wollte als diesen müden, schmächtigen Mann, der lieber tot gewesen wäre. Die dritte hatte schon ein Kind von ihm. Es war zwölf Jahre alt und nicht glücklich.
Sie weinten alle drei, denn für jede von ihnen gab es Grund genug. Schließlich hätte die eine beinahe ihren Ehemann, die andere den, den sie endlich heiraten wollte, und die dritte einen Ex-Gatten verloren, von dem sie sich einst schweren Herzens und trotz tiefster Verbundenheit getrennt hatte. Sie schluchzten aus Schmerz und aus Hilflosigkeit, aber auch aus Verlegenheit, denn am Bett eines überlebenden Selbstmörders konnte man nicht einfach übereinander herfallen, und einem überlebenden Selbstmörder eine Szene zu machen ging auch nicht, jedenfalls nicht gleich. Das wusste József auch, aber es machte die Sache nicht besser.
Nachdem sie reihum ihrem Kummer Ausdruck verliehen hatten, wurde es still im Raum, weil keiner von ihnen so recht wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Aber wir befinden uns schließlich in den ausgehenden Fünfzigerjahren, und da respektierte man noch so etwas wie eine gesellschaftliche Rangfolge: Ehefrau kam vor Ex-Ehefrau kam vor Geliebter. Und so zogen sich nach einer Weile zwei der Frauen diskret, wenn auch widerstrebend zurück, die eine für immer, die andere für mindestens eine halbe Stunde, und József Molnár blieb mit seiner Frau allein.
1
In meiner Familie lernt man sich oft sehr spät kennen und manchmal überhaupt nicht. Dafür wird sehr viel über andere Familienmitglieder nachgedacht, vor allem dann, wenn man nichts über sie weiß oder lieber nichts wissen will. Und es werden Geschichten erzählt, bei denen man nie sicher sein kann, ob sie wahr sind oder nicht und wer sie erfunden haben könnte. Denn das, was andere Familien ihren Stammbaum nennen, ist bei uns eine Art Sudoku, an dem seit Jahren gearbeitet und vor allem herumradiert wird, weil jedes Mal ein anderes Ergebnis herauskommt. Die Geschichten wollen einfach nicht zusammenpassen. Manche schließen sich gegenseitig aus, andere überbieten sich mit blumigen Details, und zum Nachfragen ist es sowieso zu spät, weil es niemanden mehr gibt, der eine Antwort wüsste. Denn das ist das Einzige, was die Geschichten gemeinsam haben: Ihre Helden sind alle tot.
An diesem Wochenende wäre mein Großvater József, genannt Joschi, hundert Jahre alt geworden. Mein Großvater war ein Mann, dem seine Frauen und Kinder abhandenkamen wie anderen Leuten Socken oder Kugelschreiber. Wenn es nicht das Schicksal war, das sie ihm wegnahm, sorgte er selbst dafür, dass er sie verlor. Leider bin ich ihm niemals begegnet. Als er starb, waren meine Mutter und Hannah nur ein paar Jahre älter als ich heute. Ich bin sechzehn. Hannah und meine Mutter sind Halbschwestern. Sie waren vierzehn, als sie sich zum ersten Mal sahen, und seitdem sehen sie sich öfter. Hannah ist fünf Monate jünger als meine Mutter. Über dieses Thema ist in meiner Familie sehr viel nachgedacht worden, und Geschichten dazu gibt es haufenweise.
Die Idee, Joschis hundertsten Geburtstag zu einem Familientreffen der besonderen Art zu machen, war von Hannah gekommen, aber ohne meine Unterstützung wäre sie garantiert am Widerstand meiner Mutter gescheitert. Das eine Problem war Buchenwald. Das andere Problem war Gabor. Bei Buchenwald hatte meine Mutter schließlich selbst eingesehen, dass es für sie an der Zeit war, endlich den Ort aufzusuchen, an dem ihr Vater inhaftiert gewesen war. Mit Gabor sah die Sache anders aus. Gabor ist auch ein Kind meines Großvaters, obwohl man bei einem über Sechzigjährigen kaum noch von einem Kind sprechen kann. Meine Mutter kannte Gabor schon immer, aber dass er ihr Halbbruder ist, erfuhr sie auch erst mit vierzehn. Seit etwa dreißig Jahren hatten sie nichts mehr voneinander gehört. Es würde sicherlich aufregender klingen, wenn ich jetzt sagte, wir hätten Gabor irgendwo aus dem australischen Outback oder einer abgelegenen Wetterstation in Sibirien ausgraben müssen, aber wir fanden ihn im Adressbuch meiner Mutter. Er lebte seit mehr als drei Jahrzehnten etwa 400 Kilometer von uns entfernt, immer im selben Haus in derselben Straße mit derselben Telefonnummer, die meine Mutter Jahr für Jahr erneut in ihren Kalender eintrug, ohne jemals den Wunsch zu verspüren, ihn mal anzurufen. Sie hätten sich nichts zu sagen, war ihre Erklärung, die ich allein schon deswegen sehr verdächtig fand, weil es praktisch nichts auf der Welt gibt, wozu meine Mutter nichts zu sagen hätte. Hannah war zwar auch der Meinung, dass ein gewisses Risiko damit verbunden war, Gabor zu diesem Treffen einzuladen, aber sie bestand auf Vollzähligkeit, und da es als gesichert galt, dass die ersten beiden Kinder von Joschi in Auschwitz umgekommen waren und niemand sonst über weitere Namen, Hinweise oder konkrete Informationen verfügte, war die Runde mit Gabor komplett. Und mit mir natürlich, der einzigen Enkelin, soweit uns das bekannt war.
Ich hatte angeboten, Gabor anzurufen, weil ich es aufregend fand, einen unbekannten Onkel mit »Hallo, hier ist deine Nichte« zu begrüßen, aber Hannah meinte, das sei ihre Sache, und sie hat es tatsächlich hingekriegt, ihn zum Kommen zu überreden. Sie sagte hinterher, es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen. Meine Mutter behauptete, er habe garantiert Geld dafür verlangt, aber das glaube ich nicht, zumal ich sie noch keinen einzigen freundlichen Satz über Gabor habe sagen hören. Als ich Hannah nach ihrem Verhältnis zu Gabor fragte, erzählte sie mir, sie habe sich ein paar Jahre nach Joschis Tod zum ersten Mal mit ihm getroffen, und sie hätten einfach keinen Draht zueinander gekriegt. Auch das fand ich irgendwie verdächtig. Hannah ist diejenige, die sich am meisten bei unserem Familiensudoku engagiert, und dass ausgerechnet sie eine Informationsquelle über Jahrzehnte vernachlässigte, erschien mir ziemlich unprofessionell. Es musste ja nicht gleich Liebe sein. Als ich ihr das sagte, lachte sie und meinte, sie sei gerne bereit, ihre Meinung nach all den Jahren zu ändern, aber dafür müsse sie auch einen guten Grund haben. Ich muss sagen, allmählich wurde ich sehr neugierig auf meinen Onkel.
Unser Plan sah vor, dass wir uns am Freitag auf dem Bahnhof in Weimar treffen würden, um Gabor vom Zug abzuholen und dann gemeinsam zum Hotel zu fahren. Für Samstag stand Buchenwald auf dem Programm, und Sonntag war Joschis Geburtstag, aber wie wir den eigentlich begehen wollten, konnte sich niemand so recht vorstellen. Mein Vorschlag, einen Stern nach ihm zu benennen oder wenigstens ein Hochdruckgebiet (ich hatte mich erkundigt, die Chancen auf eins mit dem Anfangsbuchstaben J standen für Mitte Oktober gut), war gnadenlos abgeschmettert worden. Wenn es überhaupt ein Wetterphänomen gäbe, mit dem man Joschi vergleichen könne, sagte meine Mutter, dann ginge es wohl eher in Richtung Windhose. Wir ließen also den zeremoniellen Teil offen und hofften auf eine spontane Eingebung.
Und jetzt standen wir auf dem zugigen Bahnsteig, meine Mutter und ich, und warteten, dass Gabors Zug endlich einfuhr. Die Anzeigetafel gab eine Viertelstunde Verspätung bekannt, und die Computerstimme aus dem Lautsprecher wiederholte diesen Hinweis alle paar Minuten und bat am Ende auf Deutsch um unser Verständnis und dankte auf Englisch für unsere Geduld. Ich fand den englischen Text irgendwie sympathischer, obwohl mir weder verständnisvoll noch geduldig zumute war. Meine Mutter begann die Gleise zu zählen, aus Langeweile, wie ich annahm, aber dann fragte sie mich plötzlich, ob sie mir je die Geschichte von Joschis Reise erzählt hätte, auf der er angeblich immer nur Züge nahm, die auf Gleis 5 abfuhren, egal wohin, Hauptsache Gleis 5, immer nur Gleis 5.
»War das eine wahre Geschichte oder hatte er sie sich bloß ausgedacht?«, fragte ich.
»Gute Frage«, antwortete meine Mutter.
Mein Großvater war ein Geschichtenerzähler, und natürlich ist meine Mutter auch einer geworden. Ich kenne die meisten, auch wenn ich früher oft Orte und Namen und Zeiten durcheinandergebracht habe. Das Komische an diesen Geschichten ist, dass ausgerechnet die, von denen alle behaupten, dass sie wahr sind, so klingen, als hätte sie jemand erfunden, der nichts vom Geschichtenerzählen versteht. Gelegentlich fällt meiner Mutter eine neue alte ein, aber auch die alten alten Geschichten, mit denen ich groß wurde, haben sich im Laufe der Zeit verändert. Sie wucherten und wurden immer länger und tiefer, absurder und schmerzhafter, denn meine Mutter erzählt eine Geschichte nie zweimal auf dieselbe Weise, und kein Mensch auf der Welt würde es je wagen, sie mit den Worten »Die Geschichte kenne ich schon« zu unterbrechen, es sei denn, er wäre lebensmüde oder dumm oder hätte nicht richtig aufgepasst. Am schönsten ist es, sie dabei zu beobachten: Dann leuchten ihre Augen nämlich oder werden schmal und hart, und ihre Stimme klingt voll oder schneidend, manchmal auch amüsiert oder spöttisch, und selbst wenn mir hinterher der Kopf schwirrt, weiß ich doch, dass diese Geschichten irgendwo ihren Platz in mir gefunden haben, wo sie geduldig darauf warten, dass ich sie rufe.
Ich überlegte mir gerade, ob es okay wäre, meinen iPod rauszuholen und ein bisschen Musik zu hören, aber in diesem Moment fuhr endlich der Zug ein, und gleichzeitig wurde mir klar, wie nervös meine Mutter war. Ihr Rücken war so stocksteif, dass mir mein eigener wehzutun begann, also lockerte ich meine Muskeln und hoffte, dass es auch bei ihr wirkte. Viele Leute waren es nicht, die in Weimar aus dem Zug stiegen. Wir befanden uns etwa in der Mitte des Bahnsteigs und hatten gute Sicht nach beiden Seiten, und ich entdeckte Gabor zuerst, obwohl ich gar nicht wusste, wie er aussah. Ich kannte nur Bilder, die ihn als grinsenden Zwanzigjährigen auf dem Moped zeigten, und inzwischen war er dreimal so alt. Ich stieß meine Mutter an und deutete auf ihn, und ihr Rücken wurde noch steifer, falls das überhaupt möglich war, demnach musste er es sein.
»Ich fasse es nicht«, flüsterte sie. »Er sieht aus wie eine Raubkopie von Joschi.«
»Ich finde, er sieht aus wie eine Raubkopie von dir«, flüsterte ich zurück, ohne über die Folgen nachzudenken. Das war natürlich eine blöde Bemerkung, zumal Gabor eine Glatze hatte. Der obere Teil seines Schädels ragte wie nacktes Land aus einem Halbkreis langer grauer Haare hervor, die hinten von einem Gummiband zusammengehalten wurden. Er trug Jeans und ein braun kariertes Hemd und darüber ein abgetragenes braunes Jackett, und auf seiner stattlichen Nase saß eine Pilotenbrille aus den Siebzigerjahren, die so aussah, als wäre sie mit ihm zusammen alt geworden. Die Brille war an den Rändern so dick wie ein Flaschenboden. Er sah aus wie ein Mathelehrer. Meine Mutter sah nicht aus wie ein Mathelehrer. Aber irgendwas an der Art, wie er mit gerunzelter Stirn und zusammengekniffenen Augen den Bahnsteig absuchte, war mir sehr vertraut.
»Jetzt weiß ich’s«, sagte ich. »Ihr habt beide eine große Nase und den Erdmännchenblick.«
»Jeder Mensch unter einsachtzig sieht aus wie ein Erdmännchen, wenn er auf dem Bahnsteig nach jemand Ausschau hält«, zischte meine Mutter empört und setzte sich in Bewegung.
Weil ich fand, dass sie eher Rückendeckung als meine Begleitung nötig hatte, blieb ich etwa zwei, drei Meter hinter ihr. Ich zählte ihre Schritte: Beim fünften musste sie über eine Hundeleine steigen, beim neunten knickte sie ein bisschen um. Beim dreizehnten erkannte Gabor sie endlich. Gut für mich, denn noch drei Schritte mehr, und sie wäre einfach an ihm vorbeigelaufen und hätte es mir überlassen, ihn zu begrüßen. Gabor sah meine Mutter an und zwinkerte nervös hinter seinen dicken Brillengläsern. Er streckte die Hand aus, überlegte es sich dann anders und griff stattdessen nach hinten zu seinem dünnen Zopf, als wollte er sich vergewissern, dass er noch an der richtigen Stelle saß. Dann ließ er den Arm wieder sinken. Er sah aus, als hätte er Angst.
»Hallo, Marika«, sagte Gabor. Er sprach es richtig aus, auf die ungarische Art mit der Betonung auf der ersten Silbe, und dafür müsste er jetzt eigentlich was guthaben bei ihr. Die meisten Leute sagen Ma-riiii-ka und sind nur schwer davon abzubringen, denn es gab mal eine ungarische Schauspielerin, die ihnen diesen Fehler hundert Jahre lang durchgehen ließ, weil sie in Wirklichkeit von Geburt an taub war und weder sich selbst singen noch andere ihren Namen sagen hörte, jedenfalls hatte Joschi das meiner Mutter so erklärt.
»Tag, Gabor.« Sie standen mit hängenden Armen voreinander, und offenbar hatte keiner von ihnen Lust, den anderen zu berühren. Oder genügend Mut. Als sie sich kurz nach Joschis Tod zum letzten Mal sahen, war meine Mutter ein Punk und Gabor ein Arschloch, behauptet jedenfalls meine Mutter. Ich verstehe genug von Punk, um zu wissen, dass diese beiden Eigenschaften unvereinbar sind, und es sah für mich ganz danach aus, als wollten sie genau an dieser Stelle weitermachen. Oder gleich wieder aufhören, denn es passierte nichts mehr. An den verkrampften Schultern meiner Mutter konnte ich erkennen, dass mein Entspannungszauber nicht funktioniert hatte. Ich beschloss, sichtbar zu werden, und Gabor, der hocherfreut über die Abwechslung schien, rief bei meinem Anblick: »Wie – ist das etwa meine Nichte? Du lieber Himmel, und ich habe gedacht, du wärst noch ein kleines Mädchen …«
Ich tat ihm den Gefallen und wurde auf der Stelle ein paar Jahre jünger. »Hi, ich bin Lily«, sagte ich und gab ihm die Hand. Seine war eiskalt, und sein Lächeln wirkte so, als hätte er vorher im Zug noch geübt und wäre nicht rechtzeitig fertig geworden, obwohl der Zug so viel Verspätung hatte. Seine Zähne waren klein und überraschend weiß. Wahrscheinlich waren es nicht seine eigenen. Er roch nach Zigarettenrauch und Mathelehrer.
»He, ich hab dir was mitgebracht«, sagte er und begann, in seiner ausgebeulten olivgrünen Umhängetasche zu wühlen. »Allerdings war mir da noch nicht klar, dass du fast schon erwachsen bist – ah, hier.« Er zog einen braunen Stoffbären hervor. »Das ist der Held unserer Abteilung«, sagte er stolz. »Er hat alle Tests mit Bravour bestanden. Maximaler Zug auf alle Gliedmaßen gleichzeitig, Dauerdruck, Extremtemperaturen, sogar die Augen sind bis zum Schluss dringeblieben, das kann man von seinen Kollegen weiß Gott nicht behaupten.«
Ich gebe zu, mir blieb wirklich der Mund offen stehen, weil ich nichts kapierte und trotzdem wusste, dass ich seine Worte richtig verstanden hatte. Gabor hielt mir den Bären direkt vor die Nase, sodass ich gar nicht anders konnte als zuzugreifen. Maximaler Zug auf alle Gliedmaßen? Hätte Gabor nicht so zufrieden ausgesehen, hätte man annehmen müssen, dass er gerade etwas richtig Fieses gesagt hatte.
»Könntest du das bitte wiederholen?«, fragte meine Mutter und machte ein Gesicht, als wäre sie Mitglied bei PETA oder dem Tierschutzverein und könnte jederzeit dort anrufen.
Gabor setzte zu einer Erklärung an, aber in diesem Augenblick kam endlich Hannah angelaufen, wie immer mit flatternden Seidenschals, einem unsichtbaren Gesprächspartner und deutlicher Verspätung. Sie winkte und gestikulierte und telefonierte gleichzeitig, und als sie bei uns angekommen war, drückte sie dem verdutzten Gabor einfach ihr Mobiltelefon in die Hand und fiel ihm anschließend um den Hals. Ich hätte zu gern gewusst, wer da am anderen Ende der Leitung hing und Zeuge unserer Wiedervereinigung wurde. Falls er – oder sie – etwas dazu zu sagen hatte, ging es jedenfalls in Hannahs Begrüßung unter. »Bruderherz«, rief sie mit einer Stimme, die so laut war, dass wahrscheinlich alle Bruderherzen in Hörweite aus dem Takt gerieten, »willkommen im Kreis der Familie!« Gabor stand einfach nur da wie ein Betonpfeiler und ließ sie gewähren, und als mir bewusst wurde, dass ich den Bären auf genau dieselbe Weise von mir weghielt wie er Hannahs Telefon, stieg endlich das Kichern in mir hoch, auf das ich schon so lange gewartet hatte.
»Könnte es sein, dass ich was Interessantes verpasst habe?«, fragte Hannah und nahm Gabor das Handy wieder ab, klappte es zusammen und verstaute es in ihrer Handtasche, wo es sofort wieder zu klingeln begann. Es war die Titelmelodie von »Spiel mir das Lied vom Tod«. Ich musste noch mehr lachen, während meine Mutter die Augen verdrehte, aber Hannah blieb völlig ungerührt und zog mich an sich. Für eine Weile tauchte ich ein in die wunderbare Welt zwischen Hannahs riesigen, weichen Brüsten, in der ich mich noch geborgener fühle, seit ich sicher weiß, dass meine auf keinen Fall so groß werden. Solange es Hannahs sind, ist alles gut. Das gilt auch für ihre laute Stimme und ihre roten Haare, die wie explodierte Stahlwolle aussehen und sich auch so anfühlen. Für mich ist Hannah kein Fels in der Brandung, sondern ein rotes Rettungsboot, das oft bedenklich auf und nieder tanzt, aber niemals untergehen wird.
»Bereust du etwa schon, dass du mitgekommen bist?«, fragte Hannah und ließ mich wieder auftauchen, und ich schüttelte meinen Kopf und wollte ihr gerade den Bären zeigen, als ihr Telefon wieder zu plärren begann. Hannah holte es hervor, warf einen Blick auf das Display, seufzte und schaltete es aus. Es war schwer zu sagen, ob sie wegen des Anrufers seufzte oder weil sie das Gespräch nicht annehmen konnte, aber es sah ziemlich romantisch aus. Dann ging sie hinüber zu meiner Mutter, die etwas abseits stand mit einer senkrechten Stirnfalte wie ein Ausrufezeichen.
»Schau nicht so finster, große Schwester«, sagte Hannah gut gelaunt. »Ich verspreche dir, mein Handy bleibt das ganze Wochenende aus. Und ja, die Melodie ist natürlich völlig daneben. Ich hätte auch jüdische Klingeltöne zur Auswahl. Was hältst du von ›Hava Nagila‹?«
»Echt?«, fragte ich. »Es gibt jüdische Klingeltöne fürs Handy?«
»Optional mit Davidstern oder Menorah als Hintergrundbild«, antwortete Hannah.
»Dann wäre ja wenigstens schon mal dein Handy konvertiert«, sagte meine Mutter.
»Ein jüdisches Handy ist doch ein guter Anfang«, sagte Hannah.
Ich wollte Gabor fragen, was denn nun eigentlich mit diesem Bären los sei, aber dann sah ich ihm lieber dabei zu, wie er zusah, wie meine Mutter und Hannah sich umarmten. Sein Gesicht war ausdruckslos und starr. Meine Mutter sagt manchmal, Hannah und sie wären wie Dick und Doof, aber ich finde, dass sie eher Watson und Holmes sind. Was Gabor fand, als er die beiden beobachtete, konnte man nur vermuten. Ich tippte auf blankes Entsetzen.
»Gehen wir?«, fragte Hannah. Ich steckte den Bären, dem man seine vermeintlichen Misshandlungen gar nicht ansah, vorsichtig in meinen Rucksack und folgte den anderen in Richtung Ausgang.
2
Unsere Wege trennten sich gleich nach dem Einchecken im Hotel. Hannah sagte, sie müsse noch ein paar dringende Anrufe erledigen, bevor sie ihr Telefon endgültig ausschalten könnte, Gabor sagte gar nichts, und auch meine Mutter schien es nicht besonders eilig mit dem offiziellen Beginn unseres Memorial-Wochenendes zu haben. Mich fragte keiner, und wir verabredeten uns zum Abendessen in zwei Stunden beim Italiener direkt bei unserem Hotel. Gabor hatte sein Zimmer neben unserem, aber er wollte lieber die Treppe hochlaufen, statt mit uns den Fahrstuhl zu nehmen, obwohl er das natürlich nicht so direkt sagte. Als wir ausstiegen, sahen wir ihn gerade noch in seinem Zimmer verschwinden. Meine Mutter hob die rechte Augenbraue, was sie wirklich gut kann, aber sie sagte erst was, nachdem sie unsere Zimmertür hinter sich geschlossen hatte.
»Dieser Typ hat mich all die Jahre, so lange ich ihn kannte, von morgens bis abends zugetextet. Wieso sagt der auf einmal nichts mehr?«
Mir fiel keine Antwort darauf ein, aber ich glaube, sie rechnete auch mit keiner.
»Ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, auf dem Bahnsteig stünde Joschi. Findest du echt, wir sehen uns ähnlich? Und pass gut auf, was du jetzt antwortest.«
Zurückrudern ging nicht, das hätte sie mir nicht abgenommen, also blieb nur der Kollisionskurs. »Ich glaube, wenn du die gleiche Brille aufsetzen und dich neben ihn stellen würdest, könnte man euch nicht mehr voneinander unterscheiden.«
Meine Mutter kniff die Augen zusammen und wackelte mit dem Kopf hin und her. »So vielleicht?«
»Genau so«, sagte ich. »Aber natürlich bist du viel schöner als er.«
»Ist schon gut, ich werde dich nie wieder danach fragen«, sagte meine Mutter und warf einen Blick ins Bad. Was sie dort sah, erfüllte sie mit großer Zufriedenheit. »Ich glaub, ich geh mal in die Badewanne«, verkündete sie, als wäre das etwas Neues, dabei macht sie das immer, wenn sie irgendwo eine entdeckt: Sie legt sich rein, und das für Stunden. Ich bin nicht so. Badewannen machen mich nervös. Sobald ich drinliege, frage ich mich, was passieren würde, wenn die Wanne plötzlich unter mir einen Riss bekäme. In meiner Phantasie befinden sich unter Badewannen Heizspiralen wie unter einem Keramikkochfeld, und sicher wird eines Tages auch jemand so etwas erfinden, um das Badewasser länger warm zu halten. Badewannen sind kein guter Ort für mich. Weitere Orte, denen ich misstraue, sind Solarien, Kernspintomographen, Tunnel, bei denen man beim Reinfahren nicht den Ausgang sieht, und Raumkapseln.
Während das Badewasser einlief, trafen wir noch ein paar gewichtige Entscheidungen wie etwa die,