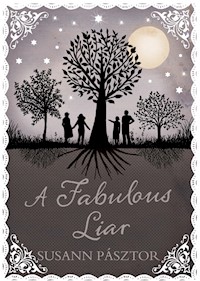8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schweigeseminar, ein faszinierender Mann und eine große Liebe Das Schweigewochenende, das Mila auf Anraten ihrer Therapeutin besucht, wird zu einer echten Herausforderung: seltsame Menschen, die man nur stumm betrachten kann, unbequeme Sitzpositionen, exotische Anleitungen. Dazu die Stille, die so viele unerwünschte Einsichten bereithält. Und dann noch dieser Simon, der Mila überredet, ihn nach dem Seminar ein Stück mit dem Auto mitzunehmen.Dass die Stille sie direkt in ein Hotelzimmer führen würde, haben die beiden nicht erwartet. Sie verbringen dort drei leidenschaftliche Tage und Nächte, begegnen sich mit rückhaltloser Offenheit und lassen sich ganz aufeinander ein. Und als sie sich so nah gekommen sind wie niemandem zuvor, beschließen sie, für immer auseinanderzugehen. Susann Pásztor erzählt einfühlsam, witzig und mit psychologischem Gespür von der großen Liebe – und von einer Frau, die alles daransetzt, damit sie doch nicht endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Susann Pásztor
Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Susann Pásztor
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Susann Pásztor
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin.
Mit ihrem Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« (2010, KiWi 1201, 2011) gelang ihr »ein ironisches Lehrstück über Erinnerung und Verdrängen« (Jüdische Allgemeine), das für seine Sensibilität und seinen Witz großes Lob erhielt und in mehrere Sprachen übersetzt wurde.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Das Schweigewochenende, das Mila auf Anraten ihrer Therapeutin besucht, wird zu einer echten Herausforderung: seltsame Menschen, die man nur stumm betrachten kann, unbequeme Sitzpositionen, exotische Anleitungen. Dazu die Stille, die so viele unerwünschte Einsichten bereithält. Und dann noch dieser Simon, der Mila überredet, ihn nach dem Seminar ein Stück mit dem Auto mitzunehmen.
Dass die Stille sie direkt in ein Hotelzimmer führen würde, haben die beiden nicht erwartet. Sie verbringen dort drei leidenschaftliche Tage und Nächte, begegnen sich mit rückhaltloser Offenheit und lassen sich ganz aufeinander ein. Und als sie sich so nah gekommen sind wie niemandem zuvor, beschließen sie, für immer auseinanderzugehen.
Susann Pásztor erzählt einfühlsam, humorvoll und mit psychologischem Gespür von der großen Liebe – und von einer Frau, die alles daransetzt, damit sie nicht endet.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture / mia takahara – aus der plainpicture Kollektion Rauschen
ISBN978-3-462-30701-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1 4. November – 6. November
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Teil 2 6. November – 9. November
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Teil 3 9. November – 18. November
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Danksagung
Samstag, 12. November
»DIE LISTE«, SAGE ICH. »Du hast doch bestimmt noch die Teilnehmerliste von unserem Wochenende, oder? Ich kann meine nicht mehr finden. Ich brauche dringend die Adresse von einem, der auch da war. Am besten gleich noch Telefon und E-Mail, alles.«
Schweigen.
»Bitte, es ist wichtig.«
»Und woher hast du dann meine Nummer?«
»Aus deiner Broschüre. Ich hab sie als Schmierzettel benutzt und mitgenommen.« Der letzte Satz wäre nicht nötig gewesen.
Wieder Schweigen. Dann: »Gut, ich seh mal nach.«
Mein Herz klopft bis zum Hals. Ich schwitze. Sie lässt sich Zeit.
»Okay, und nach wem suchst du?«
»Ich suche Simon«, sage ich und versuche, seinen Namen so beiläufig und unbeteiligt auszusprechen, als würde ich »Thomas« oder »Sven« sagen, dabei würde ich ihn am liebsten laut singen, SimonSimonSimon.
»Simon?«
»Ja, genau. Simon.« Wenigstens einmal muss ich es noch sagen. »Dieser große, dunkle Typ. Der am letzten Tag so viele Fragen gestellt hat. Weißt du noch? Ich habe nämlich ein Buch, das ich ihm schicken möchte. Über Meditation.«
»So genau wollte ich das gar nicht wissen.«
Ja doch. Rück einfach die Adresse raus, und du bist mich los.
»Hier steht niemand, der Simon heißt.«
»Das kann nicht sein.«
»Ist aber so.« Sie sagt es im gleichen Tonfall, in dem wir als Kinder beim Quartettspielen »Be-dau-re« sagten, wenn wir die angefragte Karte nicht hatten.
»Warte«, sage ich. »Kannst du mal durchzählen, wie viele Männer auf der Liste stehen? Bitte.«
Sie schnaubt unwillig, aber sie tut es.
»Sieben«, sagt sie dann. »Sieben plus Gerald.«
»Bist du ganz sicher? Es müssten eigentlich acht sein.«
»Sieben«, wiederholt sie, jetzt deutlich genervt. »Hör mal, kann es sein, dass du noch ein anderes Problem hast, als ein Buch loszuwerden?«
»Ja«, sage ich.
Und wieder zurück auf Los.
Teil 14. November – 6. November
1.
Ich hätte mir eigentlich denken können, dass man an so einem Ort keinen Empfang hat. Die Kurznachricht, die ich schnell noch rausschicken will, bleibt im Ausgang stecken, und eine von den drei Yogamuttis an der Tischseite gegenüber sieht mich missbilligend an, obwohl sie gar nicht wissen kann, was ich im Schutze meiner Handtasche treibe. Abgesehen von den drei Damen und zwei mutmaßlichen Waldorflehrern wirken die meisten hier genauso fehl am Platz, wie ich mich fühle: Da ist ein vierschrötiger Riese, der gut hinter eine Fleischertheke passen würde, neben ihm mehrere Anzugträger, ein gebräunter Pensionär, gepiercte Abiturientinnen, ein nicht mehr ganz junger Mann mit Rastalocken und eine Zicke, die ihre Unsicherheit mit Arroganz überspielt. Das bin ich. Wir sitzen im Speisesaal um einen großen Holztisch herum und lauschen den Ausführungen von Rolf, der sich als Chef des Küchenteams vorgestellt hat und uns jetzt zeigt, wo die Liste ausliegt, in die wir unsere Extragetränke und Snacks eintragen können. Ein Witzbold fragt, wo denn das Bier stünde, und erntet ein paar dünne Lacher. Neben mir sitzt eine Frau um die vierzig, vielleicht sogar mein Jahrgang, deren Namen ich sofort wieder vergessen habe, nachdem sie ihn mir genannt hat, und hebt die Hand wie im Unterricht. Wie das denn mit den Küchendiensten sei, will sie wissen.
»Aber das ist doch kein Landschulheim hier«, sage ich zu ihr, aber Rolfs nachsichtiges Lächeln zeigt mir unmissverständlich, dass es doch eins ist.
»Die Mitarbeit im Haus und in der Küche ist Teil eurer Meditation«, sagt Rolf. »Jeden Tag eine Stunde nach dem Mittagessen. An der Küchentür werden Zettel mit euren Namen und den jeweiligen Aufgaben hängen. Und natürlich gilt auch hier das Schweigegebot.«
Ich habe mir fest vorgenommen, mich nicht an Kleinigkeiten wie veganen Mahlzeiten, Gruppenduschen oder Mehrbettzimmern zu stören, also wird mich auch kein Küchendienst aus der Fassung bringen. Ganz verhindern kann ich trotzdem nicht, dass mein Widerstand manchmal schneller ist als mein guter Wille. Ich habe mich informiert, und ich weiß, dass es völlig daneben wäre, in einem buddhistischen Seminarhaus nach einem Steak oder einem Einzelzimmer mit Bad zu verlangen und dann rumzujammern, wenn man keins bekommt. Genauso daneben ist es allerdings, andere Teilnehmer anhand ihres Äußeren in Waldorflehrer und Yogamuttis einzuteilen. Ich bin hier, um etwas zu lernen, das sie »Reines Gewahrsein« nennen, wertfreies Beobachten, das sollte Königsdisziplin werden für eine wie mich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, werde ich hier den lieben langen Tag nichts anderes tun, als still zu sein und auf meinen eigenen Atem aufzupassen.
Rolf übergibt das Wort an Gerald, den Seminarleiter, und zu meiner großen Verblüffung ist es der Riese, der jetzt freundlich in die Runde grüßt und uns mit knappen Worten den Ablauf des Wochenendes vorstellt. Zwei Stunden bis zum Abendessen werden wir heute noch sitzen, danach eine weitere Stunde bis einundzwanzig Uhr. Frühmorgens um halb fünf wird ein Gong ertönen, der uns zur Morgenmeditation um fünf einlädt. Frühstück von sieben bis neun, Mittagspause und Putzmeditation von zwölf bis halb drei, Teepause irgendwann, ab da höre ich nicht mehr zu, und das Einzige, was ich am Ende noch mitbekomme, ist, dass wir uns in einer Dreiviertelstunde im Gruppenraum treffen, wo wir nach einer kurzen Einführung mit unserer ersten Meditation beginnen werden. Von da an werden wir bis zur Mittagspause am Sonntag schweigen, und mit Schweigen, sagt Gerald und erhebt die Stimme ein wenig, sei die innere Einkehr gemeint und nicht etwa ein Umschwenken auf Zeichensprache oder das Zustecken kleiner Zettel. Wahrscheinlich sagt er das jedes Mal, und jedes Mal gibt es wieder welche, die dann hö-hö sagen müssen, so wie jetzt auch.
Weil alle anderen aufstehen und ihren Teebecher zur Spüle tragen, tue ich es ihnen nach. Eine resolute ältere Dame mit Hängebäckchen und einem schwungvoll drapierten Wollumhang bietet mir und ein paar Umstehenden an, unseren Abwasch zu übernehmen. Ich taufe sie sofort Miss Marple, überlasse ihr meinen Becher und bedanke mich. Dann bringe ich mein Gepäck in das Zweibettzimmer, das ich mit einer Frau namens Lydia teilen werde. Wie sich herausstellt, ist Lydia die Mutti aus dem Yogatrio, deren Missfallen ich vorhin bei meinem Sendeversuch aus der Handtasche erregt habe. Sie wird etwa Mitte fünfzig sein, ihre Haare leuchten im typischen Menopausen-Hennarot, und aus dem Ausschnitt ihres Yogaoberteils quillt viel sommersprossiges Fleisch. Ihre Brüste sehen aus, als lägen sie in zwei waagerecht fixierten Müslischalen. Lydia hat gerade begonnen, ihre Reisetasche zu leeren, ihre erste Amtshandlung muss die Einrichtung eines Herrgottswinkels auf ihrem Nachttisch gewesen sein, eine Muschel und ein Teelicht und das gerahmte Porträt eines alten Mannes, der wie ein Inder aussieht. Ich frage nach seinem Namen, und dann, weil ich ihn noch nie gehört habe, ob er ihr Guru sei, was man halt so fragt auf solchen Wochenenden, jedenfalls dachte ich das, aber es ist eindeutig die falsche Frage. Sie zieht die Luft ein und sagt dann in einem Ton »Gu-ru?«, dass ich denke, wir können in diesem Zimmer genauso gut schon jetzt mit der Schweigephase beginnen.
Also packe ich still meinen Koffer aus, beziehe mein Bett und ziehe Jogginghosen und ein T-Shirt und darüber noch zwei Pullover an. Ich friere schnell. Dann nehme ich mir zwei Paar Socken und eine Wolldecke und will mich auf den Weg zum Gruppenraum machen. An der Tür hält mich Lydia auf, ihr ist wohl eingefallen, dass es die letzte Möglichkeit ist, um noch gewisse Dinge zu klären. Sie fragt beinahe panisch: »Aber das Fenster bleibt nachts ein Stück offen, gell?«, und ich zögere kurz und sage dann, okay, aber mein fehlender Enthusiasmus ist deutlich herauszuhören. Offenbar glaubt Lydia, dass mir noch ein paar relevante Informationen zum Seminar fehlen, denn sie fügt hinzu: »Mobiltelefone sind hier übrigens nicht erlaubt!« Ich schenke ihr ein Krokodilslächeln und flüchte.
Es muss das erste Mal seit meinen Jugendherbergszeiten sein, dass ich mit einer fremden Person ein Zimmer teile. Es ist auch das erste Mal, dass ich an einem Meditationswochenende teilnehme. Nennenswerte Erfahrungen kann ich nicht vorweisen, mein Grundwissen über Buddhismus habe ich mir in den letzten zwei Wochen aus dem Internet heruntergeladen, und es gibt viele gute Gründe für die Annahme, dass ich nicht länger als zehn Minuten ruhig sitzen kann. Ich bin hier, weil Irene mir diesen Kurs empfohlen hat. Stille, Schweigen, Loslassen, das würde mir guttun, und es hörte sich so einfach und schön an, wie sie das sagte. Irene ist meine Therapeutin. Wir sind in all den Jahren immer beim Sie geblieben, aber in Gedanken habe ich sie nie anders als Irene genannt. Beruhigend fand ich auch, dass Irene mir versichern konnte, es handle sich dabei nicht um eine Esoterik-Veranstaltung, der Kursleiter sei ein alter Freund von ihr und ein sehr bodenständiger Mann. »Sie gehen dahin und machen das einfach nur für sich, Mila«, hat sie gesagt, und auch das hörte sich schön an, aber trotzdem verging nach meiner Anmeldung kein einziger Tag, an dem ich nicht lieber einen Rückzieher gemacht hätte.
Immerhin habe ich es bis hierher geschafft. Jetzt laufe ich einen Flur entlang, dessen Wände mit Drucken von asiatischen Schriftzeichen behängt sind, und suche nach der richtigen Tür. Neben einer ist ein Schild mit der Aufschrift »Kleiner Meditationsraum«, davor stehen drei Paar Hausschuhe, präzise nebeneinander ausgerichtet. Die Tür ist angelehnt. Ich stelle meine Schuhe dazu und vertausche den rechten mit dem linken, sodass sie auseinanderstreben, so viel Rebellion muss sein.
Der Raum hinter der Tür ist nicht klein, sondern groß wie ein Klassenzimmer. Matt glänzende Holzdielen, leere weiße Wände, schmucklos bis auf eine Bodenvase, in der ein paar Herbstzweige stecken. Aber das Schönste ist das große Panoramafenster mit seiner Aussicht auf prächtige Laubwälder, die jetzt zur Sonnenuntergangszeit in wilden Gelb- und Orangetönen leuchten. An beiden Längsseiten sind Matten mit Meditationskissen ausgelegt, und Gerald, der an der Stirnseite des Raums nahe der Eingangstür sitzt, sagt mir, ich solle mir einen Platz bei den Frauen aussuchen, und weist zur Wandseite, die den Blick auf die Herbstlandschaft bietet. Ich bin entzückt, dann fällt mir ein, dass ich die meiste Zeit hier drinnen mit geschlossenen Augen verbringen werde. Die Frauenreihe ist noch leer, ich wandere sie bis zum Ende entlang, ich zähle zehn Plätze und wähle den vorletzten aus. Auf der Fensterseite gegenüber sitzen bereits zwei Männer in vorbildlicher Meditationshaltung und mit geschlossenen Augen, Streber, denke ich sofort, und gleich darauf frage ich mich, ob in den nächsten zwei Tagen wohl all meine innere Schlechtigkeit aus mir hervorbrechen wird wie ein Haufen Unrat aus einer umgekippten Mülltonne.
Allmählich füllt sich der Raum. Meine Zimmergenossin Lydia sieht mich am Ende der Reihe sitzen und entscheidet sich, ganz vorn zu bleiben. Miss Marple kommt zielstrebig auf mich zu und nimmt den letzten Platz in Beschlag. Sie hat einen Plastikstuhl dabei, den sie jetzt liebevoll mit Tüchern und Kissen ausstaffiert. »Ich kann nicht mehr so lange auf dem Boden sitzen«, flüstert sie mir zu, als sie meinen Blick bemerkt. Auch bei den Männern wird kräftig umdekoriert: Der sehnige, weißhaarige Herr mit der sonnengegerbten Haut, der von jetzt an Clint Eastwood heißen wird, hat sich ein kleines Holzbänkchen zum Sitzen mitgebracht, das mir sehr unbequem erscheint. Vielleicht will er sich quälen, aber die Wahrheit ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man auf so etwas sitzt. Der Typ mit den Rastalocken türmt zwei Meditationskissen übereinander, polstert den Boden vor sich mit einer weiteren Matte aus, und als er endlich fertig ist mit seinen Vorkehrungen und noch eine Decke um sich gewickelt hat, sieht er aus wie ein menschliches Dreieck, das alle anderen Männer um Haupteslänge überragt. Überhaupt hat das Einnehmen der Plätze bei den meisten etwas vom Nestbauen, und im Gegensatz zu mir scheinen sie sehr wohl zu wissen, welche Requisiten sie dafür brauchen. Jetzt lässt sich Namevergessen, die schon vorhin neben mir im Speisesaal gesessen hat, zu meiner Rechten nieder, allerdings war es auch der letzte freie Platz. Wir sind vollzählig: zehn Frauen, acht Männer.
Gerald wartet geduldig, bis alle zur Ruhe gekommen sind. Dann heißt er uns ein weiteres Mal willkommen, bittet um pünktliches Erscheinen zu den Sitzungen und beginnt mit der Einführung. »Unser Atem ist unser Freund und ständiger Begleiter. Geben wir ihm Raum!«, sagt er, und seine Stimme ist ein leicht monotoner Singsang. »Indem wir ihn betrachten, entwickeln wir neben der Fähigkeit zur Achtsamkeit auch die Fähigkeit zur inneren Stille. Wir kontrollieren ihn nicht, wir lassen ihn selbst seine eigene Form und seinen eigenen Rhythmus finden. Wir nehmen ihn in unserem Heben und Senken der Bauchdecke wahr, wir fühlen, wie er das Innere unserer Nasenflügel streift, wie er durch die Nase, den Hals, in die Brust, in den Bauch hinein- und dann wieder herausströmt. Unser Atem kann flach oder tief sein, mal geht er schnell oder langsam, mal ist er fließend oder unterbrochen.«
Jemand hustet, und einige versuchen, ihr eigenes Räuspern in seinem Windschatten unterzubringen. Auch ich spüre plötzlich ein Kratzen im Hals, es ist das gleiche gruppendynamische Phänomen wie bei einer Pause im Konzertsaal.
»Wir beobachten den Atem wie eine Mutter, die den Bewegungen ihres Kindes zuschaut«, fährt Gerald fort. »Liebevoll, jedoch entschieden, weich, jedoch genau, und mit einem entspannten, aber fokussierten Bewusstsein. Wenn Gedanken und Bilder in unserem Geist auftauchen, lassen wir sie vorbeiziehen und kehren immer wieder geduldig und beharrlich zu unserem Atem zurück.«
Atem beobachten, das mache ich mit links. Die Sache mit den Gedanken und Bildern scheint mir wesentlich schwieriger zu sein. Wie bitte soll ich es hinkriegen, hier Stunde um Stunde zu sitzen und NICHT über mein verdammtes Leben nachzudenken?
»Aber nicht nur innere Gedanken und Bilder, auch Geräusche, Gefühle und Körperwahrnehmungen werden uns immer wieder ablenken. Wem es hilft, der mag mit seinen Atemzügen von eins bis zehn zählen und dann wieder von vorn beginnen oder beim Einatmen ›ein‹ und beim Ausatmen ›aus‹ denken, um den Geist zu beruhigen und zur Achtsamkeit zurückzukehren.«
Gerald macht eine längere Pause, dann sagt er: »Wir werden fünfundvierzig Minuten sitzen und fünfzehn Minuten gehen. In dieser Viertelstunde bewegen wir uns in gerader, aufrechter Haltung durch den Raum, die Handflächen liegen locker übereinander auf dem Bauch oder hinter dem Rücken. Wir setzen den Fuß zuerst mit der Spitze auf und rollen ihn langsam ab. Unsere Bewegungen sind langsam und fließend und im Einklang mit unserem Atem, der Blick ist weit und unfokussiert.«
Das gefällt mir, das würde ich am liebsten gleich ausprobieren. Beim Gehen dürften meine Chancen wesentlich größer sein, meine Innenwelt zum Schweigen zu bringen. Ich hätte lieber gleich ein Gehmeditationsseminar buchen sollen. Gibt es so etwas überhaupt? Gehen klingt viel besser als sitzen. Gerald, ich möchte gehen.
»Wenn der Gong ertönt«, sagt Gerald, und ich werde nie mehr erfahren, was er davor gesagt hat, denn jetzt nimmt er eine bronzene Klangschale, die fast so groß ist wie eine halbe Wassermelone und dennoch in seinen riesigen Händen ganz zerbrechlich wirkt. Er balanciert sie oben auf den dicken Fingern der linken Hand, während seine Rechte den Klöppel mit einer unfassbaren Mischung aus Präzision und Liebe an den Rand der Schale schlägt und ihr einen Ton entlockt, der so süß und rein ist und so lange im Raum schwebt, dass ich weinen könnte, wegen der Schönheit des Klangs und wegen der Hässlichkeit meiner Gedanken.
Ich schließe meine Augen. Und jetzt? Irgendwie war das eine recht minimalistische Einführung, wenn man bedenkt, dass dies hier ein Anfängerkurs sein soll. Also dann. Atmen. Ich verfolge meinen Atem bis in die Lunge und wieder hinaus und weiß schon nach wenigen Zügen nicht mehr, wie Atmen überhaupt geht. Ich schnappe nach Luft, hechle und schnaufe. Noch einmal, ganz langsam. Wieder passiert dasselbe. Sobald mein Atem im Zentrum meiner Aufmerksamkeit steht, scheint er seinen Dienst zu verweigern, und ich bin offensichtlich nicht in der Lage, das Steuer zu übernehmen, wenn der Autopilot ausfällt. Soll ich ja auch gar nicht, fällt mir jetzt ein, ich bin ja die liebevolle Mutter, die ihrem Kind beim Ersticken zuschaut.
Wenn ich zähle, geht es besser. Einatmen: eins, ausatmen: eins, einatmen: zwei, ausatmen: zwei, und bei zehn fange ich wieder von vorn an. Wie ich auf einmal bei dreiundzwanzig gelandet bin, kann ich mir nicht erklären. Dann doch lieber die simple Variante: Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Mein linkes Bein schläft ein. Mein linkes Bein schläft aus. Ich öffne meine Augen einen Spalt weit und bewege meinen Arm Millimeter für Millimeter nach vorn, bis die Armbanduhr in mein Blickfeld kommt. Es sind sieben Minuten seit dem Gong vergangen. Noch achtunddreißig Minuten bis zur Gehmeditation. Noch fünfundvierzig Stunden, bis ich wieder nach Hause fahren kann.
Meine Augen wollen einfach nicht geschlossen bleiben. Der Drang, sie zu öffnen, ist unwiderstehlich. Also schön, von einem Sehverbot war schließlich nie die Rede. Vor mir sitzen acht Männer aufgereiht unter dem großen Panoramafenster, im abendlichen Gegenlicht sehen die Silhouetten ihrer Köpfe aus wie eine Skyline, die durch den höhergelegten Rastaman auf Platz fünf steil nach oben ausschlägt. Ich starre eine Weile auf dieses Szenario, dann schließe ich die Augen wieder und sehe ein türkisfarbenes Nachbild. Das habe ich als Kind oft gemacht, erst in helle Lichter geschaut und mich dann in den leuchtenden Welten hinter meinen geschlossenen Augenlidern verloren, bis sie sich in Schwärze auflösten. Ich warte, bis das Nachbild ganz verschwunden ist, dann öffne ich die Augen und will das Spiel wiederholen, aber jetzt langweilt mich die Aussicht. Ich blicke verstohlen nach rechts, wo Geralds Platz ist. Er sitzt mitnichten in vorbildlich vertikaler Ausrichtung da, sondern ein wenig zusammengesunken mit leicht seitwärts geneigtem Kopf und einem entrückten Gesichtsausdruck, als würde er Musik lauschen. Ich schließe schnell wieder die Augen, weil ich es plötzlich ungehörig und indiskret finde, ihn beim Meditieren zu beobachten.
Mein linkes Bein ist inzwischen zu einem toten, kalten Fremdkörper geworden. Ich hebe es vorsichtig ein paar Millimeter an, bis ich glaube, dass wieder genügend Blut hineingeflossen ist, um wenigstens eine Grundversorgung zu gewährleisten. Jetzt kribbelt es, als würde ein aggressiver Akupunkteur Nadel um Nadel in meine Wade treiben. Zu meiner rechten Seite knurrt laut und vernehmlich der Magen von Namevergessen, und auch mein Magen hört es und stimmt begeistert ein. Zwei Stunden bis zum Abendessen, hat Gerald gesagt, und noch nicht einmal die erste ist vorbei. Ich könnte meinen Hunger betrachten statt meines Atems. Ich könnte ausrechnen, wie lange es dauert, bis das Muskel- und Fettgewebe meines linken Beins endgültig abzusterben beginnt. Jetzt höre ich von weiter rechts ein leises Rascheln. Ich wende meinen Kopf zur Seite und sehe, wie eine Frau behutsam ihre Sitzposition verändert. Hurra, man darf sich doch bewegen! Ich brauche die Hilfe beider Hände, um mein betäubtes linkes Bein aufzurichten. Ich umschlinge meine Knie mit den Armen, dehne meine Lendenwirbel und bin glücklich über das Leben, das wieder ungehindert durch meine Adern strömt. Jetzt, wo es mir so gut geht, könnte ich eigentlich wieder anfangen, meinen Atem zu beobachten. Wenige Minuten später fühle ich, wie mein Hintern taub wird.
Als endlich der Gong ertönt, klingt er wie die zarteste aller Erlösungen, und ich habe in der Zwischenzeit bei mir ADHSdiagnostiziert, anders kann ich mir diese innere Unruhe nicht erklären. Ich schwanke, als ich auf beiden Beinen stehe, dann reihe ich mich in die Schlange ein. Wir drehen hintereinander im Schneckentempo unsere Runde durch den Raum. Ich bemühe mich, bewusst und akzentuiert einen Fuß vor den anderen zu setzen, und es ist überraschend schwierig, dabei das Gleichgewicht zu halten. Mein Vordermann geht so langsam, dass ich immer wieder auf der Stelle treten muss, um nicht in ihn hineinzulaufen. Er hat die Hände auf den Rücken gelegt, die linke Hand umfasst das Gelenk der rechten, genauso ist Herr Scholz immer auf dem Schulhof herumgelaufen, wenn er Pausenaufsicht hatte. Plötzlich bin ich wieder acht Jahre alt und schleiche Herrn Scholz hinterher, um ihm unbemerkt einen Zettel an den Rücken zu heften. Was steht auf dem Zettel? Auf dem Zettel steht in meiner eigenen, ungelenken Kinderhandschrift RUHE BITTE.
Von jetzt an, nehme ich mir vor, wird das mein Spickzettel sein, ich werde ihn bei jeder Gehmeditation in Gedanken am Rücken der Person befestigen, die vor mir läuft. Er soll beim Sitzen an den Innenseiten meiner Augenlider hängen, und für den Fall, dass ich sie öffne, will ich ihn auf den Boden vor mir projizieren. Leider ist seine pädagogische Wirkung ebenso flüchtig wie die von allen anderen Ermahnungen aus meiner Schulzeit. Ich probiere es in der zweiten Sitzrunde mit neuen Aufschriften, mit Beleidigungen und Beschwörungen, ich schreibe eine ausgedachte mathematische Formel auf den Zettel, ich zeichne eine Sonne, ein Herz und das Haus vom Nikolaus, und am Ende falte ich ein Papierschiff daraus. Ich verbringe die gesamte Dreiviertelstunde bis zum Ende der Sitzung mit dem Ersinnen von raffinierten Tricks, mit denen ich meinen Geist zum Schweigen bringen könnte. Immerhin: Ich habe kein einziges Mal meine Augen geöffnet. Ich war ganz bei mir.
Ganz bei mir zu bleiben gelingt mir beim Abendessen überhaupt nicht, obwohl die Voraussetzungen dafür bestens sind. Die einzigen Geräusche stammen vom Klappern des Geschirrs und von Stühlen, die vor- und zurückgeschoben werden. Das Essen ist einfach, aber liebevoll zubereitet, und es sollte eigentlich kein Problem sein, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Trotzdem schaffe ich es nicht, den Radius meiner Aufmerksamkeit auf meinen eigenen Tellerrand zu begrenzen. Mein Gehirn giert nach Informationen. Ich kenne das, es überfällt mich auch zu Hause bei meinen einsamen Mahlzeiten, und wenn keine Zeitung zur Hand ist, schrecke ich nicht einmal davor zurück, die Herstellerangaben auf der Verpackung meiner Frühstücksflocken zu lesen, in sämtlichen Übersetzungen.
Mir gegenüber sitzt ein Mädchen, deren fünf Piercings so akkurat in ihrer Augenbraue sitzen wie die Kichererbsen auf ihrem Salatteller, die sie zuerst herausgepickt und dann als Perlenkette angeordnet hat. Nebenan häuft Clint Eastwood unfassbare Mengen einer vegetarischen Paste auf sein Brot und verschlingt es mit gierigen Bissen. Ein ansehnlicher Batzen der orangefarbenen Masse bleibt an seiner Oberlippe hängen und fällt ihm unbemerkt in den Schoß, als er sich seiner Suppe zuwendet. Jetzt sehe ich doch weg. Ich verbringe die nächsten Minuten mit der Überlegung, ob vegetarische Nahrung irgendeinen positiven Einfluss auf die Ästhetik beim Essen hat, und komme zu keinem Ergebnis. Dann stehe ich auf, bringe mein Geschirr zur Spüle und treffe dort erneut auf Miss Marple. Ich würde mich gern revanchieren für ihre Freundlichkeit und den Abwasch für sie übernehmen, weiß jedoch nicht, wie ich es kommunizieren soll. Jemand rempelt mich von hinten an, ich drehe mich um und sehe in ein erschrockenes Männergesicht. Er kann das Wort »Entschuldigung« gerade noch zurückhalten, aber ich mein Lächeln nicht, mein universelles Ist-schon-in-Ordnung-Lächeln. Ein echter Fauxpas. Schuldbewusst richte ich meinen Blick auf den Boden und gehe in mein Zimmer, wo ich die halbe Stunde bis zur Abendsitzung auf dem Bett damit totschlage, mir zu sagen, dass hinter der Stille die Angst vor dem Sterben und hinter der Angst die Liebe wartet. Das ist von Irene. Es gefiel mir, als ich es zum ersten Mal hörte. Jetzt finde ich es bedrohlich.
Als die Abendmeditation beginnt, bin ich die Letzte, die sich auf ihrem Kissen einfindet. Jemand hat die Vorhänge an den großen Fenstern zugezogen, und an Geralds Platz stehen ein paar brennende Kerzen. Nicht nur der Raum wirkt verändert, auch die Stille ist eine andere. Habe ich etwas verpasst? Gerald richtet eine Fernbedienung auf die Musikanlage, die hinter ihm steht, und aktiviert den CD-Spieler. Mir fällt ein, dass ich vorhin bei der Präsentation des Abendprogramms nicht zugehört habe.
»Wir werden heute Abend das Shri-Ram-Mantra singen«, sagt Gerald. »Das ist ein sehr altes und starkes Heilungsmantra. Es existiert in unzähligen Versionen. Der Text ist sehr einfach: Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om. Ich möchte Sie einladen, mitzusingen und der Kraft eines Mantras zu vertrauen, das vom ewigen Sieg der Liebe handelt.«
Ich bin unbedingt für den ewigen Sieg der Liebe, aber dass ich jetzt dafür singen soll, geht mir zu weit. Auch auf den Männergesichtern gegenüber meine ich Verunsicherung zu erkennen, während bei mir auf der Frauenseite eitel Freude herrscht. Singen!
»Diejenigen unter Ihnen, die mit dieser Art von Gesang noch nicht vertraut sind«, fügt Gerald hinzu, »möchte ich ermutigen: Sie können überhaupt nichts verkehrt machen. Die Melodie lässt sich ganz leicht nachsingen.«
Jetzt dringen zarte Gitarrenakkorde aus den Lautsprechern, dann folgen Trommeln und noch ein Instrument, das ich mir als indische Ziehharmonika vorstelle. Eine Männerstimme singt die erste Zeile, es hört sich an wie eine Kindermelodie, und ein Chor antwortet und wiederholt sie. Und nicht nur der Chor, auch die Mehrheit der Frauen neben mir fällt sofort begeistert ein, allen voran Miss Marple, die, wie ich beeindruckt feststelle, eine wunderschöne Altstimme hat. Na gut, Mädels, aber ohne mich. Die Melodie wird jetzt etwas komplizierter, der Sänger auf der CD singt kleine Schleifen hinein, die Frauen im Raum antworten mühelos, und auch von den Männern kommen jetzt ein paar zaghafte Jai-Jai-Rams. Mein Körper macht sich selbstständig und beginnt, rhythmisch vor und zurück zu schaukeln, dieser Opportunist, so leicht lässt er sich mitreißen. Ich beschwöre Erinnerungen an Konfirmandenfreizeiten mit christlichen Liedern am Lagerfeuer herauf, an Schlachtengesänge von betrunkenen Fußballfans, ans Schunkeln beim Karneval, aber mein Körper wiegt sich weiter wie in Trance, und auf einmal begreife ich, dass nicht er der Verräter ist, sondern ich. Seit wann habe ich mir eigentlich jedes unschuldige Mitmachen so rigoros verboten, und warum bloß?
Das Lied dauert etwa eine Viertelstunde, dann schaltet Gerald die Anlage aus. Er schlägt behutsam gegen den Rand seiner Bronzeschale, und wieder bleibt der Ton lange Zeit im Raum stehen. Ich lausche ihm sehnsüchtig hinterher, filtere noch die feinsten Schwingungen heraus, als würde ich nach einem Lieblingsessen meinen Teller ablecken, aber irgendwann muss ich mir eingestehen, dass er endgültig verklungen ist, und mit der Stille kommt die Traurigkeit.
Ich stelle in Gedanken eine Liste zusammen mit allen Beschränkungen, die ich mir im Lauf der Zeit auferlegt habe. Ich singe nicht, wenn andere singen. Ich tanze nicht gern, weil es albern aussieht. Ich spiele keine Gesellschaftsspiele. Ich schreie nicht. Jeder Vergewaltiger hätte leichtes Spiel mit mir, weil ich nicht imstande wäre, um Hilfe zu rufen. Ich applaudiere nicht. Wenn ich auf einer Toilette sitze und man mich hören könnte, pinkle ich vorsichtig gegen den Rand der Porzellanschüssel, um Geräusche zu vermeiden. Im Grunde genommen bin ich die personifizierte Stille. Ich vermeide sogar Ausrufezeichen, wenn ich etwas aufschreibe.
Der Stuhl von Miss Marple zu meiner Linken knarzt ein wenig, als sie ihr Gewicht verlagert, und bringt mich zurück in die Gegenwart. Ich bemühe mich, statt meiner Defizite wieder meine Atemzüge zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Steht auf meiner Liste schon, dass ich auch beim Orgasmus nur dezentes Stöhnen von mir gebe? Fünf, sechs. Herrgott noch mal.
Ich bin bei dreihundertachtundsechzig, als der Ton das Ende der Sitzung verkündet. Aber statt sich wie sonst zu erheben und im Trott der Gehmeditation durch den Raum zu schleichen, bleiben alle auf ihren Kissen sitzen, einige lehnen sich gegen die Wand und machen es sich mit ausgestreckten Beinen gemütlich. Wieder ein Programmpunkt, auf den ich nicht vorbereitet bin, aber offenbar dient er der Entspannung. Ich rutsche ein Stück nach hinten, bis mein Rücken die Wand berührt, hülle mich in meine Wolldecke und warte auf die nächste Überraschung.
Gerald beginnt zu sprechen. Jesus, sagt er, habe vierzig Tage in der Wüste verbracht, ein Mönch namens Bodhidharma ganze neun Jahre in einer Höhle, und dazu noch mit dem Gesicht zur Wand, und von einem berühmten indischen Poeten sei überliefert, er habe jahrelang so still gesessen, dass weiße Ameisen einen Hügel über ihn bauten. Aha, die Stunde der religiösen Unterweisung hat geschlagen. Mir ist alles recht, solange es mich nur am Nachdenken hindert, sogar biblische Geschichten würde ich mir jetzt anhören, Erleuchtungsmythen oder hinduistische Götterdramen. Aber nein, es war wohl nur die Einleitung, Gerald kommt schnell auf unsere aktuelle Situation zu sprechen.
»Auch wenn es bei Ihnen nur zwei Tage sein werden und keine neun Jahre – Sie sitzen hier auch in einer Art Höhle. Jeder ist für sich allein, aber zusätzlich haben Sie noch die Unterstützung durch die anderen Meditierenden. In diesem Raum des Schweigens kann der Geist zur Ruhe kommen. Stellen Sie sich einen See an einem Sommerabend vor. Die spielenden Kinder sind längst fort, der Wind hat sich gelegt, das Wasser beruhigt sich allmählich, und Sand und Schlamm setzen sich am Boden ab. Der See ist jetzt so still und klar, dass sich Himmel und Wolken auf seiner glatten Oberfläche spiegeln können. Nun kann man bis auf den Grund des Sees blicken. Genau das ist es, was Meditation, Alleinsein und Schweigen für unseren Geist und unser Herz tun. Wir erkennen die Natur der Dinge. Das ist die Glückseligkeit des Buddha.«
Von der Männerseite kommt ein zarter Schnarchton, der mit jedem Atemzug lauter wird. Ich öffne ein Auge und sehe, wie gegenüber jemand seinen Sitznachbarn sanft anstößt. Das Geräusch verstummt. Ich schließe mein Auge wieder und versuche mir meinen Geist als See vorzustellen und auf seinen Grund zu schauen, aber mein See hat die Farbe von altem Tuschewasser, und an seinem Ufer vertrocknen graubraune Farbschollen in einem Netz aus klaffenden Rissen. Aber wenigstens sind die Kinder alle weg. Ich habe keine Kraft mehr für Gedankenspiele. Ich bin müde.
Gerald hat in der Zwischenzeit von den inneren Bewegungen des Geistes, seinen Ablenkungsmanövern und seinen Fluchttendenzen erzählt. Ich hätte jetzt lieber eine kleine Ermutigung, so etwas wie »Morgen wird alles besser, wo heute noch trübe Brühe steht, wird morgen klares Wasser sein«, aber mein Wunsch wird nicht erhört. Geralds abendlicher Vortrag endet mit den Worten »Schweigen ist eines der größten Geschenke, die wir uns selbst und anderen machen können«, er wünscht uns eine angenehme Nachtruhe und erinnert noch einmal daran, dass morgen die erste Meditation um fünf, also dreißig Minuten nach dem Weckruf beginnt.
Es ist kurz vor halb zehn. Beim Zähneputzen höre ich, wie jemand ins Bad kommt und sich neben mich an das zweite Waschbecken stellt. Wie seltsam, nicht nachzusehen, wer es ist, sondern lieber gebannt zu verfolgen, wie der Zahnpastaschaum im Abflusssieb verschwindet. Lydia ist noch nicht da, als ich ins Zimmer zurückkehre. Ich verkrieche mich unter meinen Decken und schaffe es nicht einmal, mir zu Ende zu überlegen, wann ich wohl das letzte Mal in meinem Leben zu dieser Uhrzeit ins Bett gegangen bin.
2.
Wie sich der Weckruf in einem buddhistischen Seminarhaus anhört, erfahre ich an diesem Morgen nicht, weil mich zwei neongelbe Silikonkügelchen in meinen Gehörgängen von der Außenwelt isolieren und mir Frieden und Stille vorgaukeln. Ich hatte sie nach ausgiebiger Betrachtung von Lydias Atem gegen Mitternacht einsetzen müssen, und ich gebe zu, lieber noch hätte ich ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Selbst verstöpselt drangen ihre Bässe noch zu mir durch, während ich mich durch milchige Unterwasserlandschaften träumte, was vermutlich auch dem Druck auf meinen Ohren geschuldet war. Immerhin, ich konnte schlafen.
Ich schrecke hoch, als plötzlich das Licht im Zimmer angeht, und sehe Lydia wie in einem Stummfilm ihr Handtuch und ihren Kulturbeutel nehmen und den Raum verlassen. Es ist fünf Minuten nach halb fünf, und das Zimmer ist eiskalt. Als Erstes schließe ich das Fenster und drehe die Heizung auf, dann entferne ich meine Ohrstöpsel und preise meine Intuition, die mich veranlasst hat, sie mitzunehmen. Die Packung mit den verbliebenen drei Pärchen lasse ich als stummen Vorwurf auf dem großen Tisch liegen und eile mit meinem Waschzeug ins Gemeinschaftsbad. Dampfschwaden wabern mir entgegen, als ich die Tür öffne, es sieht aus wie in einem türkischen Hamam, zumal ich wetten könnte, dass sich gerade sämtliche Frauen aus dem Kurs in diesem Raum aufhalten. Allein das Schwatzen und Kichern fehlt, unvorstellbar eigentlich und deshalb sehr gespenstisch. Angesichts der Warteschlange belasse ich es beim Zähneputzen und verlege das Duschen auf die Frühstückspause, was sich als gute Idee erweist, denn ich habe mein Handtuch im Zimmer vergessen. Auf dem Rückweg komme ich am Bad der Männer vorbei. Ich kann mir nicht verkneifen, einen Blick durch die halb offene Tür hineinzuwerfen: gähnende Leere, natürlich. Entweder sind alle schon fertig, oder keiner war da.
In den Gruppenraum einzutreten heißt, wieder in die Nacht zurückzukehren. Nur ein einziges kleines Kerzenlicht brennt vorn an Geralds Platz. Es ist sehr kühl im Raum, und die wenigen Leute, die schon vor mir eingetroffen sind, haben sich bis zur Nasenspitze vermummt. Diesmal will ich mir auch ein Nest bauen. Ich schiebe zusammengerollte Socken als Extrapolster unter meine Knie und wickle mich sorgfältig in zwei Wolldecken ein. Mein Rücken hat bisher alles brav mitgemacht, aber mir ist bewusst, dass der gestrige Tag bestenfalls ein Vorspiel war. Trotzdem bin ich sehr zuversichtlich. Ich sitze fest und aufrecht und fühle mich wie ein unbeschriebenes Blatt. Das wird mein Tag. Immer mehr Gestalten schlüpfen leise durch die Tür und gehen zu ihren Plätzen, und mich erfasst ein sentimentales Gefühl von Verbundenheit: Wir haben unsere warmen Betten freiwillig gegen ein Meditationskissen eingetauscht, um diese stille, morgendliche Dunkelheit miteinander zu teilen. Als Gerald seine Klangschale in die Hand nimmt und die Meditation einläutet, versuche ich nicht, den Ton festzuhalten, sondern bin neugierig auf alles, was danach kommen mag.
Fünfundvierzig Minuten später weiß ich, dass mein Sitzkonzept dringend überarbeitet werden muss, aber das erscheint mir im Glanze meiner neu erworbenen heiteren Gelassenheit als unwichtiger Nebenschauplatz. Ich habe in der letzten