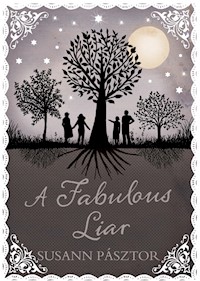9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Geschichte über die Schönheit des Lebens und die erstaunliche Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung. Das Buch zum ARD-Fernsehfilm Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein halbes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben mehr Sinn zu geben. Bei seinem ersten Einsatz möchte er alles richtig machen. Aber Karla, stark, spröde und eigensinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorstehenden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe – zu ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, darf nur noch sein 13-jähriger Sohn Phil Karla besuchen, um ihre Konzertfotos zu archivieren. Dann trifft Hausmeister Klaffki in einer kritischen Situation die richtige Entscheidung – und verhilft Fred zu einer zweiten Chance. »Dieser Roman ist keiner, der Angst vorm Sterben macht. Im Gegenteil. Er macht Lust auf das Leben.« Christine Westermann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Susann Pásztor
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Susann Pásztor
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Susann Pásztor
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Nach »Ein fabelhafter Lügner« (2010) und »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts« (2013) erschien 2017 der Roman »Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster«, für den sie den Evangelischen Buchpreis erhielt. 2021 folgte ihr vierter Roman »Die Geschichte von Kat & Easy«.
Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein halbes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist alleinerzie-hender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben mehr Sinn zu geben. Aber Karla, stark, spröde und eigensinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorstehenden Tod und möchte nur etwas menschliche Nähe – zu ihren Bedingungen. Als Freds Versuch, sie mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen, grandios scheitert, ist es nur noch Phil, sein 13-jähriger Sohn, der Karla besuchen darf, um ihre Konzertfotos zu archivieren. Dann trifft Hausmeister Klaffki in einer kritischen Situation die richtige Entscheidung – und verhilft Fred zu einer zweiten Chance.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, 2018 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Onimage/Franck Lautre
ISBN978-3-462-31593-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Fred
Phil
Karla
Fred
Karla
Fred
Phil
Karla
Gudrun
Fred
Karla
Phil
Karla und Fred
Gudrun
Karla
Phil
Fred
Phil
Fred
Phil
Karla
Fred
Karla und Fred
Gudrun
Phil
Fred
Karla
Fred
Phil
Karla
Fred
Phil
Karla
Fred
Phil
Karla
Fred
Karla
Phil
Fred
Phil
Für Uwe
Fred
Nur zehn Minuten vor Karlas Hauseingang reichten aus, um Freds Zuversicht in Beklommenheit und dann in mühsam kontrollierte Panik zu verwandeln.
Nicht, dass sie ihn hätte warten lassen. Es gehörte zu seinen Gewohnheiten, Anfahrtszeiten so großzügig zu kalkulieren, dass ihm bei der Ankunft noch genügend Zeit zur Orientierung blieb. Das gab ihm Sicherheit. War er irgendwo mit jemandem verabredet, was selten genug vorkam, schlenderte er immer ein wenig auf und ab und entfernte sich dann so weit, dass er den Treffpunkt noch gut im Auge behalten konnte, um sich bei der ersten Sichtung der anderen Person wieder dem Ziel zu nähern. Niemals würde Fred allein in einem Restaurant sitzen und sich die Blöße des Wartens, womöglich des vergeblichen Wartens geben. Lieber blieb er draußen, überwachte von Weitem den Eingang, entlastete das Gewissen der zu spät Kommenden, indem er – ganz außer Atem – noch später eintraf als sie, und konnte sich sogar einreden, er sei ja selbst gar nicht vor Ort gewesen, wenn man ihn versetzte. Besuchte er jemanden, nutzte er die Zeit, die er durch seine frühe Ankunft gewonnen hatte, um in aller Ruhe Fassaden, Vorgärten, Schaufenster, Passanten oder Plakatwände zu betrachten, bis es so weit war, dass er den Klingelknopf drücken konnte.
In Karlas Straße gab es kaum etwas, das seine Augen zum Verweilen einlud. Überhaupt hielt er sich in Gegenden wie dieser ungern auf, zu viel Graffiti an den Häuserwänden, zu viel Hundescheiße auf dem Gehweg, zu viele Kneipen, in die er niemals einen Fuß gesetzt hätte. Das Mietshaus, vor dem er stand, war Anfang des letzten oder vielleicht noch im vorletzten Jahrhundert gebaut worden und wirkte heruntergekommen und abweisend. Jemand hatte eine weihnachtliche Lichterkette an den Balkonkästen im Hochparterre befestigt, wo sie im Halbsekundentakt verdorrtes Gestrüpp mit blauem LED-Licht illuminierte. Karlas Wohnung war im vierten Stock, hatte sie ihm am Telefon gesagt. Er versuchte sich auszumalen, wie Karla wohl aussah, und merkte, dass sich sein Magen vor Nervosität verkrampfte. Um sich zu entspannen, gestattete er sich die Phantasie eines Gesichts, das ihn beim Öffnen der Wohnungstür voller Dankbarkeit und Erleichterung ansah. Das half, aber nur kurz. Er wusste, er hätte sich gelassen und souverän fühlen sollen, aber was er fühlte, war blanke Angst.
Es wurde Zeit. Noch bevor er die Hand zur Klingel ausstrecken konnte, deren Position auf dem Tableau er gleich bei seiner Ankunft ausgemacht hatte, öffnete sich die Tür, und ein schmächtiges Männlein im bordeauxroten Trainingsanzug wurde von einer Dogge ins Freie gezerrt. Fred nahm dankbar zur Kenntnis, dass sie einen Maulkorb trug. Er murmelte einen Gruß und drückte sich an ihnen vorbei ins Innere des Hauses. Das Hinweisschild »Aufzug im Brandfall nicht benutzen« sah er sofort. Er beschloss, die Treppe zu nehmen.
Er ließ sich Zeit. Als er den zweiten Stock erreichte, schwitzte er bereits, und sein Atem ging stoßweise. Je weiter er aufwärts stieg, umso mehr verfluchte er sein Vorhaben, genauso wie er die schwarze Aktentasche verfluchte, die, mit nutzlosen Papieren bestückt, unter seinem Arm klemmte und einen Eindruck von Seriosität vermitteln sollte. Wenigstens lenkte ihn seine Kurzatmigkeit von der Angst ab. Als er endlich im vierten Stock angekommen war, musste er der Versuchung widerstehen, sich erschöpft auf dem Treppenabsatz niederzulassen. Es erschien ihm unwürdig angesichts der Aufgabe, die ihm bevorstand, schließlich war er nur übergewichtig, aber ansonsten gesund. Er stand da und lauschte nach Geräuschen hinter ihrer Wohnungstür, aber sein eigener Puls dröhnte ihm viel zu laut in den Ohren, als dass er etwas hören konnte. Er musste sich noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um sich zu beruhigen.
Lächeln. In einem seiner Ratgeber hatte Fred gelesen, dass selbst ein künstliches Lächeln, wenn es nur lange genug aufgesetzt wird, jedes Unbehagen in gute Laune verwandeln kann. Das Gehirn empfängt die Impulse durch die Mimik, vermutet einen freudigen Anlass und beginnt, die entsprechenden positiven Botenstoffe auszusenden. Positive Botenstoffe waren genau das, was er jetzt brauchte. Er lächelte erst verlegen, dann mit aller Kraft die Wohnungstür an, bis ihm der Gedanke kam, Karla könnte seine Anwesenheit im Treppenhaus längst bemerkt haben und ihn durch den Spion beobachten. Er schloss den Mund und sah auf seine Armbanduhr. Schon nach halb sechs. Sie wartete auf ihn. Er nahm sich nicht mehr die Zeit, um zu überprüfen, ob seine Stimmung sich tatsächlich gehoben hatte, sondern drückte auf die Klingel. Als er hörte, wie sich auf der anderen Seite Schritte näherten, rief er seinen Namen und dass er schon oben stünde, direkt vor ihrer Wohnungstür.
»Fred Wiener«, sagte er noch einmal, als Karla die Tür öffnete. »Guten Tag, Frau Jenner-García. Wir haben miteinander telefoniert.«
Dieser Name. Musste man den letzten Teil spanisch aussprechen? Den ersten womöglich auch? Bei seinem ersten Gespräch mit ihr vor zwei Tagen hatte er vermeiden können, sie direkt anzureden, dafür aber vorher ausführlich geprobt, wie er sich am Telefon vorstellen wollte. »Ja, hallo, hier ist Fred Wiener, Ihr Sterbebegleiter.« Das klang nicht gut. »Fred Wiener, Ihr ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter.« Viel zu formell, und außerdem empfand er den Zusatz »ehrenamtlich« bei so einer wichtigen Aufgabe, Hand aufs Herz, fast schon als diskriminierend, schließlich hatte er eine lange Ausbildungszeit hinter sich. Dann besser »Ihr ambulanter Begleiter«? Am Ende entschied er sich für »Fred Wiener vom Hospiz«, das war aussagekräftig genug und dürfte auch auf Karla weniger bedrohlich wirken. Auf die Qualität ihres Gesprächs hatte es keine Auswirkungen gehabt. Karla war kurz angebunden gewesen und hatte ihm nur den Besuchstermin und ihre Adresse bestätigt, und hätte er den Mut besessen, sie wenigstens ein oder zwei Mal mit ihrem vollen Namen anzureden, hätte das Telefonat doppelt so lange gedauert. Passt es Ihnen Freitag um halb sechs? Ja, passt. Vierter Stock, es gibt einen Fahrstuhl.
Jetzt lehnte Karla Jenner-García mit einem Gesichtsausdruck am Türrahmen, als würde ihr Freitag um halb sechs doch nicht passen. Sie sah, stellte Fred überrascht fest, überhaupt nicht wie eine Sterbende aus, jedenfalls nicht wie die Sorte Sterbender, auf deren Anblick er sich vorbereitet hatte. Blass und schmal war sie, aber blass und schmal hätte sie schon immer gewesen sein können. Ihr Blick war konzentriert, ihre Haare waren lang und dunkelbraun und mit vereinzelten weißen Fäden durchsetzt. Sie trug Kleidung von einer Art, die er nicht zuordnen konnte: War das ein Kleid oder eine lange Bluse, die sie über ihrer Hose drapiert hatte? Was er hingegen wusste, war, dass sie sechzig Jahre alt war. Und er wusste noch mehr von ihr: dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und Metastasen in der Leber und an der Wirbelsäule, inoperabel. Dass sie die Chemotherapie abgebrochen und höchstens noch ein halbes Jahr zu leben hatte, wahrscheinlich deutlich weniger. Alleinstehend, privat krankenversichert, konfessionslos, hinter der Frage nach Familienangehörigen eine Handynummer und bei der Patientenverfügung ein Fragezeichen. So stand es auf dem Erhebungsbogen, den er von der Hospizleitung bekommen hatte und der zu seiner eigenen persönlichen Sicherheit in seiner Aktentasche steckte, denn er wusste, dass er ihn für ihr Gespräch nicht brauchen würde.
Karla stand reglos da, und Fred wagte nicht, sie zu bitten, ihn hereinzulassen. Wenn sein genuscheltes »Gartschia« völlig verkehrt gewesen wäre, hätte sie ihn bestimmt korrigiert. Bei so einem Namen musste man damit rechnen, dass die Leute überfordert waren. Karlas Blick wanderte von seinen Schuhen zu seiner Aktentasche, und er nahm an, dass sie ihn gerade einer Prüfung unterzog, aber er wusste nicht, was er tun musste, um sie zu bestehen. Sich den Schweiß von der Stirn zu wischen wäre sicher keine gute Idee, obwohl er es gern getan hätte. Stattdessen nahm er die Brille ab, weil die feuchte Haut auf seinem Nasenrücken unerträglich zu jucken begonnen hatte, und putzte die Gläser mit einem bröselnden Papiertuch aus seiner Jackentasche. Als er die Brille wieder aufsetzte, war das Bild unverändert. Im Stockwerk über ihnen knallte eine Tür ins Schloss. Auf eine Sekunde der Stille folgte das Klacken hoher Absätze, dann erschien eine junge Frau auf dem Treppenabsatz, wo sie strauchelte, sich wieder fing und weiter abwärts hastete. Fred trat ein Stück zur Seite, um sie vorbeizulassen. Die Frau sagte »Hi«, aber es war nicht klar, ob sie Karla kannte oder nur aus Höflichkeit grüßte. Ihre kurzen Haare waren dunkel und zerzaust, sie trug Lederstiefel, die ihr bis zu den Oberschenkeln reichten, darüber irgendetwas Knappes, Transparentes, das Fred ebenso wenig benennen konnte wie zuvor Karlas Kleidung, und aus ihrer halb offenen Handtasche hing eine blonde Langhaarperücke heraus und wippte bei jedem ihrer Schritte mit. Der Geruch nach Parfum und Terpentin, den sie hinterließ, reichte aus, um Karla und Fred im gemeinsamen Widerwillen zu vereinen und den Bann zu brechen.
»Kommen Sie rein, Herr Wiener«, sagte Karla und trat einen Schritt zurück.
Sie ging voran, er folgte ihr durch den Flur und meinte an ihrer leicht gebückten Haltung zu erkennen, dass sie Schmerzen hatte oder Schmerzen vermeiden wollte. Seine Jacke behielt er an, weil sie an der Garderobe vorbeiging, ohne ihn zu bitten, abzulegen. Der Flur war lang und kahl, an den Wänden hingen Schwarz-Weiß-Fotografien, aber er nahm sie beim Vorübergehen nur flüchtig wahr: Partybilder? Theateraufführungen? Erst als Karla ihn in einen großen, hellen Raum führte – ihr Wohnzimmer, nahm er an –, konnte er sehen, dass die meisten Bilder Aufnahmen von Live-Konzerten waren: Gitarristen mit fliegenden Haaren und schwitzende Sänger, die sich an ihr Mikrophon klammerten, Schlagzeuger hinter gigantischen Aufbauten, ekstatische Zuhörer, deren Frisuren und Kleider vermuten ließen, dass die Bilder aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren stammten. Eine fremde Welt, zu der er nie Zugang gefunden hatte, weil er weder die Musik von damals noch die aktuellere Rock- und Popmusik mochte. Mit etwas Mühe hätte er fünf klassische Komponisten und ein Dutzend deutscher Schlagertitel aus den vergangenen zehn Jahren aufzählen können, aber damit war sein Repertoire erschöpft. Musik war eine Art Hintergrundrauschen in seinem Leben, das manchmal angenehm, aber meistens störend in sein Bewusstsein drang. Von Hippies, Woodstock und freier Liebe verstand er nichts. Er nahm sich vor, Karlas Fotos irgendwann in Ruhe anzusehen.
Im übrigen Raum gab es nicht viel, was man in Ruhe hätte ansehen wollen. Keine Bücherregale, Pflanzen oder persönliche Gegenstände. Auf den Fußbodendielen standen eine Musikanlage und Lautsprecherboxen, direkt daneben ein Stapel aus abgewetzten, mit Klebeband geflickten Umzugskartons einer deutschen Spedition mit vierstelliger Postleitzahl. Er versuchte sich zu erinnern, wann die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt worden waren. An der Wand gegenüber stand ein einsames Sofa, darauf eine zerknitterte graue Decke, die aussah wie ein verlassener Kokon. Die Raumtemperatur war geradezu tropisch. Karla deutete auf den runden Esstisch in der Zimmerecke, und Fred zog endlich seine Jacke aus, hängte sie über eine Stuhllehne und nahm Platz, während sie zwei Gläser aus einer Wasserkaraffe füllte und ihm eines zuschob. Dann lehnte sie sich zurück und betrachtete ihn schweigend. Die Prüfung war noch nicht vorbei. Was sah sie in ihm? Einen Gesandten des Todes? Einen zukünftigen Beistand für schwere Stunden? Einen schwitzenden, übergewichtigen Mittvierziger?
Obwohl Fred nicht durstig war, trank er sein Glas in einem Zug aus und stellte es mit Schwung auf dem Tisch ab. Er sah, wie sie bei dem Geräusch zusammenzuckte, und traf eine Entscheidung. Sie hatte eine Begleitung gewünscht, er war ihr Begleiter. Es war unwichtig, womit er den Anfang machte, Hauptsache, er fing überhaupt an.
»Ihr Name. Sie kommen aus Spanien?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe lange dort gelebt.«
»Und wo genau?« Als würde Fred sich in Spanien auskennen.
»Erst Ibiza, später Formentera.«
Unschöne Erinnerungen an einen missglückten Familienurlaub tauchten vor seinem inneren Auge auf. »Ah, Ibiza. Da war ich schon mal. Ist eine Weile her.«
Karla nickte höflich und desinteressiert. Er versuchte es mit einem anderen Thema.
»Die Bilder. Sind die von Ihnen? Tolle Aufnahmen.«
»Tun Sie mir den Gefallen und hören Sie bitte mit dieser Scheißkonversation auf.« Sie sagte es nicht unfreundlich, aber bestimmt.
Fred erstarrte mit hochrotem Kopf. Ein Fehler, er hatte jetzt schon einen Fehler gemacht. Was wollte sie? Wollte sie über den Tod reden? Über ihre Krankheit?
»Entschuldigen Sie«, sagte er. Er wagte nicht, ihr ins Gesicht zu sehen. Stattdessen richtete er seinen Blick auf den Boden und entdeckte, dass Karla barfuß war. Warum ihn der Anblick ihrer bloßen Füße so erschütterte, konnte er sich nicht erklären.
»Herr Wiener?«, fragte Karla und wartete geduldig, bis er wieder zu ihr aufblickte. »Darf ich Sie fragen, warum Sie das machen? Was bringt Sie dazu, fremde Leute zu besuchen, die bald sterben werden?«
Keine Frage war ihm bisher lieber gewesen als diese. Nicht, dass sie ihm dauernd gestellt worden wäre, aber zumindest unter seinen Arbeitskollegen hatte sich bald herumgesprochen, dass Fred, der Langweiler, sich neuerdings auf dubiosen Fortbildungskursen herumtrieb. Wie, Sterbebegleiter? Wie er denn auf so was gekommen wäre? Erst mit Zurückhaltung, dann mit zunehmender Begeisterung hatte er ihnen erklärt, dass er einen sinnvollen Beitrag leisten wollte in dieser Gesellschaft, dass man sich dem Tabuthema Tod stellen, ja, es in die Mitte des Lebens zurückholen müsse, wo es schließlich auch hingehörte. Menschliche Zuwendung, liebevolle Begleitung, Erhalt der Lebensqualität, ein würdiges Leben bis zum letzten Atemzug: Das waren die Dinge, für die er einstehen wollte. Sie hatten ihm zugehört. Sie waren sogar beeindruckt, er konnte es in ihren Gesichtern lesen. Sieh mal an, unser Fred, das Wienerwürstchen, der traut sich was. Also, ich könnte das nie. Er kassierte keinen Spott wie sonst, wenn es um seine Lebensgestaltung ging, sondern erntete ihren Respekt. Die Hospiz-Broschüren und aktuellen Veranstaltungshinweise, die er von da an monatlich anschleppte, lasen sie nie.
Dass er Karla mit solchen Sachen nicht kommen konnte, wusste er. Mochte er bei den anderen mit seinem sozialen Engagement gepunktet haben, Kranken und Sterbenden hielt man keine flammenden Reden über gesellschaftliche Notstände. Hier war eine schlichte, bescheidene Antwort gefragt. Am besten die Wahrheit. Am zweitbesten irgendetwas Pragmatisches.
»Ich hab mal eine Fernsehsendung über Hospizarbeit gesehen«, sagte er. »Ich wusste sofort, dass ich das auch machen wollte.«
»Nehmen die denn jeden?«
Er entschied sich zu glauben, dass das nicht gegen ihn gerichtet war. »Nicht jeden. Wir sind gut und sorgfältig ausgebildet worden.«
»Aber Sie müssen doch auch irgendwas davon haben. Sie werden doch nicht dafür bezahlt, oder?«
»Nein, ich arbeite ehrenamtlich.« Fred suchte nach etwas Persönlichem, das er ihr sagen konnte, damit sie endlich aufhörte, seine verborgenen Motive auszuloten. »Was ich davon habe? Vielleicht möchte ich lernen, es auszuhalten, dass Menschen sterben.«
»Sie wollen das erst lernen? Sie können das noch nicht?«, fragte Karla.
»Das ist ein langer Weg«, sagte er vage.
Karla runzelte die Stirn, dann hatte sie offenbar eine Eingebung. »Sie machen das noch gar nicht lange, oder?«
Ach nein, nicht schon jetzt. Er hätte zu gern etwas mehr Zeit gehabt, um eine Beziehung zwischen ihnen aufzubauen und Karlas Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen auch zu sich selbst, dass er dieser Aufgabe gewachsen war, er, der blutige Anfänger. Kurz überlegte er, ob er »Seit mehr als einem Jahr« antworten und einfach seine Ausbildungszeit dazurechnen sollte, was noch nicht einmal gelogen wäre, aber dann sagte er: »Es ist mein erstes Mal.« Er versuchte, seine Stimme fest und selbstbewusst klingen zu lassen.
Sie sah ihn verblüfft an. Dann versuchte sie ein Lächeln, was ihr misslang, und sagte: »Was für ein Zufall. Bei mir ist es auch das erste Mal.«
Sie schwiegen. Durch Freds Hirn rasten Formulierungen, mit denen er an ihren letzten Satz anknüpfen könnte (»Dann lassen Sie uns doch das Beste daraus machen« oder »Ich weiß, was für eine schwierige Situation das für Sie ist« oder wenigstens »Wollen Sie gern noch mehr von mir wissen?«), aber keine davon schien ihm angemessen. Um irgendetwas zu tun, fragte er: »Darf ich?«, und wollte nach der Karaffe greifen, aber Karla kam ihm zuvor und stieß beim Eingießen sein Glas um, was sie maßlos zu ärgern schien. Sie stand auf und ging. Sie blieb lange weg. Fred sah zu, wie sich ein kleines Wasserrinnsal langsam zur Tischkante vorarbeitete. Bevor es hinuntertropfen konnte, hielt er es mit seinem Unterarm auf.
Karla kehrte mit einer Rolle Küchenpapier in der Hand zurück, riss ein paar Blätter ab und begann den Tisch trockenzureiben. »Meine Zeit wird knapp«, sagte sie.
»Kein Problem«, versicherte Fred und griff nach seiner Aktentasche. »Wir können auch gern einen neuen –«
»Vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht nur ein paar Wochen. Im Moment geht es mir erstaunlich gut, bis auf die Rückenschmerzen. Ich brauche den Pflegedienst noch nicht, aber das kann sich schnell ändern. Mich mit Schmerzmitteln versorgen kann ich selbst. Ich will nicht in ein Hospiz, ich will hier in meiner Wohnung bleiben. Dass es Hospizmitarbeiter gibt, die einen zuhause betreuen, hat mir mein Arzt erzählt. Er sagte mir, dass es geschulte Leute sind, denen man sich mit seiner Krankheit zumuten kann.«
»So ist es«, sagte Fred und stellte seine Tasche behutsam auf dem Boden ab.
»Ich möchte keine Zeit mit Gesprächen verlieren, die mich langweilen. Gespräche über meine Bilder langweilen mich. Tut mir leid, wenn ich Sie vorhin verschreckt habe.« Sie schob die nassen Papiertücher an den Rand des Tischs und setzte sich wieder.
»Was würden Sie denn gern tun mit der Zeit, die Ihnen noch bleibt?« Endlich konnte er ihr eine sinnvolle Frage stellen, die sie beide weiterbringen und ihr Gespräch in ruhigere, positive Bahnen lenken würde.
»Ist das Ihr Unterhaltungsprogramm für Sterbende, Herr Wiener?«, fragte Karla. »Ich setze eine Liste mit meinen Wünschen auf, die wir dann zusammen abarbeiten? Ein letztes Mal ans Meer? Noch einen Film für die Nachwelt drehen? Ich war noch nie in einem Sexshop oder so?«
»Warum nicht«, sagte er vorsichtig.
»Dann sind Sie sehr romantisch, Herr Wiener. Wenn ich Listen schreibe, dann sind es welche, auf denen steht, welche Todesarten mir noch weniger gefallen als die, an der ich sterben werde. Ich schreibe Listen mit meinen gebrochenen Versprechen und all den Dingen, an die ich nie geglaubt habe. Ich schreibe eigentlich nur noch Listen. Für alles andere fehlen mir die Worte.«
Jedes ihrer »Herr Wiener« drückte Fred ein bisschen fester gegen die hölzerne Lehne seines Stuhls. Er versuchte sich zu befreien, indem er sich hilfreiche Tipps aus seiner Ausbildungszeit ins Gedächtnis rief: Situationen wie diese kommen immer wieder vor. Sterbende sind nicht immer nett. Sterbende können ungehalten, unfreundlich oder sogar aggressiv werden, auch wenn sie gleichzeitig unsere Nähe wünschen. Davon abgesehen musste er zugeben, dass Karla seine geheimen Phantasien sofort durchschaut hatte. Selbstverständlich träumte er von glücklichen Klienten, deren letzte Wünsche er, Fred Wiener, herausfand und mit Kreativität und großem Geschick erfüllte, je ausgefallener, desto besser. Und daran, fand er, war nichts, aber auch gar nichts verkehrt.
»Haben Sie denn Familienangehörige oder Freunde, die sich um Sie kümmern?«, fragte er und wappnete sich gegen das nächste »Herr Wiener«.
»Ich bin erst vor einem Dreivierteljahr zurück nach Deutschland gekommen, Herr Wiener«, sagte Karla. »Nach über zwanzig Jahren. Ich konnte diese ewige Sonne nicht mehr ertragen. Andere Leute gehen nach Ibiza, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Ich wollte es umgekehrt machen. Dumm gelaufen. Aber meinen Sonnenuntergang hier kriege ich noch alleine hin, danke.«
Fred nickte. Also keine Freunde, jedenfalls nicht in der Nähe. »Und Ihre Familie?«
Sie sah ihn an, als hätte er sie nach der genauen Anzahl und Lage ihrer Metastasen gefragt. Dann stand sie auf, griff mit spitzen Fingern nach dem Häuflein aufgeweichtem Küchenpapier und sagte im Weggehen: »Ich habe eine Schwester, und die ist im Todesfall zu benachrichtigen. Solange ich das noch sagen kann, ist er nicht eingetreten.«
Schwester anrufen, notierte Fred in Gedanken. Kontakt herstellen. Versöhnung. Er streckte die Beine aus, dehnte seinen schmerzenden Rücken und spürte den Druck auf seiner Blase: das Wasser, die Nervosität. Einen Moment zögerte er, weil es ihm unangenehm war, dann rief er in die Richtung, in der er die Küche vermutete, ob er ihre Toilette benutzen dürfe. Er rechnete damit, dass sie ihn auf eine Gästetoilette schicken würde, aber offenbar hatte sie keine, denn sie wies ihm den Weg zu ihrem privaten Badezimmer, in dem er sich wie ein unbeholfener Eindringling fühlte. Auch hier lief die Heizung auf vollen Touren. Er vermied es, mit seinen Straßenschuhen auf einen der Baumwollvorleger zu treten, und setzte sich zum Pinkeln hin. Obwohl er sich strenge Diskretion verordnet hatte, konnte er nicht anders, als auf die Ansammlung von Medikamenten zu starren, die auf der Ablage neben dem Waschbecken stand. Sie hießen MST Retard, Sevredol, Novaminsulfon oder Movicol, dessen Verpackung so groß wie ein Waschpulverkarton war. Keinen dieser Namen hatte Fred zuvor gehört. Er wusch sich die Hände und rieb sie an seinen Hosenbeinen trocken, weil er nicht wagte, ihr Handtuch zu benutzen.
Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer kam er an der offenen Küchentür vorbei. Die Küche war leer und so warm wie das Bad. Auf dem Tisch lagen weitere Medikamente, zwischen den Verpackungen ein aufgeschlagenes Schreibheft. Ein Stift war zu Boden gefallen und neben ein Stuhlbein gerollt. Über dem Küchentisch hing ein mit Reißzwecken befestigtes Poster, das erste farbige Bild, das er in Karlas Wohnung sah. Es war die Zeichnung eines Totenschädels, halb versunken im gelben Wüstensand unter hellblauem Himmel, daneben ein paar Knochen und eine leuchtend rote Rose. »Grateful Dead« stand in Großbuchstaben unter dem Bild, dann folgten Termine, Städte und Veranstaltungsorte. Das Plakat war an mehreren Stellen eingerissen, am unteren rechten Rand fehlte eine Ecke. Fred fand das Bild geschmacklos. Er trat einen Schritt näher heran und entdeckte die Jahreszahl 1981 unter der Zeichnung, aber das machte es auch nicht besser. Als er Karlas Schritte im Flur hörte, blieb er stehen, wo er war.
»Ich habe es letzte Woche wieder aufgehängt«, sagte sie, als sie ihn vor dem Plakat entdeckte. »Der Ironie wegen. Und weil es mir mal viel bedeutet hat.«
»Es ist sehr – ungewöhnlich«, sagte Fred, weil er nicht wusste, was er sonst hätte sagen können.
»Es ist ziemlich scheußlich«, sagte Karla und ging an ihm vorbei zum Küchentisch. »Oder finden Sie Totenköpfe etwa schön, Herr Wiener?« Sie begann, zwischen den Medikamentenpackungen herumzuwühlen, aber fand offenbar nicht, was sie suchte. Fred hatte das deutliche Gefühl, dass er störte.
»Ich glaube, ich werde mich mal langsam wieder auf den Weg machen«, sagte er und warf einen unauffälligen Blick auf seine Armbanduhr: erst halb sieben. Auch seine Besuchszeit war großzügig kalkuliert gewesen, er hatte mindestens zwei Stunden eingeplant.
»Ja«, sagte sie, mehr nicht.
Er ging ihr voraus ins Wohnzimmer, um seine Jacke und die Aktentasche zu holen. Sie blieb an der Tür stehen. Er nahm seine Sachen und fragte: »Wann soll ich wiederkommen? Oder soll ich Sie in den nächsten Tagen noch mal anrufen, und wir machen dann einen neuen Termin aus?«
»Ich weiß nicht, Herr Wiener«, sagte sie.
»Das ist in Ordnung. Ich melde mich einfach wieder bei Ihnen.«
»Herr Wiener, ich weiß nicht, ob ich das hier –«, ihre Hand beschrieb eine Spirale, in deren Zentrum er stand, »ob ich das hier brauche.«
Darauf war er nicht vorbereitet. Anlaufschwierigkeiten, ja, man musste sich schließlich erst mal kennenlernen, was unter den gegebenen Umständen nicht einfach war, aber wer eine Sterbebegleitung anforderte, der wusste doch eigentlich, was er wollte. Es musste also an ihm liegen. Nicht feinfühlig genug oder zu geschwätzig. Die falschen Themen. Vielleicht hätte er auch nicht zugeben sollen, dass er ein Neuling war. Er war ihr zu unerfahren. Wenn das der Grund war, konnte er nichts ausrichten, schließlich fing jeder irgendwann einmal an. Mit einem Wachkoma- oder Alzheimerpatienten als erstem Fall hätte er dieses Problem nicht gehabt, die fragten einen nicht nach Erfahrung.
»Das hat nichts mit Ihnen zu tun, Herr Wiener«, sagte Karla, die sein Gesicht studierte, und es klang, als würde sie es auch so meinen. »Vielleicht ist diese Art von Beistand einfach nichts für mich.«
Weil ihm der Gedanke kam, dass sie ihn ständig mit seinem Namen anredete, weil sie dasselbe von ihm erwartete, sagte er: »Lassen Sie sich ruhig noch etwas Zeit, Frau Jenner-García.« Er hatte sich spontan für »Garzia« entschieden und fand, dass es sich besser anhörte als beim ersten Versuch. Erst dann wurde ihm klar, was für ein Schwachsinn dieser Satz war. Sie hatte keine Zeit, das hatte sie ihm selbst gesagt. Sie konnte sie sich weder lassen noch nehmen.
»Ich rufe Sie nächste Woche an«, sagte er entschlossen. Sie wehrte ihn ab, als er versicherte, den Weg zur Wohnungstür allein finden zu können. Als er hinter ihr herging, konnte er den Blick nicht von ihren bloßen Füßen abwenden. Die Zehennägel waren tiefrot lackiert. Es gab ein Märchen, in dem eine Prinzessin vorkam, die nur unter großen Schmerzen gehen konnte, an mehr erinnerte er sich nicht, aber er wusste, er hatte es Philipp vorgelesen, als er klein gewesen war.
»Wie gesagt, ich rufe Sie an. Gleich Anfang nächster Woche.« Auf die Gefahr hin, sich erneut zu blamieren, reichte er ihr die Hand, weil es ihm plötzlich ungeheuer wichtig erschien, sie zum Abschied zu berühren. Würde sie seine Hand nehmen, wäre es ein Zeichen, dass es weiterginge. Er wusste nicht, warum er das so unbedingt wollte, aber er wusste genau, wie kalt ihre Hand sein würde.
Sie zögerte, dann ergriff sie seine Hand und drückte sie kurz. »Machen Sie’s gut, Herr Wiener.« Und dann, als sie die Tür schon halb geschlossen hatte: »Es reicht völlig aus, wenn Sie nur Jenner zu mir sagen.«
»Danke, Frau Jenner«, sagte Fred, obwohl die Tür bereits ins Schloss gefallen war. Dass sie ihm sagte, wie er sie anreden sollte, nahm er als weiteres Zeichen für ein Wiedersehen mit ihr. Er fand den Schalter für das Treppenhauslicht nicht und fürchtete, versehentlich auf ihre oder irgendjemandes Klingel zu drücken, also ging er im Dunkeln nach unten; der Handlauf des Geländers zu seiner Linken und das fahle Licht vom Hinterhof reichten ihm zur Orientierung. Je weiter er abwärts stieg, desto lauter und unangenehmer erschienen ihm die Stimmen und Essensgerüche, die aus den Wohnungen drangen. Die letzte Wohnungstür im Erdgeschoss, die er passierte, wurde aufgerissen, als er sich auf gleicher Höhe mit ihr befand. Ein paar Sekunden starrten sie sich an, der Mann im roten Trainingsanzug und Fred, beide gleichermaßen geschockt vom Anblick des anderen. Dann drückte der Mann auf den Schalter neben seiner Tür, und Fred, geblendet vom Licht, floh an den verbeulten Briefkästen vorbei Richtung Ausgang.
Phil
Phil war sein Name. Phil, nicht Philipp. Als der Paketbote um zwei Uhr geklingelt hatte, war er noch der gewesen, den sie überall nur Lippe nannten und der sich wieder mal nicht traute, auf dem Signaturgerät mit »Ficken« zu unterschreiben, wie es Max angeblich immer tat, ohne dass es mal jemandem aufgefallen wäre. Max behauptete, dass die vielen Pakete, die an seine Mutter adressiert waren, größtenteils Sexunterwäsche enthielten. Die Büchersendungen, die Phil für seinen Vater entgegennahm, waren definitiv keine Sexbüchersendungen. Früher waren es psychologische Ratgeber gewesen und seit einiger Zeit nur noch Bücher übers Sterben. Die Bücher übers Sterben hatten bessere Titel als die Psychobücher.
Das Paket von heute jedoch war an Phil persönlich gerichtet, ein abgestoßener Karton, dessen Herkunft (»Gesundheitssandale Jessica, Größe 40, nougat«) zwischen unzähligen Lagen Klebeband gut zu erkennen war. Die Handschrift auf dem Adressfeld war ihm vertraut. Um die Adresse herum klebte ein gutes Dutzend Glitzersternchen, um den Empfänger in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Es war die Sorte von Paket, in der nicht mal einer wie Max Sexunterwäsche vermutet hätte.
Der Paketbote hielt ihm das Gerät zum Unterschreiben hin. Phil sah zu, wie sein Gekrakel auf dem kleinen Display mit leichter Verzögerung sichtbar wurde – großes W, kleines i –, dann verrutschte seine Linie auf der glatten Oberfläche bis ins untere rechte Eck, und der Bote nahm es als Zeichen, ihm das Gerät aus der Hand zu reißen und grußlos zu verschwinden. Er könnte Max morgen erzählen, er hätte statt mit »Wiener« beinahe mit »Wichsen« unterschrieben, wenn ihm nur genügend Zeit dafür geblieben wäre. Und als hätte dieses Wi in ihm eine neue Lust an der Einsilbigkeit geweckt, wusste er, noch bevor er die Tür mit dem Knie ins Schloss gedrückt und das Paket in das untere Fach vom Flurregal gestopft hatte, dass er sich von heute an Phil nennen würde.
Einen großen Teil des Nachmittags verbrachte er damit, seine neue Unterschrift zu üben. Bei dieser Signatur ging es um mehr, als nur das ipp wegzulassen; das l am Ende musste klarstellen, dass danach Schluss war: Phil war eine Ansage und keine Abkürzung. Lippe war Geschichte, Philipp durfte in Dokumenten weiterleben, Phil war die Antwort auf eine Reihe offener Fragen, etwa die, wie er später seine Lyrikbände nach einer Lesung signieren würde. Meinem Deutschlehrer Dr. Klausdietrich Pfotenhauer in tiefer Dankbarkeit (wofür genau, würde er vor Ort entscheiden), Phil Wiener. Er öffnete eine neue Textdatei in seinem Computer und tippte Phil Wiener in Garamond 14 Punkt, darunter schrieb er »Wörterkrankenhaus«, aber das sah einfach beschissen aus, auch in 18 und in 24 Punkt. Eigentlich hätte man das Wort »Wörterkrankenhaus« zu sich selbst in die Notaufnahme schicken müssen, aber er hatte es erfunden, als er acht Jahre alt gewesen war, und mit einer leicht gönnerhaften Liebe zu seinem jüngeren Selbst stand er zu seinem Frühwerk, jedenfalls solange ihm nichts Besseres einfiel.
»Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen, Herr Wiener – darf ich Sie Phil nennen?«
»Selbstverständlich, ich werde seit meinem vierzehnten Lebensjahr nicht anders gerufen. Meine ersten Gedichte schrieb ich schon auf der Grundschule.«
»Sie gelten als erbitterter Feind idiotischer Wörter. In einem anderen Interview erwähnten Sie einmal, Sie würden solche Wörter in eine Wörterklinik einweisen.«
»Wörterkrankenhaus. Ein kleines Hobby von mir, das ich vor vielen Jahren begonnen und ständig weiterentwickelt habe.«
Das Wörterkrankenhaus bestand aus einer dreibändigen handschriftlichen Sammlung von Wörtern, die Phils Meinung nach vorübergehend, längerfristig oder, wenn sie unheilbar erkrankt waren, auch endgültig aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Neben der Notaufnahme gab es eine Quarantänestation, eine Abteilung für Chirurgie und eine Intensivstation, andere Abteilungen waren zwischenzeitlich gegründet, aber bald wieder verworfen worden. Auf der Quarantänestation befanden sich Wörter wie beispielsweise Gott, Ferienlager oder zauberschön und seit heute auch Lippe, Wörter also, die missbraucht, falsch verstanden oder verdreht worden waren. Man musste sie zunächst isolieren und ihnen später neue Inhalte geben oder die alte Bedeutung wiederherstellen, bevor sie wieder einen Text betreten durften. Ihre Zukunft war ungewiss. Viele schafften es nie mehr nach draußen.
Dann gab es noch die Sorte Wörter, denen Betonungsfanatiker einen Trennungsstrich verpasst hatten, um auch dem letzten Depp ihre Bedeutung einzuhämmern, also Wörter wie Ent-täuschung, Ver-trauen oder Ein-sicht. Sie waren ein Fall für die Chirurgie. Manche waren zu Versalien angeschwollen oder litten an etwas, von dem Phil inzwischen wusste, dass man es Binnenmajuskel nannte: LeserInnen etwa oder BahnCard. (Binnenmajuskel war im Übrigen ein Prachtwort von geradezu überirdischer Schönheit, aber Prachtwörter sammelte er nicht, sondern verschwendete sie.) Die meisten dieser manipulierten Wörter stammten aus Briefen seiner Mutter. Sie wurden als geheilt entlassen, wenn sie wieder ihre alte Form angenommen hatten. Das konnte lange dauern.
Auf der Intensivstation regierte der Schmerz. Er steckte in harmlosen Wörtern wie Trinidad oder Zwetschgendatschi, die bei Phil ein ähnliches körperliches Unbehagen hervorriefen wie der Kontakt mit fettigen Kartoffelchips. Umgekehrt verhielt es sich mit Schmunzeln, Knuspern, Brutzeln, Schlummern oder Schnabulieren: Das waren Wörter, denen man eins in die Fresse geben, auf die man so lange draufhauen musste, bis sie um Gnade winselten. Woher seine Aversion kam, wusste er nicht, klar war nur, dass es nicht allein am u liegen konnte. Die Wörter waren einfach dumm. Strunzdumm. Und strunzdumm gehörte geohrfeigt.
Phil löschte das Dokument und klappte den Rechner wieder zu. Er nahm die signierten Papierbögen nacheinander in die Hand und markierte die fünf Unterschriften, die er am gelungensten fand. Dann schob er die Blätter zusammen und drehte den Stapel um, so dass die unbeschriebenen Rückseiten nach oben zeigten. Er überlegte einen Moment und schrieb »Wintergedicht für Sabine« auf das oberste Blatt. Gedichte mussten handschriftlich verfasst werden, Unterlage und Schreibwerkzeug waren dabei nicht von Bedeutung, und nur die allerletzte Fassung wurde eingetippt. Wintergedicht also. Er knipste die Schreibtischlampe aus, um sich in der Dunkelheit besser konzentrieren zu können, und knipste sie nach wenigen Minuten wieder an. Er schrieb Hässliche Sterne und strich die Worte gleich wieder durch, einmal, zweimal, dreimal. Er kritzelte eine Girlande aus Tannenzweigen, die sich um den Titel rankte. Noch eine Kerze für das i in Sabine? Scheiße, so machte man keine Lyrik. Als er Kalte Füße schrieb, hörte er, wie sein Vater die Wohnungstür aufschloss. Es war zehn nach sieben. Er hatte frühestens in einer Stunde mit ihm gerechnet.
»Philipp?«
Wenn sein Vater nach Hause kam, rief er nie »Hallo!« oder »Ich bin da!«, Dinge also, die normale Menschen beim Nachhausekommen rufen würden, sondern immer nur Philipp mit Fragezeichen hintendran, als wäre die Tatsache, dass das Licht in der Wohnung brannte und Phils Hausschlüssel am Haken hing, kein Grund, mit seiner Anwesenheit zu rechnen. Hastig notierte er:
Kalte Füße,
Kalte Hände,
Kaltes Herz
»Philipp?« Die Stimme war jetzt direkt vor seiner Tür. Wenn er nicht gleich antwortete, würde sein Vater als Nächstes anklopfen, aber niemals ohne Aufforderung eintreten.
Kalte Füße,
Kalte Hände,
Kaltes Herz.
Verpiss dich.
Ende.
»Komme sofort«, sagte Phil und schob das Blatt mit der ruhigen Hand eines Dichters, der sein Werk in Sicherheit weiß, unter den Papierstapel.
»Ich bin in der Küche, Philipp. Ich hab uns Pizza mitgebracht.«
Jeden Freitag gab es irgendeine Sorte von Fast Food, an allen anderen Tagen war sein Vater der Held der Mikrowelle. Phil interessierte sich nicht für Essen. Er biss mit stoischem Gleichmut in alles, was ihm vorgesetzt wurde, erkundigte sich selten danach, was es überhaupt war, und ließ grundsätzlich einen Teil davon liegen. Wenn er mittags von der Schule kam, aß er den Rest seines Frühstücks, den Rest seiner Pausenbrote und einen der beiden zwangsverordneten Äpfel. Nichts, was in einer Tüte steckte und einen klebrigen Film auf seinen Fingern hinterließ, ertrug er. Süßigkeiten waren egal. Cola oder Limo: egal. Nicht egal: dass er mit dreizehn Jahren nur einen Meter fünfundvierzig groß war. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit ihrem Essverhalten gab oder nicht, jeder konnte es sehen: Phil war zu klein, und sein Vater war zu fett.
»Hallo, Kumpel«, sagte Fred, als Phil in der Tür erschien.
»Hallo, Papa«, sagte Phil. Das Wort Kumpel mochte er, obwohl es in gefährlicher Nähe zu Knuspern wohnte. Er setzte sich. Sie aßen die Pizza aus dem Karton, Fred mit den Händen, Phil mit Messer und Gabel. Sie aßen schweigend, Phil aß bis zur Mittellinie, die er zuvor mit dem Messer markiert hatte, Fred, bis er mit seiner und danach mit Phils übrig gelassener Pizza fertig war.
»Draußen im Regal liegt wieder ein Päckchen von deiner Mutter«, sagte Fred. Er sah Phil dabei nicht an, sondern faltete bedächtig die Pizzakartons zusammen, Fettseite auf Fettseite.
»Mach ich später auf.« Warum er ihre Pakete nicht einfach wegwarf oder wenigstens gründlicher versteckte, statt sie halbherzig aus dem Weg zu räumen, hätte er gern selbst gewusst.
»Gut. Vielleicht machst du dann ja gleich noch das von vorletzter Woche auf. Und das von Ende Oktober. Liegen direkt daneben.«
»Okay«, sagte Phil. Für den Fall, dass sein Vater als Nächstes die Frage nach dem mutmaßlichen Inhalt stellen würde, der seine Abwehr verursachte, hatte er mehrere Antworten parat: Gummibärchen aus Agavendicksaft. Anthroposophische Brettspiele. Ein Sturmgewehr der israelischen Armee.
Fred erhob sich und stopfte die Kartons in den Müll, den Rücken Phil zugewandt. An seiner Gesäßtasche klebte ein schmaler Streifen roter Paprika, der wie eine Aids-Schleife aussah. Phil wurde von einer Welle der Rührung ergriffen, wie jedes Mal, wenn ihm wieder einmal klar wurde, dass Menschen unentwegt Dinge passierten, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen. Erwachsenen Menschen. Sein Vater mochte ein Freak mit Paprika am Arsch sein, aber an Millionen anderen Orten dieser Welt hatten gerade andere Leute andere Sachen an anderen Stellen hängen und merkten es genauso wenig wie Fred und würden es auch nie erfahren, jedenfalls nicht von Phil.
Der Deckel des Mülleimers klappte zu. Während er sich langsam zu ihm umdrehte, sagte Fred: »Philipp, wenn du –«
»Wäre es okay für dich, wenn du von jetzt an Phil zu mir sagen würdest, Papa?« Er war der Herr der Ablenkungsmanöver, nicht sein Vater.
»Wie, einfach die zweite Hälfte weglassen?«
Er nickte.
»Philippos, der Pferdefreund. Mit dem Namen hättest du eigentlich ein Reiter werden sollen.«
»Pferde sind blöd.«
»Hört sich auf jeden Fall besser an als dieses Lippi oder Lippe, wie deine Freunde dich nennen.«
»Ich habe keine Freunde, Papa.« Er versuchte es mit mildem Nachdruck zu sagen (»Hey Papa! Schon vergessen?«), aber es klang wie kindliches Genörgel.
»Max ist nicht dein Freund?«
»Ich rede mit Max.«
»Also dann. Phil. Phil! Wenn du jetzt gerne mit mir über deine Mutter –«
»Wieso bist du eigentlich schon wieder hier?« Der Herr der Ablenkungsmanöver ließ sich die Gesprächsleitung nicht aus der Hand nehmen. »Du hast gesagt, es würde später werden.«
Fred kam zurück an den Tisch und brachte Wasser und zwei Gläser mit. »Stimmt. Hatte ich. Ich dachte, es würde länger dauern.«
»Was würde länger dauern?«
»Mein Gespräch. Mit einer Klientin.«
Nichtangriffspakte waren unverzichtbare Komponenten in ihrer Beziehung. Sie traten dann in Kraft, wenn eine Anfrage mehrmals nacheinander ins Leere lief, wenn Blicke abweisend oder Gesichtszüge starr wurden, nach längeren Schweigepausen oder bei der Verwendung von bis zur Bedeutungslosigkeit abgeschliffenen Wörtern wie »Klientin«, an denen jedes Interesse eines Dreizehnjährigen abgleiten musste. Trotzdem entschied sich Phil fürs Nachhaken. Die Sache mit den Paketen war noch nicht vom Tisch.
»Was für eine Klientin?«
»Ich hatte dir mal davon erzählt. Eine Frau, die bald sterben wird.«