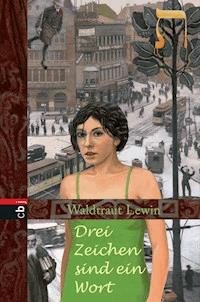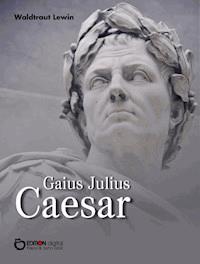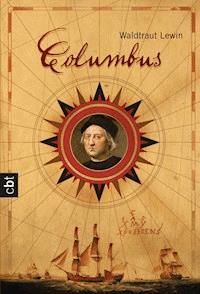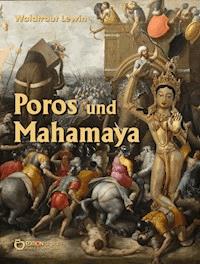14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Haus in Berlin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Berlin im Jahr 1890: Hausmeisterstochter Luise verliebt sich unsterblich in Bertram, Sohn eines vermögenden jüdischen Kaufmanns. Ihre Familien dürfen nichts von ihrer Liebe wissen, doch es kommt zum Eklat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 831
Ähnliche
Waldtraut Lewin
Ein Haus in Berlin, Die Trilogie: 1890 - 1935 - 1989
Band 1
Ein Haus in Berlin - 1890 - Luise, Hinterhof Nord
18901. KapitelLuises Welt
Luise lehnt außerhalb des Lichtkreises der Gaslaterne an der Mauer und heult.
Mutter ist nicht nach Haus gekommen. Mutter ist mal wieder abgängig. Und das bedeutet, Luise muss sie suchen.
Um sechs war der Nähkurs zu Ende. Um sieben ist sie mit Bertram verabredet. Nicht mal absagen kann sie ihm. Nicht mal auf einen Kuss, auf eine Berührung vorbeischauen. Die Fourragehandlung von Bertrams Vater, wo sie sich zwei-, dreimal die Woche heimlich treffen, liegt in einer ganz anderen Ecke der Stadt. Sie muss runter zum Kanal, wo die Kneipen und Destillen sind, und sie darf keine Zeit verlieren.
Die Leute auf der Straße haben alle einen schnellen Schritt am Leib. Es ist kalt. November. Es riecht schon nach Schnee. Wenn Mutter bei der Kälte irgendwo draußen liegen bleibt, dann holt sie sich wieder was weg. Das letzte Mal im April, da gab es noch Nachtfröste, und sie hatte sich eine Lungenentzündung eingefangen, die sie für einen ganzen Monat umhaute. Da mussten die Töchter ihre Arbeit machen, recht und schlecht, und sie hatte ein paar Kunden verloren. Wer will schon eine unzuverlässige Waschfrau beschäftigen. Als wenn’s nicht genug Leute gäbe, die die Arbeit machen. Das darf nicht wieder vorkommen, jetzt so kurz vor Weihnachten, so ein Verdienstausfall! Noch dünnere Suppen als sonst immer.
Luise wischt sich wütend die Tränennässe mit den Handflächen vom Gesicht. Am liebsten würde sie fluchen, schimpfen, auf jemanden einschlagen. Lina, die kleine Schwester, die ihr die Unglücksbotschaft überbrachte, die hat gleich die Beine in die Hand genommen. Die kennt sich aus, die krummbeinige Göre. An ihren dünnen Rattenschwanzzöpfen hätte sie sie gepackt!
Warum kann nicht wer anders die Mutter suchen? Da hocken sie zu Haus herum, ihre reizenden Schwestern. Hedwig verkriecht sich hinterm Waschbottich. Agnes, das faule Stück, sielt sich wie immer im Bett und pennt. Vater ist in der Stammdestille – Na los, Lina, renn mal zu Luise, die kann das am besten. Die kann mit den Leuten umgehen. Ist ja so schlau und so gebildet! Die feine Luise, die sogar zur Tanzstunde darf!
Noch immer steht sie im Schatten. Gaslaternen! ’ne großartige Neuheit hier in Berlin. Taghell mitten in der Nacht. Besonders schön, wenn man falsch angezogen ist für das, was man vorhat.
Ihre hübschen Knöpfstiefelchen, die sie nur für Nähkurs und Tanzstunde anzieht. So eng, dass sie an den Zehen drücken, und viel zu dünn für die Jahreszeit. Die leichte Jacke. Kein Schultertuch. Und im Haar die blaue Seidenschleife, die ihr Bertram geschenkt hat. Na Mahlzeit! Wenn sie in diesem Aufzug in so ’ne Spelunke reinkommt, kriegen die Kerle gleich Stielaugen.
Wütend zerrt sie sich das Band aus dem Haar, befestigt den Zopf so gut es eben geht mit ein paar Nadeln am Hinterkopf. Diese blonden Haare! Wenn sie bloß ein Tuch oder eine Kapotte hätte, um weniger aufzufallen! So wird sie was zu hören kriegen.
Es geht schon los, als sie aus dem Schatten tritt.
»Na, Frolleinchen, schon wat vor heute Abend?«
Sie guckt gar nicht hin. Macht den Nacken steif, setzt ihre hochmütigste Miene auf.
»Zieh ab, du Penner!«
In ihrer Stimme ist die ganze Wut, die sie in sich fühlt, ihr Zorn auf ihre Familie, die Enttäuschung über den verratzten Abend. Der Mann folgt ihr nicht.
Also los. Runter zum Kanal. Aber vorher ein paar Kunden abklappern. Vielleicht hat wer mitgekriegt, wann die Sandern ’ne Fahne hatte und wo sie abgeblieben ist …
Das ist nun mal so. Das muss man nicht beschönigen. Anna Sander trinkt. Sie kann über Wochen, über Monate »ohne« auskommen. Aber wenn sie das bewusste eine Gläschen intus hat, das ihr irgendwer angeboten hat, dann gibt es kein Halten mehr. In Berlin nennt man so was eine Quartalssäuferin.
Luise kennt die Geschichte. Weiß, dass die Mutter als Waisenkind in einer Kneipe aufwuchs und die Gäste sich ’nen Jux draus machten, dem kleinen Schmuddelmädchen was zum Trinken einzuflößen, weil sie dann so lustig wurde und auf dem Tisch tanzte. Irgendwann war’s zu spät. Da kam sie nicht mehr weg von dem Zeug. Später in Berlin als Dienstmädchen schaffte sie’s und ließ die Finger davon. Und sie heiratete Sander und alles ließ sich gut an – bis ihr Mann vom Baugerüst fiel und keine Arbeit mehr kriegte wegen der Knieverletzung, und die Kinder kamen wie die Orgelpfeifen – vier Mädchen. Da ging es wieder los.
Bloß, das rührt keinen und darum muss man es auch keinem erzählen. Die Leute zucken die Achseln über solche Geschichten. Schnapsdrossel ist Schnapsdrossel, egal, aus welchen Gründen.
Luise läuft los, rasch und energisch. Wer schnell geht, friert man weniger. Ihre Absätze klappern auf dem Pflaster.
Sie weiß, zu wem die Mutter heute Wäsche gebracht hat. Zehn, zwölf Schürzen waren dabei gewesen. Alle hatten dran schrubben müssen, so verdreckt waren sie gewesen, vor allem mit Blutflecken. Sogar die kleine Lina hatte mitgemacht, bis sie heulte, weil ihre Hände von der heißen und scharfen Seifenlauge so brannten. Alle bis auf Luise. Die saß am Küchentisch und übte Hohlsaum für ihren Nähkurs. Na, nun haben sie’s ihr heimgezahlt.
Die Schürzen gehören einer Frau im Scheunenviertel, die eine Kleintierschlachterei hat. Zu ihr kommen Leute, wenn sie ein Huhn oder ein Karnickel nicht zu Haus schlachten und noch ein paar Pfennige für den Balg oder die Federn kassieren wollen. Die Frau trocknet die Bälge und verkauft sie an Kürschner weiter, und die gesplissten Federn gehen an eine Bettenhandlung. Außerdem soll sie noch andere Sachen machen, bei denen man sich auch blutige Schürzen holt. Agnes, immer mit dem Mund vorweg, hat sie eine Engelmacherin genannt und eins von der Mutter hinter die Ohren gekriegt. Man kann sich seine Kundschaft nicht aussuchen. Man muss nehmen, was kommt.
Luise geht in der Mitte der Straße. Das Scheunenviertel ist gleich um die Ecke. Hier sind die Gaslaternen spärlicher gesät als auf den großen Boulevards. Eigentlich nur an jeder Kreuzung eine. Die Bürger, so heißt es, sind angehalten, ihre Hausbeleuchtungen anzuzünden. Aber wer schmeißt sein Geld schon zum Fenster raus? So lange es keine Poli-zeiverfügung ist! Über den Türen der Kellergewölbe, die noch geöffnet sind (sie nennen sich großspurig Viktualien- oder Kolonialwarenhandlungen), brennen trübe Petroleumfunzeln. Keine gute Gegend. Zum Glück sind um diese Zeit noch anständige Leute unterwegs, Handwerker, die nach Haus gehen, ihr Arbeitszeug in Säcken über der Schulter, Zugehfrauen, die Feierabend machen, Familienmütter, denen einfällt, dass was zum Abendessen fehlt.
Die Kleintierschlachterin ist bekannt dafür, dass sie meist ’nen Schnaps auf dem Tisch hat. Kann ja sein, die Mutter ist bei der hängen geblieben. (Wäre vernünftiger gewesen, wenn eins der Mädchen den Gang dorthin erledigt hätte.) Vielleicht hat sie ja Glück, gleich bei dieser Frau zu suchen. Wenn sie die Mutter schnell findet und sie nach Haus bugsiert – ja, dann würde sie es noch schaffen zu Bertram. Er wird warten, auch wenn es ein bisschen später wird. Bestimmt wird er warten.
Beim Gedanken an Bertram wird Luise warm. Das Blut strömt schneller durch ihre Adern. Unwillkürlich öffnet sie die Lippen. Der Gedanke an einen Kuss von ihm verbindet sich bei ihr mit dem Geschmack nach Mandeln und Zucker – meist kauft er vor ihrem Rendezvous beim Konditor eine Querstraße weiter eine Tüte Makronen. Wenn sie zu ihm kommt, sind sie noch warm. Und noch bevor sie ihre Jacke abgelegt hat, schiebt er ihr etwas von dem Gebäck zwischen die Lippen und nimmt es mit seinen von ihr ab, und so küssen sie essend und essen küssend, und ihre beiden Münder sind voll Staubzucker, luftig weichem Teig und körnigen Mandelsplittern. Sie glaubt es zu schmecken. Unachtsam geworden, stolpert sie auf dem holprigen Pflaster, knickt um. Die hohen Absätze! Fast hätte sie sich den Knöchel verrenkt.
Vor Schmerz und Enttäuschung schießen ihr die Tränen in die Augen. Sie kneift wütend die Lider zusammen, um den Schleier zu entfernen. Hier im Dunkeln rumstolpern, auf dieser kalten, dreckigen Straße in diesem dreckigen, gefährlichen Viertel, und Anna Sander bei irgendeinem Schnapsglas zu suchen, statt bei Bertram zu sein, im Warmen, mit ihm gemeinsam im großen Sessel des Kontors …
Wieder einmal hat Luise das Elend ihrer Familie satt, bis zum Stehkragen satt. Sie will raus da! Raus! Raus aus all dem! Das muss aufhören. Sie will keinen Waschtrog in der Küche und keinen Vater, der nur in der Kneipe hockt und die Gören verdrischt, sie will ihre neidischen dummen Schwestern nicht, sie will weg aus dem zweiten Hinterhaus, in dem sie lebt. Je schneller, desto bester.
Sie presst die Hände zu Fäusten. Es gibt nur einen einzigen Weg. Sie weiß das und der Rest ihrer schäbigen Familie weiß es auch. Sie muss sich heiraten lassen. Muss einen Mann finden, dem ihr hübsches Gesicht, ihre schöne Figur, ihre guten Manieren und ihr kluger Kopf wichtiger sind als Geld.
Und dass dieser Mann Bertram sein soll – nun, da muss er schon selbst drauf kommen.
Das Pflaster hat aufgehört. Luises Stiefel stapfen durch getrockneten Schlamm. Eine Baustelle neben der anderen, man muss aufpassen, dass man nicht in eine der unbeleuchteten Baugruben stürzt.
Berlin, halb Kuhdorf, halb Stadt. Mitten auf der Wiese stehen schon ein paar Mietskasernen, fünf-, sechsstöckig, und ein paar Fenster sind erleuchtet. Abendbrotzeit. Es riecht nach Kartoffeln, Kohl und Hering. Eklig. Wie zu Hause. Luise presst die Hand vor die Nase.
Ein paar Meter weiter, da kommen die alten Häuser. Zweistöckig, lang gestreckt, ohne Keller, Durchfahrt zum Hof. Einstige Kätnerhäuser. Die Stallungen verfallen. Die Felder sind zugebaut.
Hier haben kleine Bauern die Städter mit Milch, Kartoffeln und Grünzeug versorgt und recht und schlecht gelebt. Jetzt sind ihre Äcker Bauland. Haben alle ihren Schnitt gemacht. Leben von den Zinsen. Es wohnt kaum noch wer hier.
Im Seitengebäude eines solchen Kätnerhauses sitzt die Kaninchenschlachterin.
Luise findet das Haus, weil sie sich an den Birnbaum erinnert, der davor steht. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Sie kann Orte genauso behalten wie lange Gedichte.
Stockdunkel ist die Toreinfahrt. Es stinkt nach verrottetem Fleisch auf diesem Hof. Irgendetwas berührt ihren Kopf, und sie greift mit einem leisen Aufschrei danach. Ihr Herz tobt. Etwas Haariges, Weiches … Natürlich. Die Kaninchenfelle, gewendet zum Trocknen aufgehängt hier draußen. Glitschige und pelzige Dinger. Sie schüttelt sich.
Unter der Schuppentür dringt ein schwacher Lichtschein hervor. Die alte Fregatte scheint ja zu Haus zu sein.
Luise atmet tief durch.
Wär das schön: Wenn jetzt da drin, an dem wackligen Tisch, der Frau gegenüber ihre Mutter sitzen würde, mit zwei, drei Gläschen intus, aber sonst gut beisammen, so gut, dass sie aufstehen und mit ihrer Tochter losgehen könnte, nach Haus. Und sie, Luise, würde dann losrennen ins Kontor der Fourragehandlung, zu Bertram …
Sie klopft fest und energisch.
Erst rührt sich nichts. Dann klappert was, raschelt, tuschelt. Eine heisere Stimme fragt: »Wer ist da?«
»Luise, die Tochter von der Waschfrau.« Sie gibt sich Mühe, so freundlich und unbedarft zu klingen, wie’s nur geht. »Darf ich reinkommen?«
»Die is lange weg. Und bezahlt hab ick ooch.« (Luise treibt manchmal das Geld ein.)
»Ich möchte trotzdem rein!«
Keine Antwort. Na gut. Man darf sich nicht abschütteln lassen. Wenn’s sanft und wohlerzogen nicht geht, dann anders. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn die da drinnen krumme Geschäfte macht, dann will sie bestimmt keinen Krawall.
Luise schlägt mit der flachen Hand stetig und unablässig gegen die Tür.
Die Rechnung geht auf.
Der Riegel klirrt. Eine kleine, dickliche Person mit grauem Dutt und Brille steht da und sagt: »Biste meschugge, Meechen? Wat soll der Krach? Willste Kleinholz aus meene Türe machen?«
Nun kann Luise wieder zuckersüß sein. Knickst sogar. »Ich würde gern ein paar Worte mit Ihnen wechseln, Madame Irxleben, wegen meiner Mutter.« Fein hochdeutsch. Und an der Ollen vorbei ins Innere. (Der Name war ihr erst wieder eingefallen, als sie die Frau sah.)
Dachte sie’s doch. Da drin ist noch jemand. Am Tisch, im Lichtkreis der Petroleumlampe, sitzt ein junges Ding, bestimmt kein bisschen älter als Luise selbst, heult still vor sich hin und zerknüllt die Schürze mit den Händen. Guckt nicht hoch. Seitlich auf dem Tisch hat die Irxleben was mit einem Handtuch zugedeckt. Auf dem Spirituskocher da hinten steht ein Wasserkessel.
Eine Engelmacherin. Die hilft den Frauen vom Kind, wenn sie’s nicht wollen …
Schlimm, aber jetzt nicht Luises Problem. Da steht die Flasche mit dem Klaren auf dem Tisch, halb voll nur noch, und die Gläser.
»Wie viel?«, fragt sie.
Die Frau grinst. »Frolleinchen, ick hab’s Ihrer Mutter nich ins Maul jezählt. Hat ihr aber jeschmeckt. Hatte ’ne janz schöne Hacke weg, als se abjezogen is.«
Luise schluckt an ihrer Wut. »Meine Mutter darf nicht trinken«, sagt sie. »Unsere besseren Kunden wissen das auch und richten sich danach. Aber bei Ihnen …«
»Nu werd mal nich kiebig«, sagt die Frau, und sie grinst immer noch. »Jedenfalls hat deene Mutter keen Schild um ’en Hals, wo druffsteht: Bitte nichts zu trinken geben. Hab se bloß jefragt, ob sie eenen mittrinkt. Hätte se ja nich jemusst.«
»Wo ist sie hin?«
»Ick hab keenen Dunst. Vielleicht in ’n ›Hammelkopp‹ oder in ›Müllers Destille‹? Liegt hier alles um die Ecke.«
»Dann will ich Sie nicht aufhalten«, erwidert Luise mit einem Blick auf das heulende Mädchen. Sie schlägt die Tür hinter sich zu und lehnt sich draußen an die Wand.
Alles vorbei für heute. Kein Bertram. Nur Anna Sander suchen und nach Haus bringen. Irgendwie. In welchem Zustand auch immer.
Luise läuft wieder. Die Kälte beißt. Und Wut und Scham beißen auch. Der Abend schmeckt bitter wie der Rauch aus den Schornsteinen. Keine makronensüßen Küsse.
Auf zum »Hammelkopf«.
Dazu muss sie über die Wilhelmstraße.
Rechts und links alles Hundepolackei, aber die Wilhelmstraße hat sich gemausert. Da haben sie in den letzten Jahren feine Häuser mit Stuckornamenten hingesetzt. Auslagen in den Geschäften, Seide, Spitzen, Juwelen. Hier mal aufkreuzen als Madame, am Arm von Bertram, in einem Hut mit Schleier und ’nem warmen Muff aus Otterfell, und nach Herzenslust einkaufen …
Sie will über den Fahrdamm, aber das geht nicht. In Oper und Schauspielhaus fangen die Vorstellungen an, und dicht an dicht rollen die Kutschen an ihr vorüber, prächtige Gespanne mit Passpferden, Lampen am Kutschbock aus Kristall, und die Kerle auf dem Bock mit Zylinder, langem Überrock und Stiefeln und Peitsche.
Da fahren sie hin, die Reichen, die Glücklichen.
Sie steht am Straßenrand. Lasst mich durch, ihr Goldkäfer!, befiehlt sie innerlich. Ich hab’s eilig! Lasst mich vorbei, ihr feinen Pinkel!
Vor den Nüstern der Pferde stehen Nebelwölkchen. Eine Kalesche nach der anderen. Endlich zwischen dem Vierergespann mit den Rappen und dem Rotfuchspaar ein größerer Abstand.
Sie rennt los, ohne nach rechts oder links zu gucken, hört den Kutscher fluchen, der seine Tiere zügeln muss, springt aufs Trottoir.
Die lange Peitschenschnur legt sich ihr über Rücken und Schulter, und der Schmitz, die zierliche Lederschleife am Ende, berührt ihre Wange. Das ist nicht voll draufgehauen, eigentlich nur spielerisch. Ein feiner, kurzer, brennender Schmerz.
Wenn der Vater vom Bier kommt, gereizt, boshaft, zu Krakeel aufgelegt, aber keinen Grund dafür findet, steht er hinter seiner Frau am Waschtrog, kitzelt sie am Hals und sagt durch die Zähne: »Na, Anna, willste eene jeklebt kriegen?« Und dann schnippst er seine Finger gegen ihre Wangenknochen oder gegen ihre Lippen, und die Mutter legt die Hand auf die getroffene Stelle, während er lacht.
So ein Schnipser war das eben auch. Bloß, dass ihr wegen so was nicht die Tränen kommen. Im Gegenteil. Es bringt sie richtig auf Trab. Genug geheult für heute!
Überm Wasser des Weidengrabens liegt ein leichter Nebel, und es riecht nach dem Schnee, der bald kommt.
Der »Hammelkopf« ist ein altes Bootshaus direkt am Wasser, eine Bruchbude auf Pfählen. Das Dach rutscht in sich zusammen und die Regenrinne hängt seitlich herunter. Moos wächst an den Sparren. Keiner weiß, woher der Name »Hammelkopf« kommt. Jedenfalls steht über der Tür Restauration H. Uhlmann.
Vielleicht findet sie die Mutter hier.
Im »Hammelkopf« ist hin und wieder mal eine Frau, ohne dass sie gleich auf Männerfang aus sein muss. Die Arbeiterinnen von der Spinnerei an der Ecke kommen und die Weiber, die morgens die Straße fegen und den Müll aus den Gruben wegschaffen.
Die Tür ist offen. Licht, Qualm und Stimmenlärm dringen nach draußen. Und da steht eine Gruppe angeheiterter Kerle. An denen muss sie vorbei.
Männer in Gruppen mag Luise nicht. Und schon gar nicht, wenn sie im Tran sind.
Sie geht schnellen Schrittes auf sie los. Bloß nicht zeigen, dass man Angst hat. Stante pede rein zur Tür.
»He, Juste, Jette, Minna oder wie de heeßt! Komm doch bei uns bei!« Eine Hand grabscht nach ihrem Hintern, ein bärtiges Gesicht mit Schnapsfahne nähert sich ihrem.
Luise weiß: Kraft ist nicht so wichtig. Man muss bloß schnell sein.
Sie duckt sich, zieht den Kopf ein und rammt ihn dem Betrunkenen unter das Kinn, dass seine Kiefer klappen. So, das wäre erledigt.
Ein paar Männer in den blauen Blusen der Bauarbeiter prosten ihr zu und applaudieren. »Fein jemacht, Meechen!«
Der Raum ist rappelvoll. Sie kneift die Augen zu, um in dem Rauch was zu erkennen, drängelt sich durch zum Tresen. Von dort aus mustert sie die Spelunke.
An den Tischen sitzen sie dicht an dicht, grölen, streiten, singen, schunkeln oder stieren vor sich hin. Frauen? Hinten ein paar Nutten, die Pause machen, junge Frauen mit aufgeknöpften Taillen, unter denen sich die Brüste im Hemd abzeichnen, große Schleifen im Haar, die Röcke geschürzt. Sie kreischen und trinken Likör. Eine Olle will gerade ihren Mann nach Haus holen, und seine Kumpane amüsieren sich über sie. Dann am Tresen zwei große, grobknochige Mädchen in Drillichkleidern, die wild nach Schweiß und Abfall riechen. Welche von der Putz- und Räumkolonne. Sicher steht ihr kleiner zweirädriger Karren mit den Stangen und den Kübeln draußen vor der Tür. Die Mädchen trinken Anisette.
Keine Anna Sander.
Luise spricht die mürrische Wirtin an, beschreibt die Mutter. Aber die zuckt die Achseln. »Da hätt ick ja viel zu tun, wenn ick mir jede Suffnudel merken würde, die hier antanzt. Bestell wat, Meechen, oder zieh Leine.«
Jemand tippt ihr auf die Schulter, und sie fährt herum. Ein Mann ohne Bart. Der einzige Rasierte hier. Ein Mann mit einem bunten Halstuch statt einem Stehkragen. Feine Tuchjacke. Sorgfältig gescheiteltes Haar. Dunkle Augen, die sie dreist anstarren. Einer, der nicht hierherpasst. Vorsicht!
»Fassen Sie mich nicht an!«, zischt sie ihn an. »Was soll das?«
»Nur nicht so kratzbürstig!«, sagt er lächelnd. »Vielleicht kann ich behilflich sein?«
»Sie? Nicht, dass ich wüsste!«
»Ich hab gehört, Sie suchen jemanden? Große Frau, braunes Umschlagtuch, Kapotthut mit schwarzem Band?«
Luise nickt.
»Sie hat einen gebeugten Rücken und aufgesprungene Hände. Zieht die Schultern nach vorn. Auf ihrer Schürze ist ein karierter Flicken, und an der Jacke sind die Ellenbogen durchgescheuert und gestopft. Richtig?«
»Richtig«, sagt Luise verblüfft. Er beschreibt die Mutter mit einer Genauigkeit, als wenn er ein Kriminaler wäre. »War sie hier?«
»Vielleicht vor ’ner halben Stunde. Hat vom Tresen gekauft. Das weiß die Frau Wirtin ganz genau. Sie ist bloß unfreundlich.«
»Kümmern Sie sich um Ihren Dreck«, knurrt die vom Gläserspülen und wirft einen schiefen Blick. Der Mann schmunzelt.
»Ist das Ihre Mutter, mein Fräulein? Ein Jammer. So ein hübsches Kind muss nachts durch die Spelunken ziehen, um die Mutter zu suchen …«
»Das geht Sie nichts an.«
»Ich will Ihnen nur helfen!«
»Na fein«, sagt sie, unfreundlicher, als es vielleicht nötig ist. »Wenn Sie auf alles so genau draufkieken, dann wissen Sie ja auch bestimmt, was sie gekauft hat.«
»Ja«, wiederholt er spöttisch ihre Worte. »Ich kiek auf alles genau drauf. Darum weiß ich, dass sie mit zwei Quart Kümmel losgezogen ist, Richtung Kanal.«
Luise ist kalt vor Entsetzen.
Zwei Quart! Ein halber Liter. Da sind die Einnahmen des Tages hin, und wahrscheinlich noch mehr. Das Wechsel- geld, das sie zum Rausgeben mithatte. Und der Nähkurs für nächsten Monat ist noch nicht bezahlt! Von allem anderen mal ganz zu schweigen.
Sie boxt sich durch die dicht gedrängt herumstehenden Suffköppe und achtet nicht darauf, was der komische Kerl da ihr noch nachruft. Sie muss die Mutter finden! Mit zwei Quart Kümmel im Leib, da fällt man möglicherweise auch noch ins Wasser.
Luise füllt ihre Lunge mit Luft. Nach dem Mief da drin tut sogar die Kälte gut. Sie steht am Graben, presst die Hände ums Geländer der Brücke. Das Wasser ist ihr unheimlich bis zum Gehtnichtmehr. Aber das hilft alles nichts. Sie muss da unten suchen. Sie rafft ihren Rock und tastet sich die hölzernen Stufen zum Wasser runter. Schwärze und Kälte. Ein paar Enten. Das die das aushalten!
Sie rennt am Kai entlang, hält Ausschau. Auf der anderen Seite flackert ein trübes Feuer. Ein paar Penner haben Bruchholz gesammelt und wärmen sich. Einer hat eine Jacke davor gehängt. Klar, Landstreicherei und Feueranzünden ist verboten. Aber Luise sieht, die Mutter ist nicht dabei. Außerdem trinkt sie immer allein.
Weiter also. Luise fröstelt, nicht nur von der Kälte.
Sie hört die Schritte hinter sich erst im letzten Augenblick. Eine große Hand legt sich über ihren Mund, ihr Kopf wird nach hinten gebogen, die andere Hand schiebt ihren Rock hoch und versucht, sich einen Weg zwischen den Bündchen ihrer Unterhose und den Strümpfen zu bahnen. Luise riecht den Schnaps. Vielleicht der Mann von der Fuselbude, dem sie das Kinn gestaucht hat!
Schreien kann sie nicht. Sie windet sich, versucht, in die Hand über ihrem Mund zu beißen. Vergebens.
»So Mäuseken, jetzt biste jeliefert!«, stöhnt es über ihr. Die Beine rutschen ihr weg, sie geht zu Boden. Kurz bekommt sie den Mund frei, schreit gellend. Sie sind ganz nah am Kanal. Vor Angst bäumt sie sich verzweifelt auf, kommt los. Der Kerl ist zu blau, um schnell zu sein. Luise rappelt sich hoch, stolpert, läuft, schreit.
Und läuft in ein paar andere Arme. Sie trommelt mit den Fäusten gegen eine Brust, merkt, dass da kein Widerstand geleistet wird, hört über sich ein Lachen, spöttisch, weich wie Samt.
Sie taumelt gegen die Wand eines Speichers. Bloß weg von diesem Wasser. Weg von den Kerlen. Zittrig versucht sie, ihre Kleider zu ordnen, hört wie durch einen Nebel die Stimme des Fremden, jetzt ganz scharf, ganz überlegen, ganz Herr. Der bürstet diesen Suffkopp ab, dass es nur so seine Art hat. Polizei, hört sie raus, Gefängnis, Landstreicher, während sie versucht, ihren Zopf wieder hochzustecken, und gegen ein wütendes Schluchzen ankämpft. Noch schlimmer kann es nun nicht mehr kommen.
Der feine Pinkel. Kann der sie immer noch nicht in Ruhe lassen? Gut, er hat sie vor diesem besoffenen Dreckskerl gerettet. Aber vielleicht hätte sie es ja auch allein geschafft. Warum ist er ihr überhaupt nachgegangen?
Da steht er nun vor ihr und guckt sie an. Als ob er etwas kaufen wollte.
»Danke für Ihre Hilfe«, sagt sie. »Es geht schon.«
Er hört ihr gar nicht zu. »Blond, schlank, gut gewachsen. Und diese Visage – Honig und Sahne!«
»Was faseln Sie da?«
Er macht ihr Angst. Am liebsten würde sie wegrennen.
»Fräulein, ich bin Ihr Freund. Ich will Ihnen helfen, Ihre Mutter zu suchen, und bring sie sogar mit der Droschke nach Haus. Aber alles hat seinen Preis. In dieser bösen Welt ist nichts umsonst.« Wieder dies mokante Lächeln. Luise meint, zu verstehen. Daher weht der Wind!
»Geld hab ich keins. Und andere Sachen laufen nicht bei mir.«
»Seh ich so aus, als würde ich mit Fleisch handeln?«
»Ich hab keine Lust, Sie anzugucken.«
»Ich dafür umso mehr, was dich angeht.« Auf einmal ist er beim Du.
»Hauen Sie ab!«
»Nun mal nicht so wild«, sagt er, ohne sich vom Ort zu bewegen »Ich schlag dir einen Handel vor, der hat nichts Unanständiges. Keiner wird dich anfassen, das kann ich dir versprechen. Und für dich springt mehr dabei raus, als wenn du das machen würdest, was du dir offenbar gerade vorgestellt hast.«
»So was gibt’s nicht«, sagt Luise ungläubig.
»So was gibt’s«, erwidert er und lacht wieder. »Aber erst mal sollten wir deine Mutter finden.«
Anna Sander, eine ordentliche, fleißige Person. Steht von früh bis spät an ihrem Waschfass. Hat vier Kinder großgezogen und schmeißt sich manchmal dazwischen, wenn der Vater seinen Krückstock zu heftig über ihnen schwingt. Bewahrt in der Tasse mit dem Sprung hinten im Küchenspind meist noch ’nen Sechser auf, nicht für sich, sondern wenn mal wieder kein Geld für Brot im Haus ist. Lässt beim Kaufmann anschreiben, und der weiß, dass sie bezahlen wird.
Aber hin und wieder ist Anna Sander leider sturzbetrunken, wie jetzt.
Die ganze Droschke stinkt nach Fusel.
Immer, wenn sie an einer Gaslaterne vorbeikommen, fällt ein Lichtstreifen rein. Beleuchtet das blasse Gesicht Annas, ihre geschlossenen Augen, die grauen Haarsträhnen, die unter der Kapotte hervorquellen. Beleuchtet diesen Mann im weichen Tuchmantel mit Pelzkragen, Hut schräg über der Stirn, der Mutter und Tochter mustert – unverschämt, direkt, spöttisch und auch irgendwie gierig. Luise schämt sich unter diesen Blicken, und sie ist wütend. Ein Maler ist er, hat er gesagt. Was will er denn malen? Ihr Elend?
Bring uns nach Haus und dann scher dich zum Teufel!, denkt sie. Geredet wird nicht auf dieser Fahrt.
Die Kutsche hält an. Luise späht nach draußen. Angekommen. Sie schaut hoch zu der reich verzierten Stuckfassade des Vorderhauses. In der Beletage, wo die Familie ihres Liebsten wohnt, ist alles hell erleuchtet. Trotz der Novemberkälte stehen die hohen Fensterflügel offen. Stimmengewirr, Gelächter, jemand singt zu Klavierbegleitung. Bestimmt Bertrams Schwester. Die Glücksmanns geben eine Soiree.
Das fehlt gerade noch. Dass Anna Sander in diesem Zustand gesehen wird. Die versoffene Frau vom Hausmeister. Ist das nicht die, deren Tochter hoch hinaus will? Die kleine Blonde, die sogar zur Tanzstunde geht?
Jetzt bloß schnell. »Warten Sie hier. Ich wecke meine Schwestern«, sagt Luise hastig und springt aus dem Wagen. Ob Bertram auch da drin feiert? Oder sitzt er noch im Kontor der Fourragehandlung und wartet auf sie?
Luise drückt den schweren Torflügel auf, rennt durch den Flur mit den grünen, lilienverzierten Kacheln. Erster Hinterhof. Zweiter Hinterhof. Müllkuhle, Klo außen im Seitentrakt. Souterrain, Kellerwohnung. Da ist sie zu Haus. Luise Sander, älteste von vier Töchtern. Und hier wird sie nicht bleiben. Nicht ums Verrecken. Das weiß sie in diesem Moment wieder einmal so sicher wie sonst nichts auf dieser Welt.
In der Küche, die man als Erstes betritt, leuchtet nur der trübe Schein des Herds, auf dem noch ein großer Eisentopf mit Kochwäsche steht, die heiße Lauge stinkt. Luise zündet die Petroleumlampe an. Gott sei Dank, kein Vater. Der sitzt in der Kneipe. Der darf saufen. Er ist ja ein Mann.
In der Schlafkammer ist es dunkel. Die Schwestern haben sich einfach aufs Ohr gelegt. Egal, was mit der Mutter ist. Luise wird’s schon hinbiegen. Wütend reißt sie ihnen die Bettdecken weg.
»Raus mit euch, ihr faulen Hühner, oder ich mach euch Beine! Hedwig, füll ’ne Wärmflasche auf und stell rasch den Eimer ans Bett, falls Mutter schlecht wird. Agnes, zieh dir was über, du kommst mit. Du musst mir tragen helfen. Lina – ach, die ist sowieso zu nichts nütze!«
Die kleine Lina hat sich tief ins Bettzeug vergraben und markiert die Schlafende.
Die Schwestern stehen gähnend in ihren Bettjacken, die Haare offen und wirr, zwei Schlafmützen, die Luise rasend machen können in ihrer Trägheit. Sie packt Agnes am Arm, um sie mit sich zu ziehen. Und da steht er auf der Schwelle, der Fremde.
»Ich hab gesagt, Sie sollen warten!«
Er lächelt.
Traut sich zu lächeln angesichts dessen, was er hier sieht: Luise zwischen den beiden schlampigen unhübschen Mädchen, die eine dürr und knochig, die andere rothaarig und zu üppig für ihr Alter, und diese Küche mit der Waschbalje und den stinkenden Eimern und Fässern voller Lauge und Schmutzwasser, dem angeschlagenen Mobiliar, den kreuz und quer durch den Raum gespannten Leinen voller Wäsche. Sie möchte in der Erde versinken.
Indessen kommt auch noch der Kutscher. Mit schweren Schritten, seine genagelten Stiefel scheinen Funken aus dem Pflaster des Hofs zu schlagen. Hat Anna Sander über der Schulter wie einen Mehlsack. Die Bänder des Kapotthuts und ihre Haarzotteln baumeln herunter. Sie stöhnt leise.
»Wohin?«, fragt er grimmig.
Luise nimmt die Lampe und leuchtet voraus in die Kammer. Als Anna auf dem Bett liegt, sieht Luise, dass aus ihren geschlossenen Augen Tränen laufen. Sie ballt die Fäuste vor Mitleid und ohnmächtigem Zorn.
»Kümmert euch!«, herrscht sie die Schwestern an. »Und Sie, haben Sie sich nun satt geglotzt?«
»Ich glotze mich nie satt«, antwortet er ungerührt. »Das ist meine Berufskrankheit. Und an der kannst du profitieren. Ich hab dir’s ja erzählt, wie. Wiedersehn, Luise, und vergiss unsere Verabredung nicht.«
Er wendet sich zum Gehen.
»Wat is ’n det für ’n feiner Onkel?«, fragt Agnes. »Und wat für ’ne Verabredung?«
»Das geht dich gar nichts an. Hilf Hedwig, Muttern auszuziehen.«
»Und du?«
Luise hat plötzlich eine Idee. »Ich muss noch mal weg«, sagt sie knapp.
In der Toreinfahrt holt sie die Männer ein.
»Kann ich die Droschke haben? Ich muss noch mal weg«, sagt sie entschlossen.
Der Mann lacht auf. »Na, du verstehst dich ja auf deinen Vorteil. Also gut. Erzählst du mir am Montag, wenn du zu mir kommst, wo du hingefahren bist?«
»Nein«, sagt sie. »Aber bezahlen Sie den Kutscher für mich?«
»Das Wort Bitte könnte nicht schaden«, sagt er grinsend, aber er zieht seine Geldbörse. Luise nennt die Adresse und steigt ein.
Es riecht immer noch nach Schnaps. Während die Droschke anruckt, zieht sie die Visitenkarte hervor, die ihr der Mann gegeben hat.
Prof. Otto Markwart liest sie. Und eine Adresse in NO. Keine sehr feine Gegend. Aber ein Professor. Sieh mal an.
Als sie aus der Droschke springt, beginnt es leicht zu schneien. Danach hat die Luft schon den ganzen Tag geschmeckt.
Die Glücksmann’sche Futtermittel- und Fourragehandlung besteht aus einem großen Hof, dessen Querseiten von Stallungen begrenzt sind, und geradezu ist das Verkaufsgebäude mit dem Speicher und dem Futterboden.
Luises Herz klopft bis zum Hals. Im Kontor brennt noch Licht! Und Bertrams Hunde, die großen sandfarbenen Collierüden, sind nicht im Zwinger. Begrüßen sie mit leisem Winseln am Tor. Er ist noch da! Er hat auf sie gewartet!
Auf einmal kommt ihr zu Bewusstsein, wie sie aussieht – das Haar in Unordnung, Stiefel und Rocksaum dreckbespritzt von den Wegen, die sie gegangen ist. Und auf einmal spürt sie die Schmerzen in ihren kalten Füßen, den Frost, der ihr in den Knochen sitzt, die Müdigkeit. Scham und Zorn der letzten Stunden werden zu Traurigkeit. Vielleicht war es falsch, noch herzukommen. Das ist nicht die Stimmung, in der man zu seinem Liebsten geht.
Die Hunde umspringen sie mit freudigem Gebell. Die Tür des Kontors geht auf. Bertrams schmale Silhouette. »Wer ist da?«, fragt er ins Dunkel.
»Ich bin’s noch«, sagt sie halblaut. Die Erwartung steigt in ihr auf wie eine große warme Welle, die alles wegwäscht, was sie bedrückt.
Er fragt nichts, sagt nichts. Ist mit zwei großen Sprüngen bei ihr, packt sie, zieht sie ins Innere und verriegelt die Tür. Drückt sie mit den Schultern dagegen und beginnt, sie zu küssen, wild und fordernd. Beißt sie in die Lippe, schiebt seine Zunge zwischen ihre Zähne. Drängt seinen Körper gegen sie.
Luise steht und schlingt die Arme um ihn. Und jetzt, wo sie endlich bei ihm ist und im Warmen, fängt sie auf einmal an zu zittern, als wenn sie der Schneewind des Abends bis hierher verfolgt hätte.
»Halt mich richtig fest, Bertram«, murmelt sie zwischen zwei Küssen. »Halt mich bloß richtig fest.«
Es ist still. Es ist warm. In dem kleinen Kanonenofen mit den rot glühenden Wangen knacken die Holzscheite. Die Hunde winseln draußen. Wären wohl auch gern hier.
»Wo kommst du jetzt erst her?«, fragt Bertram atemlos. »Ich hab mir große Sorgen gemacht und bin vor Sehnsucht fast gestorben.«
Ohne sie aus dem Arm zu lassen, langt er zum Tisch und schraubt die Petroleumlampe herunter. Nun ist es fast dämmrig. Bertram schiebt ein Bein zwischen die Beine von Luise und bugsiert sie hinüber zu dem großen lederbezogenen Ohrensessel in der Nähe des Ofens, in dem sein Vater sich zwischen der Arbeit bisweilen ausruht (wenn er denn im Kontor ist) und in dem der Buchhalter übernachtet, wenn er Bilanz machen muss. Bertram hat Übung darin, Luise so in den Sessel zu bringen. Das gehört zu den Spielregeln. Der Sessel ist ihr Liebesnest, und Bertram platziert sie so, dass sie sich nicht wehren kann, selbst wenn sie wollte.
»Ich musste mal wieder Mutter nach Haus bringen«, sagt Luise und dann: »Lass mal ’n Moment. Meine Füße sind wie Eis. Ich will die Schuhe ausziehen.«
Bertram kniet schon vor ihr. »Das mach ich«, murmelt er und beginnt geschickt, die Schnürbänder aus den Ösen zu ziehen. Im flackernden Licht des Ofens wirkt sein dunkellockiger, runder Kopf mit der bräunlichen Haut und den hohen Backenknochen fremdartig, südländisch. Indianer, denkt Luise und streicht ihm übers Haar. Und er indessen sagt: »War sie mal wieder voll, deine …«
Eine kräftig geschlagene Ohrfeige lässt ihn verstummen.
»Komm mir bloß nicht so, Bertram Glücksmann!«, faucht Luise. »Meine Mutter kriegt einmal alle halbe Jahre ihren Rappel, und das ist schlimm genug. Aber dein Herr Papa hat schon morgens um elf so viel Schampus gesüffelt, dass er sich auf den Hausdiener stützen muss, wenn er ausgeht. Wir haben keinen Hausdiener. Und Kümmel dunt auch schneller.«
Bertram sagt nichts. Er löst weiter Luises Schuhbänder, zieht ihr die Strümpfe aus, beginnt vorsichtig, ihre Füße zu kneten. Luise stöhnt leise. Bertram führt erst den einen, dann den anderen Fuß an seinen Mund, haucht darauf, küsst und benagt ihre Zehen, bis die Eiseskälte gewichen ist. Dann führt er seine Hände langsam an ihren Beinen hoch bis über die Knie.
Luise hat die Augen geschlossen und bewegt die Zehen in Bertrams Schoß, wie eine Katze ihre Krallen beim Streicheln.
Bertram atmet laut und stoßweise. Er will eine Hand unter ihre Hose schieben, aber da sind sofort Luises Finger außen auf dem Rock, die ihn festhalten und energisch zurückschieben. Sie lacht. »Hände weg«, sagt sie sanft, ohne die Augen aufzumachen. »Nicht weiter als bis übers Knie.«
Jedes Mal der gleiche Kampf. Das Spiel bis zu einem Punkt, der Abbruch. Luise ist ein anständiges Mädchen. Wunderbar. Aber nervenaufreibend für einen jungen Mann mit Wünschen.
»Luise!«, murmelt er beschwörend. »Nur streicheln!«
Sie zieht ihre Füße hoch unter ihren Rock. »Lieber bisschen knutschen.«
»Dann muss ich aber in den Sessel und du auf meinen Schoß.«
Der nächste Abschnitt des Liebeskampfes, wie immer. Er möchte, dass sie sich rittlings auf ihn setzt. Sie will seitlich sitzen. Sie kabbeln sich, Luise gewinnt. Erhitzt und mit verschobenen Kleidern kuschelt sie sich an ihn. Sie küssen sich. Zart erst, dann immer wilder. Der nächste Punkt. Bertrams Lippen wandern zu ihrem Hals, er knöpft an ihrer Bluse herum, streift das Mieder von der Schulter, berührt und küsst ihre Brüste, bis sie seinen Kopf von sich fortschiebt.
»So. Genug.«
»Luise! Warum?«
»Weil ich Luise bin und du Bertram Glücksmann. Und weil wir keine Dummheiten machen werden. Einer von uns muss aufpassen, und das bin nun mal ich.«
Sie bringt ihre Sachen in Ordnung.
»Du bist kälter als Eis.«
»Überhaupt nicht. Ich schmelze weg wie nichts. Darum ja.« – Bertrams Lippen sind wieder auf ihrem Hals. »Nein, lass, nicht schon wieder! Du, ich fürchte, ich muss nach Haus.«
»Das soll alles gewesen sein? Ich hab so lange auf dich gewartet heute!«
»Du wirst noch ein bisschen länger warten müssen auf mich«, sagt sie zärtlich. »Wir sehen uns wieder bei der Tanzstunde. Da kannst du mich immerhin beim Wiener Walzer im Arm halten.«
»Vor all den Leuten! Was ist das schon.«
»Nimmersatt.«
»Und Luise: der Abschlussball …«
»Hör auf damit!«
»Luise!«
»Begreif doch endlich. Ich geh nicht zu dem Ball. Ich habe kein Kleid.«
»Ich kann dir doch eins besorgen.«
»Woher denn? Von deiner Schwester ausgeliehen? Die wird ja Augen machen, wenn sie mich damit sieht.«
»Ich könnte dir ein Kleid schenken, Luise.«
»Wo willst du das Geld hernehmen?«
»Das findet sich schon«, sagt er.
»Findet sich? Komisch. Bei uns findet sich nie Geld. Und davon abgesehen: Ich nehme keine Geschenke von dir. Keine großen Geschenke. Also sagen wir mal, wenn ich das Kleid hätte, dann dürftest du mir die Handschuhe dazu schenken.«
Sie hat sich in Hitze geredet. Steht vor ihm und befestigt mit schnellen, heftigen Bewegungen ihr aufgelöstes Haar zu einem Knoten. Bertram beobachtet Luise. Sie ist so hübsch!, denkt er. Und so schnippisch. Ja, ja, eine richtige Hexe.
»Warum bist du so störrisch?«
»Bin ich das?« Sie sieht ihn an, ihre Lippen zittern, und plötzlich stürzen ihr die Tränen aus den Augen. »Quäl mich doch nicht, Bertram! Ich wollte nichts lieber auf der Welt, als deine Tanzstundendame sein. Und ich wollte nichts lieber, als mit dir schmusen ohne Ende, ohne Rücksicht auf das, was anständig ist. Denkst du, mir macht das Spaß, dir Nein zu sagen? Ich hab dich lieb! Aber arme Mädchen wie ich können sich bestimmte Sachen nicht leisten. Keine Ballkleider. Und vor der Hochzeit keine bestimmten Sachen. Ist das klar?«
Er hat sie in den Arm genommen, streichelt verlegen ihren Rücken. Sie schluchzt an seinem Hals. Löst sich dann. Trocknet die Augen.
»So. Nun fühl ich mich wohler. Nun bringst du mich nach Haus, also bis zur Ecke, damit uns keiner zusammen sieht. Liebe Zeit, war das ein Tag heute! Ich bin so froh, dass ich dich habe, Bertram.«
»Und ich erst, dass es dich gibt!«
Sie ziehen sich an und treten vor die Tür. Bertram schließt die Hunde in ihren Verschlag. Er reibt sich die Hände. Die Kälte hat zugenommen. Schützend legt er den Arm um sein bibberndes Mädchen.
»Ist das nicht ’ne verrückte Welt, Luiseken? Da wohnen wir beide im gleichen Haus und müssen so tun, als wenn wir uns fremd wären, und ich komm dir von der Ecke ab nachgelatscht, damit uns ja keiner zusammen sieht …«
»Klar ist das ’ne verrückte Welt. Das liegt daran, dass du Beletage bist und ich Hinterhof. Gleiches Haus schon. Aber wo in dem Haus man wohnt …«
»Werden ja mal bessere Zeiten kommen. Wenn du erst Madame Glücksmann bist.«
»Hoffentlich hat jetzt der liebe Gott zugehört, Bertram.«
Eng umschlungen gehen sie durch die nächtlichen Straßen der Stadt, die einzigen Passanten um diese Zeit und in dieser Gegend, immer vom Lichtkegel einer Gaslaterne in den anderen. Ein paar Schneeflocken fallen, das glitzert auf Luises bloßem Haar.
»Was für ’n schönes Mädchen du doch bist, mein Schatz. Weißt du, wie verliebt ich bin in dich?«
»Ich denke schon«, sagt sie. Sie müssen erst mal stehen bleiben, um sich zu küssen.
Von dem Fremden hat Luise nichts erzählt.
18902. KapitelHeimlichkeiten
»Wer ist sie?«
Mist. Sie hat in der Diele auf ihn gelauert.
Bertrams Mutter trägt bereits ein Hauskleid und hat die Haare für die Nacht zurechtmachen lassen – eingedreht und Haarnetz drüber. Die Soiree ist zu Ende, jedenfalls der offizielle Teil. Die Damen haben sich verabschiedet. Natürlich sind die Herren noch da. Spielzimmer und Herrenzimmer sind hell erleuchtet, das hat Bertram schon von unten gesehen. Es hätte alles so laufen können, wie er es sich vorgestellt hat, denn am Spieltisch hat der Vater für nichts anderes mehr Augen und Ohren.
Aber nun steht sie da, ohne Korsett, ohne Taille, und in der Hand eine Schale mit Konfekt.
»Du solltest nicht so viel essen, Finette! Deine Figur!«
»Nenn mich nicht immer Finette. Red mich gefälligst mit Respekt an.«
»Entschuldige. Warst du wieder nicht bei der Soiree?«
»Ich war bei der Tafel dabei. Aber du sollst mich nicht ausfragen, das gehört sich nicht. Ich habe dich was gefragt. Wer ist sie?«
»Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.«
Finette schnaubt durch die Nase. »Die Glücksmann-Männer können alle lügen, ohne rot zu werden. Komm in mein Boudoir. Der Rauch aus dem Herrenzimmer macht mir Kopfweh.«
Sie geht voraus, ohne sich nach ihm umzusehen. Ihr Gang ist beschwerlich. Finette war einmal eine schöne Frau. Nun isst sie von früh bis spät.
»Also«, sagt sie und lässt sich in einen Sessel fallen. »Zum dritten Mal: Wer ist sie?«
»Mutter! Ich war in der Fourragehandlung und habe meine Hunde trainiert. Danach habe ich mit meinen Elektrosachen experimentiert. Du weißt doch, dass Vater es zu Haus nicht duldet.«
Finette Glücksmann wählt eine Praline aus der Schale. Sie schält sie aus dem Silberpapier, faltet es sorgfältig und legt es in die Schale zurück. So will sie sich selbst kontrollieren. Aber es nützt nichts. Es liegen schon viele Silberpapierchen in dem Gefäß. Ärgerlich sieht Bertram ihr zu, wie sie mit hingebungsvoll geschlossenen Augen die Süßigkeit genießt.
»Kann ich jetzt gehen, Mama? Ich bin müde.«
Finette lacht kurz. »Du bist die Unschuld selbst, nicht wahr? Aber ich will nicht zulassen, dass du ein Mädchen unglücklich machst.«
»Aber Mama! Wenn überhaupt, dann denke ich doch, dass ich es glücklich mache, das Mädchen.«
»Ach, du bist genauso frivol wie dein Vater. Sieh mich an! Sieh, was dabei herauskommt!«
»Bist du denn unglücklich, Finette?«, fragt der Sohn und der Spott in seiner Stimme ist unüberhörbar.
Die Mutter hebt die Lider. Ihre dunklen, mandelförmigen Augen, immer noch schön in dem verfetteten Gesicht, sind anklagend.
»Was ist für dich Glück? Seit wir hier wohnen, bin ich die rechtmäßige Ehefrau deines Vaters, bin ich Madame Glücksmann. Aber du sagst Finette zu mir. Finette, das Nähmädchen. Und in der Gesellschaft bin und bleibe ich ein Nichts. Heute nach dem Essen habe ich versucht, die Frau Rittmeister von Drennsal anzusprechen. Nur eine Freundlichkeit über ihr Kleid. Sie hat nicht geruht, mir zu antworten. Hat mich geschnitten. Finette aus dem Dienstbotentrakt, die dem Herrn Glücksmann zwei uneheliche Kinder geboren hat. Das bin und bleibe ich. Das soll Glück sein? Nun, ich möchte es einer anderen ersparen.«
Bertram zuckt die Achseln. Die Klagen seiner Mutter, das Gejammer über die fehlende gesellschaftliche Anerkennung! Peinlich. »Ist das denn so wichtig, wenn man sich liebt?«, fragt er. »Abgesehen davon: Ich würde es nicht wie Vater machen. Ich würde gleich heiraten – also, wenn es ein Mädchen gäbe.«
Jetzt wird Finettes Stimme schrill.
»Das fehlte gerade noch. Hier wird nicht wild herumgeheiratet. Dein Vater hat Pläne mit dir! Und erst muss deine Schwester …«
»… unter die Haube«, ergänzt der Sohn. »Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass das nicht so einfach ist, weil sie ja die Tochter der Näherin Finette ist. Mama! Nimm es mir nicht übel. Ich kenne diese Predigt. Und jetzt bin ich müde. Gute Nacht.«
Er beugt sich zu ihr herab und küsst sie auf die Stirn, atmet den Haarwasser- und Schokoladengeruch ein und denkt an den sanften Vanilleduft seiner Luise.
»Du bist so arrogant wie dein Vater!«, ruft Finette.
Er antwortet nicht, verlässt sie. Sie geht ihm auf die Nerven. Außerdem hat er noch etwas vor.
Die Tür zum Arbeitszimmer des Vaters steht offen, wie erwartet. Und wie erwartet ist auch der Schreibtisch offen. Darauf brennt die Petroleumlampe, die vom Großvater stammt und deshalb in Ehren gehalten wird – die ganze Etage hat im Übrigen die moderne Gasbeleuchtung.
Bertram späht noch einmal den Korridor entlang. Die Luft ist rein.
Das Geheimfach im Schreibtisch lässt sich durch einen Knopf öffnen. Bertram weiß, wo er angebracht ist. Und da liegt es alles. Depositen, Banknoten, Geldrollen. Wenn der Vater am Spieltisch sitzt, muss er schnell an den Nachschub herankommen. Er ist meistens am Verlieren. Und den Überblick hat er schon gar nicht. Neben den Rollen mit den Talern liegt ein Stapel loser Münzen. Bertram nimmt sich die Hälfte und lässt sie in seine Hosentasche gleiten. Es trifft ja keinen Armen …
Luise! Vielleicht kann er sie doch noch überreden, ein Kleid von ihm anzunehmen, ein Kleid für den Ball. Luise. In seinen Armen auf dem alten Sessel im Kontor, neben dem glühenden Ofen. Luise, warm und weich und duftend. Das ist das wahre Leben. Das ist die Welt. Alles andere wird sich schon noch finden.
»Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Des, der die Himmel lenkt …«
»Großartig, Luise! Und nun Strophe sechs.«
Sie überlegt einen Moment, beginnt dann:
»Hoff, oh du arme Seele
Hoff und sei unverzagt
Gott wird dich aus der Höhle …«
»Applaus, Applaus!«, sagt Markwart mit einem Überschwang, den die Sache nicht wert ist. »Ich bewundere deinen Kopf, Luise. Phänomenal, dein Gedächtnis.«
»Hören Sie auf, sich über mich lustig zu machen!« Luises Stimme klingt gereizt. »Und sagen Sie mir, wann ich endlich meine Arme herunternehmen kann. Es tut weh.«
»Ein bisschen musst du noch aushalten. So ein Licht bekomme ich vielleicht den ganzen Winter nicht wieder. Komm, rede irgendetwas. Das lenkt ab. Sag mir noch mehr Choräle auf, oder vielleicht mal eine Schiller’sche Ballade? Ihr müsst doch sicher nicht nur im Religionsunterricht auswendig lernen, sondern auch in Deutsch.« Und da Luise schweigt: »Oder erzähl mir von deiner Familie.«
»Die haben Sie doch schon kennengelernt«, erwidert Luise grimmig. Sie hält die Arme hinter dem Kopf verschränkt und hat Markwart ihren nackten Rücken zugedreht, den Oberkörper halb nach rechts verdreht. Es ist sehr unbequem, so auf dem Schemel zu sitzen. Der Bund ihres Rocks ist offen, und der Stoff ist ihr bis tief auf die Hüften heruntergerutscht.
»Richtig«, sagt Markwart vergnügt und taucht den Pinsel in ein anderes Segment seiner Palette, während er zurücktritt und die Augen zukneift. »Die Mutter guckt von Zeit zu Zeit ins Glas, die Schwestern sind keine großen Lichter – und was macht der Vater?«
»Hausmeister«, sagt sie widerwillig.
»Und das lastet einen aus?«
»Er ist Invalide«, erklärt Luise. »Die meiste Zeit sitzt er sowieso nur in der Kneipe und schimpft auf Bismarck.«
»Auf Bismarck? Das ist interessant. Gütiger Himmel, ist ihm vielleicht entgangen, dass wir einen neuen Kaiser haben und Bismarck als Reichskanzler entlassen ist?«
»Nee. So ist das Schimpfen ungefährlicher.«
Markwart lacht los. »Du bist mir vielleicht ein Schatz, Luise! Alles beisammen, Witz und Köpfchen und – na, das Übrige. In diesem Licht leuchtet deine Haut wie Seide. Und dieser Schwung der Hüften …«
»Schluss! Eh ich mir das anhöre, sage ich Ihnen lieber alle Balladen von Schiller und Uhland auf, die ich kann, und das große Einmaleins mit der Dreizehn rückwärts. Und außerdem –«
»Und außerdem?«
»Außerdem hatten wir vereinbart, dass Sie nur meinen Rücken malen.«
»Tu ich doch.«
»Der Spiegel! Sie sehen mich die ganze Zeit von vorn!«
»Stimmt. Aber ich male nur den Rücken.«
»Sie sind so ein – so ein gemeiner Kerl!«, sagt sie aufgebracht, während sich ihre Augen im Spiegel begegnen, ihre blauen, flammend vor Zorn, und seine dunklen, glänzend, spöttisch und vergnügt. »Auf der Stelle zieh ich mich an. Es gibt doch in Ihrer Akademie genug Mädchen, die so was machen. Nehmen Sie eines von denen und lassen Sie mich in Ruhe.«
»Aber ich hab es dir doch erklärt«, sagt er, ohne mit Malen aufzuhören. »Die Mädchen an der Akademie, die machen das meistens schon ein paar Jährchen. Die haben nicht solche Haut und solchen Körper wie du. Und die meisten haben vorher schon was anderes gemacht. Wozu man auch keine Kleider braucht. Da ist der Schmelz der Unschuld weg, den deine bezaubernde Rückenlinie ausdrückt.«
»Nun reicht es aber!« Luise greift nach ihrem Hemd und kann nicht verhindern, dass ihr dabei der Rock noch ein Stückchen tiefer auf die Hüften rutscht. »Ich lasse mich doch nicht von Ihnen verkohlen! Es war ausgemacht, dass ich heute für Sie Modell sitze, nicht, dass Sie sich dabei über mich lustig machen.«
»So, jetzt hast du’s verdorben«, sagt er missmutig. »Du hast die Pose abgebrochen.«
»Pose hin, Pose her! So oder so hätte ich es keine Sekunde mehr ausgehalten.«
»Das denken alle beim ersten Mal.«
»Na, bei mir wird es kein zweites Mal geben. Es war ausgemacht: Einmal Modell sitzen als Entlohnung für Ihre Hilfe da am Kanal und für die Droschke. Und das war’s.« Sie schlüpft energisch in ihr Leibchen und schließt geschwind die Knöpfe.
»Soll ich dir helfen?«
»Unterstehen Sie sich!« Ihre Arme und Hände sind wie abgestorben, und als das Blut in die Gliedmaßen zurückströmt, prickelt es unerträglich.
Er hantiert mit seinen Gerätschaften, wirft schräge Blicke zu ihr hinüber. »Na, nicht neugierig auf das, was auf der Leinwand ist?«
»Kein bisschen!«, entgegnet sie. »Was soll das schon groß sein.«
»Hm. Immerhin bin ich Akademiemitglied und Professor. Ein bisschen Neugier könnte nicht schaden.« Voller Schadenfreude glaubt sie herauszuhören, dass er enttäuscht ist über ihr mangelndes Interesse. Sie zuckt die Achseln. »Ich will weg.«
»Nicht so hastig. Im Nebenzimmer steht ein Kaffee unter der Haube. Den wirst du ja wohl noch mit mir trinken.« –
Hätte sie bloß Nein gesagt! Da sitzt er ihr nun gegenüber, hat den Malerkittel abgelegt und eine Hausjacke aus braunem Samt übergezogen, und jeder seiner Blicke ist ihr peinlich. Jeder scheint zu sagen: Ich kenne dich, wie du unter deinen Kleidern aussiehst! Es ist zum Davonlaufen. Aber dieser Kaffee – so etwas hat sie noch nicht getrunken. Echter Bohnenkaffee, kein Muckefuck, Sahne in silbernen Kännchen. Und Zucker! Stumm verrührt Luise drei Löffel Zucker in ihrer Tasse. Bei Sanders gibt es so gut wie nie Süßes.
Er lässt sie nicht aus den Augen. Dreist und aufdringlich ist er. Alles, was sie macht, scheint er irgendwie einzustufen, über alles fällt er ein Urteil, das er ausspricht oder auch nicht.
»So«, sagt er, während sie sich fast die Lippen an dem brühheißen Getränk verbrennt. »Nun hast du also mitgekriegt, dass ich tatsächlich nur vorhabe dich zu malen und nicht, dich zu fressen. War’s denn so schlimm?«
»Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe.«
»Hinter dir?«
Sie schluckt. »Ich hab das gemacht, weil Sie – also, das war eine Erpressung. Mit dem Gefallen, den Sie mir getan hatten. Und weil Sie mir gedroht haben, mir jeden Tag bei Schulschluss vor der Tür aufzulauern! Und nun ist es gut. Aus und vorbei.«
Er lacht. »Heilige Einfalt!«, sagt er und lehnt sich im Sessel zurück. »Meinst du, ich mache ein Bild in einer Sitzung fertig? Das ist kein Scherenschnitt auf dem Rummel. Hier geht’s um Kunst.«
Luise setzt ihre Tasse ab. »Wenn Sie meinen, ich komme hier noch mal her, dann haben Sie sich gewaltig geirrt. Ich bin fast in den Boden gesunken vor lauter Scham, damit Sie’s nur wissen. Keine zehn Pferde kriegen mich wieder in dies Atelier!«
»Zehn Pferde würden dich auch schwerlich die fünf Treppen hochbringen«, sagt er ungerührt ironisch. »Aber vielleicht ein anständiges Honorar, wie?«
Sie sagt nichts. Er hat die Hand in die Tasche seines Hausrocks gesteckt und klappert mit dem Geld. Angeber!
»Du bist für mich wirklich was Besonderes, Luise. Was ich über die Mädchen in der Akademie gesagt habe, im Vergleich zu dir, das meine ich ernst. Und ich, meine Liebe, ich bin auch was Besonderes. Für einen Markwart zahlt man nicht schlecht. Und ich zahle auch nicht schlecht.«
Neben ihre Kaffeetasse, auf das damastene Tischtuch, legt er hübsch nebeneinander drei Markstücke.
»Das ist für diese erste Sitzung heute. Für die folgenden bekommst du die Hälfte.«
Luise öffnet die Lippen, aber sie sagt kein Wort. Sie traut ihren Augen nicht. Drei Mark nur fürs Stillsitzen! Nichts Unmoralisches – so weit es nicht schon unmoralisch ist, sich auszuziehen vor diesem fremden Mann mit den spöttischen, durchdringenden Blicken.
Von drei Mark kann die ganze Familie Sander eine Woche leben, mit zweimal Fleisch auf dem Tisch und sogar mal solch echtem Bohnenkaffee für die Mutter.
Aber das, das wäre ihr Geld. Ihres ganz allein. Geld, von dem keiner weiß. Wenn sie das hier oft genug macht, dann könnte sie sich vielleicht das Kleid kaufen für den Tanzstundenball. Dann könnte sie mit Bertram gehen. Dann müssten die Glücksmanns sie wahrnehmen, Walther Glücksmann müsste einen Ehrentanz bei ihr erbitten, ein paar Worte wechseln … Sie würde es schon einzurichten wissen, dass sie ihm gefällt …
»Nur fürs Sitzen?«, fragt sie befangen. Ihre Stimme klingt klein.
Er nickt und schiebt die Geldstücke mit dem Zeigefinger hin und her, als wären es Mühlesteine.
»Und es passiert nichts anderes als heute?«
»Bestimmt nicht. Außer natürlich, wenn du es unbedingt willst.«
Er lacht auf, und ihr schießt die Röte ins Gesicht. »Lassen Sie das! Lassen Sie ihre frechen Sprüche!«, sagt sie heftig. Er grinst sie unbeeindruckt an.
»Wenn ich es machen würde – wie oft würde das sein?«
»Zweimal die Woche. Und bestimmt noch vier Wochen lang. Na?«
Das wäre das Ballkleid. Auf alle Fälle. Welches Mädchen hat schon so eine Gelegenheit? Wenn sie an ihre Schwester Hedwig denkt, die manchmal beim Kaufmann um die Ecke hilft Kartoffeln auszuwiegen und Mehl einzutüten. Oder an die Zeitungsausträgerei der faulen Agnes. Alles für ein paar Pfifferlinge.
»Unter einer Bedingung«, sagt sie. »Es darf niemand erkennen, dass ich das bin auf dem Bild. Sie dürfen mein Gesicht nicht malen.«
»Hab ich auch nicht vor!«, erwidert er. »Mal abgesehen davon, dass ich kaum annehme, dass die Kreise, aus denen meine Kundschaft kommt, Leute sind, die dich kennen … Natürlich weiß ich nicht, wer alles dich schon so gesehen hat, wie ich dich male.«
»Sie sind so unverschämt!«
»Ich spreche die Dinge nur aus. Findest du Heuchelei schön?«
»Ach, lassen Sie mich doch in Frieden!«
»Pass mal auf, Luise, was ich dir jetzt vorschlage. Nimm das ganze Geld hier. Dann ist es ein Vertrag. Wenn nicht, dann finde ich, dass zwei Mark auch reichen als Honorar für heute. Brauchst du Bedenkzeit? Du kannst gern noch ein wenig bleiben, in aller Ruhe einen Kaffee trinken und dabei überlegen.«
»Nein«, erwidert sie. Sie nimmt die drei Geldstücke und steckt sie in die Tasche ihres Rockes. Markwart beginnt schallend zu lachen. »Siehst du, das nenne ich ehrlich. Frisch draufzu. Wie sagte doch schon irgend so ein antiker Kaiser: Geld stinkt nicht.«
Luise beißt sich auf die Lippen.
»Das ist billig, die armen Leute auszulachen, bloß weil sie arm sind«, sagt sie.
»Jetzt wirst du auch noch philosophisch. Ich wusste ja, an dir hat man ein echtes Juwel, sowohl als Modell als auch sonst.«
Er bringt sie zur Tür.
»Was ist das da an Ihrem Türpfosten?«, fragt sie misstrauisch. »’n Geheimzeichen?«
»Sag bloß, du hast noch keine Mesusa gesehen! Das Heilige Zeichen eines frommen jüdischen Haushalts.«
»Sie können mir doch nicht erzählen, dass dies hier ein frommer jüdischer …«
»Du machst mir wirklich Spaß, Luise. Nein, ist es nicht. Aber zu meinem Einzug hier kam mein Vater vorbei, um das Haus zu heiligen, da konnte ich gar nichts gegen unternehmen.« Er grinst sie spöttisch an. »Auch wenn mein Name urgermanisch klingt: Mein Vater ist Rabbiner in Leitmeritz.«
»Und da malen Sie nackte Weiber?«
Er zuckt die Achseln. »Der Himmel erhalte dir deine Auffassung von Moral. Obwohl ich mit einem etwas freizügigeren Modell durchaus einverstanden wäre!«
Sie ist die fünf Treppen runter, als ob sie da nie wieder hochsteigen will.
Luise hat sich ordentlich frisiert und eine Schleife in den Zopf geflochten. Sie hat einen Augenblick überlegt, ob sie eine Schürze umbinden soll, und es dann gelassen. Sie geht ins Vorderhaus nicht als Hausmeisterstochter, sondern als Tanzstundendame von Bertram. Es gibt etwas auszurichten. Ein schöner Vorwand, um sich kurz zu sehen.
Sie hat alles sorgfältig abgepasst. Bertram muss seit einer halben Stunde aus dem Gymnasium zurück sein, denn sie hat die Jungen in den bunten Schülermützen der Oberprima vorhin auf der Straße gesehen. Madame Glücksmann ist mit ihrem Hausmädchen, der Rieke, auf Einkaufsbummel. Rieke redet der Madame nach dem Mund, darum darf sie mit. Das dauert. Die Köchin kommt erst abends, der Hausdiener putzt auf dem Hof Stiefel. Und Bernadette, Bertrams Schwester, die übt Klavier. Das hört man schon in der Tordurchfahrt. Eigentlich kann gar nichts schiefgehen. Bertram wird öffnen …
Nun ist sie die Marmorstufen mit dem roten Läufer hochgestiegen und steht vor der schönen Tür mit dem Messingschild. Es ist so gut poliert, dass Luise sich darin sehen kann. Und auf einmal ist ihre Freude weg, und sie steht da und traut sich nicht, zu klingeln.
Sie kennt diese Wohnung von früher. Als das Haus noch neu war, als die Wände schwitzten und es nach Salpeter und Mörtel roch, da haben die Sanders ein halbes Jahr hier gewohnt, bevor sie dann in ihren Hinterhofkeller zogen. Ein halbes Jahr mietfrei. Als »Trockenwohner«, damit der Putz schneller seine Nässe verlor. Lina ist in dieser Wohnung geboren und Hedwig davor in einer ähnlichen. Deshalb haben sie krumme Beine. Die Knochen werden nicht fest in den feuchten Stuben, so wenig wie in den Kellerbuden. Rachitis.
»Trockenwohner.« Sie erinnert sich an die großen kahlen Räume mit dem Stuck an der Decke, in denen die Schritte hallten, und an den muffigen Geruch, der ihnen den Atem nahm und die Mutter zum Keuchen und Husten brachte. Viel Platz war da. Man konnte den Korridor entlangtoben. Aber das war auch der einzige Vorteil. Die spärlichen Möbel der Sanders verteilten sich auf die Zimmer, dass es aussah, als sei gar nichts da. Luise ist beklommen zumute. Heute soll sie diese Wohnung wieder betreten …
Entschlossen hebt sie die Hand und bewegt den Ring aus Metall. Es klingelt irgendwo ganz hinten. Die Dienstboten sollen das Läuten schließlich hören und öffnen, nicht die Herrschaften selbst. Bertram, komm!, bittet Luise. Du musst doch merken, dass ich hier stehe.
Das Klavierspiel hat aufgehört. Türen schlagen. Schritte. Aber dann ist es doch Bernadette.
Luise sieht über die Schulter der anderen in die große Diele. Perserteppiche, schmiedeeiserne Deckenlampen. Eine Flurgarderobe mit geschliffenem Kristallspiegel.
»Ja?«, fragt Bernadette und gibt sich keine Mühe, freundlich zu sein. Sie ist gleichaltrig mit Luise, aber kleiner, und sieht ihrem Bruder sehr ähnlich. Obwohl die Mädchen im gleichen Haus wohnen, kreuzen sich ihre Wege so gut wie nie. Bernadette weiß nur: die Tochter von Hausmeister Sander. »Wenn du was von deinem Vater zu bestellen hast, benutz bitte in Zukunft den Aufgang hinten. Für Dienstboten.«
Luise hat ihr süßestes Lächeln aufgesetzt. »Ich möchte mit deinem Bruder sprechen«, sagt sie.
Bernadette hat die Tür nicht sehr weit geöffnet. »Bertram ist nicht da.«
Lüge!, denkt Luise. Bertram, komm endlich! Sie erhebt die Stimme. »Es ist aber sehr wichtig. Kann ich warten?«
»Komm ein andermal wieder.« Bernadette will die Tür zumachen, aber Luise kennt dergleichen. Wenn sie manchmal losziehen muss, um bei den Schuldnern ihrer Mutter zu kassieren, wird das auch versucht. Sie stemmt die flache Hand gegen die Türkante. Bloß nicht abwimmeln lassen. Langsam wird sie wütend, aber ihr Lächeln behält sie bei. »Darf ich reinkommen?« Und schon steht sie in der Diele.
Bernadette mustert sie entgeistert. »Unverschämtheit!« Sie greift den gestickten Klingelzug neben der Tür und schüttelt ihn heftig. Da kannst du lange bimmeln, denkt Luise grimmig. Eure Leute sind nicht verfügbar. Sie will an der anderen vorbei auf das Berliner Zimmer zugehen – schließlich kennt sie sich aus! –, als sich eine der hohen holzgetäfelten Doppeltüren öffnet. Nein, kein Bertram. Vor ihr steht in Weste und Hemdsärmeln, die Füße in ledernen Pantoffeln, Walther Glücksmann, der Hausherr. Er blinzelt verschlafen und fährt sich durchs zerzauste Haar, streicht den Bart glatt und fährt seine Tochter ungnädig an: »Was soll dieser Krawall, Dette? Ich bin beim Mittagsschlaf!«
Zugegeben, Luise ist erschrocken, aber die Tochter offen- sichtlich auch, und vielleicht mit mehr Grund als sie.
»Das ist die Tochter vom Hausmeister, und die kommt hier einfach rein!«
Luise macht ihren schönsten Knicks und sagt mit süßer Stimme, während sie den Herrn anstrahlt: »Sie entschuldigen, ich wollte keineswegs stören. Ich wollte nur Bertram etwas ausrichten. Ich bin seine Tanzstundendame.«
Der kleine Herr hat ein Monokel aus der Westentasche gezogen und mustert sie von oben bis unten. Seine Miene verändert sich. Ein wohlwollendes Schmunzeln … Sehr gut.
»Die Tanzstundendame meines Sohnes also«, bemerkt er. »Der Filius beweist Geschmack. Und Ihr Vater kann es sich leisten, seine Töchter in die Tanzstunde zu schicken?«
»Seine Töchter nicht, nur mich«, erwidert Luise und fügt entwaffnend hinzu: »Bei den anderen lohnt es sich nicht.«
Er sieht sie an, offenen Mundes, und bricht in Lachen aus. »Also, das würde ich ja ganz gern mal näher erläutert wissen. Kommen Sie eben mal mit zu mir. Dette, warum kümmerst du dich nicht weiter um dein Klavier?«
Luise wirft dem Mädchen einen triumphierenden Blick zu. Der Punkt ist an sie gegangen. Bernadette schlägt mit den Türen, und gleich darauf hört man einen modischen Galopp im D-Zug-Tempo. Ist die wütend!