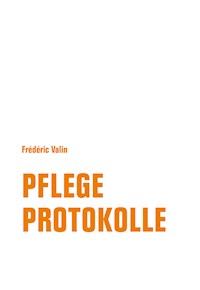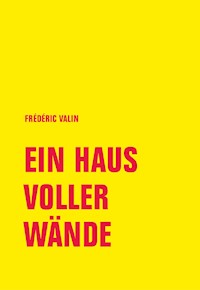
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie prägt das Pflegen einen Menschen, wie prägen ihn die Gepflegten? Nach seinem Buch »Pflegeprotokolle« (2021), in dem er Berichte über die Care-Arbeit anderer protokollierte, widmet sich Frédéric Valin nun in einem autobiografisch gefärbten Roman der eigenen Pflegetätigkeit. Sieben Jahre lang arbeitet der Protagonist auf einer Gruppe mit Menschen, die als geistig behindert gelten, und lernt dabei nicht nur die Bewohner*innen kennen, sondern auch etwas über die Macht, die ihm übertragen wird, die Machtlosigkeit der Bewohner*innen, er hinterfragt die Mechanismen des Pflegesystems und die gesellschaftlichen Gewissheiten über Krankheit, Behinderung und Tod – und er wird dabei selbst sensibler seiner Umwelt gegenüber. »Ein Haus voller Wände« ist mehr als ein Bericht von einer Arbeit, das Buch umkreist die verschiedenen Aspekte, die sich in der kleinen Wohngruppe zeigen. Darüber aber vergisst es die Menschen nicht, die hier zusammenkommen und ihre schönen, traurigen, lustigen Momente teilen. So entsteht ein bewegender Roman zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie prägt das Pflegen einen Menschen, wie prägen ihn die Gepflegten? Nach seinem Buch »Pflegeprotokolle« (2021), in dem er Berichte über die Care-Arbeit anderer sammelte, widmet sich Frédéric Valin nun in einem autobiografisch gefärbten Roman der eigenen Pflegetätigkeit. Sieben Jahre lang arbeitet der Protagonist auf einer Gruppe mit Menschen, die als geistig behindert gelten, und lernt dabei nicht nur die Bewohner*innen kennen, sondern auch etwas über die Macht, die ihm übertragen wird, die Machtlosigkeit der Bewohner*innen, er hinterfragt die Mechanismen des Pflegesystems und die gesellschaftlichen Gewissheiten über Krankheit, Behinderung und Tod – und er wird dabei selbst sensibler seiner Umwelt gegenüber.
»Ein Haus voller Wände« ist mehr als ein Bericht von einer Arbeit, das Buch umkreist die verschiedenen Aspekte, die sich in der kleinen Wohngruppe zeigen. Darüber aber vergisst es die Menschen nicht, die hier zusammenkommen und ihre schönen, traurigen, lustigen Momente teilen. So entsteht ein bewegender Roman zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit.
Frédéric Valin, geboren 1982 in Wangen im Allgäu, lebt seit einigen Jahren in Berlin. Dort studierte er Deutsche Literatur und Romanistik, bevor er begann, als Pflegekraft und Autor seinen Unterhalt zu verdienen. Im Verbrecher Verlag erschienen die Erzählungsbände »Randgruppenmitglied« und »In kleinen Städten«, der Essay »Zidane schweigt. Die Équipe Tricolore, der Aufstieg des Front National und die Spaltung der französischen Gesellschaft« und zuletzt der Band »Pflegeprotokolle«.
FRÉDÉRIC VALIN
EIN HAUS VOLLER WÄNDE
VERBRECHER VERLAG
Erste Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2022
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag 2022
Lektorat: Johanna Seyfried
Satz: Christian Walter
Druck und Bindung: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-95732-534-1
eISBN 978-3-95732-547-1
Printed in Germany
Der Autor dankt Nele Solf und Aileen Wessely.
Der Verlag dankt Anna-Lena Brunner, Lore-Marie Junghans und Dalina Schambach.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
1
Ich habe das Telefon aufgeräumt und die frühen Weckzeiten gelöscht. Seit einem halben Jahr brauche ich sie nicht mehr. 4:45 – die Zeit, zu der ich aufstehen musste, wenn ich wochentags Frühdienst hatte: gelöscht. 5:46 –, die Samstagszeit, mit der obligatorischen antifaschistischen Extraminute: gelöscht. 5:30 – für die Sonntage, weil der öffentliche Nahverkehr so beschissen fuhr, dass ich 15 Minuten länger brauchte, um rechtzeitig auf der Gruppe zu sein: auch gelöscht.
Ich hatte angenommen, ein Gefühl der Erleichterung zu verspüren, der Freude vielleicht, wenn ich diese Nachtzeiten endlich losgeworden sein würde. Stattdessen war ich traurig. Traurig darüber, dass so sieben Jahre unwiederbringlich vorübergegangen waren; traurig, dass das Ende so schnell kam, so geräuschlos, dass es nie einen echten Abschied geben konnte. Verdammte Pandemie, verdammter Albtraum. Ich hoffe, es geht allen gut.
Alle, das sind die Bewohner*innen einer Wohngruppe für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Jahrelang habe ich in einem Akt überfürsorglicher Inbesitznahme »meine Gruppe« gesagt. Alle, das sind auch die Bewohner*innen der benachbarten Gruppen, des gesamten Geländes, auf dem ich sieben Jahre lang tätig war als Betreuer und Pfleger.
Was das war, was ich dort tat, was es mit mir gemacht hat und wie das Leben jener Menschen aussah, die dort wohnten, davon handelt dieses Buch. Ihnen ist es auch gewidmet, vor allem Maria, deren Geschichte mich noch immer tief erschüttert und bewegt.
2
Es begann mit einem Gedanken: Es reicht. Genug ist genug. Ich muss was anderes tun.
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf am Rande der Alpen. Die Wikipedia-Seite meines Gymnasiums listet drei herausragende Persönlichkeiten: einen Kirchenmusiker, eine Theologin, einen Weihbischof. Meine Jugend war eng und stickig, bestimmt von den Konventionen und Erwartungen des provinziellen Kleinbürgertums, das die Kreisstädte beherrschte; und auf den Dörfern wurde ohnehin alles niedergeknüppelt vom Sadismus und der Gefühllosigkeit der testosterongesättigten Männer, die nur dann Witze machen, wenn sie wissen, dass die Pointe jemanden verletzt.
Wenn ich diese Region mit nur einer Szene beschreiben müsste, wäre es diese: Man sitzt in einem Straßencafé am örtlichen Marktplatz, mit Blick auf das barocke Rathaus, überall hängen Geranien an den mit mittelalterlichen Motiven bemalten Fassaden. Alle, die vorübergehen, sind schick gekleidet, weil es eine sehr reiche Gegend ist und es im Umkreis von 50 Kilometern keinen H&M gibt. Sie tragen ihre Einkäufe durch die Stadt, sie alle haben eingekauft. Es dauert ein wenig, bis es auffällt, aber irgendwann sieht man es doch: Alle Männer laufen mit breiter Brust, den Kopf hocherhoben, durch die Gegend, die Polohemden locker aus der Hose flattern lassend; die Frauen hingegen, auch die ganz jungen bereits, gehen gebeugt, den Kopf zwischen den Schultern, die Arme tief hängen lassend. Es ist das Land der traditionellen Werte.
Ich wollte ein anderes Leben führen und habe das auch getan. Ich hatte einige Bücher aus dem 19. Jahrhundert gelesen und ein paar Existenzialist*innen und dachte, ich wüsste schon, wie es geht: in die Stadt gehen, studieren, sich irgendwie durchschlagen, interessante Sachen machen. Dabei klug sein und anämisch, trinken und rauchen.
Ich schrieb viel, bekam Jobs, schlecht bezahlt zwar, aber interessant, und so weiter. Irgendwann kamen besser dotierte Anfragen, irgendwas mit Marketing. Ich weigerte mich so oft ich konnte, wurde aber auch schwach, sobald an einer Ziffer drei Nullen hingen. Diese Jobs waren immer scheiße, ich verkaufte Telefonanlagen und Tablets, es war langweilig, ich trank mehr. Das Trinken machte keinen Spaß mehr, das Rauchen nicht, das Geld fehlte wieder und irgendjemand winkte mit Nullen. Und ich winkte zurück.
Ich war Anfang 30, als ich keinen Bock mehr hatte. Die digitale Bohème war eine Mischung aus Selbstausbeutung, apolitischem Hedonismus, der Hoffnung auf ewige Jugend und regelmäßigen tränenvollen Abstürzen, um den Selbstbetrug zusammenzukleistern. Merci vielmals, aber nein, das war mir nichts.
Ich hatte – schon während der Schule, später im Zivildienst und auch danach, wenn ich Geld brauchte – im Sozialen gearbeitet, als Hilfspflegekraft, in verschiedenen Einrichtungen. Selbstverständlich wusste ich von den beschissenen Bedingungen, von der mauen Bezahlung, aber trotzdem erzählte ich bei Besäufnissen sehr oft von dieser Zeit. Vielleicht hat mir der Umgang mit Menschen gefehlt; ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und auch wenn ich selbst nie das Bedürfnis hatte, eine Familie zu gründen, war der Gedanke reizvoll, wieder Teil eines derartigen Kleinverbundes zu sein; aber eben auf Zeit.
Irgendwo am Stadtrand gab es eine Wohngruppe, die dringend Betreuer*innen suchte. Ich schrieb eine Bewerbung und hatte keine zwei Wochen später eine Einladung zum Gespräch. Als mich die Bereichsleiterin fragte, warum ich den Job haben wolle, antwortete ich: »Wegen des Geldes.« Sie stutzte kurz und sah mich prüfend an; ich weiß nicht genau, ob’s am Inhalt der Antwort lag oder am Genitiv. Aber da sie wirklich dringend suchten, lud sie mich zu einer eintägigen Hospitanz ein. Davor gingen wir einmal durchs Gebäude, es war mitten am Tag, kaum ein*e Bewohner*in war anwesend. Ich ging noch eine rauchen, in der Raucherecke stand eine zierliche Frau Ende 50 mit langem, weißem Haar und fragte mich, wer ich sei. Ich schilderte ihr kurz, warum ich da war. Sie nickte. Ich sagte auch, dass ich unsicher sei, ob ich diese Arbeit überhaupt könnte, da fragte sie mich: »Gehst Du gern in Kneipen?«
»Ja«, antwortete ich.
»Dann kommst Du hier auch zurecht.«
Das war Ursula, meine künftige Gruppenleitung.
3
An die Hospitation habe ich kaum konkrete Erinnerungen mehr. Es wird ein Nachmittag gewesen sein, wie ich später viele erlebte, obwohl sie mich auf eine andere Gruppe schickten als jene, auf der ich später arbeitete: Ich kam um drei, brachte Kuchen mit, wir tranken Kaffee, die diensthabende Betreuerin erklärte mir einiges, und die Bewoh ner*in nen erzählten dies und fragten das.
Lulu hat sicher das »Mensch ärgere Dich nicht« ausgepackt, hin und wieder ein bisschen geschummelt und sich gefreut, dass sie damit durchkam; und als ich einmal zurückschummelte, freute sie sich sehr, dass sie mich dabei erwischte. Vielleicht sind wir spazieren gegangen, vielleicht ging Lulu bei dem kleinen Supermarkt ums Eck eine Cola und eine Packung Gummibären kaufen. Da hatte man sie immer begleiten müssen, weil Lulu wusste, dass ihr Geld nur für eine einzige Tüte Haribo reichte; die Auswahl konnte also nicht leichtfertig getroffen werden. Und es gab keinen sichereren Weg, die ideale Sorte Gummibären herauszufinden, als sich durch das Sortiment zu testen: also riss sie die Packungen auf und probierte von allen Sorten, auch Lakritz. Irgendwann hatte sich der Supermarktbesitzer dann bei der Gruppe beschwert; seither durfte sie nicht mehr allein dorthin.
Gegen 18 Uhr gab es Abendbrot, und danach half ich hier und da beim Umziehen, Zähneputzen; ich erinnere mich an ein leichtes Unwohlsein, weil ich den Eindruck hatte, nichts zu tun. Ich war es inzwischen gewohnt, dass nach einem Arbeitstag irgendeine Art von Ergebnis vorlag, ein Text, etwas Verwertbares; hier aber kam nichts Zählbares bei raus. Das seltsame Gefühl der Nutzlosigkeit sollte mich das gesamte erste Jahr über begleiten.
Ich war also nicht unglücklich darüber, als es an der Tür klopfte und Ursula hereinkam: ob ich ihr nicht bei einer Sache helfen könnte, sie müsse noch einen Bewohner, Peter, versorgen, und der sei ganz schön schwer.
»Ja, klar«, sagte ich.
So lernte ich Peter kennen. Er war der erste Mann, den ich sterben sah.
Heute würde ich sagen, dass ich es ihm direkt angesehen habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich hatte bis dahin durchaus schon mit Menschen zu tun gehabt, die dem Tode nahe gewesen waren, aber das jetzt war anders. Einerseits – dazu komme ich später noch –, weil ich damals unbewusst den Eindruck hatte, unter anderen Menschen zu sein; dass Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung nicht anders sind als alle anderen, hätte ich zwar jederzeit behauptet, aber nie geglaubt. Und andererseits: Peter war jung, 50 vielleicht, oder irgendwas drumherum.
Zunächst lugte nur ein Kopf unter der Bettdecke hervor, ein markanter Schädel, kurzgeschorenes Haar, eine spitze, lange Nase mitten im Gesicht. Die Stirn war furchig, vielleicht auch, weil Peter fortwährend seine Augenbrauen bewegte; alle paar Sekunden änderte sich sein Ausdruck, Erstaunen glaubte ich zu sehen, Überraschung, Ärger, Zorn, Wut, dann wieder Angst, ein Erschrecken, Groll; sein schmales Gesicht nuancierte jede Regung, und ich tastete die Worte ab, die passen könnten, aber es waren schlicht zu viele Eindrücke für mich. Peter war ein mimisches Ereignis.
»Hallo«, sagte ich, »ich bin Nikolas.«
»Das ist Peter«, sagte Ursula und strich ihm einmal über die Stirn.
Sofort riss Peter die Augen auf und öffnete den Mund, den einen Schneidezahn, den er noch hatte, vorzeigend.
»Peter ärgert sich viel.« Sie streichelte ihm ein wenig über Kopf und Unterarm, bis Peter beruhigt in sein Kissen zurückgesunken war, und schlug dann vorsichtig die Decke zurück.
Peters Körper war von einer Spastik gekrümmt, seine Unterarme pressten sich an seine schmale, unbehaarte Brust, seine langen, sehnigen Beine lagen abgewinkelt zur Seite, die Knie aneinandergepresst. Jeder Muskel schien zu arbeiten in diesem Körper, er zitterte unter der Anstrengung, und durch seine weiße Haut – so weiß, dass sie fast durchsichtig war – sah man die Vibration der Fasern. Er lag in seinem Bett wie ein Grünewaldscher Christus.
Peter beruhigte sich, aber als wir ihn zur Seite drehten, protestierte er mit langen Klagelauten; zwischendurch hörte ich ihn einmal laut »Scheiße« sagen. Ich musste lachen; später erfuhr ich, dass es das einzige Wort war, das er überhaupt noch sagte, ansonsten war seine Sprache vollständig versiegt. Nachdem wir ihn eingecremt und gelagert hatten, um zu verhindern, dass seine Haut Druckstellen bekäme, erklärte mir Ursula, dass Peter sich im Endstadium Alzheimer befände.
»Ach«, sagte ich, »so jung.«
Ja, antwortete Ursula, das sei oft so bei Menschen mit Trisomie 21. Da trete Alzheimer viel früher auf als beim Rest der Bevölkerung.
Die Frage, warum Peter überhaupt in einer Wohngruppe für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung lebte, hatte ich mir zwar gar nicht gestellt, aber auf Trisomie 21 wäre ich ganz sicher nicht gekommen. Ich hatte eine diffuse Vorstellung davon, wie Menschen mit Trisomie 21 seien – lustig nämlich, lieb, fröhlich, kindlich, treuherzig und so weiter, dass sie etwas rundlich aussahen vielleicht, klein, mit dickem Nacken und rundem Kopf – und nichts davon, rein gar nichts, passte zu Peter.
Ich ging zurück auf die andere Gruppe und verabschiedete mich bald; ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf, ich könne zum nächstmöglichen Termin gerne anfangen. Das war im Juni 2013.
4
Ursula hatte nicht »Menschen mit Trisomie 21« gesagt, sie hatte »Downie« gesagt. Eine der Schwierigkeiten dieses Buches ist es, die richtigen Begriffe zu verwenden; keine Bezeichnungen zu benutzen, die mehr verdecken als sie aufzeigen. Ich war sehr lange damit beschäftigt, meine Vorurteile gegenüber Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung zu verwerfen; ich dachte, ich wüsste viel mehr als ich eigentlich wusste. Das gilt auch heute noch.
Ich spreche in diesem Buch von »Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung«, weil mir nichts Besseres einfällt. Es gibt Selbstbezeichnungen von Aktivist*innen. Das Netzwerk »Mensch zuerst« zum Beispiel zieht den Begriff »Lernschwierigkeiten« vor. So allerdings bezeichnen sich die Bewohner*innen, von denen ich spreche, nicht; sie eint vor allem diese Diagnose, und von dieser Diagnose an ist ihnen alles übergestülpt. Das in der Bezeichnung mit drin zu haben, schien mir wichtig, und dafür gibt es momentan kein gutes Wort. Vielleicht wird es nie eines geben, denn selbst die wohlmeinendsten Bezeichnungen können im Laufe der Zeit ins Bedrohliche umschlagen.
Das Wort »Idiot« zum Beispiel. Es hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Einst bezeichnete es so viel wie »Privatperson«: Menschen, die in den Gesellschaften der griechischen Stadtstaaten aus öffentlichen Fragen herausgehalten wurden. Im antiken Rom verschob sich die Bedeutung hin zu einem Synonym für Laien. Im 19. Jahrhundert dann machte der Arzt Édouard Séguin den Begriff für die Psychiatrie fruchtbar. Séguin gilt als Vater der Behindertenpädagogik, ein Vorreiter der Inklusion, der versuchte, mit dem Konzept der »Idiotie« einen neuen, menschenfreundlicheren Ansatz zur Beschreibung vor allem von Kindern mit sogenannter geistiger Behinderung zu etablieren. Séguin etablierte auch den Begriff des »idiot savant«, um einer größtenteils desinteressierten Öffentlichkeit nahezubringen, dass es sich durchaus lohnen könne, als zurückgeblieben geltende Kinder zu unterrichten.
Seinem Konzept haftet etwas Paternalistisches an, und dieses repressive Potenzial wurde – zeitgleich mit dem Verfall der Psychiatrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts – immer offenbarer, bis im Nationalsozialismus eine schon lang davor begonnene Diskussion in die Ermordung sogenannter Idioten mündete. Die Mordanstalten der verschiedenen Vernichtungsaktionen standen mitten in Deutschland, und trotzdem blieb der Widerstand gegen die Tötungen sogenannten »lebensunwerten Lebens« sehr überschaubar.
Der Begriff der »Idiotie« (oder eben zu Deutsch »Schwachsinn«) verlor nach 1945 seine diagnostische Bedeutung und wurde abgelöst vom Konzept der »geistigen Behinderung«. In Deutschland haben den Begriff Eltern betroffener Kinder eingeführt, im Jahr 1958. Diese hatten sich zusammen mit Fachleuten in der »Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.« zusammengeschlossen, einem Selbsthilfe- und Trägerverband; einer der Vorsitzenden, Werner Villinger, war ein ranghoher Mediziner im NS-Apparat gewesen, für massenhafte Zwangssterilisierungen in Bethel verantwortlich und hatte als T4-Gutachter viele »Idioten« per Federstrich in den Tod geschickt.
Der Begriff der »geistigen Behinderung« hielt sich jahrzehntelang, inzwischen ist auch er umstritten, denn was soll das sein, dieser Geist, der da behindert ist? Es braucht immer wieder neue Begriffe, weil sich Zuschreibungen von außen – so positiv sie ursprünglich gemeint sein mögen – verschleißen. Metaphorisch gesprochen sickern der Ableismus und die Behindertenfeindlichkeit, die in dieser Gesellschaft tief verwurzelt sind, in die Begriffe ein und höhlen ihr emanzipatorisches Potenzial aus. Diesen Prozess nennt die Linguistik Pejoration, also die sukzessive Abwertung eines Begriffes. Im Fall des Wortes »Idiot« ratterte die Euphemismus-Tretmühle.
Der Begriff des »Idioten« hatte von Beginn an etwas Verniedlichendes, Herabsetzendes; die Entmündigung ist ihm ab Entstehung mit eingeschrieben. Er steht in der Tradition, Menschen, die scheinbar Unvernünftiges tun, wie Kinder zu behandeln, weil sie betreut werden und als unselbstständig gelten. Er entpolitisiert die Kritik, die sie äußern, auch weil inzwischen vergessen wurde, dass soziale Kämpfe nicht am Verhandlungstisch in einem Gespräch auf Augenhöhe ausgetragen werden.
Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich irgendein findiger Kopf die Bezeichnung »Covidiot« ausgedacht. Das war äußerst geschickt, denn der Begriff verniedlicht und verkindlicht die Demonstrant*innen und unterspült Fragen nach Einfluss und Macht; er interessiert sich auch nicht dafür, wie viele Rechtsextreme da mitlaufen, wie viel kriminelle Energie da zusammenkommt und warum die Polizei diesen Leuten gegenüber so viel nachsichtiger ist als Black-Lives-Matter- oder G7-Demonstrant*innen. Das Wort ist ein rhetorisches Äquivalent zum Abwinken; sie nerven, diese großen Kinder, die nicht in der Lage sind, geradeaus zu denken. Mehr nicht.
Gleichzeitig bestärkt es diese Gruppierung, etwa deswegen, weil »Idiot« zu sein vor nicht einmal einhundert Jahren ein Todesurteil war; auch historisch stützt das Wort die erwünschte Opferinszenierung. Der Begriff »Covidioten« ist gerade deswegen ein ausgezeichneter Stabilisator, weil er nicht stimmt: Diese Menschen sind sehr wohl innerhalb der Gesellschaft und stehen nicht nur an ihrem Rand. Und das Gefährliche an diesen Demonstrationen ist ja nicht, dass sie abgeschottet sind, wie sogenannte »Covidioten« in einer Art von Selbstbeschwörung suggerieren wollen; sondern, dass nur so getan wird, als wären sie es. Währenddessen sitzen jene, die man früher mit »Idiotie« diagnostiziert hätte, isoliert in ihren Heimen und werden von niemandem gehört.
Ich habe selbst eine Weile das Wort »Downie« benutzt, weil es den Vorteil hat, fluffiger zu sein als »Menschen mit Trisomie 21«, halt auch, weil es so niedlich und süß ist. Aber die Vorstellung, die vorherrscht, sobald das Wort fällt, stimmt in aller Regel nicht. Das Wort schiebt sich vor die Bewohner*innen wie eine Milchglasscheibe. »Menschen mit Trisomie 21« ist sperrig, aber das ist möglicherweise sogar ein Vorteil: Diese Menschen werden allzu gern und allzu schnell übersehen. Gut, wenn man wenigstens in Texten einmal über sie stolpert.
Ich habe einige Kolleg*innen gefragt, wie sie mit diesen Bezeichnungen umgehen, und einer sagte dann: »Ich weiß nicht, die Leute haben Namen. Ich sage einfach Erika, Janina, Antje und so fort.« Klingt sehr nett, funktioniert aber nur im privaten Rahmen. Denn es entpolitisiert die so bezeichneten Menschen vollständig. Es muss eine Lösung geben, die beides ermöglicht: über diese Menschen als Individuen zu sprechen und dabei die spezifischen Bedingungen, die die Bezeichnung »geistige Behinderung« mit sich bringt, nicht zu vergessen. Diese Lösung kann nicht endgültig sein, sondern wird immer wieder überprüft werden müssen; freilich ein frommer Wunsch in einem Land, in dem maßgebliche Publizist*innen bei jeder Straßenumbenennung sofort den Untergang der deutschen Kulturnation befürchten.
Bleiben wir zunächst einmal beim Persönlichen: bei Karl oder Barbara oder Johannes oder Maria oder Stefan.
5
Als ich auf der Gruppe zu arbeiten begann, lebten dort fünf Bewohner*innen: Peter, Karl, Barbara, Stefan und Johannes. Konzipiert war die Gruppe für sechs bis sieben Personen, aber ein Bett blieb frei, weil kürzlich erst eine Bewohnerin zurück zu ihrer Schwester gezogen war; es stand im Doppelzimmer und war schwer zu belegen, sagte man mir später.
Mich begrüßte zunächst Karl, ein großer junger Mann, ein Brocken von einem Kerl, 120 Kilo auf einen Meter fünfundachtzig. Karl hatte viele Fragen und keine Zeit für meine Antworten, und er verfügte über die seltene Gabe, rastlos zu starren. Sein Blick ging durch mich hindurch, und ich hatte immer den Eindruck, er würde mich mit seinen Augen vollständig umfangen wollen, in Gelee einlegen. Er schien mir impertinent, aber kein bisschen bösartig: Jede Frage, die ihm durch den Kopf schoss, jeder Gedanke und jede Idee musste nur sofort ausgesprochen werden, nichts duldete einen Aufschub, und alles war derart dringend, als suchte man am Hauptbahnhof nach dem Gleis eines Zuges, der in drei Minuten abfahren sollte: Wer ich sei, fragte er, wie ich hieße, was ich mache, ob ich eine Freundin habe, wo ich wohnte, ob ich mit dem Bus hergekommen sei, ob ich schon mal im Zoo gewesen sei, er selbst sei kürzlich im Zoo gewesen, mit seiner Mutter, da habe er Pommes gegessen und Fanta getrunken. Welches denn sein Lieblingstier sei, fragte ich, da hielt er kurz inne und kuckte auf die Tischplatte, konzentriert, angespannt, ganz so, als gäbe es eine falsche Antwort auf diese Frage.»Das weiß ich nicht«, sagte er. Und dann, den Fragefaden wiederaufnehmend, fragte er, ob ich nun hier arbeiten würde, wann es Kaffee gäbe, ob er jetzt einen Joghurt essen dürfe, ob er von seinen Süßigkeiten essen dürfe, ob seine Mutter bald komme, sie käme zum Sommerfest, habe man ihm gesagt, ob das denn bald sei und ob er sich schon Kaffee nehmen dürfe.
Neben ihm saß, freundlich lächelnd, Barbara und wippte mit dem Oberkörper. Manchmal blickte sie verschmitzt zu mir auf und kicherte, wie junge Mädchen in den Heimatfilmen der 50er Jahre kichern. Sie war 73 Jahre alt, eine ältere Dame, der etwas Mauerblümchenhaftes anhaftete.
Eins weiter, die Beine locker übereinandergeschlagen, das Kinn auf der Hand abgelegt, mich mit seinen glänzend blauen Augen aufmerksam betrachtend, saß Johannes. Er besah mich jene fünf Minuten, die das Gespräch mit Karl angedauert hatte, dann sprang er auf, kam in langen Schritten auf mich zu, stellte sich sehr knapp vor mein Gesicht und fragte: »Wie heißt Du nochmal?«
»Nikolas«, sagte ich.
»Wie heißt Du?«, fragte Johannes erneut und kam noch ein Stück näher, er klang ausgesprochen vergnügt dabei.
»Nikolas.«
»Wie?«
»Nikolas heiße ich«, sagte ich, da breitete sich ein Grinsen über Johannes Gesicht, man hätte glauben können, es sei ein maßloses Vergnügen, mich zu kennen.
»Und wie heißt Du?«, fragte ich zurück.
»Ich bin Johannes«, sagte Johannes, dann nickte er, und seine Augen funkelten. »Johannes heiße ich.« Dann streckte er mir seine Hand hin, oder vielmehr: Er umfasste meine Hand mit Daumen und Zeigefinger, schüttelte sie kurz und sagte: »Schön.« Er nickte, setzte sich wieder auf seinen Platz und strahlte mich an.
Ich setzte mich ebenfalls, und wir tranken Kaffee; später gingen wir spazieren, wobei Johannes – die Arme auf dem Rücken verschränkt, seine etwas zu weite, beige Windjacke locker um den schmalen Oberkörper flattern lassend – jedes Blatt, jeden Holzzweig auf dem Weg eindringlich besah, als bärgen sie ein Geheimnis. Johannes ging nicht wirklich, er schlenderte, sein ganzer Habitus war der eines Lebemannes, der die kleinen und großen Rätsel des Lebens mit spielerischer Freude aufnahm, er hätte mit seiner Lässigkeit und seinem Charme sehr gut in ein Pariser Café gepasst.
Irgendwann muss auch Stefan noch dazu gekommen sein; er war ganz neu auf der Gruppe, erst vor einem Monat eingezogen, und verließ das Zimmer nur selten. Aber ich vermute, dass er doch mit uns zu Abend gegessen hat, wie er das die meiste Zeit zu tun pflegte; mit Sicherheit sagen kann ich es allerdings nicht. Stefan blieb so unsichtbar wie möglich, und wie so vieles, was er anpackte, gelang ihm auch das.
Nach dem Abendessen und der Abendtoilette saßen wir, die mich einarbeitende Kollegin und ich, noch im Büro: Ich war überrascht, wie entspannt alles lief, so entspannt, dass ich es beinah langweilig gefunden hatte, und ließ das auch durchklingen. Die Kollegin erzählte, dass ich eingestellt wurde, weil das Team zuvor zerbrochen war; von den damaligen Kolleg*innen sei nur noch einer da, Walter, der zudem monatelang ausgefallen war und im Dienst einen Zusammenbruch gehabt hatte, einfach umgefallen sei er, aus Stress habe er das Bewusstsein verloren, wie im Krankenhaus festgestellt wurde.
»Ach was«, sagte ich.
Vor zwei Jahren nämlich sei, auf der Höhe eines psychotischen Schubes, Karl hier eingezogen, direkt von einer psychiatrischen Station herunter; monatelang habe er völlig am Rad gedreht, immerzu herumgeschrien, sein Zimmer mit Kot eingeschmiert, er habe Stimmen gehört und gedacht, seine Schwester wohne unter seinem Bett, und er habe auch ständig epileptische Anfälle gehabt, die man sich bei ihm aber nicht wie allgemein bekannt vorstellen dürfe; vielmehr seien es psychomotorische Anfälle gewesen, er sei dann einfach aufgesprungen und im Wahn durch die Gegend gerannt, unkontrolliert gegen Wände und Türrahmen gestoßen; was insbesondere deswegen gefährlich sei, weil er Bluter sei, obendrein groß und schwer und kaum zu bändigen. Kurzum, Karl habe die komplette Gruppe auf links gezogen, reihenweise seien die Kolleg*innen ausgefallen, einige seien seit anderthalb Jahren krank deswegen, Angstzustände, Stresssymptome, allgemeine Erschöpfungszustände; ob sie jemals wieder arbeiten könnten, sei ungewiss.
»Und deswegen bin ich jetzt hier«, sagte ich.
Ja, so sei das, antwortete die Kollegin.
Dann sah sie kurz auf und wünschte mir einen schönen Feierabend. Ich folgte ihrem Blick: ah, ja. Acht Uhr. Dienstschluss für den Zwischendienst.
»Bis morgen«, sagte ich.
»Bis morgen«, antwortete sie.
6
Hinter einem Wald, an der Stadtgrenze, liegt ein kleines Dorf, da ist es ruhig, außer nachts, wenn die Wildschweine marodieren. Es gibt einen kleinen Marktplatz, da ist ein Friseur, eine Bankfiliale, ein kleiner Supermarkt, eine Bibliothek mit vielen Groschenromanen. Es gibt ein italienisches Restaurant ums Eck, in der anderen Richtung einen Sportplatz, zwei Schwimmbäder und eine Turnhalle. Alles ist grün, an jeder Ecke steht ein Baum, das Gras der Rasenflächen ist kurz geschnitten (wenn nicht die Wildschweine auf der Suche nach Engerlingen die ganze Landschaft umgegraben haben). Es gibt auch eine Kegelbahn, die habe ich allerdings nie gesehen, und eine Tonwerkstatt in irgendeinem Keller.
Ganz hinten, kurz vor dem Wald, stehen zwei Häuser; dort wird betreut gewohnt. Im hinteren Haus sind die Menschen untergebracht, die man schwerstmehrfachbehindert nennt; im vorderen die Menschen mit sogenannter schwerer oder mittelgradiger geistiger Behinderung, denen man ein eigenständiges Wohnen nicht zutraut.
Das zweite Haus ist ein Funktionsbau aus den 60er Jahren, in zwei Haushälften unterteilt. In den oberen beiden Stockwerken befinden sich die Wohngruppen, vier pro Haushälfte. Im Keller sind die Räume der Tagesbetreuung. Der Bereich ist erst kürzlich neu strukturiert worden, und die drei Gruppen, die da jetzt residieren, haben sich, ganz wie im Kindergarten, Tiernamen gegeben. Offenbar hat niemand die Bewohner*innen gefragt, wie die Gruppen heißen sollen, in die sie gehen, deswegen heißen sie jetzt »Opossum«, »Flamingo« und »Rhinozeros«. Das sind die Lieblingstiere der Betreuer*innen. Der Name »Flamingo« geht noch, doch drei Viertel der Bewohner*innen wissen nicht, was ein Opossum ist, und Rhinozeros kann kaum jemand aussprechen, aber hey!, die Gruppen heißen jetzt cool. Die Betreuer*innen freuen sich. Wenn man sie fragt, was sie sich dabei gedacht haben, werden sie sauer; sie haben es ja nur gut gemeint.
Außerdem sind im Keller: die Hauswirtschaft, die Hausmeister. Irgendwo noch ein kleiner, muffiger Sitzungssaal.
Architektonisch stellt sich die Gesellschaft Menschen mit Behinderung als alte Menschen vor. Die baurechtlichen Vorgaben sind die gleichen wie bei Seniorenresidenzen. Es kann eine Gruppe voller vitaler Mittzwanziger sein, der Gang muss trotzdem so breit gebaut sein, dass zwei Rollstühle aneinander vorbeikommen, es braucht Handläufe, und Möbel dürfen da auch nicht rumstehen, wegen Brandschutz. Es geht überhaupt viel um Sicherheit: Holzmöbel in einem Bad zu haben, führt bereits zu schlechteren Bewertungen bei der jährlichen Inspektion des Gesundheitsamtes (außer man streicht sie mit Schiffslack oder so). Innenarchitektonisch hat der Gang den Charme eines Verwaltungsschreibens.
Das ist im Wohnzimmer anders; da darf man einrichten, wie man mag (das bedeutet, wie die Betreuer*innen mögen, den Bewohner*innen wird da in aller Regel höchstens Mitspracherecht zugestanden). Es gibt eine offene Küche, einen großen Esstisch und eine Couchlandschaft mit Fernseher. Auf der Gruppe gibt es außerdem: drei Bäder, fünf Zimmer für Bewohner*innen, ein kleines Büro für die Mitarbeitenden. Das ist das Reich, in dem sich das Gruppenleben abspielt.
In der ersten Zeit dachte ich, wann immer ich hinausfuhr zur Arbeit, was für eine rückständige, mittelalterliche Idee das ist, die Alten und Kranken vor die Tore der Stadt auszulagern; ganz so, wie man es mit den Leprösen in früheren Zeiten gemacht hat. Nach einer gewissen Zeit aber stellte ich fest, dass es die Stadtwelt war, die als unzumutbar zu gelten hat; läge das Heim innerhalb des Rings, an einer vielbefahrenen Straße zum Beispiel, dann könnte Johannes das Haus gar nicht verlassen; zu groß wäre die Gefahr, dass er, der nicht weiß, wie eine Ampel funktioniert und den das auch kein Stückweit interessiert, von einem durchrauschenden Lastwagen erfasst werden würde.
Aber es ist ebenso offensichtlich, dass man diese Inseln gebaut hat, um sich abzuschotten von denen, die man behindert nennt. In den 50er Jahren hat der Soziologe Erving Goffman diese Art von Einrichtung als »totale Institution« beschrieben; darunter fallen nicht nur Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, sondern auch Klöster, Kasernen, Gefängnisse. Im Grunde sind totale Institutionen Orte, an denen alle Bereiche des sozialen Lebens zusammenfallen: Arbeit, Freizeit, Schlaf und Essen.