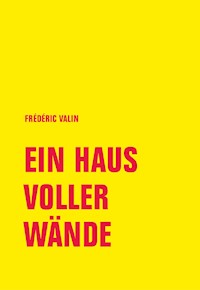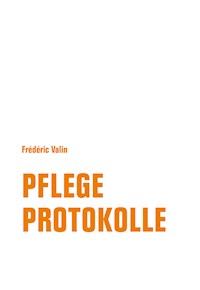Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frédéric Valin schildert einen Pfleger in einer Behinderteneinrichtung, die Anforderungen der Arbeit, die nötigen Handgriffe und lässt in der Schwebe, was Routine und was Mitgefühl ist; er zeigt einen jungen Mann, der anlässlich des Selbstmordes einer alten Jugendfreundin in seine Heimatstadt zurückkehrt und feststellen muss, dass er nichts vom Leben seiner Mutter weiß und Empathie verlernt hat; einen alternder Oberbürgermeister, der seine Provinzstadt in neue Hände übergeben will, und im Wahlkampf für seinen designierten Nachfolger mit den neuen Medien konfrontiert wird. Er erzählt von einem armen Schlucker, der mit seiner reichen Freundin in der Vorstadt zusammen ziehen wird, aber gar nicht recht weiß, ob er die Stadtmitte eigentlich verlassen möchte und von einem Trinker, der trinkt, ohne den Rausch genießen zu können. Frédéric Valin erzählt vom Abseitigen im Alltäglichen. Er erzählt vom Umgang mit Behinderung und Tod, Arbeit und Karrieremöglichkeiten, entfremdeten Familien und von Kompromissen, die man in der Liebe eingeht. In diesen Geschichten zeigt sich das große erzählerische Vermögen von Frédéric Valin. Seine genaue Beobachtungsgabe, seine Fähigkeit, diese in eine lakonische und teils melancholische, teils ironische Sprache zu übersetzen - die berührt und beeindruckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRÉDÉRIC VALIN
IN KLEINEN STÄDTEN
Erzählungen
DER VORGANG
Ich stehe in der Zimmertür und atme tief ein; es ist halb zehn, langsam beginne ich zu merken, dass ich die Nacht kaum geschlafen habe. Seit vier Uhr bin ich wach, die ganze Welt ist aus Gummi. Ich gehe zum Fenster und sehe mein Spiegelbild: Die Augen sind rotgerändert, das schmale Gesicht hängt mir müde von den Knochen, es fühlt sich an, als wäre es von einer dünnen Lauge überzogen. Ich reiße das Fenster auf, die kalte Dezemberluft schießt mir in die Bronchien, und ich beginne fast, wieder in Sätzen zu denken statt nur in Stichworten.
Fünf Minuten Pause. Dann Sylvia.
Draußen liegt das Dorf, idyllisch wie aus einem Reiseprospekt geschnitten. Direkt vor der Tür Sportplatz und Kirche, ein paar Therapieräume, ein Bauernhof, mit Schweinestall. Weiter hinten ein kleiner Platz, mit Supermarkt, Friseur, Bäcker und einem Café, ein Ärztehaus, eine Apotheke. Nichts weiter als ein kleines Kaff, irgendwo weit außerhalb, inmitten eines Waldes, in dem Wildschweine leben.
Und Behinderte. Oder Alte, das ist aus technischer Sicht das Gleiche. Sie wohnen hier, wie sie können, in ambulanter Betreuung oder in Wohngruppen, man hat einen Kindergarten zwischenreingebaut und eine Station zur U-Haftvermeidung für Jugendliche. Weiter hinten stehen noch ein paar echte Häuser, das heißt Häuser, wie man sie kennt: zwei Stockwerke, Gärten, Garage, zwischen hundertzwanzig und zweihundert Quadratmeter Wohnfläche, Giebeldächer und keine Betonrampe vor der Eingangstür. Und alle mindestens mit Zaun, wer etwas auf sich hält, pflegt seine Hecke. Manchmal ein Hund.
Als ich das erste Mal hier herausfuhr, zu meinem Bewerbungsgespräch, dachte ich noch, was es für eine mittelalterliche Idee ist, tausend Alten und geistig Behinderten ein Dorf mitten im Nirgendwo zu bauen, als könne man sie der normalen Welt nicht zumuten. Heute weiß ich, dass es andersrum ist: Die normale Welt ist unzumutbar.
Ich schließe das Fenster und atme noch mal tief ein. Das ist meine achte Woche hier, und langsam gewöhne ich mich an den Geruch. Viele der Bewohner sind inkontinent, in der Kammer lagern wir die Nasswäsche in einem Plastikeimer, da riecht es raus. Ich war mir vorher sicher, dass ich das eklig finden würde, aber schon vor der dritten Schicht fand ich, dass diese süßliche, warme Note etwas Entspannendes und Heimeliges hat.
Ich stelle mich auf die Feuertreppe und rauche noch eine; es ist kurz nach halb zehn, fünf der sechs Bewohner sind bei der Arbeit oder in der Tagesgruppe. Nur Sylvia liegt noch im Bett und schläft. Es gibt einen festen Plan, an den man sich halten muss, wenn man fertig werden will: Wer wann frühstückt, wann die Wäsche weggebracht wird, wann die Küche gesäubert, der Geschirrspüler ausgeräumt und Essen eingekauft wird. Es ist nicht wie in der häuslichen Pflege, man muss sich nicht sklavisch daran halten, man verliert kein Geld, wenn man die Wäsche nicht einräumt, weil einer der Bewohner an einem Tag besonders viel Zuwendung braucht und mit mir darüber diskutiert, ob er tatsächlich sein Frühstück essen muss oder nicht; aber es gibt kaum eine Minute, in der man nichts zu tun hat.
Zum Glück schläft Sylvia sehr viel, deswegen können wir uns um sie, die viel Zeit fordert, kümmern, wenn alle anderen außer Haus sind. Sylvia ist der einzige Pflegefall bei uns, wir haben es da gut, andere Gruppen haben bis zu vier solcher Fälle, da ist man nicht mehr weit entfernt von den Waschstraßen in den Altenheimen. Das sind dieFLW-Gruppen: Füttern, lagern, windeln. Und wenn es nicht mehr geht, kriegt einer der Bewohner einen Katheter.
Es ist auch bei uns abzusehen, dass es mehr Pflegefälle geben wird, mit jedem Jahr steigt die Wahrscheinlichkeit. Noch nie in der Geschichte sind Behinderte so alt geworden wie heute, die Grundversorgung hat sich verbessert, die medizinische Diagnostik hat sich verfeinert, es kommen immer bessere Medikamente auf den Markt. Außerdem lebt niemand so gesund wie ein Behinderter: Die meisten trinken keinen Alkohol, rauchen nicht, sie haben einen geregelten, fest gefügten Tagesablauf, einigermaßen ausgewogene Ernährung, ständig irgendwelche Vorsorge- und Kontrollbesuche bei Ärzten. Und weil die Bewohner so gut versorgt werden, werden sie alt und bekommen Krankheiten, von denen man früher nicht ahnte, dass sie auftreten könnten.
Sylvia zum Beispiel ist doppelt belastet: Einerseits ist sie Epileptikerin, sie bekommt seit früher Kindheit Medikamente gegen ihre Anfälle. Epilepsie, so hat man uns das erklärt, kommt durch Verletzungen im Gehirn, die dazu führen, dass sich dort Impulse stauen, weswegen die Nervenzellen im gleichen Rhythmus zu feuern beginnen, anfangs wenige, dann immer mehr, bis es das komplette Organ befallen hat. Man hört immer, es sei wie ein Gewitter im Kopf, aber ich stelle es mir mehr wie einen Marsch auf einer Militärparade vor; die Glieder können dann gar nicht anders, als im Takt der Nervenzellen zu zucken. Nach einer Minute ungefähr ist alles vorbei, dann hängt Sylvia schlaff im Rollstuhl, derart erschöpft, als wäre sie gerade einen Marathon gerannt.
Wodurch die Anfälle ausgelöst werden, wissen wir nicht genau; ist es das Wetter? Schnell wechselnde Lichtverhältnisse? Laute Musik, hat sie zu wenig geschlafen? Ist sie traurig, hat sie sich über etwas zu sehr gefreut? Ist es Verunsicherung, haben wir sie erschreckt? Mein Gott, ist es überhaupt Epilepsie?
Das immerhin müssen wir annehmen, nach Aktenlage ist sie es, und es gibt ja auch Anzeichen: dass Sylvia so oft unkontrolliert mit dem Fuß wackelt, die Lippen kräuselt, den Mund leckt, unwillkürlich die Arme hochreißt. Außerdem ist es schon einmal diagnostiziert worden vor langer Zeit, deswegen geben wir ihr weiter Antiepileptika. Im Grunde sind das nur starke Beruhigungsmittel, die Sylvia möglichst umfassend sedieren, damit die Welt ihr Hirn nicht überanstrengt.
Die meisten Antiepileptika sind Teufelszeug, zumindest, wenn man sie falsch dosiert. Antiepileptika wirken aufs Kleinhirn, und wenn man lange genug die falsche Dosis nimmt, hat man oberhalb des Rückenmarks nur noch Apfelmus. Leider wusste man, als man die Medikamente entwickelte, nichts von den Langzeitnebenwirkungen, die durch Überdosierung entstehen können, deswegen hat man sie in die Kranken reingestopft wie Aspirin. Inzwischen gibt man weniger, weiß aber immer noch nicht, was das dann langfristig mit den Patienten macht.
Wie gesagt, einerseits.
Andererseits, Sylvia ist Downie. Trisomie 21 sagt der Mediziner, ältere Kollegen sagen Mongo. Die Terminologie ändert sich alle zehn Jahre, je nach gesellschaftlicher Gesamtlage. Downies jedenfalls beginnen in der Regel mit Ende vierzig, Anfang fünfzig dement zu werden, Alzheimer, warum, darüber gibt es nur Vermutungen. Die Erkenntnis ist auch noch nicht so alt, früher hat man das nämlich nicht mitbekommen, weil Trisomie 21 recht oft mit Herzschädigungen einhergeht. Ich meine, Sylvia hatte bei der Geburt zwei Herzklappenfehler und ein Loch in der Scheidewand, die hatte gar keinen Muskel in der Brust sitzen, das war mehr ein leerer Luftballon. Wäre sie zwanzig Jahre früher geboren, hätte man das niemals operieren können, und wer weiß, vielleicht hätte sie nie das Alter erreicht, um Alzheimer zu bekommen, sondern wäre irgendwann einfach zusammengeklappt.
Ich gehe zurück in Sylvias Zimmer, sie liegt im Bett und spricht, ich weiß nicht mit wem, ich verstehe auch nicht alles. Sie stottert, außerdem redet sie in einem Dialekt, den ich nicht beherrsche, ich weiß nicht einmal, wo ihre Sätze anfangen oder aufhören. Sie ist noch nicht sehr lange da, drei Monate oder so, bis dahin hat sie in ihrem Elternhaus gelebt, doch da die Mutter alt und gebrechlich wurde, musste sie nun zu uns. In der Zwischenzeit hat sich ihr Zustand sehr verschlechtert; keiner weiß warum. Sie kann inzwischen kaum mehr auf den Beinen stehen, vielleicht sind es die Medikamente, vielleicht ist sie falsch eingestellt; vielleicht ist es ein Demenzschub, und sie hat vergessen, wie das geht: auf den Beinen stehen. Vielleicht ist es auch eine Depression, weil sie jetzt von der Mutter getrennt ist, die sie ein Leben lang um sich hatte, und jetzt wacht sie statt in ihrem Bett jeden Morgen bei uns auf und weiß nicht, was sie hier soll. Vielleicht hat sie Schmerzen, vor vier Monaten ist sie die Treppe hinuntergestürzt und hat sich den Knöchel angeknackst; kann sein, dass das noch nicht recht verheilt ist. Vielleicht ist es eine Thrombose, ihre Venen im Oberschenkel fühlen sich an wie Stacheldraht, völlig verhärtet und wenn ich versehentlich draufdrücke, schreit sie manchmal, manchmal nicht. Ich weiß es nicht, und wenn ich sie frage, was sie hat, schaut sie mit ihren wässrig blauen Augen rechts neben mich, als wäre ich ein Zeuge Jehovas.Ich bin immer überrascht, keine Miniatur-Flugzeugschattenauf ihrer Iris vorbeiziehen zu sehen.
Vor zwei Wochen haben wir sie ins Krankenhaus gebracht, wir wussten nicht weiter. Die Ärzte sagten, sie schlafe viel, und dass sie hohe Entzündungswerte habe, ohne Befund. Sie haben ein großes Blutbild gemacht, einCT, einMRT, sie an Infusionen gehängt und unzureichend gelagert. Dann haben sie oB in die Akte geschrieben. Woher kommen denn die Entzündungswerte, haben wir gefragt, hat sie eine verunreinigte Blutspende bekommen? Sind es die Zahnruinen, die in ihrem Mund faulen? Kann es vom Knöchel kommen? Man hat die Schultern gezuckt und uns ratlos ins Gesicht gesehen, dann haben sie Breitbandantibiotika in Sylvia reingeschüttet, bis die Werte wieder vertretbar waren. Und dann haben sie sie entlassen. Am Ende hat ein Arzt gesagt: »Sie wissen ja, wie das enden wird.«
Jetzt ist sie seit drei Tagen wieder hier, es ist mein erster Frühdienst seither. Ich ziehe mir die Gummihandschuhe über, wir werden gleich duschen, und setze mich zu ihrans Bett. Sie liegt auf der rechten Seite und hat ihre linke Hand unter ihr Gesicht geklemmt, sind das Zahnschmerzen oder ist es nur eine Schutzhaltung? »Wie geht’s dir denn heute?«, frage ich, ob sie überhaupt weiß, wer ich bin? Ich streiche ihr die nachtschweißnassen Haare aus der Stirn, sie macht irgendwas mit ihren Gesichtsmuskeln, ich weiß nicht, ob es Überraschung bedeutet, Freude oder Angst.
»Sylvia«, sage ich, »hast du gut geschlafen?« Ihre Hand beginnt zu zittern, ihre eingefallene Wange vibriert mit; sie hat viel Gewicht verloren im Krankenhaus, vielleicht ist sie deswegen so schlecht auf den Beinen, weil sie keine Energie im Körper hat. Ich muss sie aufsetzen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, ich sage: »Sylvia, wollen wir was frühstücken?« Sie antwortet nicht, irgendein Geräusch kommt aus ihrem verschlossenen Mund, schwer zu sagen, ob es ein Brummen ist oder ein Rülpser.
»Komm«, sage ich, ich fasse ihr an die rechte Schulter, um sie auf den Rücken zu drehen; sie fühlt sich weich an wie ein überreifer Pfirsich, wenn ich jetzt fest zugreife, denke ich, zerbröselt sie mir in der Hand. Kaum dass ich sie anhebe, fängt sie das Schreien an, kraftlos und leise, oder ist es nur ein Murren? »Kuck mal«, sage ich, »draußen scheint die Sonne«, ich zeige aufs Fenster, sie sieht an die Decke und hat die Augen zusammengekniffen. Dann, als sie kurz hinsieht, fasse ich unter ihre beiden Arme, drehe sie zum Bettrand und richte sie auf; sie sagt nichts, vielleicht habe ich sie überrascht. Verwundert sieht sie sich im Zimmer um, bis ihr Blick auf mich fällt, dann grinst sie und sagt: »Lass mal, du alte Schachtel!« Es geht ihr also ganz okay so weit.
Das wäre jetzt die Gelegenheit, sie ein bisschen aufzuziehen, damit sie sich ärgert; Leute mit Demenz sollen sich viel ärgern, anscheinend verzögert das den Krankheitsverlauf, zumindest sagt das der Hausneurologe. Das ist eine klassisch medizinische Herangehensweise, denke ich, wir verschlechtern die Lebensqualität, um die Lebensdauer zu verlängern; außerdem bin ich viel zu müde, um mich jetzt mit Sylvia zu kabbeln.
Sie wird sich ohnehin genug ärgern, denn aufstehn will sie nicht. Sobald ich sie an die Schulter fasse, um sie aufzurichten, beginnt sie, wie angestochen zu quieken. Ich beuge mich zu ihr herunter, immer wieder, das Blut schießt mir in den Kopf und pocht an den Schläfen entlang, meine Augen brennen, als hätte ich meine Lider mit Fußcreme eingerieben, und Sylvia quiekt.
Ich halte mein Gesicht auf einer Höhe mit dem ihrigen, damit sie weiß, woher die Stimme kommt, die ihr immer wieder sagt, dass es jetzt Zeit sei, sich an den Esstisch zu setzen und zu frühstücken, sie keucht immer schwerer und bläst ihren nassfauligen Atem in meine Richtung, wahrscheinlich bin ich noch nie einem Menschen so nahe gewesen. In mir zieht sich alles zusammen, wenn ich könnte, würde ich sie einfach hochheben, aber ich kann nicht, ich bin zu schwach. Ich zerre an ihr herum wie an einer Matratze, die sich im Kofferraum verhakt hat, meine rechte Hand, die ihren Schlafanzug an der Schulter hält, hat sich längst zur Faust verkrampft; als ich die weißen Fingerknöchel sehe, lasse ich ab und atme tief durch. »Ach, Sylvia«, sage ich, sie sitzt mit offenem Mund am Bettrand und sieht verständnislos auf die gegenüberliegende Wand. Dann zieht sie die Mundwinkel nach oben, ist das ein Lächeln? Oder Abscheu?
Ich würde gerne eine rauchen, dann allerdings müsste ich Sylvia wieder ins Bett legen, und das ganze Theater fängt wieder von vorne an. Sitzen lassen kann ich sie nicht, wenn sie von der Kante fällt, bin ich geliefert. Ich gehe zum Fenster und stelle den CD-Player an: Schlager, klar. »Zwei kleine Italiener«, ihr Lieblingslied. Im Hintergrund höre ich sie leise einzelne Silben mitsingen, immer eine halbe Sekunde zu spät, ich bin so müde, ich bin ganz gerührt. Nach einer Minute bricht sie plötzlich ab, ich drehe mich um und sehe in ihr von Anstrengung zerbissenes Gesicht, vielleicht, denke ich, habe ich ihr zu viel zugemutet, vielleicht kann sie einfach nicht mehr sitzen, geschweige denn stehen; kaum bin ich mit dem Gedanken fertig, lösen sich ihre Züge, und sie bekommt genau jenen entspannten Ausdruck um die Mundwinkel, den kleine Kinder aufsetzen, wenn sie gerade geschissen haben.
Ich könnte jetzt lachen. Oder mir an den Kopf fassen.
Ich setze mich neben sie aufs Bett und falte meine Hände ineinander. »Wie wär’s, wollen wir jetzt aufstehn?« Sylvia lacht und gibt mir einen leichten Klaps auf den Oberarm. »Du alte Schachtel!«, sagt sie, ich kann mich knapp davon abhalten, zurück zu klapsen. Ich hake sie bei mir ein und stelle mein rechtes Bein vor ihren Körper, damit sie nicht nach vorne rutscht, wenn ich sie nach oben zerre. Sie lässt mich machen, sie beklagt sich auch nicht, im Gegenteil: Alles an ihr ist passiver Widerstand. Kein einziger Muskel ist aktiv, sie hat die Körperspannung eines Bettlakens. Mit dem linken Knie schiebe ich ihren Hintern in die Gerade, mit dem rechten Arm halte ich ihre Schultern auf Linie; wie das aussehen muss, denke ich. Als würde ich einen viel zu kleinen Baum hochklettern.
Kaum habe ich ihren Körper in die Vertikale gehievt, fängt sie an, sich zu erinnern, wozu ihre Beine gut sind. Sie steht, wenn auch wacklig, und krallt sich an meinem Pullover fest; direkt auf Höhe der Brustbehaarung, jedes Mal, wenn sie zu sehr ausschwenkt, reißt sie mir den Pelz vom Leib. Nach zwei Minuten macht sie »Puh« und will sich wieder nach hinten sinken lassen; mit letzter Kraft drehe ich sie weg vom Bett und hin zur Tür. Sie macht den ersten Schritt, sie lockert sogar den Griff, ich atme durch.
Der Weg ins Bad ist kurz, es sind vielleicht sieben oder acht Meter. Immer wieder zeige ich auf die Tür, durch die wir müssen, und sage Dinge wie »Komm, Sylvia, das packst du« oder »Schau, da hinten ist der Durchgang, da müssen wir hin«.
Sie ist sehr konzentriert, hin und wieder schnauft sie laut aus oder sagt: »Du alte Schachtel!«, und kichert dann, ich weiß nicht, ob sie sich meint oder mich. Als wir im Bad ankommen, kann ich unsere Körpergerüche nicht mehr unterscheiden.
Wir stehen vor der Toilette, durch das Fenster hinter mir höre ich Clara reden. Clara ist ein Sonnenschein. Sie wohnt in der Nachbargruppe, eigentlich müsste sie um diese Zeit arbeiten gehen, vielleicht ist sie krankgeschrieben. Die meisten der Bewohner hier gehen in Werkstätten arbeiten, wo sie Verpackungsmaterial in Kartons stopfen oder Schaltknüppel für Autos zusammenschrauben. Das ist Teil des großen Inklusionsplanes: Behinderte sollen so weit wie möglich in die Gesellschaft integriert werden, dazu zählt vor allem ein geregeltes Arbeitsleben. Wenn man Clara trifft, wie sie per Fahrdienst von ihrer Arbeit nach Hause gebracht wird, und sie fragt, wie ihr Tag gewesen sei, zählt sie immer erstmal auf, was es da zu essen gegeben hat.
Wahrscheinlich hat die Kollegin sie etwas einkaufen geschickt, Clara geht von sich aus ungern vor die Tür, obwohl sie sehr gut orientiert ist. Sie ist ein bisschen verträumt, und wenn sie ein Blatt findet, das ihr hübsch vorkommt, stellt sie sich dazu, betrachtet es eine Weile und hebt es dann auf: egal, ob es in einem Park liegt oder auf der Autobahn. Sie hat mit ihrer Mutter an einer vielbefahrenen Straßenkreuzung gewohnt, und nachdem Clara von einem Fahrrad angefahren worden ist, hat sich die Mutter nicht mehr getraut, ihre Tochter aus dem Haus zu lassen. Nach ein paar Wochen bekam Clara einen Lagerkoller und hat auf die alte Frau eingeprügelt, die Mutter hat sehr geweint, deswegen ist Clara jetzt hier; hier kann sie bis zur totalen Erschöpfung durch die Gegend tapern, ohne die verkehrsberuhigte Zone zu verlassen oder vom Bus erfasst zu werden, weil sie auf der Straße ein besonders schönes Kaugummipapier gesehen hat, das nähere Betrachtung verdient hätte. Sie kann alleine einkaufen gehen, sie kann sogar vergessen zu bezahlen, ohne dass der Supermarkt die Polizei ruft, und wenn es ihr schlecht geht und sie sich auf den Boden kauert, weiß jeder Passant, dass er sich kurz um sie kümmern muss. Und wenn es draußen unter Null Grad hat, lässt sie keiner alleine nach Hause gehen, wenn sie ohne Jacke auf dem Sportplatz sitzt.
Ich stelle Sylvia vor die Toilette und ziehe die Halterungen herab, damit sie sich festhalten kann. Ich versuche, sie mit dem Rücken zur Schüssel zu platzieren, aber sie steht an den beiden Stützen wie an einem Flipperautomaten. »Wir müssen uns jetzt auf die Toilette setzen«, sage ich, da geht sie sofort in die Hocke. Ich versuche zu lächeln, das könnte auch witzig sein, denke ich, bevor ich mich unter ihrem Arm einhake. »Nein«, sage ich vorsichtig, »nein, Sylvia, wir müssen uns erst umdrehen.« Sie sieht mich verständnislos an, und als ich sie um die eigene Achse drehen will, verzieht sie ihr Gesicht zu einem tonlosen Schluchzer. Ich schließe kurz die Augen und atme durch angespannte Lippen aus. »Hör mal, ich nehme mir kurz Handschuhe aus dem Regal«, sage ich, ob sie das Wort »Handschuhe« überhaupt versteht? Während ich in den Wäscheschrank greife, bleibt sie reglos stehen; als ich dann ihre rechte Hand nehme, um sie von der rechten zur linken Halterungzu führen, lässt sie mich widerstandslos gewähren.»Komm, wir tanzen eine halbe Umdrehung«, sage ich, stelle mich zwischen sie und die Toilette und greife ihre Hüfte; sie kichert und krallt sich mit der Linken an meinem Oberarm fest, dass ich meine, den Knochen knacksen zu hören.
Kaum ist sie in Position, ziehe ich ihre Hose und die Windel aus, ein Aroma von Ammoniak und Salpetersäure durchzieht den Raum. Ihr Kot ist tief schwarzgrün und pappig, das kommt von den Eisentabletten, die machen, dass man Teer scheißt.