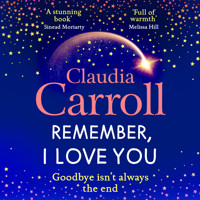Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sucht den Vater ihres Kindes – und findet den Mann ihrer Träume … Als Journalistin Eloise ganz allein ihren 30. Geburtstag feiert, beschließt sie etwas gegen ihre Einsamkeit zu tun. Selbst wenn Liebe nicht in den Sternen steht, Familie kann man auch allein machen! Ein paar Jahre später bekommt sie die Quittung: ihre kleine Tochter Lily fragt nach ihrem Vater. Kurzum macht Eloise ihren anonymen Samenspender ausfindig – und ist entsetzt: Jack Keane ist zwar extrem attraktiv, aber auch ein Ex-Sträfling und erst seit kurzem auf Bewährung! Nicht der Vater, den Lily verdient. Unter den Vorwand, einen Artikel über ihn zu schreiben, verspricht sie Jack dabei zu helfen, nach seiner Freilassung wieder auf die Füße zu kommen. Dabei plant sie, ihn zu einem perfekten Gentleman umzukrempeln – bis sie ihn wirklich kennenlernt … »Voller Wärme, Humor und Emotion – eine wundervoll geschriebene, unkonventionelle Lovestory, die von der ersten Seite an bezaubert.« Bestsellerautorin Melissa Hill Eine chaotische und herzergreifende RomCom der irischen Bestsellerautorin Claudia Carroll – Fans von Beth O'Leary werden begeistert sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Journalistin Eloise ganz allein ihren 30. Geburtstag feiert, beschließt sie etwas gegen ihre Einsamkeit zu tun. Selbst wenn Liebe nicht in den Sternen steht, Familie kann man auch allein machen! Ein paar Jahre später bekommt sie die Quittung: ihre kleine Tochter Lily fragt nach ihrem Vater. Kurzum macht Eloise ihren anonymen Samenspender ausfindig – und ist entsetzt: Jack Keane ist zwar extrem attraktiv, aber auch ein Ex-Sträfling und erst seit kurzem auf Bewährung! Nicht der Vater, den Lily verdient. Unter den Vorwand, einen Artikel über ihn zu schreiben, verspricht sie Jack dabei zu helfen, nach seiner Freilassung wieder auf die Füße zu kommen. Dabei plant sie, ihn zu einem perfekten Gentleman umzukrempeln – bis sie ihn wirklich kennenlernt …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2012 unter dem Originaltitel »A Very Accidental Lovestory« bei Avon, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Der männliche Makel« bei Piper
Copyright © der englischen Originalausgabe 2012 Claudia Carroll
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2012 Piper Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (lj)
ISBN 978-3-98952-868-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Claudia Carroll
Ein irischer Gentleman
Irland-Roman
Aus dem Englischen von Karin Dufner
»Achte auf deine Gedanken, denn irgendwann sind sie Worte,
achte auf deine Worte, denn irgendwann sind sie Taten,
achte auf deine Taten, denn irgendwann sind sie Gewohnheiten,
achte auf deine Gewohnheiten, denn irgendwann sind sie deine Persönlichkeit,
achte auf deine Persönlichkeit, denn irgendwann ist sie dein Schicksal.«
Anonymus
»Man kann das Leben entweder hinnehmen oder ändern.
Was nicht hinnehmbar ist, muss verändert werden.
Und was sich nicht verändern lässt, muss man hinnehmen.«
Winston Churchill
Prolog
Es heißt ja, dass kein Mensch eine Insel ist, aber glauben Sie mir, Eloise Elliot war eine.
Nicht, dass sie das groß gestört hätte, schließlich legte sie auch gar keinen Wert auf soziale Kontakte.
Allerdings war es heute Abend anders.
Es war nämlich ihr dreißigster Geburtstag, und abgesehen von einigen Sachbearbeiterinnen war niemand zu dem Umtrunk gekommen.
Niemand vom Vorstand, für den sie sich krummschuftete. Niemand aus der Redaktion, Kollegen, mit denen sie nun seit drei mörderischen Jahren Seite an Seite arbeitete. Ja, nicht einmal die – sehr – wenigen Mitarbeiter, die sie zwar nicht direkt als Freunde einstufte, die aber wenigstens nicht mit Möbelstücken nach ihr warfen.
Stattdessen hatten nur zwei junge Frauen aus der Buchhaltung, gefolgt von einer neuen Praktikantin, die Köpfe zur Tür hereingesteckt. Die drei hatten sich sofort miteinander verbündet und ausführlich über die gestrige Folge von X Factor gefachsimpelt. Sie hatten sich zwar verlegen bemüht, das Geburtstagskind in ihre Unterhaltung miteinzubeziehen, Eloise hatte es allerdings nicht übers Herz gebracht, ihnen zu erklären, dass sie den Fernseher zu Hause nur einschaltete, um sich die Nachrichten auf BBC oder SKY anzuschauen, und auch das nur, um sicherzugehen, dass sie auch kein aktuelles Ereignis verpasst hatte. Immerhin waren sie ja so nett gewesen, der Einladung zu folgen.
Und so verbrachte Eloise Elliot ihren dreißigsten Geburtstag im Konferenzraum der Post damit, inmitten Tabletts voller Häppchen mit Ei und Kresse, die sich bereits an den Rändern wellten, aufgesetzten Smalltalk mit mehr oder weniger wildfremden Frauen zu betreiben. Hinzuzufügen ist, dass alle sich mit der Begründung, dass sie am nächsten Tag früh aufstehen müssten, bald verdrückten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollten sie in Wirklichkeit jedoch nichts wie raus, sobald der Gratisalkohol zur Neige ging.
»Möchtest du tatsächlich keinen Windbeutel mehr?«, fragte Eloise eine Blondine mit Smileygesicht, deren Namen sie nicht richtig verstanden hatte. »Ihr könnt jetzt nicht verschwinden, schaut euch nur die Mengen von Essen an! Ihr müsst mir helfen, wenigstens einen Teil davon zu vertilgen.«
»Äh«, stammelte die Blondine und warf den anderen einen hilfesuchenden Blick zu. »Tja ... ich würde ja gern, aber weißt du ... ich habe morgen in aller Herrgottsfrühe ein Meeting und muss wirklich los ...«
»Ja, ich auch, es ist schon so spät«, stimmte ihre Freundin Isabelle ein, eine hochgewachsene Modelschönheit, an die Eloise sich vage aus der Kantine erinnerte.
»Ihr wollt doch sicher vorher noch ein Stück vom Geburtstagskuchen!«, drängte Eloise, wobei sie sich bemühte, den leicht hysterischen Unterton in ihrer Stimme zu unterdrücken. Allerdings nicht sehr erfolgreich.
»Ich kann nicht. Leider wohne ich schrecklich weit weg, und wenn ich meinen Bus verpasse ...«
»Und was ist mit dir?«, wandte sich Eloise an die neue Praktikantin, die, soweit sie wusste, Susan hieß, und hielt ihr ein Vanillecremeteilchen unter die Nase.
»Oh ... äh ... vielen Dank«, antwortete Susan, die Einzige, die ein wenig mit Eloise mitzufühlen schien, höflich. »Aber ich muss mich wirklich sputen. Es war ein langer Tag ...«
Schlacht verloren, dachte Eloise. Zeitverschwendung, sie zum Bleiben aufzufordern. Stattdessen blickte sie den dreien nach, wie sie auf ihren viel zu hohen Absätzen aus dem Büro zu den Aufzügen staksten. Ihr fiel auf, dass sie mit jedem Meter Abstand ausgelassener wurden.
»Was haltet ihr von Lanagan’s auf einen kurzen Absacker, Mädels?«, hörte sie die Blondine, die irrtümlich glaubte, weit genug entfernt zu sein, deutlich sagen. Lanagan’s war der Pub gegenüber und sehr beliebt bei allen, die nach Feierabend noch dringend einen Drink brauchten.
»Oh ja, bitte«, sagte Susan. »Ich habe mich noch nie so nach einem Gin Tonic gesehnt wie nach dieser Veranstaltung.
»Ich dachte, sie würde uns gar nicht mehr gehen lassen.«
»Nun, wenigstens waren wir dort.«
»Wir sind eben unverbesserliche Gutmenschen und hätten uns eine Ausrede einfallen lassen sollen wie die anderen.«
Da dann der Aufzug kam, konnte Eloise den Rest nicht mehr belauschen.
Also gut, dachte sie. Das war also der Anfang eines neuen Jahrzehnts. Nur, dass es bis jetzt eher den Eindruck eines wahr gewordenen Albtraums machte.
Eigentlich hatte Eloise gar keine Lust auf eine Feier gehabt, keine Zeit, vielen Dank auch. Aber schließlich war sie ja dafür berüchtigt, keine zwischenmenschlichen Kontakte zu pflegen, solange sie nicht beruflich bedingt waren und wirklich kein Weg daran vorbeiführte. Und selbst dann kam sie als Letzte, ging als Erste, klammerte sich in der Stunde ihrer Anwesenheit ungeduldig an ihr Wasserglas und fragte etwa alle zehn Minuten die Mails auf ihrem iPhone ab.
Gut, sie hatte sich auf der Weihnachtsfeier blicken lassen, hauptsächlich deshalb, weil ihr nichts anderes übriggeblieben war. Immerhin war sie die Chefin hier, und selbst sie wusste, dass ihr Fernbleiben einen miserablen Eindruck gemacht hätte. Aber im Grunde genommen war sie ihre eigene beste Freundin und mit diesem Zustand auch völlig zufrieden. Sie war eine Insel, und Beliebtheit war nun einmal ein Thema, für das Inseln sich nicht zu interessieren brauchten. Eine Einstellung, die, als sie so an einem leeren Schreibtisch zwischen vielen Reihen unberührter Weingläser saß, recht nützlich sein konnte.
Geistesabwesend nestelte sie an der Schnur eines kitschigen rosafarbenen Ballons mit der Aufschrift Happy Birthday herum, der neben ihr in der Luft schwebte. Und dabei gestattete sie sich zum ersten Mal seit Jahren einen seltenen Moment der Selbstreflexion.
Willkommen in meinem Leben, dachte sie. Dreißig Jahre alt und absolut allein. Keine Freunde. Kein Mann. Keine Kollegen, die – welch anmaßender Wunsch – freiwillig ihre Zeit mit mir verbringen wollen. Einfach niemand. Natürlich hatte sie eine Familie, die sie allerdings so selten sah, dass sie kaum eine Rolle spielte. Da war eine Mutter, die inzwischen in einer Doppelhaushälfte in Marbella wohnte, ihre Sonnenbräune pflegte und die besorgniserregende Angewohnheit entwickelt hatte, tagsüber zu trinken. Doch trotz der wöchentlichen Telefonate und der zahlreichen Einladungen, »einfach in den nächsten Flieger zu steigen und ein bisschen Sonne zu tanken«, besuchte Eloise sie nur zu Weihnachten. Wenn überhaupt. Sie hatte noch eine jüngere Schwester namens Helen, aber die war vor einigen Jahren nach Cork gezogen. Außerdem war es zwischen ihnen eine unausgesprochene Übereinkunft, dass sie eigentlich nichts gemeinsam hatten, weshalb sie nur selten miteinander redeten, und auch das nur aus Gründen der Höflichkeit.
Offen gestanden störte es Eloise nur selten, dass sie keine Freunde hatte, denn wie kann man etwas vermissen, das man ohnehin nicht kennt? Das ging schon seit der Grundschule so, als sie immer Klassenbeste gewesen und von den anderen Kindern, mies und grausam, wie Kinder eben sind, ausgegrenzt und gemobbt worden war. Wer wollte schon mit einem Mädchen befreundet sein, das den Lehrern ständig damit in den Ohren lag, dass es mehr und schwierigere Hausaufgaben aufbekommen möchte?
Und so wuchs sie, was nicht überraschend war, sehr unabhängig auf und brauchte eigentlich keine anderen Menschen. Schließlich war sie mit ihrem Beruf verheiratet, ja, sie und ihr Beruf waren eins. Übrigens war sie auch die jüngste Chefredakteurin, die die Post jemals beschäftigt hatte, und konnte das sogar mit einigen stressbedingten Magengeschwüren belegen. Innerhalb weniger Jahre hatte sie nicht nur die Auflage verdreifacht, sondern dem Blatt auch eine neue Leserschaft erschlossen. Morgens war sie die Erste am Schreibtisch, abends die Letzte, die ging, denn sie war keine Frau für beschauliche Stunden, Freunde, Familie oder geselliges Beisammensein. Niemals. Tut mir leid, keine Zeit.
Im Laufe der Jahre war sie von vielen Kollegen darauf angesprochen worden, warum sie so besessen von ihrem Beruf sei. Doch Eloise empfand solche Fragen, als hätte sich jemand erkundigt, warum sie sich überhaupt die Mühe machte, Luft zu holen. Sie liebte ihren Job, weil er sie beflügelte und ihrer Seele Nahrung gab wie sonst nichts anderes auf der Welt. Deswegen hatte sie nichts dagegen, oft noch länger in der Redaktion zu sitzen. Und darum begriff sie einfach nicht, wieso ihre Mitmenschen sich nicht mit dem gleichen Elan ins Zeug legten.
Kein Wunder, dass die Leute nicht mit ihr warm wurden. Hinter ihrem Rücken hatten ihre Untergebenen bereits einige Spitznamen für sie erfunden, von denen sich allerdings keiner hielt, da allein der Satz »Eloise Elliot möchte Sie sofort in ihrem Büro sehen« eine einschüchternde Wirkung hatte. Schnörkellos, geradeheraus und absolut ausreichend, damit jeder bedauernswerte Mitarbeiter erbleichte und zitternd verstummte.
Allerdings musste man ihr fairerweise zugutehalten, dass sie auch viele Anhänger hatte, die sie für die beste lebende Blattmacherin hielten. Für eine moderne Feministin des einundzwanzigsten Jahrhunderts, die Journalisten dazu ermutigte, die Leserschaft in regelmäßigen Abständen vor den Kopf zu stoßen. Außerdem schrieb sie bissige Leitartikel, die in bildungsbürgerlichen Kreisen zur Pflichtlektüre geworden waren.
Obwohl man hinzufügen muss, dass die meisten Fans von Eloise sie nicht persönlich kannten und ihr noch nie begegnet waren.
Und wie war sie eigentlich? Eloise gab nur selten Interviews oder tat etwas für ihr Image. Bei der jüngsten Verleihung des Preises »Vorbildlichste Geschäftsfrau des Jahres« hatte ein tapferer Journalist gewagt, sie zu fragen, wie sie mit den Gerüchten zurechtkäme, dass sie bei der Post unbeliebt sei. Jeder andere hätte auf diese Unverblümtheit konsterniert reagiert, nicht aber Eloise.
»Ich bin noch jung«, erwiderte sie achselzuckend. »Und ich habe eine der exponiertesten Stellungen in der Zeitungsbranche dieses Landes inne. Natürlich führt das zu Missgunst. Damit muss man leben.«
Allerdings hat das Schicksal die unangenehme Angewohnheit, sich sogar in das wohlgeordnete Leben der erfolgreichsten Menschen einzumischen. So auch offenbar bei Eloise.
Eigentlich wäre es gar nicht so schlimm gewesen, denn dieses grässliche Geburtstagstheater hatte als ganz gewöhnlicher und normaler Arbeitstag angefangen. Genauso hätte es auch bleiben sollen, denn von kitschigen Luftballons mit der marktschreierischen Aufschrift Du bist dreißig!, kombiniert mit einem billigen Sandkuchen, hätte sie vermutlich Ausschlag bekommen. Das Problem war nur, dass ihr Redaktionsleiter, ein reizender, jungenhafter Mann, sich gewaltige Mühe gegeben hatte, um diesen jämmerlichen Umtrunk anlässlich des meilensteinhaften Geburtstagsdatums zu organisieren. Vermutlich hauptsächlich getrieben von irregeleitetem Pflichtgefühl.
Auch wenn das Eloise ganz und gar nicht in den Kram passte, hatte sie gute Miene zum bösen Spiel gemacht – wenn auch mit der Begeisterung einer Geisel, der man eine Pistole an den Kopf hält.
Herausgekommen war eine absolute Katastrophe. Den ganzen Tag lang war ihr ausgeklügelter Terminplan ständig davon unterbrochen worden, dass Leute, die sie kaum kannte und auch nicht sonderlich mochte, anriefen, um ihre Teilnahme an fraglichem Umtrunk aus verschiedenen, nicht sehr glaubwürdigen Gründen abzusagen.
Die mieseste Ausrede lautete wie folgt: »Ich wünsche dir eine schöne Geburtstagsfeier und würde gern dabei sein, aber, weißt du, ich habe versprochen, meinen Dad im Krankenhaus zu besuchen. Ihm geht es nämlich nicht gut, und es müssen einige Untersuchungen gemacht werden ... «
Diese Begründung war es, die für Eloise das Fass zum Überlaufen brachte. Als ihr Vater vor einigen Jahren gestorben war, hatte sie am folgenden Morgen um sechs am Schreibtisch gesessen und war pünktlich auf die Minute zur ersten Redaktionssitzung des Tages erschienen. Gefasst und absolut professionell, ganz gleich, wie sehr es ihr auch das Herz gebrochen haben mochte.
Und dann war ausgerechnet der arme abgehetzte Redaktionsleiter, der den ganzen Tag hinter Eloises Rücken auf ihre Kollegen eingeredet und sie angefleht hatte, doch wenigstens für ein paar Minuten bei ihrer Geburtstagsfeier vorbeizuschauen, mit besorgter Miene in ihr Büro gekommen, um ihr mitzuteilen, dass er leider auch absagen müsse, weil bei seiner Frau verfrüht die Wehen eingesetzt hätten. Eloise konnte nur noch die Augen zur Decke verdrehen.
Und da stand sie nun. Allein mit etwa zweihundert unverzehrten Cocktailwürstchen von Marks & Spencer und im Stich gelassen von ihren »Gästen«, von deren hastiger Flucht nur noch eine Staubwolke zeugte. Und es war erst halb neun.
Eine schwächere Frau als sie wäre wohl verzweifelt gewesen und hätte sich gezwungen gesehen, ihr Leben einer Bestandsaufnahme zu unterziehen. Sie hätte sich gefragt, warum niemand privat Zeit mit ihr verbringen wollte und sich kein Mensch für ihren Geburtstag interessierte oder wer sie ... nein, so etwas durfte sie nicht einmal denken ... wirklich gernhatte. Aber nicht Eloise.
Erstaunlicherweise eilte sie an diesem desolaten Abend anders als sonst nicht einmal zurück an ihren Schreibtisch, um die versäumte Zeit nachzuarbeiten. Stattdessen blieb sie, tief in Gedanken versunken, im leeren Konferenzraum zurück. Dabei darf man nicht vergessen, dass sie eine Frau war, die nur selten Gefühle zeigte und sich seit ihrer frühesten Kindheit nicht mehr öffentlich hatte gehen lassen.
Plötzlich hatte sie ihr künftiges Leben vor sich, und zwar so deutlich, als wäre es bereits Vergangenheit. Glasklar sah sie sich mit vierzig und dann mit fünfzig, bis hinein ins Rentenalter. Immer noch als Chefredakteurin, immer noch achtzehn Stunden täglich im Büro und immer noch allein. Und Jahr für Jahr tat sie so, als feiere sie bei lauwarmem Sekt einen Tag, der ihr eigentlich nichts bedeutete, inmitten von Fremden, in deren Mienen sich ein Ausdruck malte, der sie inzwischen überallhin verfolgte: eine Mischung aus Mitleid und Grauen.
Manchmal erkennen wir die wichtigsten Momente unseres Lebens erst, wenn sie schon längst vorbei sind, doch nicht Eloise. Es war zwar nur schwer vorstellbar, dass dieser traurige Abend ihr ganzes wohlgeordnetes Leben verändern sollte, aber genau das würde geschehen.
Wenn sie viele Jahre später zurückblickte, würde sie diesen Moment als denjenigen benennen, in dem der Himmel ihr etwas ins Ohr geflüstert und sie plötzlich genau gewusst hatte, was zu tun war: Sie musste ihr Leben ändern und das Problem lösen. Denn genau so stellte es sich für einen Menschen mit ihrem scharfen mathematischen Verstand dar: als Problem, das gelöst werden musste wie eine Gleichung.
Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen – genau das sollte auch passieren.
Und so wischte sich Eloise Elliot, erfüllt von der blendenden Klarheit, die man nur an den Scheidewegen des Lebens empfindet, die brennenden, geröteten Augen ab, holte tief Luft und traf eine der schnellen, vernünftigen und rationalen Entscheidungen, für die sie berühmt war.
Es war Zeit, die Ärmel hochzukrempeln.
Teil eins
Eloise
Kapitel eins
Knapp vier Jahre später
Nicht heute. Bitte nicht heute. Ich kann gar nicht sagen, wie wenig ich das heute gebrauchen kann.
Obwohl es kaum halb sechs Uhr morgens ist, droht mein Leben aus den Fugen zu geraten, etwas, das in letzter Zeit mit beängstigender Häufigkeit geschieht. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als ich versuche, mich im Morgengrauen aus dem Haus zu schleichen, denn Elka, mein polnisches Kindermädchen, sucht sich ausgerechnet diesen verflixten Tag aus, um mir eine Szene zu machen.
Ich pirsche mich also barfuß nach unten, um ja niemanden zu wecken, wohl wissend, dass ich zu spät zur morgendlichen Redaktionssitzung kommen werde, ohnehin kein guter Start in den Tag. Im nächsten Moment kommt Madam, noch im Morgenmantel, aus ihrem Zimmer marschiert und bittet nicht etwa um ein »kurzes Gespräch«, sondern fordert es ein.
»Äh ... ja, natürlich, Elka«, antworte ich. Sofort schwant mir Übles, und ich senke die Stimme zu einem Flüstern, um Lily nicht zu stören.
Lily ist übrigens meine kleine Tochter, knapp drei Jahre alt und der Sonnenschein im Leben ihrer abgekämpften und erschöpften Mummy.
»Ist alles in Ordnung?«, frage ich, beiße mir auf die Zunge und mache mich auf das Schlimmste gefasst. Elka ist bis jetzt das einzige Kindermädchen, das Lily vergöttert. Ihr zuliebe benimmt sie sich sogar, und Elka scheint sie wirklich gernzuhaben.
»Ich muss reden mit dir, und ich dich sehe nur um diese verrückte Uhrzeit«, verkündet sie in ihrem noch immer gebrochenen Englisch. Und das, obwohl ich in den letzten Monaten ein kleines Vermögen in Hörbücher und Privatunterricht investiert habe.
Bitte sag jetzt nicht, dass du gehst ... bitte, lieber Gott, mach, dass nicht wieder eine verschwindet ...
»Schieß los, Elka«, erwidere ich äußerlich ruhig, obwohl mir davor graut, was nun als Nächstes kommt.
»In Vertrag steht, dass du mich bezahlst für aufpassen Lily«, fährt sie in anklagendem Ton fort. »Aber du musst verstehen, dass das vernünftige Stunden heißt.«
»Du meinst, vernünftige Arbeitszeiten«, antworte ich. »Dürfte ich wissen, wie du plötzlich darauf kommst?«
»Du hast Nerven, mich zu fragen das.«
»Pst! Geht das auch ein bisschen leiser? Sonst wacht Lily auf.«
»Ich großes Problem mit den Arbeitszeiten, die du von mir verlangst. Meine Freundinnen, die auch Kindermädchen sind, müssen alle nicht arbeiten so lange wie ich.«
»Aber, Elka, so viel arbeitest du nun auch wieder nicht ... zumindest nicht verglichen mit mir ...«
»Schau auf Uhr! Halb sechs! Und schon willst du ins Büro, und ich muss mich um Lily kümmern. Eigentlich solltest du abends um sieben zu Hause sein, und ich habe frei, aber das bist du nie. Nie!«
Gut, dazu fällt mir im Moment nichts ein, denn das Mädchen hat recht. Theoretisch war vereinbart, dass ich abends gegen sieben eintrudle und Elka Feierabend macht ... doch in letzter Zeit ist es immer ein klein wenig später geworden. Elf vielleicht. Oder sogar Mitternacht.
»Alle anderen Kindermädchen haben abends frei! Sie sich treffen für Bier oder Kino. Alle haben Spaß in Irland. Aber ich nicht! Nie habe ich Spaß. Ich habe satt, mir reicht es!«
»Pst! Elka, bitte sprich leiser«, raune ich ihr zu, aber Madam will nichts davon wissen. Stattdessen steigert sie sich in einen Wutanfall hinein und ist nicht mehr zu bremsen.
»Nein, du hörst mir jetzt zu. Wegen dir ich muss so lange arbeiten ... es ist zu viel, und ich will kündigen!«
»Ich verstehe dich ja, aber darf ich dich daran erinnern, dass mein Beruf das eben so mit sich bringt?«, versuche ich sie so gut wie möglich zu beruhigen, wohl wissend, dass sie mich in der Hand hat. Denn wenn sie geht ... oh, mein Gott, ich wage gar nicht, daran zu denken. »Wenn dir meine Arbeitszeiten nicht gefallen, Elka, dann ... dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Ich kann nichts dagegen tun, und glaube mir, ich arbeite genauso ungern bis in die Nacht hinein wie du. Wenn du also einen Schuldigen suchst, beschwer dich bei den Politikern der Eurozone und der Weltwirtschaftskrise ... oder beim arabischen Frühling im Nahen Osten, für den ich nun wirklich nichts kann.«
»Ich verstehe nicht ... du darfst nicht so schwierige Wörter benutzen.«
Noch einmal tief durchatmen.
»Es tut mir leid, Elka«, spreche ich so ruhig wie möglich weiter. »Aber wenn etwas Wichtiges passiert, muss die Chefredakteurin da sein und sich darum kümmern. Das ist mein Leben, und dir war das bekannt. Nachrichten machen keinen Feierabend, und deshalb kann ich es auch nicht tun. Ich habe dir das beim Vorstellungsgespräch klipp und klar gesagt.
Darf ich dich außerdem darauf hinweisen, dass ich dich gut bezahle und dass du bei mir mehr verdienst als die anderen Kindermädchen? Wenn es allerdings«, füge ich fröhlich hinzu, »um eine weitere Gehaltserhöhung geht, können wir später gerne darüber reden.«
Nein, nicht einmal das überzeugt sie. Ich könnte genauso gut mit der Wand sprechen.
»Du arbeitest zu lang, und das nicht nur schlecht für mich, sondern auch für Lily«, entgegnet sie. Der Rabenmuttertrumpf, der älteste Trick, um einer berufstätigen Mutter ein schlechtes Gewissen einzuimpfen.
»Sie vermisst ihre Mama so sehr, wenn du bist weg. Dauernd sie mich fragt, wann Mama nach Hause kommt.«
»Aber Elka, das ist einfach lächerlich und außerdem sehr kränkend ...«
»Sogar Wochenende arbeitest du, anstatt zu sein bei ihr. Immer nur Arbeit.«
Das war ein Seitenhieb in einer immer hitziger werdenden Debatte, der mir im ersten Moment die Sprache verschlägt. Ja, natürlich würde ich gern vierundzwanzig Stunden am Tag mit Lily verbringen. Wer würde das nicht? Doch wie soll ich das hinkriegen? Kurz muss ich an ihr erstes Lebensjahr denken, in dem ich es irgendwie geschafft habe. Ich war das ganze Wochenende zu Hause und habe es meistens sogar zustande gebracht, verhältnismäßig früh aus der Redaktion zu kommen. Deshalb hielt ich es für möglich, die beiden Welten miteinander zu vereinbaren. Ich konnte Superwoman sein. Arbeitszeit und Privatleben waren perfekt ausbalanciert, und ich kann aufrichtig sagen, dass ich noch nie im Leben so glücklich gewesen war wie damals. Bei Weitem.
Aber dann kam die Rezession und mit ihr der Arbeitsplatzabbau, und Schluss war es mit der Idylle. Plötzlich hatte ich die Wahl, für dasselbe Gehalt für drei zu arbeiten oder meinen Hut zu nehmen. Pech gehabt. Ich stand vor einem unlösbaren Dilemma. Denn sosehr ich Lily auch anbete, ist mir mein Beruf ausgesprochen wichtig. Gegen meine neuen Arbeitszeiten kann ich nicht viel tun, außer zu kündigen. Und wenn ich schonungslos Bilanz ziehe, weiß und akzeptiere ich, dass ich ein Mensch bin, der ohne beruflichen Erfolg als Seelennahrung in weniger als einer Woche verrückt werden würde. Ja, es ist etwas Tolles, Mutter zu sein, doch das gilt auch für meinen Job. Warum also kann ich nicht beides haben?
Allerdings habe ich in der Redaktion klare Grenzen gesetzt und allen unmissverständlich mitgeteilt, dass meine Sonntage mit Lily heilig sind. Es ist der einzige Tag in der Woche, an dem ich Gelegenheit habe, ihr vorzulesen, ihr zum Frühstück Pfannkuchen zu machen, mit ihr im Kino einen Disney-Film anzuschauen oder im Park die Enten zu füttern. Sie also nach Strich und Faden zu verwöhnen und eine richtige Mummy zu sein.
Doch ich muss zugeben, dass Elka recht haben könnte, durch den letzten Stellenabbau wurde nämlich sogar die kostbare Mummyzeit am Sonntag stark in Mitleidenschaft gezogen. Nehmen wir zum Beispiel letzte Woche. Ich hatte Lily ihr Frühstück gemacht und spielte Teetrinken mit der kleinen Armee von Puppen, die ich ihr geschenkt hatte. Gerade wollte ich mit ihr in den Spielzeugladen fahren, um ihr eine kleine Freude zu bereiten, als die Redaktion anrief. Ich müsse sofort kommen, denn es sei wegen der neuen Entwicklungen in Afghanistan eine Notfallsitzung anberaumt worden. Was hätte ich tun sollen? Ich musste einfach hin. Das gehört zu meinem Beruf dazu.
Auch wenn ich es mir vielleicht nicht anmerken lasse, liebe ich meine kleine Lily so sehr, dass es mir fast körperliche Schmerzen bereitet, von ihr getrennt zu sein. Herrje, ich fühle mich ohnehin schon schuldig genug und habe es deshalb nicht nötig, mir das von jemandem, den ich bezahle, auch noch unter die Nase reiben zu lassen.
»Ich habe einen Vorschlag, Elka«, sage ich ruhig und mit so tiefer Stimme wie möglich, weil ich gelernt habe, dass man auf diese Weise Konflikte am besten aus der Welt schafft. Und damit sollte ich mich eigentlich auskennen, schließlich habe ich im Laufe meines Lebens so einige Klippen umschifft. »Ist es zu viel verlangt, wenn ich dich bitte, einfach deine Arbeit zu machen und mich meine machen zu lassen? Wenn ich heute Abend nach Hause komme, haben wir Zeit, ausführlich darüber zu reden. Was meinst du?«
Aber Madam hat keine Lust, vernünftig zu sein.
» ... und wie ich zu den anderen Kindermädchen sage, hast du keinen Mann und keinen Freund, sondern bist verheiratet mit deiner Arbeit.«
Und ... peng.
»Verzeihung, was war das gerade?«
» ... alle anderen Kinder, die ich kenne, haben Mutter und Vater, nur Lily nicht. Sie hat nur Mutter. Also muss Mutter mehr für sie da sein. Viel, viel mehr.«
Gut, das hat sich jetzt angefühlt wie eine kräftige Ohrfeige, die so wehtut, dass ich im ersten Moment wie erstarrt bin. Und daher fauche ich sie an, sobald ich wieder zu mir komme. In letzter Zeit fauche ich sowieso alle nur noch an. Doch das ist nun mal das Ergebnis, wenn man immer und dauernd erschöpft ist und unter Stress steht.
»Elka, ich habe dir von Anfang an erklärt, dass ich alleinerziehend bin«, entgegne ich spitz. »Ich habe damit kein Problem und Lily auch nicht. Falls es dich stört, hättest du mir das gleich sagen sollen.«
»Alleinerziehende Eltern müssen mehr Zeit für ihre Kinder haben, nicht weniger.«
So, inzwischen koche ich vor Wut. Denn sie hat mit der Treffsicherheit einer Fliegerbombe genau meinen wunden Punkt erwischt. Ja, ich bin alleinerziehend, und ja, das kann auch gewaltige Nachteile haben. Aber ich vertrete die Einstellung, dass ich damit irgendwie klarkommen muss. Lilys Vater ist ein Tabuthema. Und zwar für immer und ewig.
Ich darf gar nicht daran denken, wie viel Geld ich Elka jeden Monat in den Rachen werfe. Und wofür? Dafür, dass sie sich hinstellt, Werturteile über mein Leben fällt und mich demütigt, bis ich mich so klein mit Hut fühle? Damit sie den ganzen Tag mit einem knapp dreijährigen Mädchen spielen kann? Glaubt sie denn, ich würde nicht sofort zugreifen, wenn sich mir die Gelegenheit böte, dass ich zu Hause bleibe und Vollzeitmutter werde? Ist ihr nicht klar, dass es sich jedes Mal anfühlt wie ein Schlag in die Magengrube, wenn ich Lilys Blondschöpfchen zum Abschied küsse? Am schlimmsten ist es, sich die vielen Nachrichten anzuhören, die sie auf meiner Mailbox in der Redaktion hinterlässt. Mit ihrem engelsgleichen Babystimmchen sagt sie immer wieder dasselbe. Ich vermisse dich, Mama. Wann kommst du nach Hause? Manchmal möchte ich sie einfach nur umarmen und ihr erklären, dass sie sich das Erwachsenwerden sparen soll. Es ist die Mühe nicht wert. Bleib einfach so. Bleib für immer mein kleines Mädchen.
Versteht denn niemand, wie sehr ich darunter leide, so vieles bei ihr verpasst zu haben? Ihre ersten Schritte. Die ersten Wörter ... nie bin ich dabei. Entweder sitze ich in einem Meeting, schreibe einen Leitartikel oder halte eine Pressekonferenz ab. Immer arbeite ich. Natürlich habe ich mich bewusst dafür entschieden, alleinerziehende Mutter zu werden. Ich wusste, dass sich in meinem Leben einiges verändern würde. Deshalb habe ich ja auch ein Kindermädchen, das im Haus wohnt, und außerdem noch zwei Ersatzbabysitter für Notfälle eingestellt. Nur, um mit ansehen zu müssen, dass eine nach der anderen das Handtuch warf. Und zwar aus denselben Gründen, die Elka nun umtreiben.
Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung vorbringen, dass ich keine Hellseherin bin. Woher hätte ich wissen sollen, dass sich meine Arbeitsbelastung wegen des massiven Stellenabbaus in den letzten beiden Jahren verdoppeln würde? Außerdem, so denke ich, inzwischen absolut gereizt und erschöpft, begreift Elka offenbar nicht, warum ich mir diesen Wahnsinn antue. Doch nur, um nicht den Verstand zu verlieren und um meiner kleinen Tochter so viel wie möglich bieten zu können. Es ist ja wohl nicht meine Schuld, dass ich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Nicht angesichts der Arbeitsleistung, die man von mir erwartet. Und ganz bestimmt nicht, solange meine Vertragsverlängerung, die in einem halben Jahr fällig wird, nicht in trockenen Tüchern ist. Nicht jetzt. Denn abgesehen von all den anderen Problemen, liegt auch in der Redaktion etwas im Argen, obwohl ich über solche Dinge eigentlich nur sehr ungern spreche.
Das Problem hat einen Namen, und zwar Seth Coleman, der neue Redaktionsleiter der Post.
Ach, Seth Coleman, wo soll ich anfangen? Er sitzt noch gar nicht so lange auf seinem Posten und wurde von Headhuntern von der Sunday Press abgeworben, als sein sympathischer Vorgänger die Post verließ. Ich habe den Verdacht, dass ich ihn vertrieben habe, und nun vermisse ich ihn mehr als meine rechte Hand. Sein offizieller Kündigungsgrund lautete »Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben«, und offen gestanden kann ich ihm daraus keinen Vorwurf machen. Wenn man mich offiziell nach meiner Meinung zu Seth fragt, lächle ich gekünstelt, lobe seine Führungsqualitäten und seine Branchenkenntnisse und füge hinzu, er sei stets beruflich sehr engagiert.
Doch unter der Dusche, inzwischen der einzige Ort, wo ich ein wenig Zeit für mich habe, beschimpfe ich Seth Coleman als scheinheiliges A ... mit übergroßem Ego. Er ist ein Vertreter nahezu sämtlicher Eigenschaften, die ich an der Spezies Mann verabscheue, und schafft es sogar, immer wieder neue Widerwärtigkeiten zu entwickeln. Mir gegenüber verhält er sich herablassend, aber ich weiß, wie sehr es ihn wurmt, eine Frau als Vorgesetzte zu haben. Und es geht das Gerücht um, dass er bereits an meinem Stuhl sägt.
Er ist die Missgunst in Person, merkt sich jeden meiner beruflichen Patzer und zählt sorgfältig meine Fehler, während er meine Erfolge unter den Tisch fallen lässt. Außerdem lästert er hinter meinem Rücken über mich, was mir natürlich prompt zu Ohren kommt: Seit Lilys Geburt hätte ich abgebaut und nicht mehr den Biss von früher. Außerdem identifizierte ich mich nicht mehr mit meinem Job. Man braucht mich nicht eigens darauf hinzuweisen, dass er auf Zeit spielt und nur darauf wartet, dass ich mir eine Blöße gebe. Und deshalb darf ich mir keine Schwäche erlauben.
Also tue ich, was nötig ist. Ich gehe in die Redaktion, mime die peitschenknallende Domina und verhalte mich so, wie man es von mir erwartet. Allerdings fällt mir das von Tag zu Tag schwerer, so sehr ich meinen Beruf auch liebe. Und dennoch ist der schönste Moment meines Tages, wenn ich nach Hause komme und das blonde Köpfchen meiner Tochter sehe, die, an ihren Lieblingsteddy gekuschelt, schlafend wie ein Engel in ihrem Bettchen liegt. Dann betrachte ich ihr niedliches sommersprossiges Gesicht und flüstere ihr zu, dass ich sie so sehr liebe und dass wir eines Tages mehr Zeit füreinander haben werden.
Aber nun zurück zu Elka, die immer noch auf dem Treppenabsatz steht und, beinahe ohne Luft zu holen, Gift und Galle spuckt.
»Lily ist wunderschöne kleine Mädchen«, schleudert sie mir entgegen, »und ich traurig bin, weil ich mich von ihr verabschieden muss. Doch die Zeiten, die du mich arbeiten lässt, sind verrückt. Verrückt! Und sie machen mich verrückt!«
»Entschuldige«, falle ich ihr ins Wort, da ich es nicht mehr aushalte. »Ich komme zu spät zur Arbeit. Können wir bitte später weiterreden?«
»Ich bin noch nicht fertig! Meine Freundinnen sagen, du musst mir eine Steuerbescheinigung über alle bisherigen Gehaltsansprüche ausstellen, bevor ich gehe.«
Interessant, denke ich spöttisch, während ich nach dem Autoschlüssel greife. Elkas Englisch ist so miserabel, dass sie im Supermarkt kaum zurechtkommt, und dennoch wirft sie locker mit beeindruckenden Wörtern wie »Steuerbescheinigung über alle bisherigen Gehaltsansprüche« um sich?
»Elka«, erwidere ich, um die Sache abzukürzen, denn inzwischen bin ich eine gute Viertelstunde zu spät dran. »Darf ich dich darauf hinweisen, dass du Lily schließlich nicht jeden und den ganzen Tag hüten musst? Sie ist gerade in den Kindergarten gekommen und täglich bis zum frühen Nachmittag dort, weshalb du gute fünf Stunden Pause hast. Außerdem erwartet niemand von dir, dass du auch noch Hausarbeit machst. Ich beschäftige eine Putzfrau, einen Gärtner und einen Hausmeister, die hier alles im Griff haben. Also verzeih mir, wenn ich finde, dass du verglichen mit vielen anderen Leuten ein ziemlich lockeres Leben führst.«
Doch der feuerspeiende Drache lässt sich nicht erweichen. Mit verschränkten Armen und zusammengekniffenen Augen steht sie da.
»Du hörst mir nicht richtig zu. Ich kündige. Ende der Woche bin ich weg. Tut mir leid, aber es ist Schluss.«
Mir bleibt nichts anderes übrig, als kurz zu nicken, der Versuchung zu widerstehen, die Haustür hinter mir zuzuknallen, und so ruhig wie möglich ins Auto zu steigen. Sie darf nicht merken, was für einen Magenschwinger sie mir gerade verpasst hat.
Als ich auf dem Weg zur Arbeit an einer roten Ampel halte, stelle ich fest, dass ich links ranfahren muss, denn plötzlich spüre ich ein Brennen in der Magengrube und bin machtlos dagegen, dass mir die Tränen kommen. Ja, da ist sie wieder, meine tägliche Panikattacke. Herrje, ich könnte beinahe die Uhr danach stellen. Und schon ist es da, das scheußliche, nicht zu unterdrückende Schluchzen, ausgelöst von Erschöpfung und Müdigkeit. Grund ist, dass ich mir seit ... oh, mittlerweile sieben Jahren ... keine Atempause gegönnt habe. Ich kann nichts dagegen tun.
Gütiger Himmel, noch nicht mal sechs Uhr morgens, verdammt, und ich werde beim bloßen Gedanken an den bevorstehenden Tag bereits niedergeschlagen.
Ich bin mir noch nie im Leben so zerrissen vorgekommen. Nicht nur in zwei Hälften, das heißt zwischen der Redaktion und zu Hause. Das würde ich schaffen, das wäre kein Problem. Die Sache ist nur, dass mein Job nicht einfach nur ein Job ist, sondern mit neunhundertneunundneunzig Unterjobs einhergeht, weshalb es sich so anfühlt, als würde aus tausend Richtungen an mir gezerrt. Und offen gestanden gibt es inzwischen viel zu häufig Momente, in denen ich nicht mehr weiß, wie lange das noch so weitergehen kann.
Ach, was zum Teufel ist nur los mit mir?, frage ich laut, während ich panisch meine Handtasche nach einem Taschentuch durchwühle. Bin das wirklich ich, Eloise Elliot, die sich hier so gehen lässt? Es gab einmal eine Zeit, in der ich genauso viel gearbeitet habe wie heute, ohne dass es mich belastet hätte.
Doch das war AL ... ante Lily ... inzwischen ist Eloise Elliot ein Schatten ihrer selbst, eine düstere Frau, die von Schuldgefühlen zerfressen wird. Denn heute Nachmittag wird ein knapp dreijähriges kleines Mädchen aus dem Kindergarten nach Hause kommen, übersprudelnd von Geschichten, die seine Mummy nie zu hören kriegen wird.
Und hinzukommt, dass ich kein Kindermädchen mehr habe. Wieder einmal.
Als im Autoradio die Sechs-Uhr-Nachrichten beginnen, weiß ich, dass dieser Anfall von unverzeihlichem Selbstmitleid jetzt ein Ende haben und ich mich dem neuen Tag stellen muss. Also reiße ich mich nach Kräften zusammen, nehme einen großen Schluck Rescue-Tropfen (der beste Freund einer Redakteurin), verteile mit zitternden Händen Make-up rings um meine verschwollenen und geröteten Augen und fahre weiter.
Unterwegs nehme ich mir so ruhig wie möglich vor, mir eine andere Kinderbetreuungsagentur zu suchen, und hinterlasse Rachel, meiner Assistentin, eine Nachricht, sie solle Vorstellungstermine vereinbaren, sobald sie im Büro ist. Allerdings ist das leichter gesagt als getan, denn die letzte Agentur, bei der ich war, hat mich vor etwa zwei Jahren rausgeschmissen. Ja, ganz richtig, ich bin es, die rausgeschmissen wurde. Natürlich brach daraufhin sofort der Dritte Weltkrieg aus. Ich warf den Leuten dort vor, sie würden viel beschäftigte, berufstätige, alleinerziehende Mütter diskriminieren, deren Job nun einmal diese abstrus langen Arbeitszeiten nötig mache. Die Retourkutsche bestand darin, mich als arbeitssüchtige Zwangsneurotikerin darzustellen, mit der kein Kindermädchen, das etwas auf sich hielte, unter einem Dach leben wolle.
Das tat zwar ein wenig weh, doch es gelang mir, mir nichts anmerken zu lassen. In meiner Branche ist ein Pokerface ein absolutes Muss.
Um Viertel nach sechs haste ich aus der Tiefgarage des Redaktionsgebäudes der Post nach oben, inzwischen die einzige sportliche Betätigung, für die ich noch Zeit finde.
Allerdings ist diese Schinderei in der Zeitungsbranche mittlerweile Normalzustand, denn seit der Rezession ist unsere Auflage in den Keller gefallen. Das ist auch ein Grund für schlaflose Nächte, wenn man zufällig Chefredakteurin ist, deren Arbeitsvertrag noch in diesem Geschäftsjahr zur Verlängerung ansteht.
Das Problem ist, dass den Leuten der Geldbeutel nicht mehr so locker sitzt wie früher. Marktforschungsanalysen zufolge haben die Leser, die in besseren Zeiten zum Zeitungskiosk gegangen sind, um nicht nur ihre tägliche Ausgabe der Post, sondern, je nach Lust und Laune, auch einen Kaffee zum Mitnehmen oder Zigaretten zu kaufen, so massiv zu sparen angefangen, dass sie nun auf kostenlose Nachrichtenquellen wie das Fernsehen, das Radio oder das Internet zurückgreifen.
Und was habe ich getan? Das Einzige, was ich kann. Ich habe die Herausforderung angenommen. Um dieser beunruhigenden Tendenz die Stirn zu bieten, habe ich stark in unsere Online-Ausgabe investiert, die im Grunde genommen noch in den Kinderschuhen steckt. Sie schlägt sich zwar recht wacker, ist aber nicht der große Knaller, auf den ich gehofft habe. Ein Punkt, auf den Seth Coleman mich regelmäßig hinweist. Außerdem habe ich einige Topjournalisten von Konkurrenzblättern abgeworben, damit sie für ein Erpresserhonorar stattdessen für uns schreiben. Auch das hat den Negativtrend ein wenig aufgehalten. Kommentatoren, Nachrichtenleute und Autoren mit hohem gesellschaftlichem und politischem Bekanntheitsgrad sind jeden Penny wert, den ich ihnen bezahle.
Denn, wie ich gegenüber dem Verlagsvorstand, vor dem ich mich letztlich verantworten muss, immer wieder leidenschaftlich beteuere, hat sich die Welt der Nachrichten verändert. Ob es uns nun gefällt oder nicht, Nachrichten sind im Gegensatz zu früher nicht mehr das exklusive Vorrecht der Zeitungen, sondern überall zu haben. Jeder Idiot, der ein Handy besitzt, kann sich bei Twitter einklinken und eine Geschichte schneller verbreiten als wir. Und, glauben Sie mir, das geschieht ständig. Wer keine Zeitung kaufen will, schaut sich die Nachrichten auf SKY an, wo sich die Ereignisse auf dieser Welt pünktlich zu jeder Stunde vor seinen Augen entfalten. Eine Zeitung, die jeden Abend um elf in den Druck geht und alle Vorfälle während der Nacht ausblendet, ist nur fünf Stunden später beinahe überholt und hat etwas reizend Altmodisches an sich.
Ich habe mich Tag und Nacht krummgeschuftet, um diesem Problem durch unsere Online-Ausgabe entgegenzuwirken. Doch Nachrichten schlafen nicht, weshalb die Tatsache, dass wir irgendwann einen Schlussstrich ziehen und drucken müssen, weiterhin die Wurzel allen Übels ist.
Allerdings wird es inzwischen immer schwieriger, unserem Vorstand, der ausschließlich männlich ist und ein Durchschnittsalter von fünfundsechzig Jahren hat, das Geld dafür abzuschwatzen. Ich nenne sie die Tyrannosaurier, da sie mich wirklich an Relikte aus einer längst vergangenen Ära erinnern, in der in einer Zeitungsredaktion nur das laute Geklapper klobiger mechanischer Schreibmaschinen zu hören war. Aus einer Zeit, in der Chefredakteure noch angesäuselt von ausgiebigen und alkoholgeschwängerten Geschäftsessen zurückkehrten, bei denen sie Bellinis und Wein in sich hineinschütteten und dicke Spesenkonten hatten, um Anzeigekunden zu bewirten. Wenn sie dann am späten Nachmittag sturzbetrunken in die Redaktion gewankt kamen, zuckte niemand mit der Wimper.
Das war eine andere Epoche, die Blütezeit der Zeitungsbranche. Offen gestanden fühle ich mich inzwischen manchmal wie die tapfere Nachhut, die für den Erhalt eines sterbenden Mediums kämpft. Das Internet hat mittlerweile sogar schon die Regenbogenpresse überflügelt. Mit jedem Tag wächst mein Eindruck, dass ich einen Öltanker durch ein Minenfeld steuere und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Presse ausstirbt.
Der Vorstand stuft unterdessen allein das nackte Überleben schon als Erfolg ein, was meiner Ansicht nach nicht ausreicht, zumindest nicht in diesem Klima. Und dennoch klammern sich die Vorstandsmitglieder an die altmodische Auffassung, dass die Post ein Hort der Tradition ist, ohne den uns der Himmel auf den Kopf fallen wird. Das mag einmal so gewesen sein, heute aber eindeutig nicht mehr. Die Zeiten ändern sich, und wenn wir uns nicht mit ihnen ändern, werden wir zugrunde gehen. So einfach ist das.
Noch schlimmer ist, dass eine weitere Entlassungswelle in der Luft liegt. Bald drohen wieder Stellenkürzungen, und wieder wird man einige Leute auffordern, für viel weniger Geld und in einer Dreitagewoche genau dieselbe Arbeit zu erledigen wie bisher. Und das sind noch die, die Glück haben, schließlich behalten sie ihren Job und haben eine Chance, weiter die Raten fürs Haus und das Schulgeld zu bezahlen und von den im schwindelerregenden Tempo steigenden Lebenshaltungskosten nicht abgehängt zu werden. Was wird aus denen, die ohne viel Federlesen vor die Tür gesetzt werden und von denen man nie wieder etwas hört?
Oh Gott, denke ich. Bei der bloßen Vorstellung, dass die Tage einiger Kollegen, denen ich tagtäglich auf dem Flur begegne, gezählt sein könnten, wird mir ganz flau. Und was noch schlimmer ist: Ich bin die Einzige, die verhindern kann, dass sie in der Schlange auf dem Arbeitsamt landen. Auch wenn sie es nicht ahnen, hängt ihr Überleben einzig und allein von mir ab. Dieser Druck ist manchmal unerträglich.
Ich weiß, dass ich recht unangenehm werden kann, wenn nicht jemand so auf Zack ist, wie er sein sollte, wenn er nicht so fleißig wie möglich arbeitet und wenn er in der Redaktion privat telefoniert oder im Internet surft.
Keuchend und schnaufend beschleunige ich meinen Schritt. Ich muss mir mehr Mühe geben, denke ich. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll, muss ich einen Weg finden, mehr Stunden in den Tag zu packen. Denn selbst wenn es mich umbringt, wird hier niemand arbeitslos, solange ich das Sagen habe.
Mein Büro ist ganz oben im vierten Stock, ein wunderschöner, luftiger Eckraum mit hohen Fenstern, die Aussicht auf die geschäftige Tara Street bieten. Nicht, dass ich je eine Sekunde Zeit hätte, den Blick zu genießen. Jeden Morgen zeige ich an der Pforte meinen Ausweis vor, durchquere auf dem Weg in meine Höhle das Großraumbüro und werde an der Wand über meinem Schreibtisch von einem riesigen Porträt begrüßt, das Douglas Merriman, den Gründer und ersten Chefredakteur des Blattes, darstellt. Vor hundertfünfzig Jahren hatte er in dem Büro gesessen, das nun meines ist. Er war ein alter Kauz, und wenn ich seinen Eulenblick durch die strenge viktorianische runde Brille auf mir spüre, schaue ich zurück und denke dasselbe wie jeden Tag, seit ich hier arbeite. Mistkerl. Du musstest dich nie mit dem digitalen Zeitalter herumschlagen, mit E-Mails und Handys, die dich selbst am Sonntag um zwei Uhr morgens an die Redaktion ketten. Richtig? Du warst nicht gezwungen, mit Sendern zu konkurrieren, die rund um die Uhr Nachrichten bringen. Du hast nie versucht, in der schlimmsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise Zeitungen zu verkaufen, oder?
Gerade klappe ich meinen Aktenkoffer auf und hole meine Anmerkungen zur heutigen Ausgabe heraus. Wir fangen immer den Tag damit an, dass wir die heutige Frühausgabe durchgehen und feststellen, wo wir einen Treffer gelandet haben, was wir anders hätten machen können und wo es noch Raum für Verbesserungen gibt. Alle Ressortchefs müssen zu dieser Sitzung erscheinen, was bedeutet, dass etwa zwölf Personen – von Innenpolitik bis zu Ausland, Sport und Feuilleton – um einen Konferenztisch sitzen.
Ehe ich mich versehe, steht Seth Coleman in meiner Tür. Das Anklopfen hat sich der Widerling gespart. Wie immer ist er angezogen, als hätte seine Mummy ihm die Sachen rausgelegt. Interessanterweise habe ich ihn lange für einen verkappten Schwulen gehalten, denn kein Heteromann würde eine Hose mit Bügelfalten tragen. Allerdings hat er bei der letzten Weihnachtsfeier den Fehler gemacht, mich plump anzubaggern. Ich weiß noch, wie entgeistert ich ihn angestarrt habe. Dass er es fertiggebracht hat, meine tiefe Abneigung gegen ihn als Begierde zu missdeuten, ist für immer in der Komikabteilung meines Gehirns abgespeichert.
Schade, dass Sie das nicht mit eigenen Augen gesehen haben, aber glauben Sie mir, es war einfach zum Totlachen.
»Morgen, Eloise, was machen Sie denn noch hier? Sie haben noch genau eine Minute.«
Als ob wir hier in der Fernsehserie 24 wären. Und ich wäre der Terrorismusexperte Jack Bauer.
»Alle sind bereits im Konferenzraum«, näselt er und streicht sich dabei das Haar zurück, obwohl es bereits von schätzungsweise einem halben Pfund Pomade zusammengehalten wird. »Alle Ressortchefs sind vollständig versammelt. Hoffentlich fehlt Ihnen nichts. Unpünktlichkeit passt so gar nicht zu Ihnen.«
Anstelle einer Antwort nicke ich nur knapp und lächle mit zusammengebissenen Zähnen.
»Haben Sie noch einmal über mein Angebot nachgedacht, Sie dieses Jahr zum Vorstandswochenende zu begleiten?«
Kurz schwebt ein unausgesprochener Gedanke zwischen uns in der Luft, denn eigentlich möchte er mir Folgendes mitteilen: »Sei doch ehrlich, etwas Besseres als mich kriegst du sowieso nicht mehr.«
Ich achte nicht darauf und tarne meinen Ärger hinter einem Blatt Papier. Anschließend schiebe ich mich rasch an ihm vorbei, um mich dem Tag zu stellen.
Und immer wenn ich schon glaube, dass es nicht mehr schlimmer werden kann – dann kommt es natürlich besonders dicke. Was habe ich auch anderes erwartet? Inzwischen ist es halb drei. Ich bin schon wieder im Konferenzraum, habe das Gefühl, ihn nie verlassen zu haben, und leite die erste Sitzung des Tages, um den Entwurf der morgigen Ausgabe zu erörtern.
In dieser Besprechung sitzen wir zusammen, schlagen mögliche Themen vor und reden darüber, welche Story morgen auf die Titelseite soll, was sich gerade tut und in den nächsten Stunden gründlich im Auge behalten werden muss und welche Artikel und Kommentare auf welche Seite gehören. Sämtliche Ressortchefs sind meiner Aufforderung gefolgt, stellen ihre Artikel vor und kämpfen um möglichst viele Spalten, wobei die Titelseite den Status des Heiligen Grals genießt.
Für gewöhnlich empfinde ich diese Sitzungen als sehr anregend. Emotionen kochen hoch, und es wird leidenschaftlich gestritten – eine Praxis, die ich ermutige. Es ist immer ein Genuss, mitanzuhören, wie jeder Redakteur die Werbetrommel für sein Thema rührt. Darin sind wir ein wenig wie ein Debattierclub ohne Alkohol, denn die Ressortchefs vertreten ihre Ansichten so lautstark, wortreich und aggressiv wie Kneipengäste am Freitagabend, kurz bevor eine Schlägerei losbricht.
Doch aus irgendeinem Grund bin ich heute Nachmittag nicht auf Zack.
Ich kann mich nicht konzentrieren und schweife immer wieder ab. Nach allen Ereignissen an diesem Tag des Grauens, der schon mit einer Katastrophe begonnen hat, schaffe ich es einfach nicht, bei der Sache zu bleiben. Gut, natürlich war ich noch gegen acht Uhr heute Morgen felsenfest davon überzeugt, dass ich bis zum Abend Ersatz für Elka gefunden haben würde. Und zwar jemanden, der noch viel besser zu uns passt, wie ich sogar selbstzufrieden zu denken wagte. Eine Frau, die vielleicht ein kleines bisschen weniger launisch und anspruchsvoll ist und versteht, was es bedeutet, für eine alleinerziehende Mutter zu arbeiten.
Um halb elf – inzwischen hatte ich die ersten Bewerberinnen unter die Lupe genommen – war ich zwar etwas desillusioniert, allerdings noch immer verhältnismäßig sicher, dass ich nur ein wenig würde aussieben müssen, um auf meine Mary Poppins zu stoßen. Mit Kandidatin eins und zwei hatte ich sicher einfach nur kein Glück gehabt. Ich musste einfach nur ein Weilchen weitersuchen, also bestand überhaupt kein Grund zur Panik.
Um Viertel vor zwölf ... nun, mittlerweile war die Stimmung umgeschlagen, und allmählich wurde ich ein wenig nervös. Außerdem wollte es mir einfach nicht in den Kopf, warum es mitten in einer Wirtschaftskrise so verdammt schwierig sein sollte, einen wirklich nicht anspruchsvollen Arbeitsplatz zu besetzen. Aber ich klammerte mich noch an die Hoffnung, dass ich bisher eben Pech gehabt hatte. Damit das optimale Kindermädchen in mein Leben spazierte – und blieb –, brauchte ich nur beharrlich zu sein.
Jetzt, um zwei, nach dem letzten desaströsen Vorstellungsgespräch, bin ich absolut in Panik ... anders kann ich es leider nicht in Worte fassen. Ein gutes Dutzend Stimmen debattieren hitzig und kämpfen um meine Aufmerksamkeit, während ich am Kopf des Konferenztischs sitze und so tue, als würde ich aufmerksam lauschen. Doch in Wirklichkeit bin ich ganz weit weg.
Denn nun weiß ich es. Endlich ist es offiziell. Ich stehe am Rande des Abgrunds. Ich. Habe. Keine. Kinderbetreuung. Ab Ende dieser Woche wird es niemanden mehr geben, der auf Lily aufpasst. Keinen einzigen Menschen. Was, in Gottes Namen, soll ich dann tun? Die Kleine mit in die Redaktion nehmen und sie mitten in meinem Büro in einen Laufstall setzen, in der Hoffnung, dass sie niemand bemerkt? Klar, tolle Idee. Wenn ich so etwas auch nur im Traum in Erwägung ziehen sollte, könnte ich mir genauso gut gleich eine Leuchtreklame um den Hals hängen, auf der Bin total durchgedreht. Bitte schmeißt mich raus! steht. Seth Coleman würde sich die Hände reiben.
Je länger ich über das Problem nachgrüble, desto trockener wird mein Mund, und obwohl ich verzweifelt versuche, mir nichts anmerken zu lassen, spüre ich, wie sich auf meiner Stirn kleine Schweißperlen bilden und wie mein Herz vor Angst schneller schlägt. Also öffne ich eine Wasserflasche und konzentriere mich aufs Ein- und Ausatmen. Ich muss am Ball bleiben. Niemand in diesem Raum darf je erfahren, dass ich gerade eine Panikattacke habe. Aber sosehr ich mich auch bemühe, läuft in meinem Kopf immer wieder derselbe schreckliche Gedanke ab wie auf Endlosschleife. Es gibt kein Entrinnen.
Alle verfügbaren Kindermädchen sind absolut inakzeptabel. Ich stecke in der größten Krise seit Lilys Geburt. Da ist niemand, ich wiederhole, niemand, der mir hilft. Was zum Teufel soll ich jetzt nur machen?
Heute Vormittag hat Rachel, meine leidgeprüfte Assistentin, die wenigen Kinderbetreuungsagenturen abgeklappert, bei denen ich noch nicht auf der schwarzen Liste stehe, und ganze vier Bewerberinnen aufgetrieben. Ja, richtig gehört, vier. Mitten in der Wirtschaftskrise und bei ständig steigenden Arbeitslosenzahlen.
Und hier sitze ich, bereit und willens, ein Topgehalt plus Bestechungsgeld an jede Frau zu zahlen, damit sie ein knapp dreijähriges Kind betreut und in ein modern ausgestattetes Haus in Rathgar mit eigenem Zimmer und Bad zieht. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Dazu muss man doch weder Nobelpreisträgerin noch in der Lage sein, einen multinationalen Konzern zu leiten. Ich suche doch nur eine vernünftige, verantwortungsbewusste Frau, die dafür sorgt, dass ein kleines Mädchen sein Gemüse aufisst, pünktlich in den Kindergarten kommt und brav sein Mittagsschläfchen hält, und es außerdem von Kinderserien im Fernsehen fernhält ... und dennoch kann ich niemanden finden, der die Stelle haben will?
Es ist nicht zu fassen. Heute habe ich insgesamt drei Vorstellungsgespräche geführt, und jedes einzelne davon war die totale Katastrophe. Also führt kein Weg daran vorbei: Wenn Elka sich Ende der Woche verdrückt, habe ich niemanden, der Lily betreut. Niemanden. Niemanden. Und glauben Sie mir, ich habe alles getan. Ich habe sogar meinen Stolz heruntergeschluckt, Elka angerufen und ihr das doppelte Gehalt und mehr Freizeit geboten, wenn sie es sich nur anders überlegt. Aber nichts da. Sie hat eben genug und will gehen, so einfach ist das. In meiner Verzweiflung habe ich mir sogar überlegt, meine Schwester Helen anzurufen, doch ich weiß, dass ich mir die Mühe sparen kann. Da läuft nichts.
Wenn ich gnadenlos ehrlich mit mir bin, muss ich zugeben, dass wir beide nur sehr wenig gemeinsam haben und einander nie sehr nahestanden. Folglich ist sie nicht der Mensch, an den ich mich in der Stunde der Not wenden kann. Außerdem hat Helen nach Lilys Geburt einen Typen namens Darren kennengelernt, der in Cobh eine kleine Pension am Meer betreibt. In erschreckend kurzer Zeit hat sie ihre Zelte abgebrochen und verkündet, sie werde aufs Land ziehen und mit ihm zusammenarbeiten. Für ihn hat sie alles aufgegeben. Ihren Job, ihre Wohnung, alles. Doch so ist meine Schwester eben. In meinen Augen war sie in Sachen Männer schon immer von Torschlusspanik getrieben, und nun muss sie sich mit den Folgen abfinden ... in Cobh, viele Kilometer weit weg von ihren alten Freunden und ihrem früheren Leben.
Der absolute Irrwitz, das war mein erster Gedanke damals wie heute. Obwohl ich Darren nur wenige Male an Weihnachten oder anlässlich ihrer seltenen Besuche bei mir getroffen habe, frage ich mich, ob Helen in einem dreihundert Kilometer entfernten, winzigen abgelegenen Dorf wirklich glücklich mit ihm ist. Allerdings ist es schwierig, einander auf dem Laufenden zu halten, und abgesehen von den gelegentlichen Anrufen (»Hallo, schön von dir zu hören, aber kann ich dich zurückrufen, ich habe gleich eine Sitzung?«) haben wir seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.
Und nein, ich war mit Lily noch nie in Cobh zu Besuch, sosehr die Kleine auch bettelt und ihre Tante vergöttert. Schließlich kann ich die Redaktion nicht im Stich lassen. Hin und wieder schickt Helen mir eine Mail, in der sie entweder ein wenig über Darren jammert oder mich unverblümt um ein Darlehen bittet. Anscheinend ist die Hotellerie von der Wirtschaftskrise noch härter betroffen als wir anderen. Ich tue ihr stets den Gefallen und schicke ihr einen Scheck, ohne das Geld zurückzuverlangen. Sie nimmt dankend an und mailt dann fröhlich und vergnügt, Lily und ich könnten doch auf Kosten des Hauses ein Wochenende bei ihr verbringen, wann immer wir wollen. Das ist ein netter Vorschlag, und ich weiß das Angebot auch zu schätzen, aber ich bitte Sie ... Ein ganzes Wochenende freinehmen? Samstag und Sonntag? Am Stück? Das soll wohl ein Scherz sein?
Außerdem weiß ich, dass sie in ihrer Pension in Arbeit versinkt. Also hat sie sicher genug um die Ohren, weshalb ich ihr nicht auch noch Lily aufhalsen kann. Hinzu kommt, dass ich mein kleines Mädchen dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommen würde. Und offen gestanden ist der kurze Blick auf ihr schlafendes Köpfchen morgens und abends das Einzige, was mich die tägliche Tretmühle bei einigermaßen intakter geistiger Gesundheit überstehen lässt. Sie gibt mir den Antrieb, der den Rest ein wenig erträglicher macht.
Also zurück zu dem Problem, was zu tun ist, wenn Elka Ende der Woche verschwindet. Ich werde untergehen. Und zwar sehr schnell.