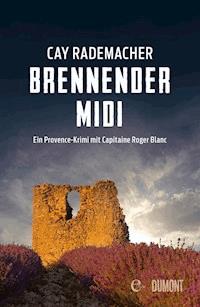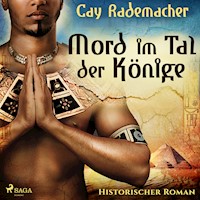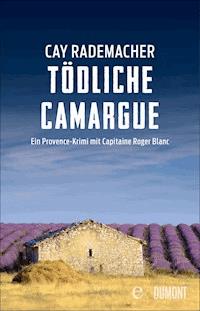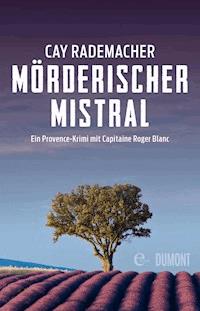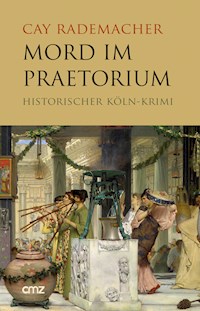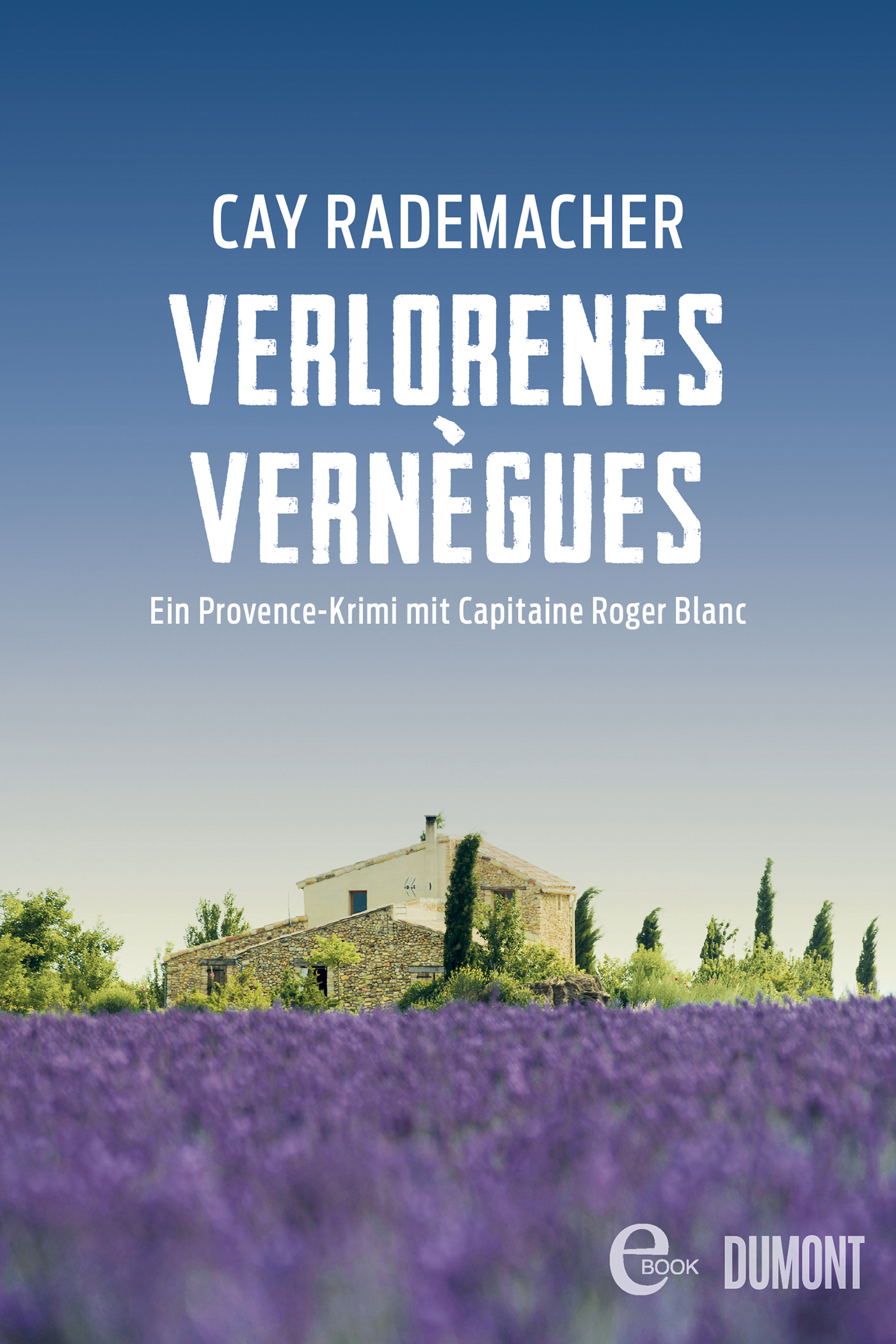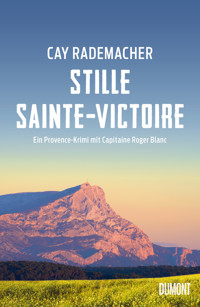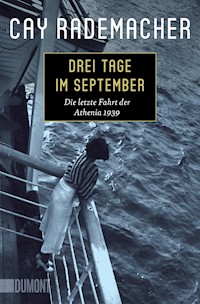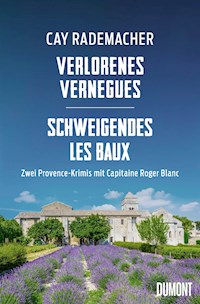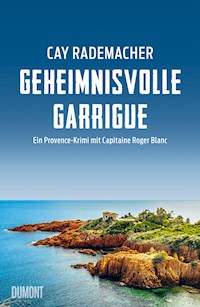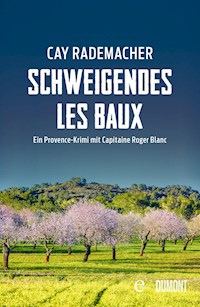9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Böse unter der provenzalischen Sonne Méjean, ein Fischerdorf an der Côte Bleue, in dem die Bewohner und Gäste die ersten heißen Tage genießen. Bis fünf Fremde aus Deutschland anreisen. Mit ihnen kehren die düsteren Erinnerungen an ein seit dreißig Jahren ungelöstes Verbrechen zurück – und damit Misstrauen, Angst und Hass. Sommer 1984: Claudia und Dorothea, Oliver, Barbara, Rüdiger und Michael haben gerade Abitur gemacht. Die Clique verbringt einen letzten gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus von Michaels Eltern und verlebt eine großartige Zeit. Bis eines Nachts Michael in eine Bucht geht und nicht wieder auftaucht. Am nächsten Tag wird klar: Es handelt sich um Mord. Doch die Polizei findet keinen Schuldigen, weder unter den Deutschen noch unter den Einheimischen. Nun, im Sommer 2014, kehren die fünf überlebenden Freunde von einst nach Méjean zurück. Sie haben sich längst aus den Augen verloren. Manche haben Karriere gemacht, andere sind gescheitert. Doch sie alle haben einen Brief erhalten, der sie an diesen Ort zurückzwingt. Auch Commissaire Renard aus Marseille reist an, weil er ein Schreiben erhalten hat. Denn in diesem Sommer in Méjean, so verspricht der anonyme Absender, werden sie endlich Michaels Mörder finden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Méjean, ein Fischerdorf an der Côte Bleue, in dem Bewohner und Gäste die ersten heißen Tage genießen. Bis fünf Fremde aus Deutschland anreisen. Mit ihnen kehren die düsteren Erinnerungen an ein seit dreißig Jahren ungelöstes Verbrechen zurück – und damit Misstrauen, Angst und Hass.
Sommer 1984: Claudia und Dorothea, Oliver, Barbara, Rüdiger und Michael haben gerade Abitur gemacht. Die Clique verbringt einen letzten gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus von Michaels Eltern und verlebt eine großartige Zeit. Bis eines Nachts Michael zum Schwimmen in eine Bucht geht und nicht wieder auftaucht. Am nächsten Tag wird seine Leiche gefunden, und es ist klar: Es handelt sich um Mord. Doch die Polizei findet keinen Schuldigen, weder unter den Deutschen noch unter den Einheimischen. Nun, im Sommer 2014, sind die fünf überlebenden Freunde von einst wieder zusammen in Méjean. Sie haben sich längst aus den Augen verloren. Manche haben Karriere gemacht, andere sind gescheitert. Aber sie alle haben einen Brief erhalten, der sie an diesen Ort zurückzwingt. Auch Commissaire Renard aus Marseille reist an, der ebenfalls ein Schreiben erhalten hat. Denn in diesem Sommer in Méjean, so verspricht der anonyme Absender, werden sie endlich Michaels Mörder finden …
Credit: © Françoise Rademacher
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018) und ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Mehr über das Leben im Midi erfahren Sie im Blog des Autors: Briefe aus der Provence
Cay Rademacher
EIN LETZTER SOMMERIN MÉJEAN
Kriminalroman
Alle Personen in diesem Roman sind erfunden, ganz so, wie meine geschätzte Kollegin Joanne Harris einmal schrieb: »Und jedem, der Angst hat, sich auf den Seiten dieses Buches wiederzufinden, sei versichert: Du bist nicht drin.«
eBook 2019 © 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagmotiv: © plainpicture/mia takahara Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-8321-8443-8
www.dumont-buchverlag.de
’t ess paar Johr her, doch die Erinnerung fällt nit schwerHuck kutt mer vuur, als wenn et jestern woor.
BAP, Verdamp lang her
I
Die Briefe
1
Freitag, 27. Juni 2014. Claudia Bornheim blickt in acht verschlossene Gesichter, und sie fragt sich einen Augenblick lang, ob sie in ihrem Leben nicht etwas fundamental falsch gemacht hat. Sie ist 48Jahre alt und seit sechs Jahren Ministerin. Andere schnupfen Kokain, sie ist süchtig nach Politik – war jüngste Landtagsabgeordnete, jüngste Staatssekretärin, jüngste Landesministerin. Dafür hat sie beinahe auf alles verzichtet; keine Familie, keine Kinder und, wenn sie ehrlich ist, nicht einmal Freunde außerhalb der kleinen Welt zwischen Düsseldorf und Berlin. Und wofür? Sie verkündet ihr neuestes Gesetzesvorhaben im Raum der Landespressekonferenz, und da verlieren sich acht Korrespondenten im Saal, von denen vier aussehen wie Praktikanten, deren größte intellektuelle Leistung darin besteht, diesen Raum rechtzeitig gefunden zu haben. Und von den anderen vier haben zwei es nicht einmal für notwendig gehalten, sich Notizen zu machen. Es ist Freitagmorgen, noch nicht einmal zehn Uhr, und Claudia Bornheim ist schon erschöpft, sie spürt ein Ziehen in den Schläfen, das verfluchte Alarmsignal der Migräne, und wünscht, sie dürfte sich wenigstens ein bisschen gehen lassen.
Stattdessen zwingt sie sich das von den Fotografen geliebte Claudia-Bornheim-Lächeln ins Gesicht, als sie aufsteht. Sie ist sportlich, Joggen und Schwimmen, in ihren langen dunkelbraunen Haaren schimmert noch keine graue Strähne, sie sieht mindestens zehn Jahre jünger aus, als sie ist, und zwanzig Jahre jünger, als sie sich fühlt.
»Sie werden den Text des Gesetzesentwurfs ab zehn Uhr auf der Website des Ministeriums finden«, verkündet sie. »Und wenn sie noch Fragen haben …«
Wowlick von der Rundschau ist schon an der Tür, sicher auf dem Weg zur Raucherecke. Die anderen Journalisten klappen Notebooks zusammen oder checken ihre Smartphones.
»Denk an deine Post, Claudia.« Jasmin da Silva, die freundlich lächelnd und loyal die ganze Pressekonferenz neben ihr gesessen hat, springt auf. Sie ist ein Junkie wie Claudia Bornheim, nur eine Generation jünger. Jasmin könnte als Navajofrau durchgehen oder als Algerierin oder Inderin. Mit ihrer ungewöhnlichen Schönheit, die im Fernsehen noch deutlicher zutage tritt als im echten Leben, würde sie es weit bringen – vorausgesetzt, Jasmin würde die Flut der Hassmails und Drohungen ertragen, die unweigerlich über sie hereinbräche, wie immer, wenn sich eine Frau ihres südländischen Aussehens für ein öffentliches Amt zur Wahl stellt.
Claudia Bornheim blickt auf ihre Uhr, Rolex, Stahl, eine Männeruhr und das letzte Überbleibsel einer schon vor Jahren gescheiterten Beziehung. »Gleich ist Fraktionssitzung«, erwidert sie.
»Es ist nicht viel. Wer schickt heute schon noch Briefe? Du kannst sie auf dem Weg lesen. Ich halte dir die Türen auf.« Jasmin da Silva lacht.
Claudia Bornheim ringt sich ein Lächeln ab. Selbstironie steht einer Ministerin gut. Vor sechs Monaten hat sie eilig auf einem Flur Akten studiert und ist gegen eine Glasschiebetür geknallt, die sie übersehen hatte. Sehr schmerzhaft. Und wahrscheinlich sehr witzig für Jasmin und die beiden Referatsleiter, die ihr gefolgt waren. Zum Glück hatte das niemand mit dem Handy gefilmt, eine Slapstickeinlage wie diese hätte ihr eine halbe Millionen Zuschauer auf YouTube eingebracht – und man konnte nie wissen, wie sich das auf die Karriere auswirkt.
»Zeig her«, sagt sie.
Sie laufen durch einen langen Gang, der zu den Fraktionsbüros führt. Wer ihnen entgegenkommt, macht respektvoll Platz und grüßt. Claudia Bornheim lächelt jeden an und grüßt zurück. Jasmin da Silva zieht so kalt wie ein arktischer Luftstrom vorbei. Das muss sie noch lernen, denkt Claudia Bornheim, Arroganz ist eine gefährliche Schwäche, weil sie lange nachwirkt. Sie macht sich im Geist einen Vermerk: Wenn Jasmin sich bewährt, wird sie irgendwann ihre öffentlichen Auftritte coachen. Sollte Jasmin hingegen nicht ganz so loyal sein, wie sie sich gibt, dann wird sie diese Schwäche gegen sie verwenden.
Sie ist beim letzten Brief angelangt. Kein Absender. Verwischter Briefmarkenstempel. Keine Unterschrift. Sie liest und bleibt abrupt stehen.
»Hier ist keine Glastür«, scherzt Jasmin da Silva.
»Buch mir einen Flieger nach Südfrankreich«, befiehlt Claudia Bornheim. Ihre Stimme ist flach geworden. »Nimm Marseille, und falls da alles ausgebucht ist, Nizza. Und reservier mir einen Mietwagen. Für übermorgen.«
Ihre Referentin blickt sie an. Es dauert ein paar Sekunden, bis sie begriffen hat, was die Ministerin wünscht. »Und die Parteiversammlung übermorgen in Köln? Und die Fraktionssitzung am Montag? Und die Eröffnung von …«
»Nimm das erste Flugzeug, das du kriegen kannst. Ich zahle. Es ist nicht dienstlich, sondern privat.«
Jasmin da Silva starrt sie fassungslos an. »Was ist denn los? Wie lange bleibst du denn weg?«
Claudia Bornheim eilt weiter, schneller jetzt. Ihre Bürotür. Sie öffnet sie. »Keine Ahnung«, sagt sie, »lass das Rückreisedatum offen.« Sie knallt ihrer Referentin die Tür praktisch vor der Nase zu und ist froh, endlich in ihrem Büro zu sein.
Allein mit dem Brief.
Dorothea Kaczmarek öffnet die Eingangstür ihres Altbauhauses im Venusbergweg. Unverschlossen. Sie seufzt. Oliver denkt nie daran, den Riegel von innen vorzulegen. Irgendwann wird sie in ihrer Mittagspause hier ankommen, und ihr Heim wird leer geräumt sein bis auf das Wohnzimmer, in dem Oliver liest und nichts mitbekommt. Sie schließt die Tür, legt den Riegel vor, sammelt die Post auf, die durch den Briefschlitz auf den Parkettboden gesegelt ist.
Im Flur hängt ein gerahmtes Poster von einem jener Bonner Kultursommer damals, als sie noch Studentin war. Daneben ein Spiegel. Würde Dorothea hineinschauen, sähe sie eine Neunundvierzigjährige, die im Prinzip immer noch so wirkt wie die Studentin von früher: kurze blonde Haare, weißes T-Shirt, Jeans, Joggingschuhe. Der Ring, den ihr Oliver geschenkt hat, als sie beide sechzehn waren, ist ihr einziges Schmuckstück geblieben. Wenn sie neuen Bekannten verrät, dass sie Sportlehrerin auf einem Gymnasium ist, überrascht das niemanden.
Dorothea Kaczmarek geht den Flur hinunter bis zu einer Tür, an der bunte Kinderzeichnungen kleben. Sie öffnet sie, blickt kurz in das Zimmer. Der Rollladen ist heruntergelassen, die Luft riecht nach Staub und ungelüfteter Kleidung. Oliver hätte wenigstens das Fenster aufmachen können. Sie stellt es auf Kipp, lässt jedoch den Rollladen unten. Dann verlässt sie den Raum und geht in die Küche. Alles sauber, Teller und Töpfe unberührt, der Kühlschrank ist gut gefüllt. Sie holt einen Salat heraus, Tomaten vom Biomarkt, schwarze, salzige Oliven, die sie auf ihrer Mittelmeerreise am Ende der Schulzeit zu schätzen gelernt hat. Kurz zögert sie. Eigentlich reicht ihr ein Salat, und Oliver hat in letzter Zeit am Bauch zugesetzt. Aber er wird ungehalten sein, wenn es mittags nichts Warmes gibt, also wirft sie noch eine Handvoll Spaghetti in einen Topf und stellt ein Glas Pesto bereit.
Während Dorothea darauf wartet, dass das Nudelwasser kocht, überfliegt sie die Post, die sie auf den Küchentisch geworfen hat. Prospekte, Prospekte, Prospekte. Sie fragt sich, welchen Sinn der Bitte keine Werbung!-Aufkleber auf ihrem Briefschlitz eigentlich hat. Zwischen den Broschüren eines Baumarkts und eines Gartencenters fischt sie einen Brief heraus. Kein Absender. Verwischter Stempel. Adressat: »Dr. Oliver und Dorothea Kaczmarek«. Sie überlegt einen Moment lang, ob sie Oliver das Schreiben öffnen lassen soll. Aber es ist ja auch an sie adressiert, oder? Sie reißt den Umschlag auf.
Ein Blatt. Sie liest.
Danach braucht Dorothea Kaczmarek fünf Minuten, bis sie endlich die Kraft findet, die wenigen Meter von der Küche zum Wohnzimmer zu gehen. Das Wasser im Topf sprudelt, aber das ist ihr jetzt gleichgültig. Oliver sitzt im Lehnstuhl am Fenster, einem bequemen, aber unfassbar hässlichen Erbstück seiner Mutter. Er hat ein Buch in der linken und einen grünen Faber-Castell-Bleistift in der rechten Hand. Ein älteres englisches Werk, eines seiner Lieblingsbücher, sie hat es nie gelesen, irgendetwas über antike griechische und römische Seefahrer im Roten Meer und im Indischen Ozean. Er hat ganze Passagen unterstrichen und mit Ausrufe- und Fragezeichen markiert. Dr. Oliver Kaczmarek ist ein ziemlich großer Mann. Kurze, dichte, angegraute braune Haare, gut getrimmter Bart, kariertes Hemd, das auch nach mehreren Stunden im Stuhl noch frisch gebügelt aussieht. Er trägt noch immer diese große, schrecklich unmodische viereckige Brille mit Stahlgestell, die er schon in der Oberstufe getragen hat, nur hat er irgendwann die alten, dicken Kunststoffgläser durch dünnere aus echtem Glas ersetzt. Gleitsichtgläser, die hat er früher nicht nötig gehabt.
»Ach, du bist da«, begrüßt er sie, als hätte er sie doch tatsächlich nicht in der Küche hantieren gehört. Er wartet, dass sie zu ihm kommt und ihn zur Begrüßung küsst, doch sie schafft es nicht, durch das Wohnzimmer zu gehen, muss sich gegen den Rahmen der geöffneten Tür lehnen.
»Du, wir müssen mal wieder in Urlaub fahren«, sagt sie tonlos.
Oliver Kaczmarek blickt seine Frau erstaunt und ein wenig tadelnd an. »Paula ist im Pfadfinder-Ferienlager.«
»Und da wird sie auch die ganze erste Hälfte der Sommerferien bleiben. Es geht ihr gut dort. Wir müssen doch nicht zu Hause bleiben, nur weil Paula in der Eifel im Zeltlager ist. Und da könnten wir dann ja mal einen Urlaub zu zweit machen. Nur wir beide. So wie früher.«
Jetzt steht Oliver doch auf. Nun kann sie das Bäuchlein sehen, kein Fett im Gesicht, nichts Schwabbeliges an den Beinen, aber eben diese kleine Wölbung oberhalb des Gürtels, die früher undenkbar gewesen wäre. Und die Schultern lässt er jetzt hängen, als sei er erschöpft, aber wovon eigentlich?
»Diese komischen Pfadfinder wollen auf dem Rursee segeln. Du weißt selbst, wie tief diese Stauseen sind. Wie kalt das Wasser ist. Und sie wollen im Wald übernachten. Und was die alles essen! Jederzeit könnte uns jemand anrufen und bitten, die Kleine abzuholen. Vielleicht verletzt sie sich. Oder sie hat Heimweh. Von Bonn aus wären wir in einer Stunde bei ihr. Aber ausgerechnet jetzt willst du in Urlaub fahren, während deine Tochter in den Händen dieser Pfadfinder ist?« Er lacht ungläubig.
Dorothea Kaczmarek strafft sich. »Paula ist nicht meine Tochter, sie ist unsere Tochter. Und es geht ihr bestimmt sehr gut im Ferienlager. Wahrscheinlich besser als bei uns.« Sie blickt ihren Mann auf einmal so zornig an wie noch nie zuvor. Er sieht aus, als wolle er sich wieder in den Sessel fallen lassen, überlegt es sich dann jedoch anders.
»Wir fahren in Urlaub«, verkündet sie bestimmt. »In den Süden. Nach Frankreich.«
Oliver Kaczmarek legt das Buch auf einen Beistelltisch. Seine Rechte zittert plötzlich so stark, dass der Bleistift vibriert wie die Nadel eines Geigerzählers. »Du willst nach Méjean?«, stößt er hervor. »Da wollten wir doch nie wieder hin! «
»Diesen Sommer werden es dreißig Jahre her sein«, erwidert Dorothea Kaczmarek.
»Um Himmels willen, Méjean, hast du das denn alles vergessen?« Er starrt sie an und schüttelt schließlich verstört den Kopf. »Nein, du hast nichts vergessen, im Gegenteil. Das ist gar kein Urlaub. Du willst wegen dieser alten Geschichte dahin fahren. Was ist in dich gefahren?«
Sie wendet sich jedoch bloß ab. »Ich fange mit dem Packen an.«
Barbara Möller weiß, dass sie jetzt eigentlich Kartoffeln schälen müsste. Sie weiß, dass sie Detlev bitten müsste, langsam mal die Holzkohlen auf dem Grill anzuzünden. Aber sie spielt mit den Zwillingen Boccia auf dem Rasen vor dem Haus, seit mindestens zwei Stunden schon, und die Kinder haben Spaß und feuern sich gegenseitig an. Die Zwillinge sind Teenager, und wer weiß, wie lange sie noch mit ihrer Mutter im Garten spielen wollen? Detlev sitzt auf der Terrasse am Tisch und bastelt an einem Röhrenradio herum, einem riesigen Kasten aus Holz und Ferne verheißenden Senderskalen, einem Apparat, der einen Weltkrieg und drei Umzüge, aber leider nicht den Blitzeinschlag der letzten Woche überstanden hat. Ein freier Freitag, ein Urlaubstag für alle. Detlev denkt garantiert nicht eine Sekunde an seine Arbeit bei der Bank, sie denkt seit Stunden nicht an die Arbeit bei der Bank, die Kinder denken nicht an ihre iPhones, das Leben ist heiter, und dann wird eben später gegrillt.
»He, Babs, ich brauche eine Unterschrift!« Der Postbote steht lächelnd am Gartenzaun.
»Sükrü, du reißt mich raus, ich habe gerade einen Lauf.« Barbara Möller legt die Kugeln beiseite und geht zum Gartenzaun. Alles an ihr ist rund: Die braunen lockigen Haare, die sie gerne in einer voluminösen Frisur trägt, ihr Gesicht, ihre Wangen, die Augen, der Leib, in dessen Rundungen sich Detlev auch nach so vielen Ehejahren nur allzu gerne verliert.
Barbara Möller quittiert eine kleine Paketsendung, irgendein Teil eines Elektronikversands. Sie hält den schmalen Karton in die Höhe und ruft ihrem Mann zu: »Das wird dich glücklich machen!«
»Mein Nachmittag ist gerettet«, antwortet Detlev, schiebt seine Brille von der Nasenspitze hoch bis auf die Stirn und winkt dem Postboten zu.
»Das habe ich auch noch«, sagt Sükrü und drückt ihr drei Briefe in die Hand. »Einen schönen Nachmittag!« Er schwingt sich auf das wackelige gelbe Rad.
Sie blickt kaum auf die Briefe, will zurück zum Bocciaspiel. Zwei identische Schreiben von ihrem gemeinsamen Arbeitgeber: die Einladungen für das Sommerfest der Raiffeisenbank. Wer organisiert das? Die Schmidt-Bachmann vom Personal? Oder jemand von der PR? Barbara Möller müsste irgendwann mal mit irgendwem darüber reden, warum bloß immer alle Sachen an Detlev und sie doppelt zugeschickt werden, ein Schreiben würde doch reichen, das würde der Bank Geld sparen und ihnen ein bisschen Altpapier. Ohne genau hinzusehen, reißt sie den dritten Umschlag auf.
Barbara Möller liest, bleibt mitten auf dem Rasen stehen, dreht sich um, geht zurück zum Gartenzaun, als wolle sie dem davonradelnden Postboten noch etwas hinterherrufen. Doch sie sagt nichts, starrt einfach bloß auf die Wohnstraße mit den Reihenhäusern zu beiden Seiten. So friedlich. So sicher. Sie hätte nie geglaubt, dass der alte Horror einmal bis hierher dringen könnte. Hoffentlich sieht mich jetzt niemand. Sie wendet Detlev und den Zwillingen den Rücken zu, kommt sich dabei wie eine Verräterin vor. Barbara Möller faltet den Brief so klein zusammen, bis das Blatt nicht noch einmal geknickt werden kann, dann stopft sie es in die Tasche ihrer weiten Sommerhose. Sie atmet tief durch, versucht, sich ihr strahlendstes Lächeln ins Gesicht zu zwingen. Endlich wendet sie sich ihrer Familie zu.
»Schatz«, ruft sie, »denk an den Grill! Ich muss heute Nachmittag noch etwas vorbereiten.«
»Klar, ich brauche eh eine Pause«, antwortet Detlev lächelnd und legt einen dünnen Schraubenzieher beiseite. Dann sieht er ihr Gesicht. »Ist was?«
»Es ist mir total peinlich«, gesteht sie, und sie spürt selbst, wie rot ihre Wangen leuchten, »aber ich habe gerade eine Einladung bekommen, die ich unmöglich absagen kann.«
»Spielst du doch mit deinen Freundinnen ›Siedler von Catan‹ am Samstag?«, fragt Friedrich erstaunt, während er die Bocciakugeln vom Rasen aufhebt.
»Nein, ich mache am Sonntag bloß einen kleinen Ausflug. Mami ist bald wieder da.« Hoffentlich, denkt Barbara Möller, hoffentlich bin ich bald wieder da.
Rüdiger von Schwarzenburg geht nachdenklich durch den Park seiner Villa. Er ist groß und schlank und dunkel: schwarze schulterlange Haare, Augen wie Obsidian, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, schwarze Halbschuhe. Die meisten Leute hätten wohl Schwierigkeiten, sein Alter richtig zu schätzen, er ist der Typ Mann, der sich zwischen seinem dreißigsten und sechzigsten Geburtstag so gut wie nicht verändert. Andererseits haben die meisten Leute, mit denen er zu tun hat, längst zumindest den Wikipedia-Eintrag über ihn gelesen. Das spart ihm beim Small Talk nach Vernissagen manche Schleife über seine Herkunft: 48Jahre alt, geboren in Köln, Studium in Düsseldorf, seit Ewigkeiten in Berlin und Potsdam, und nur selten noch muss er sich abgestandene Witze über Rheinländer an der Spree anhören.
In der Nähe röhrt ein Lastwagen, aber zum Glück sieht er ihn kaum. Eine beinahe zwei Meter hohe Hecke verwehrt den Blick vom Anwesen zur Straße. Jaroslav stutzt gerade ein paar Zweige mit der Astschere, er wird Stunden dafür brauchen. Doch ein motorbetriebener Heckentrimmer würde Lärm machen, und wenn es etwas gibt, das Rüdiger von Schwarzenburg verabscheut, dann ist es Lärm. Als er die Sträucher an der Seeseite der Villa setzen ließ, hat er sich von einem befreundeten Zoologen der Humboldt-Uni beraten lassen, welche Büsche er wie platzieren sollte, damit möglichst viele Singvögel Nistplätze finden. Es hat sich gelohnt. Zwischen die Büsche hat er nur wenige Bäume pflanzen lassen, eine Zeder, ein Sequoia, der in hundert Jahren so hoch sein wird wie ein Kathedralenturm, einen Ahorn, dessen Blätter jeden Herbst wie zehntausend kleine Feuer glühen und der ihn an seine Zeit in Amerika erinnert, Indian Summer, für einen Künstler eine Droge für die Augen.
Auf der Wiese hat er einige Skulpturen verteilt, die er nicht für Sammler geschaffen hat, sondern für diese Villa, sein Refugium, sein Atelier, sein Kraftwerk, wo er für den Rest seines Lebens schöpferisch arbeiten wollte, mit Carmen an seiner Seite. Vier Jahre war das auch so gewesen, vier intensive kreative Jahre, und dann war der Morbus Charcot über die zwei Meter hohe Hecke gestiegen und hatte Carmen mitgenommen, und Rüdiger von Schwarzenburg blickt auf die monumentalen Skulpturen, die er vor diesem unwillkommenen Besucher geschaffen hat, und fragt sich, ob er je wieder so etwas vollenden wird.
Ein Kopf, klassisch wie eine griechische Statue, nur gigantisch groß und schräg auf dem Rasen liegend, als hätte ihn ein Gott zuerst geformt und danach zu Boden geschleudert. Eine Hand aus Bronze, so wuchtig wie ein Felsbrocken, die Finger zu jener segnenden Geste geformt, die Dürer seinem Jesus gegeben hatte. Eine Betonwand, mit Hammer und Meißel in tagelanger Schufterei eigenhändig zertrümmert (ein Presslufthammer wäre viel zu laut gewesen), darauf Graffiti: »Berlin« ist da zu lesen, in allen Formen und Farben.
Rüdiger von Schwarzenburg hält ein Blatt Papier in der Hand, blickt jedoch nicht darauf.
Frieda de Mazière tritt aus der Terrassentür der Villa. Sie ignoriert die gewundenen Kieswege, ignoriert Jaroslavs Grimasse, sie geht in gerader Linie auf Rüdiger von Schwarzenburg zu. Sie trägt eine enge dunkle Hose, eine enge dunkle Bluse, die am Hals in einem engen Kragen endet, der von Schwarzenburg an eine Soutane erinnert. Ihre Haare sind kurz und grün gefärbt wie der Rasen eines Golfplatzes, ihre Brille viel zu groß für ihr schmales Gesicht. Rüdiger von Schwarzenburg strafft sich innerlich. Frieda hat vor drei Jahren über eines seiner frühen Bilder promoviert, summa cum laude in Kunstgeschichte. Für ihre Forschung hat sie sich bei ihm vorgestellt, und er hat sofort ihre Ängste und Komplexe erkannt, aber auch ihre ungeheure Intelligenz bewundert, ihre Effizienz, ihre nie nachlassende Energie, ihren bedingungslosen Willen, ihn zu verehren.
»Ich wollte eigentlich nicht gestört werden«, begrüßt er seine Assistentin.
Frieda de Mazière gehört zu jenen Menschen, die einem Idol ergeben sind und zugleich die Fähigkeit haben, dessen Worte zu ignorieren. »Die zweite Auflage vom Werkkatalog ist da«, beginnt sie und hält ein voluminöses Buch hoch, auf dessen Cover genau jene graffitibesprühten Betontrümmer zu sehen sind, neben denen Rüdiger von Schwarzenburg gerade steht. »Die Druckqualität ist noch besser als bei der ersten Auflage. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass es sich lohnt …«
»Okay«, sagt er und nimmt ihr den Katalog aus der Hand.
»Okay?! Das ist alles? Ich meine, das ist der technisch brillanteste, am besten gedruckte Katalog, den ich seit vielen Jahren gesehen habe!«
Rüdiger von Schwarzenburg gibt ihr das Buch zurück. Er weiß, dass Frieda nicht allein wegen der Druckqualität euphorisch ist, sofern jemand wie sie euphorisch sein kann, sie will vielmehr, dass er sich den für die zweite Auflage geschriebenen Einführungstext durchliest und die Bildbeschreibungen, denn das hat sie alles neu verfasst. Aber er fühlt sich zu überhaupt nichts in der Lage, nicht einmal zu einem richtigen Lob reicht seine Energie. »Schön«, erwidert er.
Sie starrt ihn an, hofft, dass ihre übergroße Brille ihren verletzten Blick verbergen wird. »Was ist mit Ihnen los? Sie laufen seit heute Morgen durch den Garten wie ein Roboter. Die Kanzlerin ist von Ihrem Porträt begeistert. Die Ausstellung ist ein Erfolg. Selbst der Michalski hat sie in der FAZ loben müssen, obwohl Sie wissen, wie der denkt. Und jetzt ist auch noch der Katalog da und …«
»Frieda, du denkst, ich leide unter einer Depression?«
Seine Assistentin ist nicht überrascht, wenn er über seine Psyche redet wie über das Wetter. »Wie lange ist es jetzt her, dass Carmen gegangen ist? Zwei Monate?«
»Drei«, korrigiert von Schwarzenburg. »Und ›gegangen‹ würde ich das nicht nennen, was sie in ihren letzten Tagen durchmachen musste.«
»Drei Monate. Da ist Trauer vollkommen normal. Der Tod gehört zum Leben, sagt man, aber das hilft einem ja nicht, wenn der Tod im eigenen Haus steht. Ich könnte für Sie …«
»… eine Liste von guten Therapeuten zusammenstellen«, vollendet er. »Ich bin sicher, daran herrscht in Potsdam kein Mangel.« Bevor sie darauf etwas erwidern kann, hebt er begütigend die Hand. »Du hast recht, Frieda. Ich muss hier raus. Wenigstens für einige Zeit. Berlin, Potsdam, dieses Haus – alles erinnert mich an Carmen. Ich muss mal einen anderen Himmel sehen. Einen helleren Himmel.«
»Italien?«, schlägt sie vor, und ganz, ganz leise schwingt die Hoffnung in ihrer Stimme mit, ihn begleiten zu dürfen.
»Südfrankreich«, erklärt Rüdiger von Schwarzenburg und tippt dabei unbewusst mit dem Zeigefinger der rechten auf das Papier in seiner linken Hand. »Die Provence, das Land der Künstler. Ich fahre schon morgen. Allein.«
Frieda de Mazière sieht ihn nicht mehr an, sie scheint die Graffiti auf den Betontrümmern zu studieren. »Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich meine, ausgerechnet die Provence? Die erinnert Sie doch erst recht an den Tod.«
Verdammt, denkt Rüdiger von Schwarzenburg, lässt sich aber nichts anmerken. Frieda weiß wirklich alles über ihn. Wie hat sie die Sache mit Michaels Tod bloß herausgefunden? Das war doch noch aus der Zeit vor Google. Sie wird alte Zeitungsberichte gelesen haben, in irgendeinem Archiv, bei der Recherche für ihre Dissertation, bei der sie nicht bloß sein Frühwerk, sondern sein ganzes Leben durchleuchtet haben muss.
»Vielleicht«, antwortet er vorsichtig, »hilft mir ja der alte Tod über den neuen Tod hinweg. Wenn ich einmal ganz allein bin.«
Damit lässt er sie stehen, auch wenn er weiß, dass seine Worte sie härter getroffen haben als eine Ohrfeige. Aber er muss jetzt wirklich allein sein. Frieda darf keinen Verdacht schöpfen. Denn er reist nicht freiwillig in die Provence.
2
Aus der Klimaanlage im Fenster oberhalb seines Schreibtisches quillt kalte, nach Schimmel riechende Luft. Vielleicht hat mir das den Krebs gebracht, denkt Marc-Antoine Renard, mit jedem Atemzug ein kleiner Tod. Aber niemand in der Évêché würde das Ding abstellen. Draußen sind es fünfunddreißig Grad im Schatten, wenn du überhaupt irgendwo in Marseille Schatten findest, und der Sommer hat noch nicht einmal richtig begonnen. Er trägt trotzdem eine Lederjacke über dem T-Shirt, er ist so dünn geworden in den letzten Monaten, dass er sogar in der Hölle frösteln würde.
Luc sitzt an seinem Schreibtisch im Nebenraum und liest in der La Provence. Als Renard durch die Verbindungstür eintritt, springt er auf. »Commissaire!«, ruft er. »Endlich sind Sie wieder an Bord.« Diese Freude, denkt Renard erleichtert, hört sich echt an.
»Ich freue mich auch«, sagt er und schüttelt Lucs Hand.
»Gut sehen Sie aus.« Das, denkt Renard nun, war jetzt aber eine dreiste Lüge. So sollte man einem Flic von der Police judiciaire eigentlich nicht kommen. Er hat sein Aussehen, bevor er die Wohnung verlassen hat, noch einmal im Spiegel gecheckt: die Haare an den Schläfen jetzt grau, nicht mehr schwarz. Auf den Wangen und an den Mundwinkeln Falten, feine Linien, als hätte sie jemand mit dem Skalpell gezogen. Die Haut jetzt hell von den Wochen, in denen er kaum in die Sonne gehen konnte.
»Es ging mir schon mal schlechter«, antwortet er und versucht sich an einem schiefen Grinsen.
Luc hüstelt. »Ich hätte nicht gedacht, dass …«
»… ich noch einmal zurückkomme?«, vollendet Renard.
»… dass Sie es so schnell schaffen.«
»Vier Monate sind nicht schnell.«
Luc hebt die Hände. Die Geste des Charmeurs, der jede Spannung verpuffen lassen kann und überall damit durchkommt. »Ich bin bloß überrascht. Sie sind noch bis nächste Woche krankgeschrieben.«
»Ich habe lange genug im Bett gelegen«, erklärt Renard, noch immer lächelnd, wenn auch angestrengter. Allein, setzt er im Geiste hinzu, ich habe allein im Bett gelegen. Wochenlang in diesem verdammten Krankenhausbett. Und dann im Doppelbett in der Wohnung. Annabelle hat ihn schon vor Jahren verlassen, und er hat ihr nichts vom Krebs erzählt, denn er wollte auf keinen Fall, dass sie nur aus Mitleid wieder bei ihm aufkreuzte.
Luc räuspert sich. »Der Chef hat gesagt, ich soll Sie zu ihm schicken, wenn Sie hier hereinschneien. Der Alte muss geahnt haben, dass Sie es zu Hause nicht mehr aushalten würden.«
Renard muss sich nun endlich nicht mehr anstrengen, das Lächeln kommt ganz von allein. »Das hat schon seine Gründe, warum er Chef der Kriminalpolizei geworden ist.«
Er macht sich auf den Weg zum Büro des Alten.
»Anklopfen war noch nie ihre Stärke«, begrüßt ihn der Chef.
»Ich habe mich nicht verändert.«
Sein Chef sieht einen Moment so aus, als wolle er widersprechen, doch stattdessen dreht er sich bloß um und sieht aus dem Fenster. Draußen leuchtet das Zuckerbäckergebirge der Kathedrale La Major, und dahinter liegt das Mittelmeer, ein tiefblaues, gekräuseltes Tischtuch, das bis nach Afrika reicht. Renard folgt dem Blick seines Vorgesetzten. Eine große Jacht gleitet aus dem Vieux Port, vorbei am Fort Saint-Jean und am Mucem, und er weiß, dass der Alte da jetzt am liebsten das Steuerrad halten würde.
»Eines ist mal sicher«, fährt Renard rasch fort, damit das Schweigen nicht noch länger und peinlich wird, »ich bin nicht hier, um einen Urlaubsantrag einzureichen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs rauszugehen.«
»Setzen Sie sich bitte.«
Renard ignoriert die Aufforderung, tritt nah ans Fenster und schaut noch immer hinaus. »Ich mag die Farben von Marseille«, sagt er.
»Der Himmel ist blau, der Koks ist weiß und das Blut rot. Irgendwann wird jeder sentimental.«
»Ich bin nicht sentimental. Ich bin bloß geheilt.«
Der Alte stellt sich neben ihn ans Fenster, sieht der Jacht nach, die Kurs auf das offene Meer nimmt. »Müssen Sie noch Medikamente nehmen, Renard?«
»Diese Frage gefällt mir nicht.«
»Mir auch nicht. Aber ich kann Sie nicht einfach in die Brigade Antigang zurückschicken. Sie gehen da raus in die Hochhäuser, um Dealer hochzunehmen. Und dann müssen Sie mitten im Einsatz selbst ein paar Pillen einwerfen? Irgendeins von den Kids wird Sie mit dem Handy filmen und das ins Internet stellen, wie sie es jetzt ständig tun, wenn wir zu Verhaftungen oder bei Demonstrationen ausrücken. Unmöglich. Ich kann Sie da nicht zurückschicken.«
Renard spürt, wie sich seine Kiefermuskeln anspannen, spürt die Hände, die er zu Fäusten ballt, bis sie ihm wehtun. Entspann dich. »Ich bin fit wie ein Zwanzigjähriger«, knirscht er.
»Da haben Sie aber schon lange nicht mehr in den Spiegel gesehen.« Sein Chef legt ihm die Hand auf die Schulter, begütigend, aber auch schwer. »Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Sie wissen selbst am besten, was die Ärzte gesagt haben. Es ist ein Wunder, dass Sie es überstanden haben. Aber Sie müssen ihren Körper erst wieder aufbauen. Wie ein Sportler trainieren muss, der lange verletzt war: langsam, methodisch, jeden Tag ein bisschen mehr.«
Renard lacht bitter auf. »Und wo wollen sie mich zum Joggen hinschicken, Chef?«
»An die Côte Bleue.«
Renard braucht einen Augenblick, bis er versteht, dass das kein Scherz war. »An die Küste?«
»Nach Méjean. Ein Fischerdorf. Und ein paar ziemlich teure Sommerhäuser. Ein winziger Jachthafen. Ein einfaches Fischrestaurant.«
»Ich war vor hundert Jahren mal da.« Mit Annabelle. Aber seine Ex-Frau hatte Angst vor dem Meer, was nicht unbedingt die beste Phobie ist, die man in Marseille haben kann.
»Es geht um einen Mord«, fährt der Alte fort.
»Warum schicken Sie keinen Kollegen hin? Ich hab mich die letzten zehn Jahre um Drogen gekümmert. Mord, das ist lange her.«
»Dieser Mord ist auch lange her. Dreißig Jahre.«
»Dreißig Jahre?!« Jetzt kann sich Renard doch nicht länger beherrschen. »Merde, Sie binden mir einen dreißig Jahre alten Fall ans Bein?! Sagen Sie mir doch gleich ins Gesicht, dass Sie mir nichts mehr zutrauen!«
Der Chef ist von dem Ausbruch weder überrascht, noch empört er ihn. Er lächelt auf einmal so arrogant wie ein junger Dealer, der den Stoff versteckt hat, bevor ihn die Flics hochnehmen konnten. »Ich gebe Ihnen diesen Fall, weil ich Ihnen besonders viel zutraue, Renard. Ich muss einen Bluthund nach Méjean schicken, einen Einzelkämpfer, der den Kopf frei hat, weil er sich nicht mit anderen Fällen befassen muss. Und ich brauche jemanden, der Deutsch spricht. Ihre Mutter war doch Deutsche, oder nicht?«
»Meine Großmutter. Ich war zweimal in Bad Kreuznach, als ich ein Kind war, und einmal in Berlin. Deutsch war meine zweite Fremdsprache auf dem Lycée, und die Lehrerin hat mich nur vor dem Sitzenbleiben gerettet, nachdem ich ihr versprochen habe, Deutsch abzuwählen.«
»Damit sind Sie immer noch weit besser qualifiziert als jeder andere auf diesem Flur.«
»Chef, wenn das Verbrechen dreißig Jahre her ist, dann liegt ein Meter Staub auf der Akte.«
»Nicht mehr. Ich habe die Akte rausgeholt, um etwas Neues darin einzuheften. Das heißt: Sie werden es einheften. Die erste neue Spur seit dreißig Jahren.«
»Eine neue Spur?« Renard könnte sich dafür in den Hintern treten, dass er seine Neugier so verrät, aber er kann nicht anders. Jetzt ist er schon gefangen, hat den Köder geschluckt. Jetzt will er es auch wissen. Bluthund, he? Er hat Witterung aufgenommen.
»Das ist heute hereingekommen«, erklärt sein Chef, beugt sich über seinen Schreibtisch, wühlt herum und hebt ein Blatt Papier und einen Briefumschlag hoch.
Renard erkennt eine fremde Briefmarke auf dem Umschlag, sieht genauer hin: eine deutsche Briefmarke.
»Darf ich den Brief lesen?«, fragt er.
Der Chef gibt ihm das Schreiben und schiebt dann einen vollgepackten Leitzordner über den Tisch. »Lesen Sie das in den nächsten Stunden. Und übermorgen fahren Sie nach Méjean.«
II
3
Es war Michael Schiller, der – ironisch lächelnd und gleichzeitig ein wenig stolz – die Tür zu dem Haus aufgeschlossen hatte. Und die theatralische Geste, mit denen er ihnen danach den Vortritt ließ, sie aufforderte, über die Schwelle zu treten, das war den anderen fünf so selbstverständlich erschienen, dass sie sich nicht einmal darüber lustig gemacht hatten. 1984, das Orwell-Jahr, der Sommer nach dem Abitur. Michael hatte die Clique in das Ferienhaus seiner Eltern eingeladen, die in jenem Jahr eine Kreuzfahrt unternahmen oder eine Karawanenreise oder sonst irgendetwas Exklusives. Sie hatten ihm zwei Wochen in ihrem Domizil als Belohnung für das Abitur geschenkt, während sie selbst ans andere Ende der Welt reisten. Es sollte für Michael und seine Freunde der letzte gemeinsame Urlaub werden, bevor sie sich ins Studium stürzen würden oder in sonst etwas, auf jeden Fall ins richtige Leben.
Sie hatten den 5er-BMW der Schillers genommen und sich unvorschriftsmäßig zu viert auf der Rückbank zusammengezwängt. »Ein Fünfer heißt Fünfer, weil er sechs Plätze hat«, hatte Katsche gesagt, der Herr Professor, der als Einziger noch keinen Führerschein hatte und deshalb zur Strafe die ganzen tausend Kilometer vom Rheinland bis in den Süden auf der Rückbank ausharren musste, während alle anderen irgendwann mal fahren oder auf dem Beifahrersitz die Landkarte checken und die Beine ausstrecken durften: Dorothea Bessenich, die schon ewig mit Oliver Kaczmarek zusammen war und allen immer wieder sagte, wie sehr sie sich freute, endlich im Mittelmeer und nicht im Hallenbad ihre Bahnen zu ziehen, und dass sie trotzdem Bücher mitgenommen hatte, um sich schon einmal aufs Lehramtsstudium vorzubereiten. Rüdiger von und zu, der unbedingt seine Staffelei mitschleppen wollte, die aber nicht mehr in den Kofferraum gepasst hatte und schließlich auf dem Dachgepäckträger festgezurrt worden war. Babs Möller, die für die ganze Clique Sandwiches gemacht hatte, so viele, als würden sie nonstop bis nach Südafrika fahren. Und Claudia Bornheim, seit dem Abi nun die Ex-Schülersprecherin, Michaels Freundin, die sich auf dem Beifahrersitz aus Javaanse Jongens dünne Zigaretten drehte, bis der ganze Fußraum voller Tabakkrümel lag und sich Katsche beschwerte, noch eine Selbstgedrehte mehr und er würde das Auto vollkotzen.
Michael hatte meistens am Steuer gesessen und Kilometer gefressen. Sie hatten so lange wie möglich SWF3 gehört, Frank Laufenberg und »Trio« und minutenlange Verkehrsdurchsagen über Monsterstaus an irgendwelchen Autobahnkreuzen vor Leverkusen oder Karlsruhe. Aber irgendwann war bloß noch Rauschen aus dem Apparat gekommen, und die französischen Sender, die sie stattdessen empfingen, brachten pausenlos französisches Gequatsche oder englische Popsongs mit französischen Texten. Claudia musste schließlich das Kassettenteil im Autoradio füllen, damit Michael »Our House« von Madness und »True« von Spandau Ballet mitsingen konnte. Irgendwann überhitzte die Anlage jedoch und fraß die Bänder, und die letzten paar Kilometer mussten sie dem Fahrtwind lauschen, was irgendwie auch nicht so schlecht war.
Michael war nicht größer als Claudia, aber sportlich, dunkelblond, und er hatte Augen, die so blau waren wie das arktische Meer. Er fuhr so gelassen schnell wie Alain Prost, spielte Gitarre in einer Band und Volleyball in der A-Jugend-Landesliga (obwohl er dafür eigentlich nicht die richtige Körpergröße hatte), er trainierte ehrenamtlich eine Volleyballmannschaft, D-Jugend Mädchen, er hatte das beste Abitur gemacht, eins null, und er wusste nicht, was er in diesem Herbst studieren sollte, Kinderarzt oder Sportmediziner vielleicht oder doch etwas ganz anderes. Entweder liebte man Michael, oder man hasste ihn, und die fünf, die mit ihm im BMW saßen, liebten ihn.
Sie hatten nicht einmal elf Stunden gebraucht. Am späten Nachmittag lenkte Michael den BMW über enge, unfassbar steile Straßen, bis er vor dem Haus hielt. Seinen Freunden hatte er immer von der »Hütte« erzählt, die sich seine Eltern schon vor Jahren am Mittelmeer gekauft hatten und in der er schon manchen Sommer verbracht hatte. Aber das war nicht eine aus Natursteinen grob zusammengefügte Scheune, keine Baracke, kein billiger Kasten einer Ferienanlage: Das war ein moderner Bungalow mit einer großen Terrasse, mit großen Fenstern, mit einem vielleicht staubigen und trockenen, doch großen Garten drumherum. Von Michaels fünf Freunden wohnte nur Rüdiger daheim in einem Anwesen, das größer war als dieses Ferienhaus.
Michael ging halb um das Gebäude herum, schob an einer Seitenwand die Triebe eines violett blühenden Oleanders beiseite und zog einen lockeren Stein aus dem Mauerwerk. Er griff in die Lücke dahinter und holte einen Schlüssel hervor. Den steckte er ins Schloss der Eingangstür und verneigte sich galant wie ein Renaissancehöfling.
»Willkommen in Méjean!«, rief er und lachte, als könnte dieser Sommer niemals enden.
4
Sonntag, 29. Juni 2014. Rüdiger von Schwarzenburg dirigiert seinen weißen Bentley vorsichtig durch die Serpentinen. Kalte Luft strömt aus den Schlitzen der Klimaanlage, doch er spürt trotzdem, wie ihm der Schweiß das Rückgrat hinunterläuft. Er ist seit fünfzehn Stunden unterwegs, aber sein Kopf ist noch immer klar. Adrenalin, denkt er, die selbst produzierte Droge. Hinter dem Flughafen von Marignane bei Marseille sind die Straßen immer enger geworden. Er gleitet durch karge Hügel, Garrigue, trockenes, zähes Buschwerk, graue Felsen, der Duft nach Piniennadeln und heißer Erde. Selbst als er die Seitenscheibe hinunterfährt, hört er den Motor nicht, nur das millionenfache Sägen der Zikaden, ein an- und abschwellender Lärm wie aus irgendeiner höllischen elektrischen Maschine. Hinter einer Kurve: das Blau.
Die Calanque von Méjean ist wie ein antikes Theater und das Mittelmeer dessen Bühne: ein weites Halbrund aus Felsen, das sich in Falten und Stufen aus hundert Metern Höhe bis hinunter zu den Wellen erstreckt. An den äußersten Rändern bricht sich die Brandung weiß und schaumig am Stein, überwölbt Brocken, die dicht unter der Meeresoberfläche lauern, verliert sich in den innersten Bögen in erschöpften Zügen, die sanft über Kiesstrände streichen, vor und zurück, der Atem des Ozeans.
Pinien haben sich in Spalten, Risse, auf winzigste Vorsprünge gekrallt, ihre knorrigen, verdrehten Stämme schweben über dem Abgrund, ihre Äste werfen tanzende Schatten auf die Steine, und golden glänzt das Harz auf der Rinde. Tief unter ihm schimmert türkisgrün das flache Wasser in zwei von Molen ummauerten Becken. Petit Méjean und Grand Méjean, Rüdiger erinnert sich, wie sie damals darüber gelacht und nie herausgefunden haben, was denn das »Große« im tatsächlich doch so winzigen »Grand Méjean« sein mochte. Beide Häfen werden nur durch eine kurze, steile Landzunge voneinander getrennt, beide sind klein, das Wasser kaum eins fünfzig tief und so klar, dass die Bootsrümpfe auf dem Grund Schatten werfen. Ein paar Motorboote aus weißem Plastik, Halterungen für Hochseeangeln am Heck neben den Außenbordmotoren, einige Zodiacs, graue und schwarze Wülste, dazu Fischerkähne aus verbeultem Stahlblech und zwei Segler, deren Kiele so weit hochgeholt werden können, dass sie im flachen Wasser nicht auflaufen. Die meisten Boote sind kleiner als sein Bentley und kosten wahrscheinlich weniger als dessen Jahresinspektion.
Doch für jedes der Häuser, die sich wie die Pinien auf die Vorsprünge der felsigen Küste krallen, müsste Rüdiger schon einige Bilder verkaufen. Von vielen sieht man bloß Terrassen, Dächer, eine fensterlose Wand, oft nur ein Garagentor. Die einzige Straße, die sich zwischen ihnen hindurchwindet, wäre in Deutschland verboten. Ein schmales Asphaltband, das im Sturzflugwinkel in die Tiefe fällt, gleich darauf ebenso steil wieder ansteigt, absurde Spitzkehren schlägt. Einmal jagt er den Bentley über eine Kuppe wie eine Achterbahnkarre und fährt dabei bis zum letzten Moment blind, denn er sieht nicht, ob ihm jemand auf der Straße, auf der nur Platz für ein Auto ist, entgegenkommt.
Nur aus den Augenwinkeln erhascht er manchmal Details: ein weißes Haus, modern und kühl und klar wie der Traum jeder Art Directorin. Eine verwinkelte Bude, ockerfarben, der Putz feuchtigkeitsschlierig, die hat seit einem halben Jahrhundert kein Handwerker mehr gesehen.
Er hält an und erinnert sich, als wäre es gestern gewesen: eine schmale Steintreppe, die rechts von der Straße etwa zehn Meter steil einen Hang hinaufführt, und eine schiefe Pinie, die sich hoch darüberwölbt. Am Stamm klebt die abgestreifte Hülle einer Zikade, ein hohles Phantominsekt, so groß wie eine Fingerkuppe. In den Ästen darüber flirrt die Luft vom Gesang der lebenden Artgenossen.
Rüdiger zirkelt den Wagen sorgfältig vor der Treppe bis auf Millimeter an den Hang, damit auf der Straße noch gerade eben Platz bleibt, um vorbeizufahren – sie führt hier steil hinab, er greift sich einen im Rinnstein liegenden großen Stein und verkeilt ihn zur Sicherheit unter dem linken Vorderrad. So steht es nicht im Benutzerhandbuch des Bentleys, aber so haben sie es schon vor dreißig Jahren gemacht. Die Treppe führt ihn auf eine Terrasse, dahinter die Fenster eines Zimmers und ein Nebeneingang. Eine zweite Treppe, weiter den Hang hoch. Eine weitere große Terrasse aus Holzplanken, wie auf einem Schiff, eine schmiedeeiserne Pergola, die eine schwere Decke aus wildem Wein trägt, in dessen Blättern Wespen und Bienen gegen die Zikaden ansummen wie verrückt.
Das Haus ist ockerrot verputzt, Fünfzigerjahre, breite Fenster, gut erhalten, ein Hauch von Frank Lloyd Wright am Mittelmeer. Er holt ein Blatt Papier aus der Tasche seiner cremefarbenen Leinenhose, blickt einen Augenblick darauf, zögert, geht weiter. Der Oleander an der Seitenwand ist größer geworden, sechs Meter hoch, schätzt er, mindestens, die ersten violetten Blüten, es ist noch früh im Sommer, ragen über die unterste Reihe der braunroten Dachschindeln hinaus. Er muss regelrecht eintauchen in den Busch, die Luft schmeckt süß und schwer, und der Duft ist so intensiv, dass ihm unwillkürlich eine Szene ins Gedächtnis kommt: Nach dem Bad hatte ihn Hermine, die Haushaltshilfe seiner Eltern, in ein weiches, flauschiges Handtuch gehüllt, das ganz genau so geduftet hat, Lavendel, Oleander, Vernel. Seine Mutter hatte den Weichspüler bald wieder verbannt, weil sie glaubte, dass er bei seinem jüngeren, behinderten Bruder allergische Anfälle ausgelöst hatte. Rüdiger atmet den Duft ein, Mittelmeer und Siebzigerjahre, verharrt einen Moment so, mitten im Oleander, tastet dann mit der Rechten an der Wand herum. Der lockere Stein. Der Hohlraum dahinter.
Und dort, tatsächlich, der Schlüssel.
Hinter dem Bentley stoppt ein schwarzes Mini Cabrio, das Faltdach ist eingeklappt. Der Wagen wirkt neben der Luxuskarosse wie eine Barkasse neben einem Ozeanriesen. Nein, korrigiert sich Rüdiger, falsches Bild: wie eine Motorjacht neben einem Dampfer. Schnell, ein bisschen frech, für Leute, die durchs Leben rauschen. Er ist nicht überrascht, als er die Fahrerin erkennt. Rüdiger erhebt sich vom Deckstuhl aus echtem Teak, den er in den Schatten der Pergola geschoben hat, und schreitet die Treppen hinunter zur Straße.
»Ich habe geahnt, dass du schon da bist«, sagt Claudia Bornheim und bietet ihm ihre Wange zum Begrüßungskuss. »Noch immer bist du Rüdiger der Erste.«
»Ich habe ein Angebot bekommen, das ich nicht ablehnen konnte.«
Sie lachen beide, verlegen. »Dieser Brief …«, beginnt Claudia, weiß dann aber nicht weiter.
Rüdiger lächelt. Ein melancholisches Lächeln, erinnert sich Claudia, ein Lächeln, das schon vor dreißig Jahren mehr als eine Freundin von ihr bis in den Schlaf verfolgt hat. Auf einmal wird ihr bewusst, dass es damals unecht war, nicht direkt verlogen, aber eben auch nicht tief. Erst jetzt, denkt sie, ist Rüdigers Melancholie echt. Sie hat ihn über all die Zeit nie aus den Augen verloren. Sie haben sich ein-, zweimal im Jahr getroffen, regelmäßiger nach dem Mauerfall, als Berlin zum Epizentrum von Kunst und Politik mutierte und es leichter wurde, von einer Sphäre in die andere zu springen. Irgendwann werde ich dich porträtieren, für irgendein Ministerium, hat er oft gescherzt. Eigentlich könnte sie ihm jetzt einen Auftrag erteilen, doch Bilder für die Galerie der Ministerien werden aus Steuermitteln bezahlt, und da ist es politisch klüger, als Landesministerin auch einen im Land ansässigen Künstler zu bedenken. Wer weiß, wenn sie denn erst in Berlin sein wird … Falls Rüdiger sie dann noch malen will. Sie hat von Carmens Tod erfahren, auch wenn sie keine Zeit gehabt hat, zur Beerdigung zu gehen, es war gerade Wahlkampf. Und sie hat von den Gerüchten gehört, dass Rüdiger seither keinen Pinsel mehr angerührt hat.
»Hast du auch so einen Brief bekommen? So eine …. seltsame Einladung?«, fragt sie vorsichtig.
Er nickt. »Warum wäre ich wohl sonst hier?«
»Und, was denkst du darüber?«
»Ich bin hier, um mich überraschen zu lassen.« Irgendetwas auf dem Meer ist so interessant, dass Rüdiger angestrengt dorthin sieht, Claudia allerdings kann nichts sehen, außer einer geriffelten blauen Fläche, in der sich selten genug der weiße Riss einer Schaumkrone auftut.
»Wann haben wir uns zuletzt gesehen?«, fragt sie, um das Thema zu wechseln. »Das war auf dieser Ausstellung in Mitte, oder?«
»Muss Jahre her sein.«
»Neun Monate. Mathe war noch nie deine Stärke.«
Rüdiger hilft ihr, den Koffer aus dem Mini zu hieven. »Hübsches Auto«, sagt er. Auch er verspürt nicht das Bedürfnis, diese Briefe anzusprechen, nicht jetzt schon.
»Ich habe zu Hause so einen. Und meine Referentin bucht mir immer einen Mini als Mietwagen, wenn es geht. Dann muss ich mich nicht umgewöhnen. Du weißt ja: Frau am Steuer!«
Er lacht. »Und das von einer Emanze wie dir!«
Claudia ist dreimal durch die praktische Prüfung gefallen. Bis heute glaubt sie, dass es nicht an ihren Fahrkünsten gelegen hat, sondern an dem schmierigen älteren Prüfer und daran, wie er die lilafarbene Latzhose und ihren Palästinenserschal angestarrt hat, mit denen sie beharrlich bei allen vier Führerscheinprüfungen aufgekreuzt war. Sie ist bereit, jedem Mann, der darüber einen Frauenwitz reißt, die Augen auszukratzen. Aber in diesem Augenblick fällt ihr nichts anderes ein, als dieser billige Scherz auf eigene Kosten, um die Verlegenheit zu überwinden.
Sie gehen die erste Treppe hoch. Die zweite. Die Terrasse unter der Pergola. Die offene Eingangstür. Plötzlich bleibt Claudia stehen, berührt Rüdiger leicht am Arm. »Warte bitte.«
»Die Aussicht ist wirklich fantastisch.« Er deutet auf das Mittelmeer, das sie von hier aus viel deutlicher sehen, eingerahmt zwischen Pinienzweigen und Oleanderblüten, über den Wellen ein feiner Hitzedunst, als kämen Gespenster aus der Tiefe.
»Es ist nicht die Aussicht, die mich umhaut. Und das weißt du auch verdammt gut.« Claudia deutet auf die Tür, zögert. »Ich habe Angst, da reinzugehen.«
Er schüttelt den Kopf. »Das tut nicht weh«, beruhigt er sie. »Ich war schon drinnen. Es sieht beinahe genauso aus wie vor dreißig Jahren.«
»Das meine ich ja.«
»Im Wohnzimmer steht sogar noch der alte Hi-Fi-Turm mit dem Technics-Plattenspieler. Weißt du noch, wie du immer ›Wish you were here‹ aufgelegt hast? Und wie du beinahe auf Katsche losgegangen wärst, weil der die Nadel auf die Platte hat fallen lassen?«
Sie lächelt, fast gegen ihren Willen. »Oliver war schon immer der Typ fürs Theoretische. Der Mann mit den zwei linken Händen. Das darf ich übrigens auch nicht mehr laut sagen, sonst gibt es einen Shitstorm, und kein Linkshänder wählt mich mehr.«
»Meinst du, der Katsche kommt auch?«
Jetzt sind sie doch wieder bei den Briefen, irgendwie. Claudia atmet durch. »Ich habe keine Ahnung«, gesteht sie. »Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren. Und Dorothea auch. Soweit ich weiß, sind die beiden immer noch zusammen. Ewige Liebe … hättest du gedacht, dass es so etwas gibt?«
»Ja«, antwortet Rüdiger und blickt auf das Meer. So blau. So fern.
Claudia hätte sich ohrfeigen können. »Tut mir leid«, stammelt sie. »Carmen …«
»Es ist gut, dass ich hier bin«, erwidert er sanft. Er lächelt wieder, und gerade weil er traurig ist, merkt er nicht einmal, wie geheimnisvoll und begehrenswert er damit wirkt.
»Ich bekomme von Dorothea und Oliver jedes Jahr eine Karte zu Weihnachten, und zwar …«
»… sieben Tage vor Heiligabend!« Jetzt grinst Rüdiger plötzlich wieder wie ein Teenager. »Ich auch! Jedes Jahr ungefähr derselbe nichtssagende Text. Jedes Jahr ungefähr derselbe Weihnachtsbaum mit einem Weihnachtsmann davor.«
»Hast du ihnen je zurückgeschrieben?«
Nun müssen sie beide laut lachen.
»Und Babs?«, fragt sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hat.
»Die ist in einem schwarzen Loch verschwunden, und das hat sie ja leider auch so gewollt.« Rüdiger hat noch ihre Stimme im Ohr, damals, als die Polizei sie endlich abreisen ließ, als ihre Eltern sie abholten aus Méjean. Wie Babs ihnen allen entgegengeschleudert hat, dass sie sie nie, nie, nie wiedersehen wollte.
»Ich habe eine Zeit lang versucht, wieder an sie heranzukommen«, sagt Claudia. »Habe mich bei alten Schulfreunden erkundigt und sie ein-, zweimal gegoogelt. Babs wohnt ja praktisch bei mir um die Ecke. Sie ist bei der Raiffeisenbank. Und da hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Detlev Ficken.«
»Ficken?!«
»Nach der Hochzeit hat er Barbaras Namen angenommen.«
Rüdiger kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Es gibt noch Gerechtigkeit auf der Welt. Ficken war nicht gerade Barbaras größtes Hobby auf der Schule.«
Sie stößt ihm in die Seite. »Sei nicht gemein. Babs war doch ganz hübsch.«
»Ich wusste nicht, dass du den gleichen Geschmack hast wie Peter Paul Rubens.«
»Und Babs war die größte Ulknudel im Land«, fährt Claudia unbeirrt fort. »Und die beste Köchin. Ohne sie wären wir verhungert. Und wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass sie unsere Clique zusammengehalten hat.«
Rüdiger nickt. »Ich fresse Kreide. Babs ist die Letzte, die Spott verdient. Und Michaels Tod hat sie damals besonders mitgenommen. Fast genauso schlimm wie dich natürlich«, setzt er rasch hinzu.
»Fast so wie mich, ja«, murmelt Claudia. Sie greift den Koffer und tritt über die Türschwelle. Sie sieht sich im Wohnzimmer um: weiß verputzte Wände, ein niedriger Holztisch, Fünfzigerjahre-Sessel, die viel bequemer sind, als sie aussehen, der Hi-Fi-Turm, kein Fernseher, ein altes Klavier, Stiche an den Wänden, irgendwelche Hafenszenen aus Marseille, ein Kamin, bei dem sie sich schon damals gefragt hat, ob in dem – in einem Haus am Mittelmeer! – schon jemals ein Feuer gebrannt hat. Auf einem Beistelltischchen steht noch dasselbe orangefarbene Wählscheibentelefon wie damals; wann hat sie zuletzt einen solchen Apparat benutzt, mit Bleistift in den Löchern der Wählscheibe, damit die Zeigefingerkuppe vom ständigen Wählen nicht anschwillt? Dass muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als sie ihren letzten Euroscheck ausgestellt hat.
Hier hat wirklich niemand etwas angerührt, denkt sie und schaudert unwillkürlich. Wie ein Museum. Oder ein Spukhaus.
»Weißt du«, sagt sie zögernd, »die ersten Jahre habe ich mich immer wieder bei dem Kripobeamten – dem mit dem Walrossschnauzbart, erinnerst du dich? –, na, bei dem jedenfalls habe ich nachgefragt, ob es etwas Neues gibt. Zu Michael. Zu dem Mörder. Ob er etwas von seinen französischen Kollegen gehört hat. Hat er nie. Also habe ich irgendwann nicht mehr gefragt. Und dann kommt vorgestern dieser Brief …« Sie starrt ihn an. »Meinst du, wir haben alle so einen bekommen? Die ganze Clique von früher?«
»Wir werden sehen, ob die anderen drei hierherkommen.« Rüdiger hebt entschuldigend die Hände. »Ich weiß es nicht. Aber es liest sich so, als hätten sie auch Briefe erhalten.«
»Das kann doch nur einer von uns gewesen sein«, murmelt Claudia. »Wer sonst hätte so etwas schreiben können? Und wer erinnert sich überhaupt noch an dieses alte Verbrechen? Ob das eine Erpressung ist? Oder macht irgendjemand aus unserer alten Clique mit uns so eine Art üblen hinterhältigen Scherz?«
»Für mich klingt das weder nach einer Erpressung noch nach einem Scherz«, sagt Rüdiger. »Ich habe keine Ahnung, ob es von einem der anderen kommt, aber für mich liest sich das so, als wüsste da plötzlich jemand, wer vor dreißig Jahren Michael umgebracht hat.«
Vor dem Haus rasselt eine Weile ein Dieselmotor, bevor er endlich abgestellt wird. Rüdiger blickt die Treppen hinunter bis zur Straße. »Ein Skoda Kombi«, sagt er zu Claudia, die noch immer im Wohnzimmer steht und sich umsieht. »Mit deutschem Kennzeichen. BN.«
Das Auto ist weiß, nicht mehr neu, die Heckscheiben sind mit Sonnenschutzblenden verklebt, auf denen Janoschs Tigerente leuchtet. Die Beifahrertür wird zuerst geöffnet. »Katsche!«, ruft Claudia, die auf die Terrasse getreten ist. Sie springt die Stufen hinunter. Rüdiger folgt ihr, deutlich langsamer.
»So hat mich schon lange keiner mehr genannt«, erwidert Oliver Kaczmarek, steigt aus und streckt sich. Er trägt eine Leinenhose, ein hellblaues langärmliges Hemd und beugt sich zum Rücksitz, von wo er einen Strohhut holt, den er sich auf den Kopf setzt.
»Du hast dich echt nicht verändert«, ruft Claudia, »du bist sogar deiner Brille treu geblieben!« Sie bleibt einen Moment lang vor ihm stehen, bevor sie sich dazu durchringt, ihn kurz zu umarmen.
»Du siehst genauso aus wie im Fernsehen«, erklärt Oliver. »Und du auch!«, ruft er Rüdiger zu. »Euch Politiker sieht man ja dauernd auf der Mattscheibe, aber welcher andere Pinselschwinger schafft es schon bis ins Fernsehen?«
Rüdiger hat eigentlich die Rechte ausstrecken wollen zum Handschlag, ändert im letzten Moment jedoch seine Meinung und deutet bloß eine Art Winken an. »Manchmal stehen auch Wissenschaftler vor der Kamera«, erinnert er ihn. »Du bist doch garantiert an der Uni, oder? Professor Doktor Oliver Kaczmarek! Das hört sich an wie aus einem Film mit Heinz Rühmann.«
»Das mit dem Doktor stimmt«, brummt Oliver und schaut ein wenig mürrisch drein.
Inzwischen ist auch die Fahrertür aufgegangen. Dorothea Kaczmarek steigt aus, bleibt unschlüssig hinter der geöffneten Tür stehen. Claudia lächelt, geht um den Skoda herum und umarmt sie. »Unsere Nixe ist da!«, ruft sie, vielleicht ein wenig zu fröhlich. »Die Einzige, die ihrem Macker niemals einen Tritt gegeben hat. Seit wann seid ihr zusammen, ihr beiden? Seit der zehnten Klasse? Der elften? Zweiunddreißig Jahre?«
»Dreiunddreißig«, korrigiert Dorothea und versucht sich an einem Lächeln.
»Das macht ein Dritteljahrhundert«, erklärt ihr Mann.
»Jetzt, wo du es sagst, fällt es selbst mir auf«, murmelt Rüdiger, aber so leise, dass sie ihn nicht hören.
»Dreiunddreißig Jahre!«, fährt Claudia fort und lacht. »Du musst mir deinen Trick verraten. Ich glaube, ich habe es noch mit keinem Mann auch nur dreiunddreißig Wochen ausgehalten.«
Dorothea sieht sie verwundert an. »Nicht mal mit Michael?«
Das Schweigen danach ist so tief, dass das Sägen der Zikaden wirkt, als habe jemand plötzlich den Tonregler höher gedreht.
Dorothea ist rot geworden. »Wir haben einen Brief bekommen«, stottert sie.
Da entschließt sich Rüdiger, ebenfalls um das Auto herumzugehen. Er berührt sie sanft am Ellenbogen, zieht sie ein paar Schritte vom Wagen fort, schließt die Fahrertür und umarmt sie lange. »Wir wissen auch nicht mehr als ihr«, erklärt er. »Sind selbst gerade erst angekommen.« Er spürt, wie Dorothea in seinen Armen erzittert, sich an ihn klammert.
»Wie lange wird das hier dauern? Irgendwann sind die Schulferien vorbei, und ich muss wieder unterrichten. Und da ist noch unsere Tochter und, ich meine …«
Oliver bedenkt sie mit einem mitleidigen Blick. »Ich bin sicher, dass sich diese Sache schnell erledigt haben wird. Ein Wochenende vielleicht. Irgendjemand macht sich über uns lustig. Das ist lächerlich. Ich wäre ja niemals hierhingefahren, aber«, er sieht Claudia an, »so hält eine Beziehung dreiunddreißig Jahre, wenn man hin und wieder den Wünschen der Gnädigsten nachgibt.«
»Geht jeder wieder auf sein Zimmer?«, fragt Dorothea. »Von früher?«
Niemand antwortet, doch alle sehen zur Treppe. Rüdiger ist der Erste, der sich auf den Weg macht. Die anderen folgen. Nur Dorothea bleibt noch eine Minute neben dem Auto stehen und starrt mit leerem Blick die Straße hinunter. Dann öffnet sie die Heckklappe und holt eine große Reisetasche heraus. Sie schultert ihre Last und folgt den anderen, die bereits im Haus verschwunden sind.
Sie gehen in den Salon, rücken Stühle hierhin, dorthin, stellen Taschen ab. Niemand geht auf ein Zimmer. Oliver ist auf der Terrasse geblieben, blickt aufs Meer, wendet den anderen den Rücken zu. Seine Frau schiebt einen Sessel Richtung Kamin. Rüdiger setzt sich auf den Klavierhocker. Da lässt Dorothea den Sessel wieder los, geht quer durch den Raum und setzt sich auf den Stuhl neben den Maler. Claudia beobachtet sie dabei, wirft einen Blick auf Oliver draußen, lächelt wissend, sagt nichts.
Draußen hupt jemand. »Ein Taxi«, ruft Oliver. »Mit unserer Babs.« Er macht jedoch keine Anstalten hinunterzugehen.
Und bevor die anderen auch nur richtig aus dem Haus getreten sind, steht Barbara Möller schon auf der Terrasse. Sie hat zwei Stufen auf einmal genommen, atmet heftig, ihre Wangen sind rot, in ihrer Rechten schwingt sie einen violetten Plastikrollkoffer, den sie achtlos abstellt. Sie breitet die Arme aus. »Klar, immer bin ich die Letzte!«, ruft sie mit gespielter Empörung.
Und dann ist es plötzlich so, als hätte es diese Szene vor dreißig Jahren nie gegeben und ihre heftigen Worte. Als hätten sie alle Babs mindestens einmal pro Woche gesehen, wenn nicht jeden Tag. Sie strahlt etwas aus, eine Herzlichkeit, die die anderen anzieht wie ein Magnet Eisenspäne. Rüdiger umarmt sie, verschwindet trotz seiner Körpergröße fast in ihrer Fülligkeit; Dorothea umarmt sie, hat sogar Tränen in den Augen; selbst Oliver drückt sie sanft gegen sein gebügeltes Hemd. Nur Claudia bleibt im Türrahmen stehen und hebt leicht die Hand. Barbara ignoriert jedoch ihre Zurückhaltung, geht mit großen Schritten zu ihr und drückt sie an ihren Busen.
»Babs«, sagt Rüdiger, »gut, dass du da bist. Jetzt werden wir wenigstens nicht verhungern.«
»Alter Macho«, spottet Claudia. »Du kannst selbst kochen!«
»Also, wenn ich mir den Rüdiger so ansehe, dann glaube ich nicht, dass er das kann«, verkündet Barbara und klingt dabei nicht unzufrieden. »Besser, ich übernehme das.«
»Du hast dich kein bisschen verändert, Babs«, meint Dorothea.
Sie seufzt theatralisch, lacht aber. »Ich habe mich um zwanzig Pfund verändert. Das ist die wahre Bedeutung von Babyspeck: zehn Pfund pro Baby!«
»Du hast zwei Kinder?«, entfährt es Claudia. Zu spät bemerkt sie die Peinlichkeit ihres Ausrufs, als hätte sie Barbara so etwas nie zugetraut. Und ein ganz klein wenig neidisch klingt es auch.
»Zwillinge«, erklärt sie stolz, »Anfängerglück. Die erste Schwangerschaft und gleich ein Doppelvolltreffer. Junge und Mädchen. Besser geht es nicht. Die machen schon bald Abitur!«
»Abitur …« Oliver Kaczmarek hat das nur gemurmelt, aber jeder hat ihn gehört. Sie schweigen. Er räuspert sich. »Wir sind tatsächlich alle da. Die alte Abi-Clique. Abgesehen von Michael natürlich.«
»Habt ihr auch …« Barbara muss den Satz nicht vollenden, sie blickt fragend in die ratlosen Gesichter der alten Freunde.
»Sieht so aus, als hätte keiner von uns diese Briefe geschrieben«, vermutet Oliver. »Sieht eher so aus, als hätte jemand anderer die Clique einbestellt. Zum Jubiläum.«
»Sei nicht so geschmacklos, Katsche«, sagt Rüdiger.
»Wer sollte das denn sonst gewesen sein?«, fragt Claudia, und es gelingt ihr nur mühsam, dabei nicht aggressiv zu klingen. »Eigentlich kann doch nur einer von uns diese Briefe geschrieben haben. Mein Brief jedenfalls klingt so …«, sie sucht nach dem treffenden Wort, entscheidet sich dann jedoch lieber für eine unverfänglichere Formulierung, »… so gut informiert.«
»Aber Oliver hat doch recht«, pflichtet ihm seine Frau bei. »Jemand hat uns alle antanzen lassen, und zumindest unser Brief hatte keinen Absender. Den Stempel habe ich nicht lesen können. Wir sind alle nach Méjean gekommen. Irgendjemand anderer muss uns hierherge…«, sie will sagen »gezwungen«, hustet verlegen, fährt dann fort: »gelockt haben.«
Die anderen schütteln den Kopf, heben die Achseln, fuchteln verärgert mit den Händen herum. »Hast du was herausgekriegt?«, fragt Oliver Claudia.
»Warum ich?«, erwidert sie und ärgert sich gleich, dass sie so defensiv klingt. Katsche hat so eine Art, die sie wahnsinnig macht, das hat sie nach all den Jahren verdrängt.
»Du bist schließlich Ministerin. Da hat man doch einen kurzen Draht zu Kripoleuten oder Verfassungsschützern oder so. Hast du denen den Brief nicht gezeigt?«
»So funktioniert Politik nicht, Katsche«, erwidert Claudia, eine Spur zu scharf. Aber ehrlich, gewissermaßen. Tatsächlich kennt sie den Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz ganz gut. Aber wenn sie dem den Brief gezeigt hätte, dann hätte er den Brief wiederum irgendeinem Mitarbeiter gezeigt und der … und irgendwann wäre das in der Westfälischen Rundschau gelandet oder gar in der Bild: »Ministerin in alten rätselhaften Mord verwickelt«. Das ist genau die skandalträchtige Schlagzeile, die sie auf gar keinen Fall provozieren will.
»Und jetzt?«, fragt Barbara. »Ich meine, wir sind jetzt alle hier. Aber wie geht es weiter? In dem Brief steht davon nichts, oder?«
Niemand antwortet, bis Rüdiger seufzt. »Sieht so aus, als müssten wir einfach abwarten, was passiert«, verkündet er.
Dorothea und Oliver haben das Zimmer von einst bezogen: ein kleiner Raum, gerade Platz genug für ein Doppelbett, einen Kleiderschrank, einen winzigen Tisch, aber keinen Stuhl. Das Zimmer liegt jenseits von Salon und Küche, einen schmalen Flur hinunter, ein paar Stufen hinauf – das Haus ist am Hang gebaut, überall gibt es Treppen –, das Fenster weist auf einen trockenen Garten: Oleander, Pinien, Ginster, viel nackter Fels, dazwischen Kieswege. Nichts, das man ständig gießen müsste.
»Zähes Grünzeug«, meint Oliver und deutet mit dem Kinn nach draußen. Er liegt auf dem Bett und hat sich beide Kissen unter Kopf und Schultern geschoben, damit er bequemer hinaussehen kann.
»Ich habe bei uns den Rasensprenger programmiert«, erwidert seine Frau. Auch in Bonn kann der Sommer heiß und trocken sein, und man kann nie wissen. Dorothea liebt ihren Garten, die kleine grüne Insel hinter dem Haus, Rosen, Stockrosen, eine vorwitzige Birke und einen gelben Oleander, dessen Trieb sie vor dreißig Jahren in Méjean abgeschnitten und nach Hause gebracht hat, trotz allem. Die Pflanze ist im Grunde zu empfindlich für Deutschland, sie hat sie im Topf aber zu immerhin fast zwei Metern Höhe gezogen und schleppt sie jeden Herbst ins Wohnzimmer, wo der Oleander am großen Fenster überwintert. Sie steht am Schrank, räumt Kleidung aus der Reisetasche ein, hält inne: Zwischen Olivers Hemden zieht sie ein zerfleddertes Buch mit braunem Umschlag hervor. Informiert reisen: Provence.