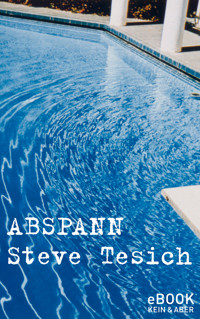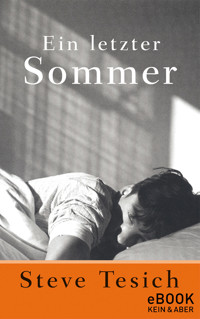
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
East-Chicago, 1960: Daniel Price ist achtzehn und schließt gerade zusammen mit seinen Freunden Larry und Billy die Highschool ab. Die Zukunft wartet auf sie, aber sie haben keine Ahnung, wie sie aussehen wird. Vor ihnen liegt ein Sommer der Entscheidungen und viel schneller als erwartet trennen sich ihre Wege: Billy wählt das ruhige Leben, Larry die Revolte und Daniel bleibt zunächst unentschlossen. Das ändert sich schlagartig, als er sich in die unergründliche Rachel verliebt. Sie ist für ihn das Versprechen einer großen weiten Welt, die Flucht aus den Konflikten seiner schönen, exotisch anmutenden Mutter und seinem krebskranken, verbitterten Vater. Doch Daniels Liebesglück ist überschattet von Rachels Geheimnis, das ihn immer tiefer in den Sog seiner widersprüchlichen Gefühlen zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Steve Tesich
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www. keinundaber.ch
Über den Autor
ÜBER DEN AUTOR
Steve Tesich wurde 1942 in Užice geboren und kam im Alter von vierzehn Jahren nach Indiana/USA. Er studierte russische Literatur an den Universitäten von Indiana und Columbia und promovierte 1967. Er schrieb zahlreiche Stücke und Drehbücher, u. a. das mit einem Oscar ausgezeichnete Drehbuch für den Film Breaking Away und für Garp und wie er die Welt sah. Steve Tesich starb 1996 im Alter von 53 Jahren.
Über das Buch
ÜBER DAS BUCH
Ein letzter Sommer vor dem Erwachsenwerden: Daniel Price ist achtzehn und hat gerade die Highschool abgeschlossen. Die Zukunft wartet auf ihn – doch wie soll sie aussehen? Er vertreibt sich die Zeit mit Ringkämpfen und flieht, so gut es geht, vor den Konflikten seiner attraktiven Mutter mit seinem krebskranken Vater. Als er die schöne, unergründliche Rachel kennenlernt, scheint plötzlich alles möglich.
Buch lesen
Widmung
Für Sam, Julia und MaryaIn Liebe und Dankbarkeit
Zitat
Im Herzen der Menschen gibt es leere Orte,und in sie dringt das Leid ein,damit sie fühlbar zu existieren beginnen.
Léon Bloy
1
Er hieß Presley Bivens. Er kam aus Anderson, Indiana, er wog 76 Kilo, und er lächelte mich an. Er war schon zweimal hier gewesen, hatte beide Male gewonnen, und war wiedergekommen, damit es drei Siege in Folge wurden. Er entsprach überhaupt nicht dem, was ich mir unter einer Legende vorgestellt hatte.
Die Stadthalle war bis auf den letzten Platz ausverkauft, die Zuschauer tobten, die Cheerleader kreischten, aber er schien nichts von alledem zu hören. Er wirkte freundlich, entspannt, überhaupt nicht wie ein Gegner. Und er lächelte immerzu. Der Kampfrichter verwarnte ihn mehrmals wegen Passivität, aber eigentlich war er nicht passiv. Er hatte es nur nicht eilig. Er schien zu wissen, wie der Kampf ausgehen würde. Dass er gewinnen würde. Dass er schon gewonnen hatte. Was ihn anbelangte, war er schon wieder daheim in Anderson, Indiana, stand auf seinem Wohnzimmerteppich und blickte auf alles zurück, erinnerte sich daran, wie er mich besiegt hatte.
Es waren nur noch etwas über zwei Minuten Kampfzeit übrig, und ich lag sechs zu vier vorn, trotzdem flatterten nicht seine, sondern meine Nerven. Er lächelte einfach nur. Er hatte kleine runde Schweinsäuglein, die noch runder wurden, wenn er lächelte. Nichts an ihm deutete auf den größten Ringer hin, den Indiana je gesehen hatte. Seine Brust war flach, mit blondem Haarflaum bedeckt, seine Arme waren weich, seine Beine unterentwickelt, seine Haut blass. Das einzig Kräftige an ihm war sein Hals, ein massiver, Furcht einflößender Hals; Dinosaurier hatten solche Hälse. Sein kleiner runder Kopf saß auf diesem prähistorischen Hals wie ein Tennisball auf einem Hydranten. Er redete unablässig mit mir. Als ich mit meinem ersten Wurf punktete, sagte er mit seinem südlichen Indiana-Näseln, mit seiner hohen, gequetschten Stimme:
»Prima Griff, Kleiner. Astrein.«
Er nannte mich immer nur »Kleiner«. Er war so alt wie ich und nannte mich immer nur »Kleiner«. Er lag zurück, es blieben ihm kaum noch zwei Minuten, und er war entspannt. Ich gewann und er lächelte. Nein, er war überhaupt nicht so, wie ich es erwartet hatte.
Die Zuschauer waren auf meiner Seite. Einige riefen meinen Namen. Los, Price. Gib’s ihm. Jetzt hast du ihn. Andere riefen den Namen meiner High School. Los, Roosevelt. Er gehört dir. Du hast ihn. Trainer French kniete am Rand der Matte und brüllte Anweisungen.
»Bleib von ihm weg! Fall nicht drauf rein! Lass dich nicht kriegen!«
In einem Bundesstaat mit wenigen Sportlegenden, die meisten davon Basketballspieler, war Bivens eine Ringerlegende. In seiner Gewichtsklasse war er zweimaliger Landesmeister, er war seit drei Jahren ungeschlagen und hatte immer durch Schultersiege gewonnen. Ich hatte schon lange, bevor ich ihm begegnete, von ihm gehört. Jeder, der je gegen ihn angetreten war, sagte dasselbe. Alle hatten gedacht, sie hätten ihn, sie lagen immer nach Punkten vorn, er war immer am Rande der Niederlage, und dann passierte etwas. Alle wussten über seinen Trick Bescheid. Trainer French hatte mich schon Wochen vor der Landesmeisterschaft davor gewarnt. Als wir dann in seinem Auto nach Indianapolis fuhren, redete er von nichts anderem.
»Du weißt, was er macht, also fall nicht drauf rein. Er hat nichts weiter als die Brücke. Die ist alles, was er hat. Also fall nicht drauf rein. Leg’s nur auf Punkte an. Verstanden?«
Die letzten zwei Minuten brachen an. Ich war Untermann. Der Kari pfiff. Ich entwischte und erzielte zwei weitere Punkte. Ich führte jetzt acht zu vier.
»Prima rausgewunden, Kleiner«, näselte Bivens. »Aalglatt.«
Er kam auf mich zu. Wir packten uns und kamen von der Matte ab. Der Kari trennte uns und schickte uns zum Mittelkreis zurück. Auf meinem Weg dahin zwinkerte er mir zu. Er wollte, dass ich gewann. Alle wollten, dass ich gewann. Einige wenige waren aus Anderson hergekommen. Sie hatten vor dem Kampf mit mir geredet; sogar die Leute aus seiner Heimatstadt wollten, dass ich gewann. Alle wollten, dass die Legende stürzte.
Ich musterte Bivens vom Rand des Mittelkreises aus. Er sah auf die Uhr. Nur noch knapp anderthalb Minuten. Er kam auf mich zu. Wir packten uns wieder. Er ließ sich plötzlich fallen und griff nach meinem Fußgelenk, und ohne nachzudenken, schob ich den Unterarm vor sein Gesicht, täuschte links an und zog rechts und erzielte mit einem weiteren Wurf noch zwei Punkte. Jetzt stand es zehn zu vier. Trainer French sprang auf. In seinen ganzen fünfundzwanzig Trainerjahren hatte er noch nie einen Landesmeister gehabt. Gleich war ich sein erster.
Bivens lag flach auf dem Bauch. Ich war über ihm. Er kämpfte sich auf die Knie. Mein rechter Arm umklammerte seine Taille. Er versuchte eine Wende, aber ich sah sie kommen und fing ihn ab. Ich steckte meinen rechten Arm zwischen seine Beine und hob ihn hoch. Mein linker Arm glitt um seinen Hals. Er lag jetzt auf dem Rücken. Ich war oben und wollte einen Schultersieg.
»Lass ihn los. Mach’s nicht!«, brüllte Trainer French. Ich hörte ihn ganz deutlich. Und dann merkte ich, dass die Zuschauer verstummt waren. Alle waren aufgestanden, gaben aber keinen Laut von sich. Trainer French brüllte weiter auf mich ein, doch ich schüttelte den Kopf. Ich wollte einen Schultersieg. Ich spürte Bivens’ Körper unter mir nachgeben. Eines seiner Schulterblätter berührte schon die Matte. Das andere kam ihr immer näher. Ich verlagerte mein Gewicht auf diese Schulter und spürte, wie sie sich senkte. Der Kari lag flach auf dem Bauch und spähte, wann die Schulter den Boden berühren würde.
Und dann stemmte Bivens sich plötzlich zur Brücke hoch. Die Bewegung war so schnell und so kräftig, dass mir keine Zeit blieb, darauf zu reagieren. Mein ganzer Körper hob sich, gleichzeitig verdrehte er seinen und erwischte mich ohne Halt. Schlagartig tauschten wir die Plätze. Er war oben und wollte einen Schultersieg. Ich war unten.
Ich kann immer noch gewinnen, dachte ich. Ich liege nach Punkten vorn. Sogar ein Wurf über den Rücken bringt ihm nur drei Punkte: Ich kann immer noch gewinnen. Ich rechnete hin und her, während ich mich verzweifelt bemühte, mit den Schultern nicht die Matte zu berühren. Sie waren ihr schon so nahe, dass ich die feuchte Wärme spürte, die von dem schweißgetränkten Kunststoff aufstieg.
»Fünfundvierzig Sekunden«, rief der Kari. Eigentlich durfte er uns nicht sagen, wie viel Zeit noch blieb, aber sogar er wollte, dass ich gewann.
Bivens hatte es immer noch nicht eilig. Sein Kopf lag auf meiner Brust, und er schien ein Nickerchen zu machen. Ich konnte mir nicht erklären, welche Kraft mich unten hielt. Ich spürte nicht, dass er sich irgend Mühe gab. Ich strengte mich fürchterlich an, er überhaupt nicht. Er hob den Kopf, legte das Kinn auf meine Brust und sah mich an. Unsere Gesichter berührten sich fast. Er lächelte mir zu. Quäl dich doch nicht so, schien er mir zu sagen, als ich mich mit aller Macht dagegen wehrte, zu Boden gedrückt zu werden. Warum wehrst du dich so heftig? Eine Niederlage ist gar nicht so schlimm. Wirklich nicht. Sie tut nicht weh. Er kam mir plötzlich völlig vertraut vor, schmerzlich vertraut. Ich kannte diese Augen. Dieses Lächeln. Und ich war sehr verlegen und schämte mich dafür, dass ich versucht hatte, ihn zu schlagen.
Ich sah weg und atmete aus, und im selben Augenblick verließ mich die Widerstandskraft. Ich sank in die Niederlage wie an den mir angemessenen Platz. Der Kampfrichter schlug mit der flachen Hand auf die Matte und verkündete damit das Ende des Kampfes.
Der alte Mercury von Trainer French roch nach verschüttetem Kaffee und Pfeifentabak. Auf dem Hinweg hatte ich ihm ein Versprechen abgenommen. Wenn ich gewann, durfte ich auf der Rückfahrt ans Steuer. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, das Auto zu fahren. Trainer French zog an seiner Pfeife, schüttelte den Kopf und trieb die Tachonadel über einhundertzehn. Er schien auf einen Unfall zu hoffen, damit sich dieser Schweinetag zu einer richtigen Katastrophe auswuchs. Er starrte in die Dämmerung, als hielte er nach einer Ausschau. Das Radio lief. Die Drifters sangen.
»There goes my baby
Moving on … down the line …«
Trainer French stellte das Radio ab.
»Verdammt noch mal, Price! Du hattest ihn! Ich sage dir, du hattest ihn! Verdammt noch mal!«
Er konnte es immer noch nicht glauben. Er stellte das Radio wieder an. So machte er es immer wieder. Wenn er etwas zu sagen hatte, stellte er es aus, ließ etwas Dampf ab und stellte es danach wieder an. Musik und Vorwürfe bei Tempo einhundertzehn auf Highway 41. Ich befingerte meine Silbermedaille und versuchte, es positiv zu sehen. Der zweite Platz war gar nicht so schlecht. Zweiter im ganzen Bundesstaat Indiana.
Wir rasten durch die Dämmerung und in die Nacht hinein. Trainer French stellte das Radio ab.
»Verdammt, Price. Du hast aufgegeben.«
So einfach war das. Ich hatte aufgegeben. Aber ich war überrascht, dass er es gemerkt hatte. Wenn man aufgibt, denkt man immer, das geschieht tief in der eigenen Seele, in die niemand hineinsehen kann. Aber Trainer French hatte hineingesehen.
»Wie kamst du dazu, einfach aufzugeben?«
»Ich weiß es nicht, Trainer.«
»Ich wünschte, du hättest das nicht getan. Ich wünschte wirklich, du hättest das nicht getan.«
Ich zuckte die Achseln.
»Du hattest ihn. Weißt du das?«
»Ja, ich … ich dachte, ich hätte ihn.«
»Ach was! Du hattest ihn schon. Du hattest ihn. Und weißt du, was du dann gemacht hast?«
»Ja, ich weiß, Trainer.«
»Du hast aufgegeben.«
»Ich weiß.«
»Ich wünschte, du hättest das nicht getan.«
»Ich habe nicht gewusst, dass ich’s tun würde, Trainer. Ich hab nur einfach … ich weiß nicht.«
»Du hättest jetzt das Auto fahren können, stimmt’s?«
»Ja.«
Er stellte das Radio wieder an. Trainer French redete, wie er arbeitete. Seine Ringkampfphilosophie basierte auf der Maxime: Man musste ein paar Griffe wirklich gut lernen und sie dann anwenden. Seine Äußerungen entsprangen und entsprachen dieser Philosophie. Fünfundzwanzig Jahre Trainerarbeit, und nie ein Landesmeister. Ich sah ihn an. Ich fragte mich, wie oft er diese Fahrt schon gemacht hatte, voller Hoffnung auf dem Hinweg, voller Verzweiflung und Enttäuschung auf dem Rückweg. Es würde kein nächstes Mal geben. Er ging in den Ruhestand.
Wir hielten bei einem Tankstellenrestaurant, um etwas zu essen. Wir bestellten uns beide einen Cheeseburger und einen Milchshake. Eigentlich ist es unmöglich, todunglücklich auszusehen, während man einen Milchshake durch einen Strohhalm schlürft, aber Trainer French arbeitete daran.
»Siehst du das hier?« Er wies mit seiner Pfeife in die Runde. Es war ein deprimierendes Lokal. Alle Gäste waren bleich und übergewichtig und trugen schlecht sitzende Kleidung. Alle aßen etwas, das nicht so gut schmeckte, wie sie es sich vorgestellt hatten. Wobei sie viele Servietten verbrauchten, wahrscheinlich, weil die umsonst waren. »Sieht doch aus wie ein mieser Schuppen?«
»Und ob.« Ich lächelte.
»Aber weißt du was? Dieser miese Schuppen würde wie das feinste Restaurant der Welt aussehen, wenn du die Landesmeisterschaft gewonnen hättest.«
Ich legte meinen Cheeseburger auf den Teller. Mir wurde klar, dass er in seinen langen Trainerjahren schon oft hier gehalten und genau diesen Satz zu anderen Verlierern gesagt hatte. Ich war jetzt Teil dieser Tradition. Sieger haben ihre eigenen Traditionen, und Verlierer haben andere. Er bezahlte, und wir gingen.
»Willst du fahren?«, bot Trainer French an.
»Ist schon gut, Trainer.«
Er fing wieder an zu rasen. In der Ferne sahen wir die ewigen Flammen der Ölraffinerien, die höchste und hellste gehörte zur Sunrise Oil Company. East Chicago, Indiana. Zuhause.
Ich dachte an meinen Vater. Schon seit etwa einem Jahr war kein Tag vergangen, an dem ich nicht an ihn denken musste. Ich trug ihn in mir herum wie ein zusätzliches Organ, das ich nicht brauchte, aber versorgen musste.
Ich zuckte zusammen, als Trainer French das Radio abstellte.
»Sag’s mir, Price, ich will’s wirklich wissen. Was hat dich dazu gebracht?«
»Wozu, Trainer?«
»So aufzugeben.«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. Das Bild meines Vaters wollte nicht verschwinden.
»Du brauchtest dich nicht auf die Matte drücken zu lassen.«
»Ich weiß.«
»Du hattest ihn.«
»Ja, ich weiß.«
»Du musstest nur noch dreißig Sekunden überstehen. Weiter nichts, stimmt’s?«
»Stimmt, Trainer.«
»Und dann hab ich dich gesehen. Ich hab gesehen, wie’s passiert ist. Ich hab gesehen, wie du aufgegeben hast. Warum hast du das gemacht, mein Sohn?«
»Ich …«
Aus dem Nichts heraus fing ich an zu schluchzen. Trainer French, weichherzig wie er war, sah aus wie vom Donner gerührt.
»He, nicht doch. Komm schon, lass. Du solltest nicht auf mich hören. Ich bin ein dummer alter Mann, der zu lange Trainer war. Was weiß ich schon? Ich weiß gar nichts. Lass doch …«
Ich konnte nicht aufhören. Hätte ich gewusst, dass ich weinen würde, hätte ich mir etwas überlegt, um aufhören zu können. Aber so war es für uns beide ein Schock. Er ließ für den Rest der Fahrt das Radio an.
»Sie können mich hier rauslassen«, sagte ich, als wir an der Aberdeen Lane vorbeikamen.
»Ich fahr dich nach Hause.«
»Ich kann hier aussteigen, Trainer. Wirklich.« Ich wollte noch nicht gleich nach Hause.
»Es sollte einfach nicht sein, das ist alles«, sagte er, als ich aus dem Auto stieg. Er versuchte zu lächeln. »Es gibt immer ein nächstes Mal.«
Und dann fiel ihm ein, dass er in den Ruhestand ging und ich Examen machte und es kein nächstes Mal geben würde. Er zwinkerte langsam, als ließe er die Jalousien herunter gegen alle Hoffnungen auf die Zukunft.
»Gute Nacht, Trainer.«
»Gute Nacht, Danny.«
Er fuhr langsam davon in seinen Ruhestand. Sein linkes Rücklicht brannte nicht.
Das Erste, was mir immer in der Aberdeen Lane auffiel, waren die Bäume. Ich hatte Fotos von Städten in Vermont und New Hampshire mit hohen Bäumen in jeder Straße gesehen. In East Chicago hatten wir nur die Aberdeen Lane. Entweder wollten die Bäume anderswo in der Stadt nicht wachsen, oder niemand pflanzte welche, oder wenn welche gepflanzt worden waren und wuchsen, dann wuchsen sie nicht so hoch, so ausladend, so schön. Sogar jetzt, Mitte März, mitten in der Nacht, wirkten die Bäume prächtig, richtig prächtig, obwohl sie noch kein Laub trugen und auch in nächster Zeit keines tragen würden. Das Licht der Straßenlaternen, das Licht aus den Häusern, das Licht von Fernsehern hinter Fenstern im ersten Stock fiel durch die kahlen Zweige, als ich langsam, schlurfend, den Bürgersteig entlangging.
Ich kannte niemanden, der in der »A« Lane wohnte. Wir wussten alle, denen dort ging es besser als den übrigen Einwohnern von East Chicago, sie hatten mehr Geld und blieben, nach den hellen Fenstern zu urteilen, abends länger auf. Die Häuser waren alle aus Ziegelsteinen gebaut, und die meisten hatten ein Obergeschoss; die Rasenflächen waren groß, ihr Gras grüner als anderswo, und etliche hatten unterirdische Rasensprenger. Ungefähr jedes zweite auf der Straße geparkte Auto war ein neuer Kombi.
Zuletzt hatte ich mich im Oktober längere Zeit in der Aberdeen Lane aufgehalten. Ich brauchte zwanzig Blätter zu einer Laubsammlung für den Biologieunterricht. Ich verbrachte einen ruhigen Nachmittag damit, Blätter vom Boden aufzuheben – Silberahorn, Zuckerahorn, Traubenrüster, Sumpfeiche, Maulbeerbaum. Der Tag prägte sich meinem Gedächtnis ein: der Frieden, den ich empfand, das Gefühl, Fortschritte zu machen, der Geruch des Herbstes und der Anblick fallender Blätter an einem windigen Tag.
Deshalb war ich absichtlich hier ausgestiegen, denn bevor ich nach Hause ging, wollte ich wissen, ob der Frieden, den ich an jenem Tag erlebt hatte, immer noch da war, um die Scham und den Schmerz meiner Niederlage zu mildern.
Ich versuchte, positiv zu denken. Ein zweiter Platz war nicht schlecht. Der Zweite im ganzen Bundesstaat Indiana. Überhaupt nicht schlecht. Ich stellte mir eine Schlange aus allen Ringern von Indiana in meiner Gewichtsklasse vor. Es war eine lange Schlange, die um den Block reichte, und in dieser langen Schlange war ich der Zweite von vorn. Ich musste nicht mit Druck auf mich rechnen. Wenn man Zweiter war, wurde nichts Besonderes von einem erwartet. Jeder würde bewundern, wie dicht ich herangekommen war, ohne danach zu fragen, wie weit ich es bringen würde. Für meine beiden Freunde, Larry Misiora und Billy Freund, beide Ringer, die es nicht mal über die Regionalliga hinausgebracht hatten, würde kein Abgrund der Überlegenheit zwischen uns klaffen. Es gab viele Punkte zu meinen Gunsten.
Ich überlegte, ob nur Verlierer sich bemühten, positiv zu denken. In meinem Hinterkopf flackerte das Bild meines Vaters. Ich konnte an andere Dinge denken und trotzdem dabei an ihn denken. Er war wie eine durchsichtige Folie, die sich allem, was ich sah, überlagerte, damit ich die Welt schließlich mit seinen Augen sah.
Ich blieb mitten zwischen zwei Querstraßen stehen. Das grüne Haus, das im Oktober zum Verkauf gestanden hatte, war immer noch zu verkaufen. Ich lehnte mich an den Stamm des Silberahorns und versuchte noch einmal, den Frieden vom Oktober einzufangen.
Ein Auto kam aus einer Querstraße, bog in die Aberdeen Lane, einer Einbahnstraße, und fuhr in die verkehrte Richtung. Ich trat hinter den Baum, um nicht vom hellen Licht der Scheinwerfer erfasst zu werden. Das Auto hielt auf der anderen Seite des Baumes; die Scheinwerfer blieben noch ein paar Sekunden an und verloschen dann. Ein Mann stieg aus dem Auto und streckte sich. Er stand direkt unter der Straßenlaterne und sah aus wie ein Schauspieler auf einer Bühne, der im Begriff stand, etwas zu sagen. Er wirkte nicht so alt, wie es seinem silbergrauen Haar entsprach, aber auch nicht so jung, wie er sich kleidete. Vielleicht fünfzig. Er sah zum grünen Haus hinüber, betrachtete prüfend ein Schlüsselbund in seiner Hand und ging dann über den Rasen zur Haustür. Nach vielem Stochern gelang es ihm, die Tür aufzuschließen.
»Er passt«, rief er.
»Schade«, erwiderte ein Mädchen im Auto. »Ich hab schon gehofft, wir müssen die Tür aufbrechen.«
Es war für mich zu spät, hinter dem Baum hervorzukommen. Sie hätten gedacht, ich spionierte ihnen nach. Also zog ich mich noch weiter zurück, damit sie mich nicht sahen.
Der Mann verschwand im Haus. Mehrere Lampen gingen an, darunter ein Scheinwerfer, der den Rasen beleuchtete.
Die Autotür ging auf, und ein Mädchen stieg aus. Türkisohrringe schimmerten im Dunkel. Sie zündete sich eine Zigarette an und warf das brennende Streichholz fort. Schwarze Haare, braune Haut, hohe Wangenknochen.
»Rachel«, rief der Mann im Haus.
»Stimmt, so heiße ich«, murmelte sie vor sich hin.
»Rachel!« Der Mann erschien in der Tür. »Kommst du?«
»Das tu ich ja gerade. Ich komme. Komme schon.« Sie hatte offenbar schlechte Laune. Ihre Hüften bewegten sich beim Gehen nicht.
Der Mann trat von der Tür zurück, um sie einzulassen. Sie ging an ihm vorbei, ohne stehen zu bleiben. Er sah ihr einen Augenblick lang nach, dann verschwand auch er.
Rachel, dachte ich. Ich hatte noch nie eine Rachel gesehen. Ich hatte ein Bewusstsein für Wörter und merkte mir, wann ich sie zum ersten Mal benutzte. Ich war siebzehn, es war der Sommer des Jahres 1960, und ich saß auf Mrs. Deweys Veranda, als ich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort »irrational« benutzte.
Ich ging. Als ich an der Ecke Aberdeen Lane und Northcote ankam, schaute ich mich um. Rachel und der grauhaarige Mann gingen zum Auto. Ich sah zu, wie sie Koffer und Kartons ausluden und ins Haus trugen, dann ging ich nach Hause. Hinter mir, unten bei der Stadtbücherei, ratterte ein Zug durch die Nacht. Die Lokomotivpfeife heulte auf. Ich erkannte an dem Geräusch, dass es der New York Central nach Osten war.
Irrational. Ich hatte das Wort erst einmal benutzt. Die Regel besagte, man musste ein Wort dreimal benutzen, bevor es einem gehörte.
Mein Vater saß am Küchentisch, als ich nach Hause kam. Er hatte die Deckenlampe tief zum Tisch heruntergezogen, und die schwache Birne war das einzige Licht im Haus. Meine Mutter schraubte 150-Watt-Birnen ein. Er nahm sie heraus und schraubte 60-Watt-Birnen ein. Wenn man irgendwo auf der Welt einen Strich gezogen hätte, die beiden hätten sich automatisch auf die gegenüberliegenden Seiten gestellt. Er löste das Kreuzworträtsel der Chicagoer Sun-Times.
»Hi, Dad.« Ich musste immer der Erste sein, der etwas sagte.
»Ja, hi.«
»Mom ist zur Arbeit?« Ich wusste, sie war zur Arbeit.
»Ja. Nachtschicht. Den ganzen Monat.«
Ich machte den Kühlschrank auf, aber ich hatte keinen Hunger. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich etwas gegessen.
»Deshalb müssen wir den Kühlschrank so oft abtauen. Du stehst da mit der offenen Tür.«
Ich machte die Tür zu.
»Ich hab verloren.«
»Was verloren?«, fragte er und wandte den Kopf um. In dem trüben Licht sah er jung aus. Ein kleiner Mann, in dessen kräftigen, dichten Haaren sich noch kein einziges graues fand. Er hätte ein Schuljunge sein können, der seine Hausaufgaben machte. Die Leute sagten, wir sähen uns ähnlich. Ich hatte das Gesicht meines Vaters und den Körperbau meiner Mutter. Um meine Seele stritten sie sich immer noch.
»Den Kampf. Ich habe den Kampf verloren. Ich bin Zweiter geworden.«
Er lächelte sein trauriges Lächeln und nickte. Genau dieses Lächeln hatte ich auf dem Gesicht meines Gegners gesehen. Ich wusste nicht, welchen Kampf mein Vater und ich miteinander austrugen, aber ich wusste, ich war wieder zu Hause und er hatte gewonnen, und ohne die Bedingungen unseres Kampfes zu kennen, schämte ich mich wieder dafür, dass ich versucht hatte, ihn zu besiegen. Zum Zeichen der Versöhnung zeigte ich ihm meine Verlierermedaille.
»So ist das Leben nun mal. Man verliert. Du wirst darüber hinwegkommen. Lass dich von deiner Mutter nicht klein machen wegen der Niederlage. Du weißt, sie wird es tun, wenn du sie lässt.«
Ich überlegte, unter die Dusche zu gehen. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich mich lange unter die heiße Dusche gestellt und den Kampf noch einmal durchlebt.
»Ich geh schlafen.«
»Ja, ich auch. Gleich«, sagte er, ohne aufzuschauen.
»Gute Nacht, Dad.«
»Ja, gute Nacht.«
2
Wir saßen alle nur da. Das Gekicher und die geflüsterten Witzeleien hatten sich schon lange gelegt. Wir warteten auf die Pausenklingel, damit wir das Klassenzimmer verlassen konnten, und obwohl klar war, dass der Unterricht zu Ende war, dass Mr. Geddes, unser Englischlehrer, vor unseren Augen wahnsinnig wurde, blieben wir alle auf unseren Plätzen und warteten auf die Pausenklingel. Niemand bewegte sich. Hände lagen reglos auf Pulten oder in Schößen, die Haltungen waren starr, und außer dem irren Redeschwall von Mr. Geddes war nichts weiter zu hören als der Schluckauf von meinem Freund Billy Freund, der alle paar Sekunden auf dem Platz hinter mir hickste.
Die Stimme von Mr. Geddes hob und senkte sich, sein Mund öffnete sich weit und schloss sich, seine Augen traten aus den Höhlen hervor und verschwanden wieder darin.
»Blaue Flamme.« Er reckte nachdrücklich den rechten Zeigefinger hoch empor. »Blau …«
Er gab ein ersticktes Lachen von sich und zeigte uns seine Zähne und seine Zunge.
»Ich werde das jetzt in einem Satz anwenden. Aufgemerkt.« Wieder das erstickte Lachen. »Die blaue Flamme hat mich verbrannt.
« Er nickte und knurrte wie ein Hund. »Ja, hat sie … grrr.« Er lockerte seinen Schlips. Er sah ihn sich an. Dann sah er uns an. Dann schrie er auf.
»O mein Gott, ein blauer Schlips. Marineblau.« Er lockerte ihn weiter, bis die Schlaufe über sein Kinn reichte, dann schob er sich den Schlips in den Mund und zuckte zusammen wie ein Pferd, dem die Kandare eingesetzt wird. Er biss fest auf den Schlips und redete weiter.
»Grrr, blaue Anzüge. Blaue Strümpfe. Wisst ihr, grrr, was Blaustrümpfe sind?«
Er wartete. Natürlich hob niemand die Hand. Eine Augenbraue vielleicht, aber das war auch alles.
»Blazer! Von der blauen Flamme kommen wir nun zu, grrr, blauen Blazern. Ich werde das jetzt in einem Satz anwenden. Aufgemerkt: Billy kaufte sich einen blauen Blazer.«
Hinter mir hickste Billy Freund. Larry Misiora warf mir einen Blick zu. Sogar der fiese Larry, auf seine Art auch ein Irrer, saß still und schien ausnahmsweise einmal Angst zu haben.
Das Gesicht von Mr. Geddes war mit Schweiß bedeckt; Falten, die ich noch nie gesehen hatte, zerfurchten es, Grimassen, die ich noch nie gesehen hatte, wechselten sich in rascher Folge ab. Er schien wütend zu sein, wenn er lächelte. Er schien glücklich zu sein, wenn er weinte. Alles hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Sein Gesicht war für mich schon so lange ein normales, nichtssagendes Gesicht gewesen, dass es mir nicht gelang, Mr. Geddes, unseren alten Englischlehrer, mit diesem rasenden, Furcht erregenden Wesen, das an seinem Pult saß, in Verbindung zu bringen. Sein Gesicht blieb keinen Augenblick still. Unablässig spiegelten sich darauf die widersprüchlichsten Empfindungen. Im Biologieunterricht hatten wir mal einen Film über die Geburt eines Kindes gesehen. Auf dem Gesicht der Mutter spiegelten sich in dem Film die Empfindungen eines ganzen Lebens. Mr. Geddes schien niederzukommen.
»Grrr«, knurrte er und würgte an dem Schlips in seinem Mund.
Wir hatten anfangs gedacht, das Ganze sei ein Witz. Es begann als Diskussion über Metaphern in der Lyrik. Mr. Geddes brachte einen Schlager ins Gespräch, um zu zeigen, dass Schlager teilweise dieselben Bilder benutzten wie die Lyrik. Er schweifte eine Weile ab, um uns darauf hinzuweisen, dass es sich, wenn das Wort »wie« vorkam, um einen Vergleich handelte, und wenn nicht, um eine Metapher. Er bat um Beispiele von Schlagern, die um eine Metapher konstruiert waren. Jemand meldete sich: »Blue Moon.«
Ich hatte nicht aufgepasst. Ich hatte meine eigenen Metaphern und meine eigenen Probleme. Obwohl fast ein Monat seit meinem Kampf um die Landesmeisterschaft verstrichen war und der stechende Schmerz der Niederlage sich gelegt hatte, war ein ziehender Schmerz zurückgeblieben, das Gefühl, es würde keine zweite Chance geben, die Erkenntnis, dass meine Karriere als Sportler zu Ende war. Ich ging Trainer French aus dem Weg. Wir kannten uns seit vier Jahren, aber jetzt schien uns nur noch dieser eine Abend zu verbinden. Er versuchte, mir nicht weh zu tun, aber er konnte nicht anders. Wenn ich gewonnen hätte, sagte er mir immer wieder, hätte ich eins der wenigen Ringer-Stipendien für die Indiana University oder die Purdue University bekommen können. Bivens bekam eins für die Indiana University. Ich denke mal, es sollte einfach nicht sein, sagte er immer wieder. Sogar wenn er es nicht sagte, war es seinen Augen abzulesen. Dieser Ausdruck wurde zu unserer Begrüßungsformel. Hi, wie geht’s. Ich denke mal, es sollte einfach nicht sein. Ja, denke ich auch. Je weiter ich mich von meiner Niederlage entfernte, desto mehr schien ich verloren zu haben. Meine Freunde Billy Freund und Larry Misiora spielten Bivens’ Sieg herunter und betonten, wie nahe ich dem Sieg gewesen war, und obwohl das meine eigene Denkweise war, hatte ich beide im Verdacht, insgeheim froh zu sein, dass ich verloren hatte. Die Ringkampfsaison war zu Ende. Wir hatten keine andere Sportart. Wir spürten, wie unsere durchtrainierten Körper die Spannung verloren. Wir rutschten langsam hinüber in die Arena der Ehemaligen. Das verstörte und deprimierte uns alle drei und machte den fiesen Larry Misiora nur umso fieser und wütender. Wir waren es gewohnt, am Ende des Schultages müde zu sein, und mangels dieser wundervollen Erschöpfung nach hartem Training steckten wir voller überschüssiger Energie und hatten kein Ventil dafür. Wir redeten davon, in Freunds Garage einen Trainingsraum einzurichten, wir redeten davon, jeden Tag Dauerlauf zu machen, wir redeten davon, auf Amateursportfesten zu ringen, aber wir wussten, das war nur Gerede. Die Schule war bald zu Ende, und wir wussten nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollten, außer, uns aneinander zu klammern. Also klammerten wir uns aneinander, halb, um einander zu stützen, und halb, so mein Gefühl, um sicherzugehen, dass keiner sich allein davonmachte.
Zu Hause herrschte zwischen meiner Mutter und meinem Vater abwechselnd eisiges Schweigen oder offene Feindseligkeit. Wenn sie miteinander redeten, versuchten sie, sich gegenseitig weh zu tun. Wenn sie schwiegen, schienen sie neue Waffen zu ersinnen. Manchmal kam es vor, dass sie höflich miteinander umgingen, aber da wir alle drei wussten, dass es nicht anhalten würde, waren sogar diese seltenen Pausen nicht angstfrei.
Deshalb hatte ich in der Unterrichtsstunde von Mr. Geddes anfangs nicht aufgepasst. Ich war mit meinen eigenen Problemen beschäftigt, mit dem Nebel aus Problemen, der sich langsam um mein Leben legte. Als ich dann das Gekicher und Geflüster wahrnahm, war Mr. Geddes schon in Fahrt. Als Freund mir auf die Schulter hieb und mir ins Ohr flüsterte: »Ich glaube, Mr. Geddes verliert gerade den Verstand«, waren die anderen im Klassenzimmer schon still. Wir sahen alle zu, wie er wahnsinnig wurde.
»Picasso hatte seine blaue Periode.« Zu diesem Zeitpunkt schien noch offen zu sein, welchen Weg Mr. Geddes nehmen würde. Das war spannend und weckte unsere Aufmerksamkeit.
»Habt ihr von Picassos blauer Periode gehört? Habt ihr von Gainsboroughs Der Knabe in Blau gehört?« Er wartete auf Antwort. »Und? Was ist mit Das blaue Hotel von Stephen Crane? Was ist mit der Blauen Junaita von Malcolm Cowley? Was ist mit der Blauen Reise von Conrad Aiken?« Er wartete auf Antwort.
»Also, was ist damit? Oder ist Blue Moon alles, was ihr kennt? Ist das alles, was ihr kennt? Blue Moon?«
»BLAU«, schrieb er an die Tafel. Ein paar von uns wollten sich davonstehlen, solange er uns den Rücken zuwandte, setzten sich aber sofort wieder hin, als er sich umdrehte.
»Ich werde das jetzt in einem Satz anwenden. Aufgemerkt: Ich bin blau. Nicht wie Paul Bunyans Ochse oder die Nasen der feinen Leute oder das Blut von Bostonern, nein, so überhaupt nicht, sondern blau auf meine Weise. Ja. Ich bin blau auf meine Weise. Das ist ein Satz. Ich werde euch jetzt das Schema aufzeichnen. Aufgemerkt.«
Er griff wieder zur Kreide und begann, das Schema an die Tafel zu malen. Die Kreide zerbrach, aber das schien er nicht zu bemerken. Er fand sich nicht mehr zurecht. Er versuchte immer
wieder, gerade Striche zu ziehen, aber sie wurden krumm und schief: die Handschrift eines Wahnsinnigen. Und auf einmal schien ihm klar zu werden, was ihm widerfuhr. Er stieß einen Schrei aus, warf die Kreide in die Höhe, und es war nicht mehr spannend. Von da an war es nur noch grauenhaft.
Der Schlips steckte immer noch in seinem Mund, aber er zog jetzt den Knoten wieder zusammen, um sich zu knebeln und zum Schweigen zu bringen. Der Schlips zerrte seine Mundwinkel auseinander und gab den Blick frei auf seine Backenzähne und seine geschwollene, gefangene Zunge. Die Zunge bewegte sich und versuchte, Laute zu formen.
»Au – au – au?« »Blau« konnte er nicht mehr sagen. Er zeigte auf das Wort BLAU an der Tafel und dann auf sich. »Au – au!«
Es klingelte, und wir stürmten aus dem Klassenzimmer. Auf dem Flur blieben wir zusammen. Jeder wollte etwas sagen, aber niemand sprach. Wir hatten Angst vor den Wörtern. Sie kamen uns nicht mehr sicher vor. Schüler aus anderen Klassen, anderen Unterrichtsräumen, strömten auf den Flur und die Treppe hinunter. Sie redeten und lachten. Wir fühlten uns wie Schiffbrüchige, die es auf eine einsame Insel verschlagen hatte, und wir liefen auf unsere lärmenden Mitschüler zu, als seien sie zu unserer Rettung ausgeschickt worden.
An dem Tag fand kein weiterer Unterricht statt. Uns wurde gesagt, wir sollten nach Hause gehen, aber die meisten von uns blieben da. Wir standen draußen herum wie bei Feueralarmübungen. Meine Klassenkameraden verwandelten sich von stummen Zuschauern in Hauptbelastungszeugen und beschrieben möglichst drastisch, was sie gehört und gesehen hatten. Viele von ihnen, wie zum Beispiel Johnny Wasco, hatten noch nie Zuhörer gehabt und würden auch nie wieder welche haben. Jetzt redeten sie und konnten es nicht fassen, dass ihnen jemand zuhörte.
Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene fuhr auf die Schule zu, raste über den Parkplatz und verschwand im Hinterhof.
»Au – au«, heulte die Sirene. Wir sahen nicht, wie Mr. Geddes fortgebracht wurde. Es war, als wäre das Heulen der Sirene gekommen und hätte ihn mit sich fortgenommen. »Au – au.«
Langsam gingen wir drei nach Hause, Billy Freund, Larry Misiora und ich. Wie üblich gingen wir die Baring Avenue entlang, Freund rechts, nahe am Bordstein, Misiora links, und ich in der Mitte.
»Der arme Mr. Geddes.« Freud schüttelte den Kopf. Sein richtiger Name war Freund, aber ein Aushilfslehrer hatte ihn vor ein paar Jahren versehentlich mit Freud angeredet, und der Versprecher war an ihm kleben geblieben. »Der arme Kerl. Das war entsetzlich. Entsetzlich. Mhm.«
»Schöne Schule haben wir, hm?« Misiora setzte sein fieses Grinsen auf. »Tolles Gebäude, oder? Und prima Lehrer. Ich meine, Himmelarsch, wir haben Unterricht gehabt bei einem Verrückten.«
»Er war nicht schon immer verrückt.« Ich fühlte mich verpflichtet, Mr. Geddes zu verteidigen. Schließlich hatte er einige meiner Aufsätze gelobt. Es wurmte mich, dass der einzige Lehrer, der mich in all meinen Schuljahren je ausdrücklich gelobt hatte, wahnsinnig geworden war. Der arme Mr. Geddes. Sollte jemand in Zukunft seinen Namen erwähnen, dann würde es immer heißen: Der arme Mr. Geddes.
»Ich möchte mal wissen, was ihn dazu gebracht hat.« Freud, der Schwergewichtler in unserer Ringerriege, hatte eine Stimme wie ein Nebelhorn. Er redete so, wie er ging. Erst ein Fuß, dann der andere. Erst ein Wort, dann das andere. Er schob den Filzhut seines Vaters in den Nacken. »Vielleicht war es eine Frau?«
»Er hatte keine Frau.« Misiora spuckte auf die Straße.
»Das kann es auch gewesen sein.« Freud schüttelte seinen großen Kopf, aber er schüttelte ihn langsam. »Vielleicht werden wir auch noch verrückt. Wir haben keine Mädchen. Im zweiten Jahr in der High School dachte ich, wenn ich in der Oberstufe bin, habe ich ein Mädchen. So, und jetzt stehe ich kurz vorm Abschluss und habe immer noch keins. Ich weiß nicht, wie man eins kriegt.«
Schweigend gingen wir weiter. Unser Lehrer hatte vor unseren Augen den Verstand verloren, aber eigene Probleme blieben eigene Probleme. Keiner von uns hatte ein Mädchen. Keiner von uns wusste, wie man eins kriegte. Wir wussten, dass wir etwas verpassten. Ich jedenfalls. Wieder einmal dachte ich an meinen Vater. Er war ein Mann, der es geschafft hatte, ganz wie jemand auszusehen, der etwas verpasste. Ob er wohl die Liebe verpasste? Ich wusste darüber nicht genug, um die Frage beantworten zu können.
Misiora, der seinen Namen »Missuhrej« aussprach wie in »das weite Missouri«, holte seine Schleuder aus der Tasche und schoss auf das Stoppschild vor uns. Er war ein treffsicherer Schütze. Freud kniff jedes Mal die Augen zu, wenn der Stein das Metallschild traf. Eine alte Frau kam heraus auf ihre Veranda und wollte Misiora den Kopf waschen, aber nach einem kurzen Blick auf ihn dachte sie nicht mehr daran. Etwas in Larrys blitzenden blauen Augen verkündete, dass Ärger das Schönste war, was ihm passieren konnte.
Nicht mal die Schwarzen in unserer Schule legten sich mit ihm an. Er war ein besserer Ringer als ich, aber er gewann nicht oft, weil er nicht versuchte, seine Gegner zu schlagen. Er versuchte, ihnen weh zu tun. Der Punktestand war ihm egal. Sein Haarschnitt sagte alles. Es war kein Igel und keine Bürste und auch keine Ente. Blonde Stoppeln standen in alle Richtungen ab, und hier und da war die kahle, zementfarbene Kopfhaut zu sehen. Er schnitt sich die Haare selbst. Und er machte es absichtlich so, um hässlich und fies auszusehen. Einer, der das seinem eigenen Kopf antun konnte, war zu allem fähig.
Er spuckte in die Richtung der alten Frau, und die zog sich in ihr Haus zurück wie von der Vernunft hereingerufen.
»Ich kann euch sagen.« Misiora grinste und sah sich in der Straße um wie ein zynischer Immobilienschätzer bei einem Bankrott. »Die Heimatstadt.« Seine Augen schienen in die Häuser hineinzuschauen, an denen wir vorbeikamen, schienen das Leben in diesen Häusern zu sehen, die Schonbezüge, die Tischdecken, die Schränke voll billiger Kleidung, die knallbunten Duschvorhänge, die auf den Sommer wartenden Liegestühle, die auf ihren Urlaub wartenden Menschen, das Innenleben der Menschen und ihrer Behausungen, und sein Grinsen schien alles und jedes zu Wertlosigkeit zu verdammen. »Eines schönen Tages … Mann … ich kann euch sagen …«
Er lud wieder seine Schleuder und ließ den Satz in der Luft hängen. Er hatte sich von Mrs. Dewey angewöhnt, seine Sätze nicht zu beenden. Nach Jahren als Ringer, immer bemüht, Gewicht zu verlieren, um sein Wettkampfgewicht zu erreichen, stundenlang spuckend, um ein paar Gramm abzunehmen, hatte er sich angewöhnt, beim Gehen zu spucken. Er ging die Baring Avenue hinunter, hielt die geladene Schleuder halb gespannt und sah sich nach einem Ziel um. Meine Gedanken kehrten zu der Stunde bei Mr. Geddes zurück: Der Gebrauch von Metaphern in der Lyrik. Die halb gespannte, geladene Schleuder kam mir vor wie das vollkommene Sinnbild für Misiora.
Ein Zug ratterte in der Ferne, die Lokomotive pfiff. Es war ein Güterzug. Das hörte ich inzwischen heraus. Er fuhr nach Chicago.
Misiora feuerte seine Schleuder ab und traf ein weiteres Stoppschild. Freud kniff die Augen zu. Misiora lud nach. Seine Taschen steckten voller Steine.
»Ich habe da einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen. In Feld und Wald.« Freud wartete, ob Misiora oder ich ihm das Wort abschneiden würden, und als wir es nicht taten, ging und redete er im selben Tempo weiter, wie ein tapsiger Braunbär mit einem Filzhut auf.
»Und in dem Artikel stand, in Alaska und Montana und so gibt es ganz viele Jobs. Man arbeitet da im Auftrag des Ministeriums für Wild und Fische.«
Misiora ächzte höhnisch.
»Doch, das gibt es.« Freud registrierte den Hohn und redete weiter. »Das Ministerium für Wild und Fische. Und das braucht Leute für diese Arbeit. Zum Beispiel folgt man Wapitiherden und schreibt auf, wie viele Wapitis man gesehen hat und wo. Oder man zählt, wie viele Forellen man in einem Bach sieht. Man kriegt eine Hütte gestellt, in der man wohnen kann. Da war ein Foto von der Hütte. Mann, richtig toll. Mit Kamin.« Er lächelte und sah alles vor sich. »Wir kaufen uns Stiefel und so Schaffelljacken. Ihr wisst schon. Den Artikel hab ich immer noch zu Hause. Man kann sich was schicken lassen. Man füllt den Coupon aus, und die schicken einem was, Bewerbungsformulare und so. Wisst ihr, das wäre doch toll für uns drei.«
Misiora sah mich an. Wer ist dran, fragten seine Augen mich, Freud zu sagen, dass er eine Macke hat?
»Freud«, sagte er, »weißt du was?«
»Was?«
»Du hast eine Macke.«
»Wisst ihr bessere Jobs?«
»Nein.«
»Warum habe ich dann eine Macke?«
»Weil du eine hast. Manche haben eine und manche nicht. Du zählst zu denen, die eine haben. Forellen in einem Bach zählen!« Misiora schüttelte den Kopf.
»Wir müssen einen Job finden, wenn wir mit der Schule fertig sind, oder? Oder etwa nicht?«, fragte Freud.
Wir wussten, er hatte Recht. Nach achtzehn Lebensjahren voller Träume und Tagträume, nach Jahr um Jahr, das wir damit verbracht hatten, Bücher zu lesen, Essays zu schreiben, zahllose Male zusammen nach Hause zu gehen, uns nach dem ersten Kuss vom ersten Mädchen zu sehnen, über Witze zu lachen, die wir längst wieder vergessen hatten, nach zahllosen Abenden auf Mrs. Deweys Veranda und zahllosen Trainingsstunden in der Sporthalle lief nun alles auf einen Job hinaus. Wir hatten letztes Jahr in den großen Ferien im National Supermarket gejobbt und die Regale aufgefüllt. Im Jahr davor hatten wir auch gejobbt. Wir hatten immer etwas gefunden: Autos waschen, Rasen mähen, in Kaufhäusern in Hammond Weihnachtsgeschenke verpacken. Aber diesmal war es anders. Das war unser letztes Schuljahr. Wir hatten unsere letzten großen Ferien vor uns. Das veränderte alles. Wir wollten eigentlich in unseren letzten großen Ferien nicht jobben. Wir wussten noch nicht, was wir machen wollten, aber wir wollten – zumindest Larry und ich – nicht irgendeinen Job. Ich hatte Angst davor, irgendeinen Job anzunehmen, ohne dass der Beginn des nächsten Schuljahres im Herbst ihn automatisch beendete. Wir alle drei, denke ich, hatten das Gefühl, die nächsten Jobs, die wir fanden, würden für den Rest unseres Lebens unser Beruf bleiben. Das machte uns ängstlich und unentschlossen. Wenigstens brauchten wir für den Augenblick kein Geld. Wir hatten unsere bescheidenen Ersparnisse. Wir hatten weder Mädchen noch Autos, und so war selbst das wenige, das wir hatten, mehr als genug. Früher waren wir ins Kino gegangen, aber das Herannahen des Sommers machte uns irgendwie zu unruhig, um ganze Filme auszusitzen, also gingen wir einfach nicht mehr hin. Wir warteten darauf, dass eine Veränderung mit uns vorging. Mit allen anderen ging nach dem Schulabschluss eine Veränderung vor sich. Mit uns bestimmt auch bald.
»Ich kann den April nicht ausstehen«, verkündete Misiora kategorisch. »Alle finden den März unausstehlich, aber ich den April. Und wisst ihr, warum? Weil er genauso ist wie der März.«
In der Baring Avenue gab es nur wenige Bäume, und sie standen weit auseinander, wie alte Freunde, die ihrer eigenen Wege gegangen waren. Sie trugen alle noch kein Laub. Aber Knospen waren schon zu sehen, Andeutungen dafür, dass sich bald etwas tun würde. Ich wünschte mir, das Menschenleben, mein Leben, könnte denselben Kreislauf durchmachen wie die Bäume. Innerhalb eines Jahres alles hinter sich bringen und dann von vorn anfangen. Das kam mir besser vor als zu warten, zu grübeln und zu bangen, welche Früchte, wenn überhaupt, das eigene Leben tragen würde. Manchmal spürte ich Bäume in mir rauschen. Es gab Zeiten, da wurde ich von meiner eigenen Sexualität überwältigt, mir war schwindlig vor Sehnsucht nach etwas, das ich nie gehabt hatte, nach Liebe vielleicht, und dann brach plötzlich eine Flutwelle der Einsamkeit über mich herein, als hätte ich mit Achtzehn mein Leben schon gelebt und wäre ein alter Mann, der sich vergeblich bemühte, sich an die Lieben und Tage seiner Jugend zu erinnern. So wechselte sich das ab. Alles lag schon hinter mir oder noch vor mir. Aber jetzt schien alles auf einen Job hinauszulaufen.
Ein Tankwagen von der Sunrise Oil Company hatte eine Fehlzündung, als er an uns vorbeifuhr. Misiora schrak zusammen und nahm das sofort persönlich.
»Du Arschloch!« Er spannte die Schleuder und feuerte einen großen Stein auf die Rückseite des Tankwagens. »Wie ich gesagt habe.« Er ließ sein Dolchgrinsen aufblitzen. »Das ist das Problem in diesem Land.«
Freud zog langsam die Augenbrauen hoch. Misioras unlogische Schlussfolgerungen verwirrten ihn immer noch. »Wie ich gesagt habe« sagte Misiora oft von Dingen, über die wir gerade gar nicht redeten. Vielleicht dachte er nur gerade daran.
»Weißt du«, fuhr Misiora fort, »du gehst die Straße runter, hängst deinen hasserfüllten Gedanken nach, und so ein Hornochse knattert vorbei und stört dich. Das ist nicht nett.« Er sah dem Tankwagen nach. »Eines schönen Tages …«
»Ich finde, du hast Glück«, sagte Freud und senkte bedächtig die Augenbrauen, wie eine einsame alte Frau am Ende des Tages ihre Jalousien herunterlässt.
»Ach ja, und wieso, o Freud?«
»Na, dein Vater arbeitet bei Sunrise. Der kann dich bestimmt da unterbringen. Wenn nichts anderes klappt, kannst du immer noch das machen.«
»Aha.« Misiora streckte die Arme hoch. »Deshalb. Weißt du was, Freud? Du hast Recht. Meine Sorgen haben ein Ende. Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters.«
»Mir kannst du nichts vormachen«, sagte Freud verächtlich.
»Ich merke, wenn du sarkastisch wirst. Mann, ich brauche mir nie was Sarkastisches einfallen zu lassen. Ich brauche mich nur an dich zu halten.«
»Musst du nicht, Freud. Kein Gesetz besagt, dass du dich an mich halten musst.«
Wir gingen schweigend weiter. Ich spürte, dass es Freud leidtat, etwas gesagt zu haben. Es gab für ihn nichts Schlimmeres als zu hören, dass wir auch auseinander gehen konnten. Seiner Meinung nach mussten wir unbedingt zusammenbleiben. Seiner Meinung nach bestand wahre Freundschaft darin, zusammen unterzugehen.
Wir gingen stumm weiter. Wir überquerten die Eisenbahngleise, und wie es so oft unter Freunden geschieht, die viel Zeit miteinander verbracht haben, sahen wir alle drei gleichzeitig nach links und dann gleichzeitig nach rechts, gingen im Gleichschritt wie eine Drei-Mann-Armee bei einer Parade.
Wir setzten uns auf die Betonbalustrade vor der Stadtbücherei und betrachteten den Verkehr auf der Chicago Avenue.
»Schöne Stadt, in der wir leben«, sagte Misiora. »Unsere beiden größten Straßen sind nach anderen Städten benannt. Das sagt eigentlich alles.« Er meinte die Chicago Avenue und den Indianapolis Boulevard.
Ich erwiderte nichts. Die Luft wurde neblig und rauchig, und die Ampeln auf dem Indianapolis Boulevard blinkten in der Ferne wie Hafenfeuer. Man konnte die Stahlwerke und die Ölraffinerien riechen. Der Geruch kribbelte in meiner Nase und gab mir das Gefühl, gleich niesen zu müssen. An manchen Tagen konnte man den Ruß fallen sehen wie schwarzen Schnee.
»He, seht mal.« Freud streckte den Finger aus. »Da fährt ein 56er T-Bird.«
Wir sahen hin. Da fuhr er.
»Hätte ich doch bloß ein Auto«, seufzte er. Aus irgendeinem Grund nahm er seinen Filzhut ab, legte ihn in den Schoß und fuhr mit den Fingern langsam über den Rand. Alle in der Schule machten sich über seinen Hut lustig. Das hielt ihn nicht davon ab, ihn zu tragen. Es war der Hut seines Vaters. Er hing sehr an seinem Vater, und dessen Tod hatte Freud veranlasst, sich noch enger an uns zu klammern. Er kam nur einen Tag, höchstens zwei ohne irgendein Zeichen der Zuneigung von Misiora und mir aus, und wenn er es nicht bekam, fing er an, sich an uns zu schubbern, sich auf uns zu werfen, wie ein einsamer Bernhardiner. Wenn er gekonnt hätte, er hätte mit dem Schwanz gewedelt.
»Gehen wir zu Mrs. Dewey, oder wie?«, fragte er.
Misiora blinzelte, ich zuckte die Achseln, keiner von uns antwortete. Freud lehnte sich auf mich. Im Profil sah er gut aus. Er hatte eine hübsche gerade Nase, tiefliegende dunkle Augen und einen kindlichen Schmollmund. Bei jedem Augenaufschlag sah man, wie seine langen schwarzen Wimpern sich senkten und hoben. Sein Stoffwechsel war nur unwesentlich schneller als die Evolution. Er bewegte sich langsam, er ging langsam, er dachte, aß und rang langsam; und wenn er sich auf jemanden lehnte, wie jetzt auf mich, dann tat er sogar das langsam – immer nur fünfzehn, zwanzig Pfund auf einmal, bis sein volles Gewicht auf einem ruhte und er seufzend zum Stillstand kam.
»Seht ihr diese Schuhe?« Er bewegte langsam einen seiner großen Füße. »Das sind die von meinem Vater.« Er sprach leise, um Misiora nicht auf die Palme zu bringen.
»Die sind schön«, sagte ich.
»Ja. Meine Mutter wollte alle seine Sachen wegwerfen. Dieses Biest. Aber ich habe sie in die Garage geschafft. Sie passen mir fast alle.« Er rieb seine Schulter an meinem Rücken wie ein Bär, der sich an einem Baum schubbert. »Die ist ja so ein Biest. Ich komme nicht drüber weg, dass sie das Auto einfach so verkauft hat.« Eine nächtens Mordpläne schmiedende Lady Macbeth verdiente in Freuds Augen wesentlich mehr Sympathie als seine Mutter, denn die hatte den 1960er Buick seines Vaters verkauft.
»Hat mir nicht mal was davon gesagt. Sondern ihn einfach verscheuert. Als wäre er ein Stück Dreck.«
Nachzügler aus unserer Schule kamen an uns vorbei. Sie winkten. Wir winkten. Misiora winkte nicht. Er schoss aber auch nicht mit Steinen auf sie, also hielten sie es wahrscheinlich für eine freundliche Begrüßung und gingen weiter.
Die dicke Patty Campbell begann Blue Moon zu singen, und die Mädchen in ihrer Gruppe lachten. Ich merkte, dass sie über Mr. Geddes redeten. Eine von ihnen stopfte sich den Schal in den Mund und ahmte den armen Mann gnadenlos nach. Ich hielt mich nicht für übermäßig sensibel oder mitfühlend, aber in dem Augenblick wünschte ich, Misiora würde ihnen seine Steine schmerzhaft auf die fetten Hintern pfeffern.
»Blöde Kühe«, murmelte ich.
»Ich mag Kühe«, sagte Freud lächelnd. »Besonders Milchkühe. Mein Vater hat mich mal auf eine Farm in Crown Point mitgenommen, und da hab ich welche gesehen. Sie laufen, als kandidierten sie alle für das Amt des Präsidenten, so richtig wichtig, und ihre großen Milchkannen schwingen wie Glocken. Habt ihr schon mal eine Milchkuh Wasser trinken sehen?« Er schloss die Augen und atmete genüsslich aus. Er hätte auch fragen können, ob wir schon mal Caruso singen gehört hatten. »Sie stecken das Maul in den Bach, und du könntest schwören, sie tun gar nichts … das Wasser regt sich nicht, bleibt völlig still … als passierte überhaupt nichts, aber sie trinken. Und wie!«
Misiora stupste mich an.
»Schau mal, wer da kommt.«
Er drehte sich um. Ich drehte mich um. Freud wälzte sich in mehreren Stadien von mir herunter.
Die schöne Diane Sinclair kam allein die Straße herauf. Ihre schwarzen Haare wippten bei jedem Schritt. Ihre Augen sahen an uns vorbei; ihr Mund lächelte, als hörte sie gerade zu, wie jemand sie ihrer Fangemeinde ankündigte; sie lächelte an uns vorbei. Und dann kamen die Formen ihrer Brüste, dann ihr Parfüm, dann die wenigen feinen Haarsträhnen, die auf ihrem Nacken tanzten, alles segelte an uns vorbei wie eine mit Schätzen und Düften beladene Galeone auf dem Weg zu anderen Häfen.
Misiora sprang von der Balustrade und ging ihr nach. Wir folgten. Eine kleine Änderung in ihrer Haltung verriet uns, dass sie sich ihres Gefolges bewusst war.
Ganz gleich, wie oft wir Diane sahen, ihre Schönheit deprimierte uns jedesmal. Wir starrten auf die Umrisse ihrer Unterwäsche, wir rochen das Parfüm, das ihr nachschwebte, und wurden immer deprimierter. Wir waren Sträflinge, die von der Tochter des Gefängnisdirektors zum Exekutionskommando geführt wurden. Wenn einem klar wurde, wie uns allen dreien, dass es vollkommen gleichgültig war, wie lange wir lebten oder was wir machten, wir würden nie und nimmermehr Diane Sinclair küssen, sondern jemand anders würde es tun, dann kam einem der Rest des Lebens vor wie eine lange Suche nach dem Zweitbesten.
Wir überquerten die Chicago Avenue und gingen ihr nach, vorbei an geparkten Autos und an Einkaufswagen, die vor dem National Supermarket herumstanden, wir schlossen zu ihr auf, ließen uns zurückfallen und schlossen dann wieder zu ihr auf. Sie bog um die Ecke, und die Drei-Mann-Armee trabte mit.
Sie veränderte wieder ihre Haltung und zuckte mit der linken Schulter, als wollte sie Fliegen von ihrem Körper verscheuchen.
»Diane!«, rief Misiora. Freud und ich erschraken. Man quatschte Diane nicht an. Wir hatten Misiora viele erschreckende Dinge tun sehen, aber das hier kam für uns völlig überraschend.
»Di-ane!« Misiora spaltete das Wort in zwei Hälften und bewarf sie zornig mit den Silben. »Herrgott noch mal, Diane, die Zeit wird knapp. Wir stehen kurz davor, die Schule abzuschließen und unserer wunderbaren eigenen Wege zu gehen, und mir ist aufgefallen, dass du noch nie mit uns geredet hast.«
Während Freud und ich uns zurückfallen ließen, schloss Misiora näher zu ihr auf.
»Ich kann’s natürlich verstehen. Wir haben alle furchtbar viel zu tun, aber das ändert nichts daran, Diane, dass wir über vier Jahre lang in dieselbe Schule gegangen sind und in denselben Klassenzimmern gesessen haben. Fast fünf Jahre lang. Und nicht ein Wort! Ich kann dir sagen… also ich kann dir sagen, Diane.«
Sie wandte leicht den Kopf. Wir konnten ihre Nasenspitze sehen, ihren lächelnden Mundwinkel.
»Vielleicht denkst du, wir mögen dich nicht«, fuhr Misiora fort.
»Aber das Gegenteil ist der Fall. Soll ich dir was sagen? Wir finden dich schön. Wir träumen von dir, Diane. Und wenn du jetzt stehen bleiben und dich umdrehen und mit uns reden würdest, weißt du, was dann passieren würde? Du würdest uns für den Rest des Tages glücklich machen. So, jetzt weißt du Bescheid.«
Glaubte er wirklich, dass sie stehen bleiben und mit uns reden würde? Doch, das glaubte er tatsächlich. Und sie, sie ging weiter, segelte davon, eine Galeone, erhaben über das Gekreisch der Möwen in ihrem Kielwasser. Misioras Gesicht verhärtete sich. Sehnen traten an seinem Hals hervor. Er hasste sie in diesem Augenblick. Er hasste das Unmögliche.
»Diane, mein Engel, ich will dir nur noch eins sagen. Wenn deine Muschi ebenso eng ist wie dein Herz, dann musst du ein toller Fick sein.«
»Das wirst du kaum rauskriegen«, erwiderte sie, ohne ihr Tempo oder ihre Haltung zu verändern.
»Ja, sieht schlecht für mich aus. Aber ich sage dir noch was, da wir plötzlich miteinander reden. Ich würde mir lieber den Schwanz abschneiden, als ihn dir zu geben.«
»Abgeschnitten würde ich ihn vielleicht nehmen.«
Sie bog wieder um die Ecke, aber Larry folgte ihr nicht weiter. Sie ging in ihr Haus, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Ich hab’s versucht«, grinste Larry, »aber es sollte einfach nicht sein.«
Er sah mich an. Ich hatte den Satz von Trainer French als Entschuldigung für meine Niederlage benutzt, und jetzt benutzte Larry ihn, um mir weh zu tun, um mich daran zu erinnern, dass er nicht der Einzige war, der verloren hatte. Freud bekam nichts davon mit und griff den Spruch auf.
»Ja, wenn was nicht sein soll, dann soll es einfach nicht sein.« Wir gingen weiter.
»Und?«, fragte Freud und setzte voraus, dass wir wussten, was er meinte.
»Und was?«, fragte Misiora zurück.
»Gehen wir zu Mrs. Dewey, oder wie?«
»Nein.« Misiora spuckte aus. Fast hätte ich ihm eine gedonnert. Sein Gespucke ging mir plötzlich auf die Nerven. Er steckte seine Schleuder weg und wandte sich ab, gab uns zu verstehen, dass er allein sein wollte. Freud sah ihm traurig nach.
»Willst du mitkommen in meine Garage? Ich habe da jetzt ein Radio.«
»Glaub nicht.«
»Mit meiner Mutter halte ich’s nicht mehr aus. Ich räume meine Sachen aus meinem Zimmer in die Garage. Mein Vater fehlt mir sehr.« Er zuckte die Achseln, seine mächtigen Schultern hoben sich und kamen wieder herunter wie ein langsamer Fahrstuhl.
Die Straßenlaternen gingen an. Es wurde dunkel. Ich spürte meine Gedanken abschweifen.
Freud legte den Arm um mich, als wollte er mich festhalten.
»Was ist mit ihm los?«, fragte er.
»Mit wem?«
»Mit Misiora.«
»Ich weiß nicht. Er ist bloß …« Ich fing auch an, meine Sätze nicht zu beenden.
»Er wird etwas tun.«
»Was meinst du mit ›etwas‹?« Ich wurde ungeduldig.
»Du weißt schon. Etwas eben. Ich fühle das. Er wird etwas Schreckliches tun«, flüsterte Freud.
Wir trennten uns. Ich winkte. Freud winkte. Ein paar Häuser weiter zwang ich mich dazu, mich umzudrehen, und nur weil Freud es erwartete, winkte ich noch einmal. Er winkte zurück. Mit dem Hut seines Vaters sah er aus wie ein riesiger einsamer Detektiv, der die Nacht schwerfällig nach Hinweisen darauf durchkämmte, was er mit sich anfangen sollte.
3
Die Petroleumlampe flackerte in der Dunkelheit und warf Schatten an die Wände. Es war erst vier Uhr nachmittags, aber es mutete an wie Mitternacht. Ein Wolkenbruch ging nieder. Donnergrollen erschütterte die Fensterscheiben; Blitze zuckten alle Sekunden auf und schufen Bilder wie Röntgenaufnahmen von der Welt draußen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!