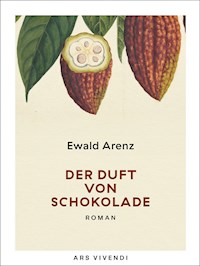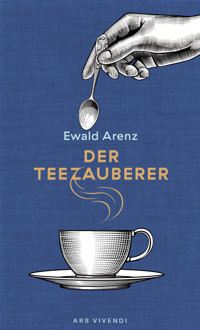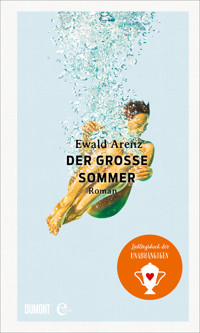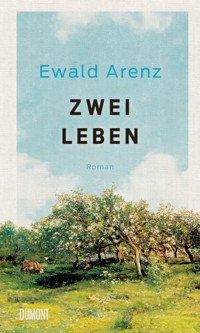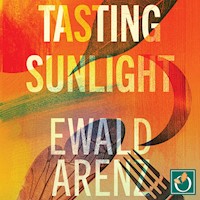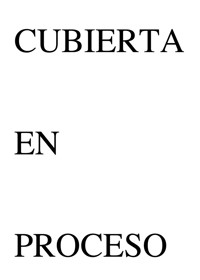Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kleinstadt im Sommer 1929. Die Pfarrerstochter Luise Anding kennt keine größere Sehnsucht als das Fliegen. Obwohl es in diesen Jahren für ein Mädchen alles andere als einfach ist, Pilotin zu werden, gelingt es Luise, ihren Traum gegen alle Widerstände zu verwirklichen. Sie verlässt die Stadt und wird eine gefeierte Kunstfliegerin. Als sie jedoch Jahre später die Fliegerei als Beruf aufgeben muss und die Gestapo ihren Vater bedroht, kehrt sie in ihren Heimatort zurück. Vieles hat sich hier verändert. Die politische Lage spitzt sich zu, ihre Familie, aber auch Georg, der beste Freund aus Jugendzeiten und nun im Widerstand aktiv, geraten zunehmend in Gefahr. So kommt der Tag, an dem Luises Liebe und ihr fliegerisches Können auf die Probe gestellt werden ... Ein Roman, dessen zarte Poesie verzaubert und der die bittersüße Melodie der Sehnsucht singt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ewald Arenz
Ein Lied über der Stadt
Roman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Februar 2013)
© 2013 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: Philipp Starke, Hamburg unter Verwendung eines Fotos von © Bettmann/CORBIS
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-250-1
Für Anna
Teil I
1
Wenn Luana im Sommer sang, hielt das kleine fränkische Städtchen den Atem an. Sie saß auf der Terrasse des Pfarrhauses, hatte ihre amerikanische Gitarre auf dem Schoß und sang selbstvergessen die fremden Lieder aus ihrer Heimat. Unten auf der sonnenheißen Gasse, die an der weiß gekalkten Mauer des Pfarrgartens entlang verlief, zügelten die heimkehrenden Bauern die Gespanne, und ihre Pferde zogen die Heuwagen im langsamsten Schritt. Der dicke Apotheker stieg vom Rad und hörte eine Weile zu, ohne zu merken, dass ihm die Zigarre ausging. In den Armenwohnungen, die auf der anderen Seite des Stadtgrabens lagen, verebbte das Geschrei; in den Fenstern erschienen die Köpfe der früh ergrauten Frauen, die mit ihren verarbeiteten Händen blau gemusterte Kissen auf die Fensterbank legten und sich für eine Viertelstunde forttragen ließen. Es war ein Klang in diesen Liedern, den keiner von ihnen hätte benennen können, eine lockende Fremdheit, die nach mehr duftete als die Sommergerüche ihrer kleinen Stadt. Etwas unsagbar Schönes lag in Luanas Liedern; es war, als würfe sie Töne wie fein glitzernde Fäden in die Spätnachmittagsluft; Fäden, die einem unmerklich an der Brust anhingen, in der Nähe des Herzens, und, später am Abend, wenn alles schon vorbei war und die Stadt still wurde, leicht und süß an einem zu ziehen begannen, ohne dass man gewusst hätte, wohin.
Wenn Luana im Sommer sang, unterbrach Luise alles, was sie tat, und kam in den Garten, um ihr zuzuhören. Meistens setzte sie sich ins Gras, den Rücken an den großen Walnussbaum gelehnt, wo Luana sie nicht sehen konnte. Immer hatte Luise das Gefühl, dass sie vielleicht aufhören würde zu singen, wenn jemand zwischen ihre Augen und die Ferne träte, in die sie in diesen Viertelstunden wohl sah.
»Wovon singst du?«, hatte Luise Luana manchmal gefragt, wenn sie später zu ihr auf die Terrasse getreten war.
Luana hatte dann lächelnd die Schultern gehoben und gesagt: »Ach, von allem. Von den Bergen. Vom Urwald. Und vom Meer.«
»Wie ist das Meer?«, hatte Luise dann wohl gefragt.
Luana hatte lächelnd geantwortet: »Wie soll ich das beschreiben? Du musst es selbst sehen. Das Meer kann man nicht erklären.«
»Doch«, hatte Luise bestimmt gesagt, »versuch’s mal.«
Luana hatte die Gitarre vorsichtig in die Ecke des Balkons gestellt und ein bisschen überlegt. Ein Nachmittagswind war aufgekommen. Auf den Feldern wogte der Weizen noch jung und grün in der Junisonne, und sein warmer, durchsichtiger Duft wehte durch die Gassen des Städtchens. Luana schloss für einen Moment die Augen und legte den Kopf an die Rückenlehne des Deckchairs, den sie genauso wie ihre weißen Kleider aus Brasilien mitgebracht hatte, als sie mit Paul vor drei Jahren zurück ins Reich gekommen war. Dann öffnete sie die Augen wieder und sah in den makellos blauen Himmel.
»So«, sagte sie dann und deutete nach oben, »das Meer ist wie der Himmel, nur auf der Erde.«
Luise sah auch nach oben. »Der Himmel hat aber kein Ende.«
Luana überlegte kurz, dann nickte sie. »Das stimmt. Das Meer sieht unendlich groß aus, aber irgendwo gibt es immer ein anderes Ufer. Das ist das Schöne daran, nicht wahr?«
Da schüttelte Luise entschieden den Kopf. Ihre kurzen braunen Locken flogen. »Das Schöne am Himmel ist, dass er kein Ende hat.«
Luana hatte wieder nach ihrer Gitarre gegriffen. »Das würde mir Angst machen«, sagte sie, während sie leise stimmte, »wenn etwas kein Ende hat.«
Luise staunte. »Aber warum singst du dann immer von der Unendlichkeit?«, fragte sie.
Luana wandte sich Luise zu. Luise dachte, dass ihr fremdes Gesicht in dem weichen Nachmittagslicht so schön war, wie sie es selbst wohl nie sein würde.
»Tue ich das?«, fragte sie überrascht.
Luise nickte. »So hört es sich an. Nach der Ferne. Nach Unendlichkeit.« Sie zögerte einen Moment. »Nach Fliegen. Ich verstehe ja die meisten Worte nicht«, setzte sie schnell hinzu.
Luana strich über die Gitarre. »Das macht nichts«, erwiderte sie und fing wieder an zu singen.
Das Pfarrhaus war sehr groß und lag, anders als in den meisten Kleinstädten dieser Art, nicht gleich bei der Kirche, sondern zehn Minuten entfernt an der Stadtmauer in einem außergewöhnlich großen Garten. Eigentlich war es fast schon ein kleiner Park, dessen Längsseite sich an der Mauer um die siebzig Meter erstreckte und der in die Stadt hinein sicher noch einmal vierzig Meter maß. Das kam, weil das Gelände bis ins 18. Jahrhundert eigentlich der Friedhof gewesen war, bis er zu klein wurde und man den neuen Friedhof vor den Toren der Stadt angelegt hatte. Und als hundert Jahre später, um 1820, das alte Pfarrhaus bei der Stadtkirche in der letzten großen Feuersbrunst ausbrannte, hatte man das neue in den aufgelassenen Friedhof gebaut. Ein ungewöhnlich unbescheidenes Haus war es, sehr ungewöhnlich für die fränkisch kargen Protestanten. Aber vielleicht lag es an einem letzten Aufflammen von reichsstädtischem Stolz, mit dem die Stadt das Haus gebaut hatte, nachdem sie fünf Jahre zuvor den Bayern zugeschlagen worden war und ihre Bewohner plötzlich zu Untertanen geworden waren. Denn immerhin: Eine Reichsstadt war man gewesen, und auch, wenn das alles lange vorbei war, hatte man den Eindruck, als lebten die Bürger jetzt noch von der Erinnerung.
Das Haus war nun, nach hundert Jahren, nicht mehr pompös und nicht mehr herrschaftlich, sondern bequem und vielleicht ein klein wenig nachlässig geworden wie eine alte Dame, die nicht mehr ausgeht. Wenn Luise im Sommer an der warmen Hauswand lehnte und in den Garten sah, dann bröckelte sie manchmal geistesabwesend am Putz oder schob ihren Fingernagel sacht unter eine dünne altrosa Farbscholle, die dann von der Wand platzte und auf den Steinen der Terrasse wie Eis zersplitterte. Für sie war das Haus schon immer so gewesen, und sie verschwendete keinen Gedanken daran. Das Pfarrhaus war einfach ihr Haus. Sie war drei Jahre alt gewesen, als ihr Vater die Pfarrstelle übernommen hatte und sie hierher gezogen waren. Von München wusste sie kaum noch etwas. Es gab ein paar Bilder in ihrem Kopf, die so schwarzweiß und verblasst waren wie die Fotografien aus dieser Zeit, und sie war sich nie ganz sicher, ob die vagen Eindrücke von der großen Wohnung mit den hohen Decken ihre eigenen, echten Erinnerungen waren oder sich nur aus den Erzählungen ihres Bruders und den Bildern im Familienalbum zusammensetzten.
Luana sang. Nie sang sie leise, so wie andere Menschen, die nur für sich sangen. Immer sang sie mit voller Stimme. Sie kann vielleicht nicht anders, dachte Luise, sie vergisst sich selbst beim Singen. Der Juninachmittag war so heiß, dass sogar die Katze, die sonst immer auf der Mauer in der Sonne lag, aufgestanden war, sich träge gestreckt hatte und dann die Mauer entlang in den Schatten unter der alten Wagenremise geschlichen war. Vom Holzschuppen kam mit der Sommerbrise der Geruch von altem Holz und auch der von Teer. Die Sonne schien so stark auf das Dach des Schuppens, dass die Teerpappe ganz weich wurde. Sommergerüche.
Manche Wörter aus Luanas Liedern kannte sie: amanhã zum Beispiel. Oder água. Und vor allem triste. Obwohl es »traurig« bedeutete, war es ein schönes Wort, weil es so weich ausgesprochen wurde; das s war so ein besonderes sch, wie sie es im Deutschen nicht hatten. Luise sah in den Himmel, hörte ihre schöne Schwägerin Luana singen, und plötzlich wusste sie, warum ihr diese Lieder so gut gefielen. An dieser Musik war alles so leicht, dass die Wörter und die Töne aufstiegen und sich irgendwann im Blau auflösten wie die kleinen Morgenwolken an einem Sommertag wie diesem. Sie lehnte an ihrem Walnussbaum und sah über die Dächer von Pfarrhaus und Scheune in den Himmel. Es gab nichts, was so perfekt war. Sie hatte in der Schule gelernt, dass die Menschen früher glaubten, der Himmel sei wirklich ein Zelt oder eine Schale, die über die Erde gestülpt war. Das hatte sie nie verstanden. Wenn man in den Himmel sah, dann wusste man doch: Er war so weit und so offen und vor allem so unendlich wie nichts anderes auf der ganzen Welt. Und weil Luise sich nach der Unendlichkeit sehnte, so sehr, dass es manchmal wehtat, wollte sie fliegen, seit sie das erste Flugzeug gesehen hatte.
Es war still geworden. Luana war ins Haus gegangen, um zu kochen. Neben dem Deckchair stand ihre Gitarre an das Tischchen gelehnt. Vom Kirchturm klang es weich herüber. Ein Schlag nur. Ob es Viertel nach fünf oder schon nach sechs war? Im Juni waren die Tage so wunderbar lang, dass man manchmal gar nicht merkte, wenn der Nachmittag zum Abend wurde. Es war so still, dass man denken konnte, man säße auf einer Insel des Schweigens, und alle Geräusche wie das Schlagen der Kirchturmuhr, das Pfeifen der Werkslokomotive aus der Brauerei oder das Geschrei der badenden Kinder unten am Fluss kämen nur wie kleine müde Wellen an den Strand dieser Insel geplätschert. Die Hitze und das leise Summen der Bienen taten ihr Übriges: Ihr wurden die Lider schwer.
In diesem Augenblick erschütterte eine Explosion die Remise. Der Knall, trocken, scharf und laut, riss sie hoch. Noch in das Echo hinein regnete splitternd Glas auf den Boden, und irgendetwas Schwarzes segelte über Luises Kopf hinweg. Sie duckte sich erschrocken, aber es wäre nicht nötig gewesen, das Ding blieb im Laub des Walnussbaums hängen, und Luise erkannte, dass es ein schwarz emaillierter Topfdeckel war. Zwischen ihren Beinen wischte die Katze durch, das Fell vor Entsetzen so gesträubt, dass sie ein Drittel größer erschien als sonst. Luise rannte hinüber zum zerborstenen Fenster der Remise und versuchte hineinzusehen. Ihre Augen mussten sich nach der Sonnenhelle kurz an das Dunkel im Inneren gewöhnen, aber auch so sah sie, dass ihr Vater etwas fassungslos hinter der Werkbank stand, wo ein Bunsenbrenner immer noch mit blauer Flamme unter der Ruine eines Topfes brannte. Es stank durchdringend nach Alkohol.
»Papa«, fragte sie durch das Fenster, »ist dir was passiert?«
Ihr Vater schüttelte fast erbost den Kopf.
»Das hätte nicht geschehen dürfen«, sagte er dann, als sei er persönlich beleidigt worden. Es schien nicht so wichtig zu sein, dass eben das Fenster zu Bruch gegangen war und wahrscheinlich bereits alle Nachbarn am Tor standen.
»Was hast du da eigentlich gemacht?«, fragte Luise, dann fiel ihr etwas auf, und sie rief rasch: »Dein Bart glimmt!«
Sie musste lachen, als ihr Vater sich hastig auf den Bart klopfte. Sie fand, dass er manchmal aussah wie ein russischer Mönch. Er war hager, und den langen Bart hatte er schon auf dem Hochzeitsfoto, das Luise sich vor langer Zeit aus seinem Schlafzimmer heimlich in ihr Nachttischchen geholt hatte und nachts ab und zu ansah.
»Ich habe etwas ausprobiert«, antwortete ihr Vater, »einen Kräuterauszug. Ich dachte, es geht schneller, wenn man den Alkohol heiß macht, aber er ist übergekocht, hat angefangen zu brennen, und dann ist es in den Topf übergeschlagen.«
Er drehte den Brenner aus. Dann sah er an sich herunter, schaute zu Luise hinaus und zuckte in komischer Hilflosigkeit die Achseln. »Ich bin manchmal seltsam, oder?«, fragte er.
Luise hatte plötzlich ein warmes Gefühl, als sie antwortete: »Ja. Manchmal schon.«
Aus dem Haus hörte man es läuten.
»Die Leute wollen wissen, ob du tot bist«, sagte Luise.
Ihr Vater sah verlegen aus. »Würdest du …«, fragte er bittend, »willst du gehen, ja?«
Luise nickte mit halb spöttischem, halb mitfühlendem Gesichtsausdruck und lief hinüber ins Haus, von wo jetzt ungeduldiges und wiederholtes Läuten drang. Am Treppenabsatz im Flur begegnete ihr Luana, die aus der Küche kam und sich die Hände trocknete.
»Ich gehe schon«, sagte Luise hastig, »und für Gottfried brauchst du nicht mehr zu kochen. Er ist tot.«
Luana lachte erst, als sie wieder in der Küche war. Luise öffnete die Tür und sah sich dem Mesner gegenüber, der sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Er habe einen Schuss gehört. Den Mesner mochte Luise nicht sehr. Sie hatte ihn noch nie lachen sehen. Manchmal kniete er sogar an Wochentagen in der Kirche vor dem Altar und betete murmelnd. Ein dünner Mann mit unruhigen Augen, die einen selten direkt ansahen. Er war nicht glücklich mit Luises Vater als Pfarrer. »Ein Glaubensfanatiker«, hatte der eines Sonntags seufzend gesagt, als er nach einer langen Diskussion mit dem Mesner über seine Predigt viel zu spät zum Essen gekommen war.
»Alles in Ordnung«, sagte Luise fröhlich, »Papa musste nur den General erschießen. Unseren Hund. Er ist tollwütig geworden.«
Der Mesner sah sie verständnislos an, und Luise fügte erklärend hinzu: »Der Hund. Nicht mein Vater.«
»Sonst ist nichts passiert?«, fragte der Mesner misstrauisch nach.
»Nein«, gab Luise bestimmt zurück, »sonst nichts.«
Dann schloss sie die Tür. Luise hatte eine reiche, überschäumende Fantasie. Das zumindest fanden ihr Bruder und ihr Vater. Im Städtchen dagegen fanden einige, dass die Pfarrerstochter zu oft log. Aber die fanden ja auch den Vater komisch. Es war eine kleine, zuweilen sehr enge Welt, die sie umgab, und Luise dachte manchmal, dass der Garten des Pfarrhauses weiter war als die ganze Stadt.
2
An diesem Abend lag Luise in ihrem Bett und wartete darauf, dass es im Haus still wurde. Weil sie noch zur Schule ging, musste sie auch im Sommer, wenn es abends eigentlich gar nicht dunkel werden wollte, um neun Uhr auf ihrem Zimmer sein. Also hatte sie sich halb ausgezogen, ins Bett gelegt und hoffte nun, dass sie nicht einschlief, bis sie aus dem Fenster steigen konnte. Ihr Raum lag im ersten Stock, aber nach hinten zu den Wirtschaftsgebäuden, und an die Hausmauer lehnte sich der etwas heruntergekommene Hühnerstall, dessen Dach zwar dünn war, aber das Gewicht eines mageren Mädchens, das sich leise von seinem Fensterbrett herabließ, durchaus tragen konnte. Schon seit jeher war das ihr Fluchtweg gewesen, wenn ihr Bruder oder – was viel seltener vorkam – ihr Vater sie eingesperrt hatte, nachdem sie wieder etwas getan hatte, wofür Töchter anderer Väter geschlagen wurden, und er sich anders nicht mehr zu helfen wusste.
Luise lag in ihrem Bett und lauschte in die Nacht. Es gab kein anderes Wort für dieses nächtliche Hören. Man musste sich nicht anstrengen. Da waren ein paar Grillen, wenn auch längst noch nicht so viele wie im August. Da war das ganz leichte Rauschen des Nachtwinds in der Krone des Nussbaums. Das weit entfernt klingende Stoßen eines durchfahrenden Eilzuges. Und in ihrem Kopf: ein Echo von Luanas Stimme. Dass es Dinge gab, die so schön und so traurig zugleich sein konnten! Vielleicht bedeutet das Sehnsucht, dachte Luise, das Glück zu wissen, dass irgendwo dort draußen die Vollendung liegt, das große Wunderbare; und die Trauer, dass man doch den Weg dorthin nicht findet.
Es wurde allmählich still im Haus. Paul und Luana hatten noch mit Papa auf der Terrasse bei einer Flasche Wein gesessen. Das Murmeln ihrer Unterhaltung war manchmal um die Ecke gedrungen und hätte sie beinahe eingeschläfert. Aber jetzt hörte sie die beiden auf der Treppe. Die Tür des Badezimmers. Wasserrauschen. Das Quietschen des Hahns beim Zudrehen. Wieder die Tür des Badezimmers. Weiter weg die Tür des Schlafzimmers, das früher das Bubenzimmer gewesen war. Luise lag und lauschte. Papa war noch auf, aber dann hörte sie den leisen Pfiff, mit dem er den General rief, und gleich darauf das Klicken seiner Krallen auf dem Steinboden des unteren Flurs. Sie lachte leise in ihre Decke, als sie den durchaus lebendigen Hund vernahm. Schließlich, endlich, das vertraute leise Klirren der Scheiben in der Terrassentür und das Schleifen der Läden. Papa würde zwar noch auf sein, aber sein Arbeitszimmer lag im Erdgeschoss und zur Straße hin. Sicherheitshalber wartete sie trotzdem noch und zwang sich, auf dem Wecker die vollen fünf Minuten verstreichen zu lassen, bevor sie fast geräuschlos aus dem Bett stieg, in die weiten Wanderhosen und die Segeltuchschuhe schlüpfte, die Beine vorsichtig übers Fensterbrett hob und sich leise auf das Dach des Hühnerstalls hinabließ.
Die Glockengasse lag verlassen da. Sie verlief unter der Gartenmauer und bog dann in die Torgasse ein, die auf der Innenseite der Stadtmauer entlangführte. Die Schatten der Häuser, der Bäume und der längst erloschenen Straßenlaternen auf dem Katzenkopfpflaster waren scharf und klar. Es war fast Vollmond und die Nacht hell. So lautlos zu laufen gab ihr ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Schläfrigkeit von vorhin war verflogen. Vom Marktplatz hörte man das Lachen und ab und zu unverständliche Rufe der Handwerksgesellen und der Primaner, die noch am Schweppermannbrunnen herumstanden, nachdem sie aus den Wirtshäusern geworfen worden waren. Vom Kirchturm schlug es elf Uhr, kurz darauf gefolgt von der Glocke des Rathausturmes. Luise lief am Schulgarten des Gymnasiums vorbei, roch das Gras, das der Pedell am Tag zuvor gemäht hatte, lief über die Brücke, lief hinter dem Bahnhof über die zwei Geleise und war in der Vorstadt, wo die vier, fünf kleinen Fabriken der Stadt lagen und all die Werkstätten, die in den Mauern der Stadt keinen Platz hatten. Luise fiel in Schritt. Sie war ein bisschen außer Atem, aber das kam nicht nur vom Laufen. Immer hatte sie ein wenig Herzklopfen, wenn sie sich trafen. Als ob ich einen Liebsten hätte, dachte sie spöttisch über sich selbst.
Hier in der Vorstadt war es nicht ganz so still. Die Maschinen der Weberei liefen die ganze Nacht durch. Luise mochte das Geräusch. Es war so ein gleichmäßiges Arbeiten, das sich nach Stärke anhörte und nach Zuverlässigkeit. Vielleicht mochte sie es aber auch deshalb, weil es sich mit ihren nächtlichen Ausflügen verband. Seit fast einem halben Jahr kam sie jetzt mindestens einmal, manchmal auch zweimal in der Woche hierher. Hier waren die Straßen dunkler, weil die Fabrikgebäude so eng beieinanderstanden und viel höher als die Bürgerhäuser waren, auch wenn manche der verrußten Scheiben von der Werksbeleuchtung erhellt wurden.
Luise war da. Zwischen dem neuen Brauereigebäude und einer kleinen Möbelfabrik lag eine Werkstatt, der man noch ansah, dass sie einmal eine Scheune gewesen war, bevor die Gebäude um sie herum gebaut worden waren. Es gab keine Rolltore wie an den anderen Fabriken, sondern noch immer ein großes Scheunentor mit zwei Flügeln und einer kleinen Tür daneben. Durch den Spalt zwischen Tor und Pflaster fiel ein Streifen Licht. Luise atmete auf. Er war da! Sie konnten sich nicht immer verabreden, und manchmal hatte sie schon vor der dunklen Werkstatt gestanden und war nach einer halben Stunde ungeduldigen Wartens enttäuscht wieder nach Hause gegangen. Meistens schlief sie dann schlechter, als wenn sie, so wie sonst, erst am frühen Morgen heimkam. Sie klinkte die Tür auf und trat in die Halle. Sofort war da der vertraute Geruch von Eisen und Schmieröl und Holz. Georg in seiner blauen Schmiedsschürze, dunkle Schmutzstreifen im Gesicht unter der ebenso blauen Leinenmütze, sah mit seinem jungenhaften Lächeln auf zu ihr, dann wischte er sich mit dem Handrücken über die Stirn. Über der Werkbank brannte eine nackte Glühbirne.
»Weißt du was?«, fragte er sie statt einer Begrüßung vergnügt, als habe er ein Geschenk für sie.
»Was?«, fragte Luise und kam näher. Georg hatte eines der Gestellrohre in den Schraubstock gespannt und war dabei, es im richtigen Winkel abzusägen. Als sie bei ihm stand, roch sie das heiß gewordene Öl, das er auf die Säge gab. Jetzt legte er sie beiseite und ging zur Tür des Lagerraums.
»Rate«, sagte er, und Luise musste lachen, weil er sich so freute, sie überraschen zu können. Sie hatte eine Vermutung, aber sie wollte ihm den Spaß nicht verderben. Sie hob die Hände in einer Geste des Nichtwissens.
»Ich habe keine Ahnung, sag schon, komm!«
»Du musst die Augen zumachen«, bestimmte Georg, bevor er die Tür zum Lagerraum öffnete, sie an der Hand nahm und hineinzog. Luise musste wieder lachen. Das mochte sie an Georg. Er konnte sich ganz und gar für eine Sache begeistern; so sehr, dass es schien, als gäbe es nichts Wichtigeres für ihn als nur dieses eine. So hatten sie sich kennengelernt – weil sie beide so waren.
»Darf ich jetzt?«, fragte Luise gespannt.
»Jetzt darfst du«, antwortete Georg stolz.
Luise öffnete die Augen und sah zwei große Ballen auf dem Boden vor sich liegen.
»Nein!«, sagte sie überrascht.
»Doch«, sagte Georg, und man hörte seiner Stimme an, wie er sich freute, »der Stoff ist gekommen.«
Luise trat vor und riss das braune Ölpapier auf, mit dem die Ballen umwickelt waren.
»Endlich«, flüsterte sie.
»Ja«, antwortete Georg, »jetzt wird’s langsam. Ich bin auch schon fast mit dem Fahrgestell fertig.«
»Georg«, sagte Luise, als sie sich endlich von dem feinen weißen Leinenstoff lösen konnte, der da säuberlich auf zwei Rollen gewickelt vor ihr lag, »du bist der Beste.«
»Weiß ich doch«, antwortete Georg fröhlich, »und jetzt musst du mal Mädchenarbeit machen. Wird auch Zeit. Und wird dir gut tun«, fügte er in sanftem Spott hinzu, »ich hab die alte Nähmaschine von meiner Oma geholt.«
Luise war zur Werkbank gegangen und befühlte die Schnittkante am Rohr. Noch war sie rau, aber ihre Finger mochten das. Eine plötzliche Angst vor der eigenen Courage kam sie an.
»Meinst du, wir schaffen das wirklich, Georg?«, fragte sie, ohne zu ihm hinüberzusehen.
Georg kam von hinten an sie heran. Eigentlich fassten sie sich nie an, aber diesmal legte er ganz leicht und nur sehr kurz die Hand auf ihren Rücken.
»Wir packen das«, sagte er mit dieser unbekümmerten Zuversicht, die er anscheinend nie verlor, »wir schon.«
Luise holte tief Luft und streckte sich.
»Dann will ich mal mit dem Zuschneiden anfangen«, sagte sie und spürte, wie die Freude am Abenteuer wieder in ihr aufstieg.
Georg, der Schmied, und Luise, die Pfarrerstochter, hatten sich gefunden, um zusammen ein Flugzeug zu bauen.
3
Georg und Luise kannten sich eigentlich, seit sie zwölf und er siebzehn Jahre alt war. In Luises Familie gab es vielleicht so etwas wie eine Tradition des Freiheitsdrangs. Schon Luises Vater war in seiner Jugend ein Wandervogel gewesen – einer der ersten – und auch ihr Bruder war in die bündische Jugend gegangen. Frei umherziehen, ohne Regeln, mit Gitarre und Wimpeln durchs Land wandern, in Ruderbooten die Donau hinunter oder mit dem Rucksack auf Schwedenfahrt: Luise hatte von klein auf mitbekommen, was ihnen Freiheit bedeutete. Und so war es ihr ganz natürlich erschienen, ebenfalls zu den Bündischen gehen zu wollen, sobald sie endlich alt genug war. Es war nicht ganz einfach gewesen, als Mädchen in die einzige Gruppe des Städtchens aufgenommen zu werden. Obwohl die Jungen, die ein- oder zweimal in der Woche jenseits der Stadtmauer auf der Schwedenwiese zusammenkamen, spöttisch auf die kleinbürgerlichen Spießer herabsahen, obwohl sie nach einem verlorenen Krieg die alte, verkrustete Ordnung verachteten, die sich innerhalb der Stadtmauern und in den verrauchten Wirtshäusern noch immer so zäh hielt, waren sie doch sehr zurückhaltend, was Mädchen anging.
»Wir wandern manchmal mehr als dreißig Kilometer!«, hatte der junge Student gesagt, der die Gruppe führte, als Luise das erste Mal alleine auf der Schwedenwiese aufgetaucht war und aufgenommen werden wollte. Luise hatte schweigend genickt.
»Wir schlafen alle in einem Zelt, wenn wir auf Fahrt sind«, hatte ein anderer, ziemlich kleiner Junge gesagt, der vielleicht zwei Jahre älter als Luise war, aber kaum größer, »da kann man keine Mädchen brauchen.«
Luise hatte nichts gesagt, aber den Jungen so lange angeschaut, bis der die Augen niederschlug.
»Wir brauchen keine Zimperliesen aus dem Pfarrhaus!« Das hatte Georg gesagt, kurz und böse. Es lag die ganze Verachtung des Handwerksgesellen für die Studierten darin.
Luise hatte eine scharfe Erwiderung auf der Zunge gehabt, aber sie nahm sich zusammen und antwortete nur kurz: »Ich bin zäh.«
Trotzdem wäre sie vielleicht nicht aufgenommen worden, hätte nicht ihr Bruder am selben Abend mit dem Werkstudenten gesprochen, der die Gruppe führte. Paul ließ ihn hoch und heilig versprechen, dass Luise nie davon erfahren würde, denn er kannte seine Schwester. Obwohl sie jünger war als er, konnte sie ihm, wenn sie zornig war, tagelang das Leben sauer machen. Und sie wäre sehr zornig gewesen, wenn sie erfahren hätte, dass man sie erst auf die Fürsprache ihres Bruders hin akzeptiert hatte. So wurde Luise als erstes Mädchen der Stadt bei den freien Wandervögeln aufgenommen und war von da an bei jeder Fahrt dabei.
Es war dann etwa zwei Jahre später gewesen, als sie an einem Spätsommernachmittag auf einem Berg hoch über einem großen Weiher Lager machten. Sie waren sehr früh aufgebrochen und über Land gewandert, hatten die meisten Dörfer gemieden und den Weg lieber über leere Weizen- und Roggenfelder genommen. Der September war fortgeschritten und die Tage jetzt manchmal schon windig und nicht mehr so heiß. Es war eine gute Zeit für ihre Fahrten. Auf dem Berg ragten die zerfallenen Reste des Burgfrieds vielleicht noch sechs, sieben Meter auf, die längst abgetragenen Grundmauern der Burg aber waren überwachsen, und was einmal der kleine Innenhof der Feste gewesen sein mochte, das war jetzt eine Wiese mit einer Feuerstelle in der Mitte. Vom Bergrücken aus hatte man eine wunderbare Aussicht. Auf beiden Seiten lagen Täler, das eine eng, in dem eine Schafherde langsam weidend nach Süden zog, das andere weit und darin der See. Er war in der Mitte schmaler und wirkte von oben wie eine liegende Acht. Der Hang zum Wasser hinab war dicht mit Fichten und Kiefern bewaldet, und der Wind schaukelte sacht die Zweige. Luise hatte, wie die anderen, Holz für das Feuer gesammelt, aber jetzt stand sie auf dem Wall, der vielleicht einmal eine Mauer gewesen war, und sah über die Baumkronen hinunter auf den See. Die Wasseroberfläche, vom Wind bewegt, glitzerte. Zwei Ruderboote wiegten sich im Takt an einem kleinen Steg und sahen sehr klein aus. Obwohl es windig war, gab es keine Wolken, und der Himmel war blau und offen. Ein Turmfalke stand rüttelnd hoch über ihr in der Luft. Als jemand neben sie trat, war sie erstaunt zu sehen, dass es Georg war. In den zwei Jahren, seit sie dabei war, hatte er kaum je mit ihr gesprochen.
»Was machst du?«, fragte er, aber es klang nicht so, als wollte er sie auffordern, weiter Holz zu sammeln oder Wasser zu holen.
»Nichts«, antwortete Luise kurz, aber nicht unfreundlich, »ich schaue.«
Am Rand des Geländes lief eine grob gezimmerte Absperrung entlang, die vor dem steilen Abhang schützen sollte. Es waren kaum mehr als in den Boden gerammte Pflöcke, auf die entrindete Fichtenstämmchen genagelt waren. Georg stützte sich neben ihr auf und sah hinunter zum See, sagte aber nichts weiter. Als sie den Kopf hob, um noch einmal nach dem Falken zu sehen, folgte er ihrem Blick. Ein paar Sekunden beobachteten sie beide, wie der Vogel so ruhig seine Kreise zog, als ob es da oben nicht ebenso wehen würde wie hier unten.
»An solchen Tagen möchte man seine Arme ausbreiten und losfliegen«, sagte Georg auf einmal unvermittelt. Luise warf ihm einen überraschten Blick zu, dann wandte sie den Kopf unsicher wieder ab. Sie war sich nicht ganz im Klaren darüber, warum er das ausgerechnet ihr sagte. Aber dann sah sie aus den Augenwinkeln, wie er rot wurde. Er hatte es ernst gemeint.
»Ja«, meinte sie zurückhaltend, »das wäre schon schön.«
»Ich werde später Flieger«, erklärte Georg nach einer Weile, in der sie beide weiter dem Falken nachgesehen hatten, den seine Kreise allmählich immer weiter nach Osten trugen.
Luise drehte sich zu ihm um. Der Wind wehte ihr von hinten die Locken ins Gesicht, und sie wischte sie mit einer unwilligen Handbewegung fort.
»Gehst du nicht bei deinem Vater in die Lehre?«, fragte sie.
Georg nickte.
»Schon«, sagte er dann, »aber wenn ich Geselle bin, dann mache ich noch eine Lehre als Flugzeugmechaniker. Ich bin gut mit Motoren. Ich kann alles reparieren.«
Er wirkte sehr eifrig und auf einmal viel jünger als sonst. Luise kam sich in diesem Moment stärker und klüger vor als er.
»Wir haben keinen Flugplatz in der Nähe«, sagte sie altklug, »und außerdem: Mechaniker fliegen nicht. Die reparieren immer nur.«
Georgs Gesicht verdunkelte sich. Luise, die das auch gesagt hatte, weil sie aus irgendeinem Grund, der ihr selbst nicht ganz klar war, ihren Traum vom Fliegen nicht teilen wollte, spürte, dass sie ihn verletzt hatte, und es tat ihr leid.
»Vielleicht kannst du trotzdem Pilot werden«, sagte sie, »die müssen ja auch reparieren können.«
Sie hatte das ins Blaue hinein gesagt, ohne Überzeugung. Sie las alles, was übers Fliegen ging, alle Reiseberichte und Zeitungsmeldungen, alle Bücher, die sie bekommen konnte, und sie wusste es eigentlich besser. Es war ja nicht mehr wie vor dem Krieg, als die Flieger noch alles selber tun mussten.
»Nein«, sagte Georg jetzt und wandte sich zum Gehen, »du hast recht. Schmiede werden keine Piloten. Ich gehe mal noch ein bisschen Holz fürs Feuer sammeln.«
Luise hätte ihn gerne zurückgehalten, aber sie wusste nicht, was sie sagen sollte, und so ließ er sie stehen und ging, um den anderen beim Feuermachen zu helfen. Sie sah ihm nach und schämte sich. Es war dasselbe Gefühl, das sie gehabt hatte, als sie einmal einen Groschen aus der Milchkasse in der Küche gestohlen und sich dafür bei Langmayer eine Tüte Bonbons geholt hatte. Es war nie herausgekommen, aber sie konnte sich noch genau erinnern, dass sie sich … falsch gefühlt hatte. Sie wusste kein anderes Wort dafür. Sie sah nach dem Falken. Er war verschwunden. Der Himmel war blau und leer. Auf einmal brannte ihr Gesicht vor Scham, und sie beeilte sich, Wasser zu holen.
Am Abend hatte der Wind nachgelassen, und alle saßen ums Feuer herum, holten vorsichtig Kartoffeln aus der Glut, die sie auf ihrer Wanderung über die Felder aufgelesen hatten, bliesen auf ihre Hände, wenn sie die schwarz gebrannte Schale abbröselten, und sangen. Manchmal, wenn ein Ast durchgebrannt war und auseinanderbrach, stoben die Funken in die Nachtluft, und Luise sah ihnen zu, während sie mitsang, und dachte, dass die einfach so fliegen konnten, dass es war, als würden sie vom Himmel angezogen und nicht, wie sie, von der Erde. Scheu sah sie zu Georg hinüber, der auf der anderen Seite des Feuers saß, lachend Gitarre spielte und hoffentlich vergessen hatte, dass sie gemein gewesen war. In dem Dorf auf der anderen Seite des Tales, das auf halber Höhe des Hanges lag, gingen allmählich, Haus um Haus, die Lichter aus. Die Nacht war mondlos und dunkel. Hier oben, wo das Gras karg und trocken wie auf einer Heide war und die Kalksteine des Berges durchbrachen, zirpten die Grillen überall und waren lauter als das Feuer, nachdem der Gesang allmählich aufgehört hatte. Sie sahen schweigend in die Glut, wie es wohl alle Menschen tun, seit es Lagerfeuer gibt.
Sebastian, ihr Anführer, stand auf und dehnte sich. »Ab in die Falle«, befahl er halblaut und goss das Spülwasser auf das Feuer. Es zischte, und weißer Qualm stieg auf. Luise hatte ein eigenes kleines Zelt, das sie etwas abseits von den anderen aufgeschlagen hatte. Sie wollte eben ihre Decke nehmen und hinüber, aber dann sah sie, dass Georg alleine stand und seine Gitarre in ein Tuch schlug, und ging schnell zu ihm.
»Ich will auch fliegen«, sagte sie leise. »Und du wirst bestimmt Pilot«, fügte sie noch leiser hinzu, als dürfte das kein anderer hören. Georg sah sie an. Sein Gesicht war in der Dunkelheit kaum zu erkennen, aber sie hörte an seiner Stimme, dass er lächelte, als er antwortete.
»Na, vielleicht fliegen wir später beide mal. Schlaf gut.«
Mehr war es gar nicht, aber Luise schlief wirklich gut in dieser Nacht, obwohl anscheinend alle Grillen sich in ihrem Zelt versammelt hatten und sie am frühen Morgen sogar eine aus ihrem Haar befreien musste.
4
Sie arbeiteten nun schon seit einem halben Jahr an ihrem Flugzeug. Nachts konnten sie auch nicht so laut sein wie am Tage, obwohl die Werkstatt in der Vorstadt lag. Georg konnte dann nicht schmieden oder schleifen. Er konnte drehen oder zusammenschrauben, aber nicht hämmern. Und tagsüber hatten sie eben nur selten die Gelegenheit dazu. Georg war mit der Werkstatt seines Vaters eigentlich schon mehr als ausreichend beschäftigt, aber er hatte auch noch an der großen Hauptstraße, die nach München führte, eine Tankstelle eröffnet; die erste der kleinen Stadt. Deshalb waren es vielleicht die Samstagnachmittage, an denen Luise keine Schule hatte und Georgs Vater sich um die Tankstelle kümmerte, obwohl er das nicht gerne tat. Er hatte Fassreifen geschmiedet, Hufeisen und Pflüge, Radreifen und Eggen. Er war kein Freund von Motoren und Maschinen, auch wenn Georg manchmal sagte, es sei doch gar kein Unterschied, ob eine Mähmaschine von Pferden oder einem Motor angetrieben wurde: Georgs Vater mochte weder Automobile noch Motoren, und er hätte seine Werkstatt schon gar nicht für ein Flugzeug hergegeben. Deshalb mussten Georg und Luise auch immer alles wegräumen, wenn sie die Werkstatt verließen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!