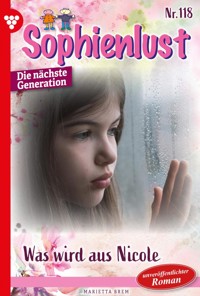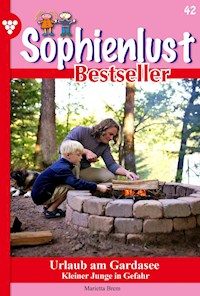Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust - Die nächste Generation
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie wird die von allen bewunderte Denise Schoenecker als Leiterin des Kinderheims noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Norma, ich habe Hunger.« Die zarte Mädchenstimme klang kläglich. »Norma, wo bist du?« Ein zitternder Schluchzer folgte den verzweifelten Rufen, dann war es wieder still. Im Zimmer war es dunkel, doch man konnte noch gerade so die Umrisse der Möbel erkennen, denn die Straßenlaterne, die vor dem Haus stand, spendete ein schwaches Licht. Lucie rieb sich die Augen. Wann war sie eingeschlafen? War es noch Abend oder bereits gegen Morgen? Sie schaute sich um. Mit ihren noch nicht ganz sechs Jahren war sie schon sehr vernünftig. Das Leben hatte sie dazu gemacht. Seit ihr Vater die kleine Familie vor vier Jahren verlassen hatte, war Lucies kleine Welt nicht mehr in Ordnung. Schön hatte sie es nie gehabt mit Eltern, die sie nicht haben wollten. Sie hätte ein Junge werden sollen, das hatte der Vater so bestimmt. Als es dann statt eines Sebastians eine Lucie geworden war, hatte er das Interesse an seinem Kind verloren. Er war still und leise gegangen, und seitdem überwies er jeden Monat eine Summe Geldes, von dem sie mehr schlecht als recht leben konnten, zumal die Mutter das meiste Geld für Zigaretten und vor allem für Alkohol verbrauchte. Das alles erlebte Lucie täglich mit, doch im Grunde störte es sie nicht sonderlich, denn sie war der Meinung, dass alle Familien so lebten und es halt so sein musste. Anders hatte sie es nie kennengelernt. Doch wenn sie Hunger hatte, dann bekam sie es mit der Angst zu tun. »Norma?«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust - Die nächste Generation – 133 –Ein neuer Himmel für Lucie
Die Erwachsenen machen dem kleinen Mädchen große Sorgen
Marietta Brem
»Norma, ich habe Hunger.« Die zarte Mädchenstimme klang kläglich. »Norma, wo bist du?« Ein zitternder Schluchzer folgte den verzweifelten Rufen, dann war es wieder still. Im Zimmer war es dunkel, doch man konnte noch gerade so die Umrisse der Möbel erkennen, denn die Straßenlaterne, die vor dem Haus stand, spendete ein schwaches Licht.
Lucie rieb sich die Augen. Wann war sie eingeschlafen? War es noch Abend oder bereits gegen Morgen? Sie schaute sich um. Mit ihren noch nicht ganz sechs Jahren war sie schon sehr vernünftig. Das Leben hatte sie dazu gemacht. Seit ihr Vater die kleine Familie vor vier Jahren verlassen hatte, war Lucies kleine Welt nicht mehr in Ordnung. Schön hatte sie es nie gehabt mit Eltern, die sie nicht haben wollten. Sie hätte ein Junge werden sollen, das hatte der Vater so bestimmt. Als es dann statt eines Sebastians eine Lucie geworden war, hatte er das Interesse an seinem Kind verloren. Er war still und leise gegangen, und seitdem überwies er jeden Monat eine Summe Geldes, von dem sie mehr schlecht als recht leben konnten, zumal die Mutter das meiste Geld für Zigaretten und vor allem für Alkohol verbrauchte.
Das alles erlebte Lucie täglich mit, doch im Grunde störte es sie nicht sonderlich, denn sie war der Meinung, dass alle Familien so lebten und es halt so sein musste. Anders hatte sie es nie kennengelernt. Doch wenn sie Hunger hatte, dann bekam sie es mit der Angst zu tun.
»Norma?«, fragte sie jetzt vorsichtig, und als wieder niemand antwortete, stieg sie aus dem Bett und schlüpfte in ihre Plüschpantoffeln. Sie waren ein Geschenk ihres Vaters, er hatte sie mit der Post geschickt. Fröstelnd zog sie die Schultern zusammen, dann schlich sie aus dem Zimmer. Immer wieder blieb sie stehen und lauschte, doch es war kein Geräusch zu hören.
Endlich fand sie die Mutter. Sie kauerte auf dem Küchenfußboden, an die kalte Wand gelehnt und hielt eine fast leere Flasche in der Hand. Mit glasigen Augen starrte sie ihrer Tochter entgegen. »Was willst du?«, lallte sie.
Lucie blieb ängstlich an der Türe stehen. »Ich hab Hunger«, flüsterte sie und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Wo ist was zu essen?«
Die Frau, deren graubraune Haare ziemlich wirr bis über die Schultern hingen, deutete wortlos auf den Kühlschrank. »Schau nach, ob du noch was findest«, knurrte sie, dann nahm sie wieder einen Schluck aus ihrer Flasche. »Ohne dich wäre ich besser dran. Warum bist du ein Mädchen? Ich könnte das schönste Leben haben, wenn du ein Junge geworden wärest.«
Lucie machte sich, wenn möglich, noch kleiner und schlich zum Kühlschrank. Sie fand ein altes Brötchen und auf einem Zeitungspapier einige Wurstscheiben, die sich an den Rändern bereits nach oben rollten, weil sie so vertrocknet waren. »Darf ich das haben?«, fragte die Fünfjährige hoffnungsvoll.
Die Frau winkte nur ab. »Ist mir doch egal. Und jetzt verschwinde, ich muss arbeiten.« Sie lachte bitter vor sich hin. »Einer muss ja dafür sorgen, dass du satt wirst.«
Lucie verschwand eilig aus der Küche, ihre Beute an sich gedrückt. In ihrem Zimmer kauerte sie sich aufs Bett und nagte wie ein Eichhörnchen an dem trockenen Brötchen. Die Wurst ließ sie als Nachtisch übrig, dann konnte sie sich später vorstellen, sie hätte nur Wurst gegessen.
Als sie fertig war, füllte sie ihr Trinkglas mit kühlem Wasser aus dem Wasserhahn und stellte es auf den Stuhl neben dem Bett. Sie kuschelte sich in die muffig riechende Zudecke und war wenig später eingeschlafen.
*
»Bist du sicher, dass du es dir nicht noch einmal überlegen willst? Es ist eine gute Idee, wenn du deine Freundin Denise besuchen möchtest. Doch beim momentanen Stand unserer Ehe finde ich den Zeitpunkt für diese Entscheidung nicht gerade glücklich gewählt.« Klaus Doda, ein ziemlich gut aussehender Mann Mitte vierzig, fuhr sich mit den Fingerspitzen seiner rechten Hand durch das dichte dunkle Haar. Er war eine auffallende Erscheinung mit leicht gebräunter Haut und den dunklen Haaren, die an seine südländischen Wurzeln erinnerten.
»Ich habe Denise bereits Bescheid gesagt«, antwortete seine Frau Alexandra. Sie stand vor ihrem Kleiderschrank und überlegte, welche Oberteile sie mitnehmen sollte. Zwei Jeans und eine schwarze, etwas festlichere Hose hatte sie bereits eingepackt. Langsam drehte sie sich zu ihrem Mann um, als wollte sie zuerst noch die richtigen Worte finden, die sie ihm sagen wollte.
Klaus stand an den Türrahmen gelehnt da und schaute ihr zu. Noch immer spürte er diese tiefe Liebe, die er von Anfang an für sie empfunden hatte, dennoch war zwischen ihnen die Mauer, die sich vor fünf Jahren von selbst aufgebaut hatte und über die keine Verständigung möglich schien. »Dann ist es halt so.« Er zuckte die Schultern und wollte das Schlafzimmer verlassen, das Alexandra seit einigen Monaten allein bewohnte. Er war ins Gästezimmer gezogen, hatte die Gleichgültigkeit, die sie ausstrahlte und die immer stärker zu werden schien, nicht mehr ertragen.
»Versteh mich doch, Klaus«, bat sie mit trauriger Stimme. »Ich will auch nicht, dass wir uns trennen. Deshalb werde ich für einige Zeit zu Denise gehen. Du weißt, dass ich in Sophienlust eine Zeit lang als Kinderpsychologin gearbeitet habe und dort sehr glücklich war. Es ist für mich zwar kein Arbeitsplatz vorhanden, doch ich kann wenigstens immer mal wieder beratend eingreifen. Vor allem aber möchte ich meine Freundin wiedersehen.«
Klaus, der gerade resigniert das Zimmer hatte verlassen wollen, drehte sich noch einmal um und kam ins Zimmer zurück. Unmittelbar vor ihr blieb er stehen und schaute ihr in die Augen.
»Es tut mir leid«, versicherte Alexandra erneut. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Haben wir noch eine Chance?«
»Wie meinst du das?«
»Wirst du wieder zurückkommen?«
»Ich muss«, versicherte sie mit traurigem Lächeln. »Ich habe hier meine Praxis, konnte mir nur mit Mühe einige Wochen freischaufeln. Aber die brauche ich.«
»Und dann?«
»Dann werden vermutlich die Karten neu gemischt.« Sie wich seinem Blick aus. Auf seine stummen Fragen hatte sie keine Antworten, wusste selbst nicht, wie es weitergehen würde.
»Bekomme ich noch einmal die Herz Königin oder wenigstens einen Joker?«
Jetzt musste Alexandra doch lachen. »Den Joker bekommst du auf jeden Fall. Die Herz Königin. Ich kann dir nichts versprechen. Aber ich kann dir sagen, dass in meinem Herzen niemand anderes ist. Ich möchte doch auch, dass wir wieder eine glückliche Familie sind.«
Er hob seine Hände und legte sie auf ihre Schultern. Sanft zog er sie an sich. »Ich möchte auch eine Familie. Warum versuchen wir es nicht noch einmal? Unsere Tochter war krank, sie hatte keine Überlebenschance, das haben die Ärzte gesagt.«
Sie legte ihre Wange an seine Brust. »Ich weiß«, antwortete sie leise und mit brüchiger Stimme. »Aber ich habe Angst. Noch einen Verlust würde ich vermutlich nicht überstehen.« Sie begann zu zittern. »Bitte Klaus, mach es mir nicht unnötig schwer. Ich brauche diese Zeit.«
»Warum adoptieren wir nicht ein kleines Mädchen?«, schlug er plötzlich vor. »Es gibt so viele heimatlose Kinder. Vielleicht findest du in Sophienlust ein Mädchen, in das du dich spontan verliebst. Ich wäre überglücklich, wenn das so wäre.«
»Du weißt, wie ich darüber denke«, widersprach sie und machte sich hastig von ihm los. »Eine Adoption ist eine wunderbare Sache – für beide Seiten. Doch die Kinder in Sophienlust haben fast den Himmel auf Erden. Den möchte ich ihnen nicht nehmen. Denise und die anderen sind die besten Vorbilder, die sie bekommen können, und an Liebe mangelt es ihnen dort ganz bestimmt nicht.«
»Aber eine Adoption …«
Sie hob beide Hände, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Ja, das mag in schlimmen Fällen wirklich gut sein. Wenn ich irgendwann ein Kind auf der Straße finde, das unsere Hilfe benötigt, dann werde ich nicht nein sagen.« Ihre Stimme klang hart. »Bitte, Klaus, lass uns erst an unserer Ehe arbeiten, ehe wir so viele Schritte weiterdenken. Ich muss erst wieder zu mir finden.«
Klaus seufzte schwer, dann wandte er sich um. »Ich wünsche dir eine gute Fahrt und schönen Urlaub. Bitte gib Bescheid, wenn du angekommen bist. Ich muss noch ins Büro, habe dringende Termine.« Kaum hatte er ausgesprochen, verließ er das Zimmer.
»Klaus«, murmelte Alexandra mit schwacher Stimme, als er längst die Türe hinter sich geschlossen hatte. »Klaus, ich liebe dich doch.« Dann brach sie in Tränen aus.
Als sie sich wieder beruhigt hatte, fuhr sie mit Packen fort. Jetzt ging es wesentlich schneller als vorhin. Im Grunde war es gleichgültig, was sie mitnahm. Wenn etwas fehlte, konnte sie es in einem der schönen Shopping Center in Maibach kaufen. Es gab ja mehrere davon.
Sie schaute auf die Uhr. Es war bereits spät am Nachmittag. Sollte sie erst morgen fahren? Sie würde in der Dunkelheit ankommen, wenn sie sich jetzt auf den Weg machte. Einen Moment lang zögerte sie. Vielleicht läutete sie mit dieser Flucht das Ende ihrer Ehe ein. Womöglich würde Klaus sich nach einigen Tagen daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr da war. Was würde sie dann tun? Sie wusste es nicht. Nachdenklich schaute sie aus dem Fenster in den gepflegten Garten hinaus. Er war ihre Freude, ihre Entspannung. Sollte sie das alles zurücklassen?
Schließlich jedoch entschied sie sich, gleich zu fahren, denn wenn sie noch eine Nacht blieb, würde sie womöglich bleiben. Und damit hätte sie gar nichts erreicht. Sie griff nach ihren Taschen und trug sie nach draußen. Die Entscheidung war gefallen.
*
»Hier hast du was zu essen. Die Nachbarin hat eben den Rest von ihrem Mittagstisch gebracht. Ich hatte ihr gesagt, dass ich krank bin.« Schwankend stand Norma Müller an der Türe zum Kinderzimmer und hielt eine Schüssel in der Hand. »Es sieht aus wie Eintopf«, stellte sie fest und zog die Nase hoch. »Mein Fall wäre es nicht«, fuhr sie fort und grinste. »Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Willst du es oder soll ich es gleich wegwerfen?«
Lucie, die den ganzen Vormittag selbstvergessen mit ihrem Bär Bobo gespielt hatte, sprang sofort auf. »Ich will es«, rief sie und rannte zu ihrer Mutter. Hastig griff sie nach der Schüssel. »Ich hol einen Löffel«, sagte sie, nachdem sie den Eintopf auf ihrem Bett in Sicherheit gebracht hatte. »Willst du nichts davon?«
Frau Müller legte ihre Hand auf den Bauch, an die Stelle, an der sich der Magen auffallend aufblähte. »Mir ist nicht so gut«, antwortete sie mit jammernder Stimme. »Iss du allein, du musst noch wachsen.« Sie drehte sich um und wankte in die Küche zurück. Sie setzte sich an den Tisch, auf dem zwei Flaschen standen, eine leere und eine noch fast volle. Glücklich schaute sie diese an, dann legte sie die Arme auf die Tischplatte und den Kopf darauf.
Zögernd blieb Lucie an der Türe stehen. Sie überlegte, was sie tun sollte, einfach zu ihrem Eintopf gehen, ehe der kalt wurde, oder lieber die Nachbarin verständigen, weil sie plötzlich das Gefühl hatte, dass sich ihre Mutter wirklich nicht wohlfühlte?
Lucie entschied sich fürs essen. Der Eintopf duftete lecker, und sie spürte bereits, wie sich alles in ihrem Mund zusammenzog bei dem Gedanken daran, die ganze Schüssel leer essen zu dürfen.
Als sie auch später nichts von ihrer Mutter hörte, bekam sie es doch mit der Angst zu tun. Sie schlich in die Küche zurück. »Geht’s dir gut, Norma?«, fragte sie vorsichtig und tippte die Frau an der Schulter. Als Antwort bekam sie nur ein ärgerliches Brummen.
»Dann ist es gut, wenn es dir gut geht«, sagte sie fröhlich und lief davon. Zuerst wollte sie weiter essen, doch dann entschied sie sich dagegen. Den Rest wollte sie sich für den nächsten Morgen aufheben. Der schmeckte kalt bestimmt auch noch gut. Ihren Bären Bobo fest an sich gepresst kuschelte sie sich in ihr Bett und war wenig später eingeschlafen.
Als Lucie erwachte, dämmerte es draußen bereits. Sie schaltete das Licht an und stand auf. Nichts hatte sich verändert. Auch der Eintopf stand so auf dem Stuhl, wie sie ihn hingestellt hatte. Etwas kam ihr komisch vor. Im Zimmer war es still wie immer, und doch fühlte es sich anders an als sonst.
Auf nackten Füßen tappte Lucie nach draußen in die Küche. Die Mutter kauerte noch immer mit dem Kopf auf dem Küchentisch, nur die zweite Flasche war jetzt auch leer. Die Herdplatte klickte immer wieder, schaltete sich ein und dann wieder aus, obwohl kein Topf auf dem Herd stand. Die Mutter musste vergessen haben, sie auszudrehen, als sie sich etwas zu essen gemacht hatte. Lucie kannte das, es war ihr auch schon passiert.
Eilig drehte sie den Knopf auf aus, denn wenn die Mutter aufwachte und es entdeckte, würde sicher wieder ihr die Schuld geben. Dann stand das Mädchen wieder da und wartete, doch die Mutter rührte sich nicht. Dieses Mal schien sie sehr gut zu schlafen, denn sie hatte nicht einmal gehört, als Lucie gegen den Topf gestoßen war und das ein schepperndes Geräusch gegeben hatte.
»Norma?«
Nur Stille antwortete ihr.
»Sag doch was, Norma. Was ist los?«
Die Frau bewegte sich nicht. Offensichtlich war sie zu müde, um zu reagieren.
»Soll ich die Nachbarin holen?« Sie stupste die Mutter an der Schulter. Doch sie reagierte noch immer nicht. Da bekam Lucie es mit der Angst zu tun. Sie schlüpfte hastig in ihre Pantoffeln, dann rannte sie aus der Wohnung. Bei der Nachbarin klingelte sie Sturm, doch auch da kam keine Reaktion. Schließlich war Lucie klar, dass sie irgendwie Hilfe holen musste. Telefon hatten sie nicht, also musste sie jemanden auf der Straße finden, der mit ihr kam, um der Mutter zu helfen.