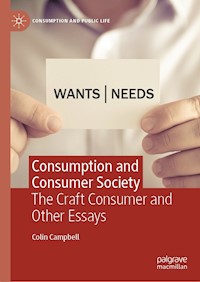7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Geschichte über eine einzigartige Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Eine dramatische Veränderung erwartet Colin als er von einer Geschäftsreise zurückkehrt: Seine Frau hat ihn ohne Vorwarnung verlassen. Ihm bleiben einzig die Wohnung und eine drückende Einsamkeit. Um dieser Leere zu entkommen, nimmt Colin einen vernachlässigten Landseer-Neufundländer aus dem Tierheim auf: George. Nach und nach finden die beiden Vertrauen zueinander, werden beste Freunde und lernen gemeinsam wieder einen positiven Lebensweg zu gehen. Das Duo entdeckt außerdem noch eine besondere gemeinsame Leidenschaft: Das Surfen! Colin merkt, dass er nach außen hin vielleicht Georges Leben rettete, George ihm aber ebenso geholfen hat. Der Bestseller aus den USA und Kanada erzählt in einer rührenden Geschichte, was die Beziehung zwischen Mensch und Haustier ausmacht und lehrt, die kleinen Dinge des Lebens schätzen zu lernen, um (wieder) echtes Glück zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Gedenken an meinen Großvater Nick Howes, der mir beigebracht hat, wie wichtig es ist, das Meer zu erleben und zu lieben, fleißig zu sein und die freien Tage im Leben zu erkennen und wertzuschätzen.
HIER SIND EIN PAAR DINGE, DIE ICH WEISS:
Ich weiß, dass die Menschen, die mir im Leben am meisten bedeuten, diejenigen sind, die mir in die Augen sehen können.
Ich weiß, dass ich das Meer liebe und dass es mich zu mir selbst zurückführt.
Ich weiß, dass mein Großvater, der Mann, der mir das Schwimmen beigebracht und mich gelehrt hat, das Leben voll auszukosten, einer meiner wichtigsten Mentoren und Ratgeber bleibt, auch wenn er vor vielen Jahren gestorben ist.
Und ich weiß, dass zu einer der stärksten Erfahrungen meines bisherigen Lebens meine tiefe und beständige Freundschaft zu einem Hund namens George gehört, der all die Dinge, die ich weiß, vereint.
Prolog
Ich bin Schwimmer und Surfer. Ich liebe das Meer. George, mein 140 Pfund schwerer Landseer-Neufundländer – das sind umgerechnet stolze 63 Kilogramm –, liebt das Wasser ebenfalls. Ich zögere etwas, wenn ich »mein Hund« sage, denn das klingt, als würde ich dieses Geschöpf besitzen, mit dem ich einen Großteil meines Lebens teile. Wie Sie, so hoffe ich zumindest, in diesem Buch sehen werden, gehört George ausschließlich sich selbst. Wir Menschen, die wir das Glück haben, ihn zu kennen und in unserem Leben von ihm berührt worden zu sein, sind nur die Empfänger seiner großzügigen Gaben.
George ist der Hund, der mein Leben verändert hat. Als ich ganz unten war, war er da, um mich zu trösten. Er hatte kein Zuhause, als ich ihn bei mir aufnahm, aber wie sich herausstellte, war er es, der mich gerettet hat. Er hat mir beigebracht, zu gehen und zu warten, zu sitzen und geduldig zu sein und Veränderungen anzunehmen. Er hat mich gelehrt, wie wichtig Umarmungen sind, zu flüstern, anstatt zu brüllen, anderen um mich herum genauer zuzuhören und einfühlsam gegenüber Bedürftigen zu sein. Er hat mir gezeigt, wie man die Wellen des Lebens reitet, anstatt sich von ihnen überspülen und ertränken zu lassen. Er hat mir beigebracht, dass man zu weit aufs Meer hinausschwimmen kann – und er hat mich öfter, als ich mich erinnern kann, zurück ans rettende Ufer gezogen. Er hat mich gelehrt, dass der Surfsport, genau wie das Leben, nicht zu ernst genommen werden sollte – dass man manchmal nur auf ein Brett steigen muss, um sich selbst und die Leute um sich herum glücklich zu machen.
Viele der Lebenslektionen, die ich mit George gelernt habe, erinnerten mich an Lektionen, die mir eigentlich schon vor langer Zeit begegnet waren. Ist es nicht so, dass sich im Leben oft, ohne dass wir es erkennen, ein Kreis schließt?
Mein Großvater Nick Howes war die erste positive Kraft in meinem Leben und in vielerlei Hinsicht mein erster Lehrer. Er lehrte mich die Werte, die mir später George erneut nahebringen sollte, als mein Großvater es nicht länger konnte.
Ich möchte daher an dieser Stelle ein wenig zurückspulen und von meinem Großvater Seymour Wylde Howes III erzählen. Er wurde im Jahr 1913 auf einer Zuckerplantage auf der Karibikinsel Montserrat geboren. Er zog es vor, Nick genannt zu werden, aber ich nannte ihn Grandpa. Im Zweiten Weltkrieg war er einer der Ersten, die am D-Day in Frankreich an den Stränden der Normandie landeten, wo er mehrere seiner Kameraden vor dem Ertrinken rettete, nachdem ihr Landungsboot auf eine Mine gefahren war. Nach dem Krieg führte Grandpa ein, wie man allgemein wohl sagen würde, bescheidenes, gewöhnliches Leben. Doch für mich war er alles andere als gewöhnlich.
Mein jüngerer Bruder David und ich hatten eine sehr enge Beziehung zu unserem Großvater. Grandpa lebte sein Leben mit voller Hingabe, er war selbstlos und gab uns das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Es waren seine kleinen und großen Gesten, die über Jahre hinweg dazu beitragen sollten, unser Leben zu prägen. Als Jungen verbrachten wir oft den ganzen Sommer in seinem Cottage an einem stillen Strand in einer ruhigen Bucht im kanadischen Nova Scotia. Morgens wachten wir oft vom Geruch von brutzelndem Speck und der tiefen, begeisterten Stimme meines Großvaters auf. »Aufgestanden, ihr Schlafmützen!«, rief Grandpa, während wir noch im Bett lagen. »Heute ist ein wichtiger Tag! Wir haben wichtige Dinge zu tun!« Meinem Großvater zufolge hatten wir jeden Tag »wichtige Dinge« zu tun.
»Augenblick …«, sagte er dann, während er im Türrahmen unseres Zimmers stand. Er sah in einem unsichtbaren Terminplan nach, der draußen hinter dem Panoramafenster des Cottage schwebte, irgendwo weiter unten, wo das Meer gegen die Ufer des Sandstrandes schlug. »Heute müssen wir schwimmen. Und Sandburgen bauen. Dann müssen wir den Rasen mähen und Brennholz hacken und noch einmal schwimmen. Danach müssen wir segeln, gefolgt von einem kurzen Ausflug in die Stadt, um ein paar Lebensmittel einzukaufen. Dann steht ein Barbecue auf dem Programm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir direkt im Anschluss daran noch ein bisschen Blaubeerkuchen essen müssen. Und dann werden wir das alles abrunden, indem wir uns die Zähne putzen, unsere Pyjamas anziehen und eine Gutenachtgeschichte lesen.«
Mein Bruder und ich lauschten seinen Worten von der warmen Behaglichkeit unserer Etagenbetten aus und stellten uns weiter schlafend, bis Grandpa sagte: »Aber bevor wir das alles tun können, muss ich euch Schlafmützen erst einmal aus dem Bett holen!« Und mit diesen Worten stürzte er sich auf uns und kitzelte uns durch einen Berg von Decken hindurch, während wir lachten und kicherten und noch ein bisschen mehr lachten.
Egal, wie alt wir waren – jahrelang, ein Jahrzehnt lang, begann so jeder einzelne Sommertag mit ihm.
Er beendete unsere Tage auf fast die gleiche Weise. Nach unserem Tag voller Aufgaben und Spaß, und bevor wir es überhaupt richtig bemerkten, senkte sich die Dämmerung über uns. Wir waren hundemüde, schlüpften in unsere Pyjamas und machten uns bettfertig. Dann kam er herein, um uns eine Geschichte vorzulesen, und bevor er das Licht ausschaltete, fragte er jedes Mal: »Jungs, hattet ihr einen schönen Tag?«
»Natürlich hatten wir das, Grandpa!«
»Wisst ihr, Jungs«, sagte er dann mit leiser, sanfter Stimme, »heute war ein freier Tag.«
»Was ist ein ›freier Tag‹, Grandpa?«, fragten wir jedes Mal.
Und dann sah er mit einem breiten Lächeln zu uns hinunter und sagte: »Ein freier Tag ist, wenn man einen ganzen Tag damit verbringt, Dinge zu tun, die man liebt – wie zum Beispiel Sandburgen bauen, Drachen steigen lassen oder schwimmen gehen. Und wenn du diese Dinge mit Leuten tust, die du liebst und die dich lieben, dann wirst du an diesem Tag kein Stückchen älter. Das ist ein freier Tag.« Dann hielt er inne und strich uns die Haare aus dem Gesicht, während er uns tief in die Augen sah. »Heute, Jungs, hatten wir einen freien Tag auf der Erde. Heute sind wir nicht alt geworden. Und jetzt schlaft gut. Ich liebe euch.«
Dann schaltete Grandpa das Licht aus, und wir sanken in einen tiefen, schweren Schlaf. Wir liebten ihn von ganzem Herzen, und er liebte uns sogar noch mehr.
Erst viel später in meinem Leben, nachdem ich verloren hatte, was ich am meisten liebte, und lange nachdem Grandpa nicht mehr war, lernte ich, wie schwer »freie Tage« in diesem Leben zu bekommen sind. Ich vergaß, wie sie sich anfühlten, bis George mir half, sie wiederzufinden. Und jetzt, mit Georges Hilfe, versuche ich aus jedem Tag einen freien Tag zu machen.
TEIL EINS
Unter Wasser
EINS
Die Wolken hatten New York City den ganzen Tag eingehüllt, eine zerknautschte graue Decke, die über den Hochhäusern lag. Es war Februar 2008 und so kalt, dass die New Yorker, selbst wenn New York sich weigerte zu schlafen, es mit Sicherheit vorgezogen hätten, zusammengerollt im Bett zu bleiben. Jene Unglücklichen, die sich aus dem Bett und hinaus in die kalte Welt schleppen mussten, eilten jetzt mit bitterer Entschlossenheit durch die Straßen, die Kragen hochgeschlagen und die Mäntel gegen die Kälte fest zugezogen. Ich war geschäftlich in New York, und ich wollte meinen Tag voller Meetings einfach nur hinter mich bringen, um nach Hause zu meiner geliebten Frau zu fliegen, mit der ich seit vier Jahren verheiratet war. Die Kälte und das Chaos konnten mir nichts anhaben, denn bald würde ich nach Hause fliegen. Bald würde ich bei Jane sein.
Ich arbeitete als Manager für MKTG, eine hippe Marketingfirma mit Sitz in New York City. Ich arbeitete gern dort – die Kollegen waren die klügsten, innovativsten Leute, mit denen ich je zusammengearbeitet hatte. Sie waren professionell und witzig. Ich leitete das kanadische Büro in Toronto und war in die Stadt gekommen, um wegen einer Fernsehshow nachzuhaken, die wir NBC angeboten hatten. Ein paar Wochen zuvor hatten wir den NBC-Vizesportchef von einer Reality-Sportshow überzeugt, die ich entwickelt hatte. Das Leben war toll. Ich hatte eine schöne, liebevolle Ehefrau und einen großartigen Job, bei dem ich mit netten Leuten zusammenarbeitete.
An jenem Morgen wachte ich eineinhalb Stunden, bevor mein Wecker klingeln sollte, auf und sah durch das Fenster auf die Häuserdächer hinaus. Ich konnte nicht mehr schlafen, daher schrieb ich Jane eine SMS, um zu sehen, ob sie auch schon wach war. Augenblicke später hörte ich nicht das Piepsen einer Antwort-SMS, sondern das Klingeln meines Telefons.
»Hey, du bist ja wach!«, sagte ich.
»Irgendwie schon«, antwortete sie sanft lachend, die Stimme noch belegt vom Schlaf. »Ich habe deine SMS gesehen.«
»Ich lasse dich weiterschlafen«, sagte ich fast im Flüsterton. »Aber es war schön, deine Stimme zu hören. Danke, dass du angerufen hast.«
»Wann ist dein erstes Meeting?«
»Halb zehn.«
»Du wirst deine Sache toll machen.« Ich konnte ihr Lächeln hören.
»Danke, es dürfte alles glattgehen.«
»Ich liebe dich. Viel Glück. Ruf mich später an.«
»Mache ich. Ich liebe dich auch«, sagte ich.
Ich legte auf, froh, ihre Stimme gehört zu haben. Auch wenn es zu meinem Job gehörte, um die ganze Welt zu reisen, in tollen Hotels zu wohnen und in fantastischen Restaurants zu essen, vermisste ich Jane jedes Mal, wenn ich fort war. Unsere Terminkalender sorgten oft dafür, dass wir getrennt waren, umso mehr wusste ich unsere gemeinsame Zeit zu schätzen. Zu Hause hieß für mich Jane.
Ich stand auf, duschte, zog mich an und fuhr zu meinem ersten Meeting, das besser verlief, als ich mir erhofft hatte. Meine Kollegen und ich aßen gemeinsam zu Mittag, bevor wir uns in unsere Nachmittagsmeetings stürzten. Mein Flug sollte an jenem Abend gehen, aber als wir mit dem Essen fertig waren, hatte der Wind aufgefrischt und den Himmel in einen kräftigen Bluterguss aus Dunkelviolett und Grau verwandelt. Es hatte noch nicht zu schneien begonnen, aber in den Nachrichten wurde bereits vor einem bevorstehenden Wintersturm gewarnt, und ich wusste, dass die Chance, dass mein Flugzeug planmäßig starten würde, rasch schwand. Während ich zusah, wie die New Yorker versuchten, fluchtartig zurück in die Wärme und den Schutz ihrer Häuser zu gelangen, verspürte ich einen überwältigenden Drang, dasselbe zu tun. Ich wollte nicht an einem Flughafen stranden. Ich wollte nach Hause. Ich wollte zu meiner Frau. Ich wollte bei Jane sein.
Jane und ich hatten uns fast 15 Jahre zuvor bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt. Sie war jemand, der in einer Menge immer hervorstach. Sie war hübscher, größer, blonder und lebhafter als jede andere Person im Raum. Ich hatte sie aus der Ferne gesehen, während sie mit einem anderen Teilnehmer sprach, und ich war hingerissen von ihrer natürlichen Haltung und Eleganz, ganz zu schweigen von ihrem Lächeln. Es ließ mich dahinschmelzen. Als mich nur noch ein paar Schritte von dem mir zugewiesenen Tisch trennten, wurde mir klar, dass sie nicht nur an meinem Tisch saß, sondern wir sogar nebeneinander platziert waren. Mein Herzschlag hämmerte in meinen Ohren und übertönte jedes andere Geräusch im Raum.
Bevor ich zu nervös werden konnte, streckte sich mir eine Hand entgegen. »Hi, ich bin Jane.«
Wir redeten übers Wetter, die Toronto Blue Jays, unsere Jobs – banale Dinge –, aber in ihrer Gegenwart nahmen sie eine neue Bedeutung an. Sie war Journalistin und berichtete für eine Lokalzeitung über die Veranstaltung. Sie vertiefte sich in unser Gespräch und gab mir das Gefühl, die faszinierendste Person im Raum zu sein. Mir wurde schnell klar, dass sie einen messerscharfen Verstand und ein weltgewandtes Wesen hatte. Und sie fluchte wie ein Seemann – was nicht allzu viele Frauen bringen. Es gefiel mir sehr. Während des Hauptgangs hatte ich bereits das Gefühl, wir hätten eine Verbindung und ich jemand Besonderen kennengelernt.
Am Ende des Abends schlug ich vor, in Kontakt zu bleiben, und wir tauschten unsere Visitenkarten aus. Als ich ging, sagte ich zu einem Kollegen, dass ich diese Frau heiraten würde. Er lachte. »Sie kann vermutlich heiraten, wen immer sie will, und du wirst es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sein.« Ich lachte ebenfalls und sagte: »Wart’s ab.«
In den nächsten paar Tagen nahm ich Janes Visitenkarte immer wieder in die Hand. Anrufen oder nicht? Ich wollte eine angemessene Zeit verstreichen lassen und nicht allzu interessiert erscheinen. Ich hielt ganze eineinhalb Tage durch, bevor ich sie auf einen Kaffee einlud. Ich hinterließ eine Nachricht auf ihrer Mailbox, und während ich auf eine Antwort wartete, erzählte ich jedem, der bereit war, zuzuhören, dass ich diese unglaubliche Frau kennengelernt hatte. Mir war bewusst, dass ich ein bisschen vorpreschte – ich kannte sie schließlich noch gar nicht –, aber in diesem Moment war mir das eigentlich egal.
Jane rief mich am nächsten Tag zurück. Wir trafen uns auf einen Kaffee. Nach ein bisschen Small Talk erzählte sie mir, sie sei seit Kurzem mit jemandem zusammen. Sie sagte, sie könne nicht leugnen, dass es während des Wohltätigkeitsessens zwischen uns gefunkt habe, aber mit diesem anderen Typen sei es ihr ernst. Sie wolle offen und ehrlich bezüglich ihrer Beziehung sein, sagte sie, denn sie wolle trotzdem mit mir befreundet sein. Ich war enttäuscht, aber ich wollte unbedingt ein Teil ihres Lebens sein, auf welche Weise auch immer. Außerdem, nennen Sie es jugendliche Arroganz, aber ich dachte ernsthaft, es sei nur eine Frage der Zeit, bis sie diesem anderen Typen den Laufpass geben und sich für mich entscheiden würde. Schließlich war sie die Frau, die ich heiraten würde. Wir würden den Rest unseres Lebens zusammen verbringen. Sie würde nur noch ein bisschen länger brauchen, um es zu begreifen.
Im Laufe der nächsten Monate entwickelte sich eine warmherzige Freundschaft zwischen uns. So schwer es mir auch fiel, nicht mit ihr zu flirten, tat ich mein Bestes, um ihre Grenzen zu respektieren. Aber ich fand dennoch jede nur erdenkliche Ausrede, sie zu sehen. Über die Arbeit meldete ich mich bei »Essen auf Rädern« an, einem ehrenamtlichen Dienst, der sozial benachteiligten Menschen in der Gemeinde, die nicht immer in der Lage sind, selbst für sich zu kochen, Mahlzeiten bringt. Als ich erfuhr, dass man einen Partner brauchte, um die Mahlzeiten auszuliefern, rief ich Jane an und fragte sie, ob sie mitmachen wolle.
»Auf jeden Fall«, sagte sie. »Wann fangen wir an?«
»Diesen Mittwochmittag. Oder nächste Woche – was immer dir besser passt.«
»Diese Woche könnte ich. Abgemacht.«
»Fantastisch«, sagte ich und grinste über beide Ohren. »Ich hole dich von der Arbeit ab.« Mahlzeiten auszuliefern bedeutete, dass ich Jane jede Woche neunzig Minuten sehen durfte. Mir war klar, dass die ehrenamtliche Arbeit nicht glamourös sein würde, aber zu wissen, dass Jane dabei sein würde, war alles, was ich an Glamour brauchte.
Von unserer ersten Auslieferung an war die Arbeitsteilung klar: Jane klopfte an die Türen und übernahm den Großteil des Gesprächs; ich trug die große Essenstüte herein. Die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, lebten in Sozialwohnungen in einer rauen Ecke von Toronto, die von Armut und Gewalt geprägt war. Das Leben hatte ihnen übel mitgespielt. Ein paar von ihnen waren schon älter, und viele waren von ihren Familien nahezu völlig im Stich gelassen worden. Andere lebten mit HIV oder Aids, und im Laufe der Wochen und Monate wurden wir Zeugen, wie sie vor unseren Augen immer mehr abmagerten, obwohl wir ihnen gutes, gesundes Essen brachten. Sowohl Jane als auch ich konnten ihre Einsamkeit und Verzweiflung spüren, und wir taten unser Bestes, um ihnen ein bisschen Freundlichkeit und stille Unterstützung zu bieten. Freunde fragten mich oft, wie ich damit klarkam, ohne depressiv zu werden. »Das ist ganz leicht«, antwortete ich dann. »Ich mache es gemeinsam mit Jane.«
Wenn sie über die Schwelle einer geöffneten Tür trat, brachte Jane jedes Mal dieselbe ungeteilte Aufmerksamkeit mit, die sie an dem Abend, an dem wir uns kennenlernten, mir schenkte – sie hinterließ immer einen tiefen Eindruck. Ich beobachtete fasziniert, wie sich einer nach dem anderen in sie verliebte. Und ich konnte nicht umhin, mich selbst immer mehr in sie zu verlieben. Je mehr Zeit ich mit ihr verbrachte, desto besser lernte ich sie kennen. Und je besser ich sie kannte, desto mehr spürte ich, dass mein anfänglicher Impuls, den Rest meines Lebens mit ihr verbringen zu wollen, doch nicht so verrückt war.
Jede Woche, bevor wir anfingen, wandte sie ihre Aufmerksamkeit mir zu. Sie sah mir tief in die Augen und fragte: »Wie geht es dir, Colin? Was gibt’s Neues bei dir? Was gibt’s Gutes in deinem Leben?« Das ist ein roter Faden in meinem Leben: Die Leute, die mir am meisten bedeuten, sehen mir tief in die Augen – mein Großvater, mein guter Freund und Boss Charlie, Jane. Und später mein Hund, George. Wenn Jane mich so ansah, verspürte ich jedes Mal ein Gefühl von Verbundenheit und beantwortete ihre Fragen bereitwillig. Sie wiederum erzählte mir amüsante Geschichten von ihrer Arbeit oder ihren Freundinnen, und wir teilten Freud und Leid. Zeit mit ihr zu verbringen, war tröstlich und vertraut, und bei diesen allwöchentlichen Treffen schafften wir es, einen kalten, deprimierenden, verborgenen Teil der Stadt zu unserer Zuflucht zu machen. Am Ende der Essensauslieferung gaben wir uns jedes Mal die Hand, und sie sagte: »Ich wünsche dir eine schöne Woche.« Und ich winkte und lächelte, während ich mich entfernte. Und dann vermisste ich sie die nächsten sieben Tage.
So ging es monatelang, und es wurde zu einem verlässlichen Rhythmus in meinem Leben. Hin und wieder kreuzten sich unsere Wege bei anderen arbeitsbezogenen Veranstaltungen. Sie zu sehen, war jedes Mal toll, und mein Wunsch, sie zu heiraten, ließ nie nach; im Gegenteil, er wurde immer stärker. Dann, eines Tages, rief mich Jane aus heiterem Himmel an, und es hatte nichts mit unserem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz zu tun. »Ich wollte fragen, ob wir uns vielleicht auf einen Kaffee treffen könnten«, sagte sie. Sie klang anders, ernster als sonst.
»Natürlich«, sagte ich.
Ein paar Tage später trafen wir uns in einem Starbucks. Sie schien nervös und zappelig, aber als sie mir gegenüber Platz nahm, musterte sie mich mit diesem unverwandten, fast einschüchternden Blick. Sie sagte seelenruhig: »Ich glaube, ich weiß, was du für mich empfindest, und ich weiß, dass etwas Besonderes zwischen uns ist. Ich weiß wirklich zu schätzen, was wir als Freunde haben, und daher wollte ich, dass du es von mir hörst, bevor irgendjemand anderes irgendetwas sagt.«
Ich spürte, dass das, was als Nächstes kommen würde, nichts Gutes war.
»Ich werde heiraten.«
Über zwei Jahre lang war ich damit umgegangen, nicht mit ihr zusammen sein zu können, indem ich meine Gefühle beiseitegeschoben hatte. Aber im Hinterkopf hatte ich die Überzeugung nie abgeschüttelt, dass sie sich letztendlich von diesem Typen trennen und sich für mich entscheiden würde. Als sie mir diese Neuigkeit mitteilte, war ich am Boden zerstört, und ich wusste, dass ich sie nicht mehr sehen konnte, nicht einmal als Freund. In dem Augenblick machte ich das Beste daraus – ich lächelte und sagte ihr, dass ich mich für sie freute, und wünschte ihr viel Glück. Aber von diesem Tag an vermied ich bewusst den Kontakt mit ihr. Sie brauchte mich nicht in ihrem Leben. Es wurde Zeit für mich, nach vorn zu blicken, so schwer es auch fiel.
Einige Jahre später, es war 2004, hatte ich Jane fast vergessen. Ich war noch immer Single, hatte meinen Job in Toronto aufgegeben und war zurück nach Nova Scotia gezogen, um in der Nähe meines Großvaters zu sein. Er war bei schlechter Gesundheit, und ich wollte das Beste aus der Zeit machen, die ihm noch blieb. Er war für mich ein Anker gewesen, als ich aufwuchs, und ich wollte die Liebe und Fürsorge, die er mir als Kind geschenkt hatte, zurückgeben. Mein Großvater war der leidenschaftlichste Mensch, den ich je gekannt habe, ein Mann, der das Leben voll auskostete, egal, was er tat – ein Auto reparieren, einen Witz erzählen, ein Barbecue veranstalten oder mit seinen Enkeln schwimmen gehen.
Mich um meinen Großvater zu kümmern, hieß, für ziemlich lange Zeit fern von meinem normalen Leben zu sein. Ich unternahm mehr oder weniger regelmäßige Trips nach Toronto, geschäftlich und um Freunde zu besuchen. Bei einem dieser Trips – es war Anfang März, und ich hatte einen Termin bei meinem Steuerberater – lief mir Jane über den Weg. Sie stand an einem Fußgängerübergang im Finanzdistrikt und wartete darauf, dass die Ampel umsprang. Sie trug eine dicke Winterjacke und eine Mütze, aber sie war es eindeutig. Ich hatte im Laufe der Jahre versucht, nach vorn zu blicken – und ich dachte, ich hätte es getan –, aber in dem Augenblick, in dem ich sie sah, wusste ich, dass mir das nicht sehr gut gelungen war.
Ich sah sie näher kommen, nachdem die Ampel grün geworden war. Dann sah ich, wie ihre schönen hellblauen Augen aufleuchteten, als sie mich bemerkte. Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, und sie streckte die Arme aus und drückte mich fest an sich. Wir standen mitten auf der Kreuzung, und ich war zu perplex, um etwas zu sagen. Ein Taxi, das versuchte, um die Ecke zu biegen, hupte uns an, daher legte ich den Arm um sie und führte uns hinüber auf den sicheren Gehsteig.
»Ich habe gehört, dass du weggezogen bist«, sagte sie atemlos. »Ich habe gehört, dass du in Halifax bist.«
Das Einzige, was ich hervorbrachte, war: »Ja.«
»Und was tust du wieder in Toronto?«
Ich erzählte ihr, dass ich nur für einen Tag in der Stadt war und dass ich nach Osten gezogen war, da es meinem Großvater nicht so gut ging.
»Es tut mir wirklich leid, das zu hören«, sagte sie. »Ich kann mich erinnern, dass du jedes Mal ein breites Lächeln im Gesicht hattest, wenn du von ihm gesprochen hast.«
»Danke. Ich will einfach etwas Zeit mit ihm verbringen, solange ich das noch kann.«
Dann fragte sie: »Wie wär’s mit einem gemeinsamen Abendessen?«
Mein Flug ging in ein paar Stunden, daher tat ich das Einzige, was ich tun konnte, um sie zu sehen: Ich log. »Ich reise erst morgen ab. Na klar – Essen gehen wäre toll!«
Ich buchte meinen Flug um und traf sie in der Innenstadt in der Bar des King Edward Hotels. Wir aßen und tranken und tauschten alle Neuigkeiten über unser Leben aus. Sie erzählte mir, dass sie sich von ihrem Mann getrennt habe.
»Er war nicht der Typ, für den ich ihn gehalten habe«, sagte sie, während sie den Blick senkte und ihre Hände in ihrem Schoß betrachtete. »Wir haben uns einfach treiben lassen. Es hat nicht geklappt«, fügte sie hinzu. »Ehrlich gesagt, habe ich in letzter Zeit oft an dich gedacht.«
Und das war der Moment, in dem sie innehielt, mir tief in die Augen sah und erklärte: »Ich habe den falschen Mann geheiratet.«
Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. In den Jahren, seit ich sie kennengelernt hatte, hatte ich Verabredungen mit anderen Frauen gehabt und mich sogar auf ein paar ernsthafte Beziehungen eingelassen. Aber ich hatte nie gefühlt, was ich mit Jane hatte, und ich war nie imstande gewesen, mich irgendeiner anderen völlig hinzugeben. Und jetzt saß Jane hier, mir gegenüber am Tisch, und sagte genau die Worte, die ich mir von ihr immer erhofft hatte. Ich verspürte Freude, Genugtuung, Aufregung. Ein bisschen Verwirrung. Tonnenweise Schock. Und Liebe. Ich glaubte, mein Lächeln würde mein Gesicht zerreißen. Ich sagte ihr, dass meine Gefühle für sie so stark waren wie eh und je, dass ich sie liebte und schon immer geliebt hatte.
»Und, meinst du, wir können die ganze Zeit nachholen, die wir versäumt haben?«, fragte sie.
»Ja«, sagte ich. »Ja, das können wir.«
Ein Jahr später, an einem wunderschönen Herbsttag, vor vierzig unserer engsten Verwandten und Freunde, in einer winzigen Kirche am Meer in Boutiliers Point, Nova Scotia, in den tröstlichen Geruch von Ahornholz gehüllt, das im Holzofen brannte, heirateten wir.
Es war der glücklichste Tag meines Lebens.
An all das erinnerte ich mich an jenem eiskalten Nachmittag in New York City, vier Jahre, nachdem ich Jane geheiratet hatte, während der Sturm alle Flüge vom Flughafen LaGuardia zu verhindern drohte. Es hatte noch immer nicht zu schneien begonnen, daher bestand noch immer eine Chance, dass ich es aus der Stadt schaffen würde, wenn ich mich beeilte. Während ich das Taxi im Stillen beschwor, sich schneller durch den Verkehr zu schlängeln, rief ich Jane an. »Bis jetzt wurden noch keine Flüge gestrichen, aber das wird bald passieren. Ich werde versuchen, den frühestmöglichen zu kriegen.«
»Heißt das, wir sehen uns heute Abend noch?«, fragte sie mit einem Zittern in der Stimme.
»Ich hoffe es.«
»Was meinst du, um wie viel Uhr du hier sein wirst?«
»Ungefähr zum Abendessen, falls mein Flug umgeleitet werden kann.«
»Bitte versuch es«, sagte sie.
»Du weißt, dass ich das tun werde.«
Schließlich erreichte ich den Flughafen, wo ich feststellte, dass eine regelrechte Revolte unter den Reisenden ausgebrochen war. Geschäftsleute mit Handkoffern bahnten sich mit den Ellenbogen unsanft einen Weg zwischen Gruppen panischer Touristen hindurch, und Flughafenmitarbeiter wurden in die Mangel genommen wie Hauptzeugen in einem Mordprozess. Die Schlange, die sich vor dem Air-Canada-Schalter erstreckte, war unvorstellbar lang und voller schreiender Kinder. Ich stellte mich an ihrem Ende an. Nach, wie es mir vorkam, Stunden stand ich endlich vor einer Air-Canada-Angestellten, die wohl einen der schlimmsten Tage ihres Lebens hatte.
»Halten Sie durch?«, fragte ich, während ich mein Ticket auf den Tresen legte.
»Mit Mühe«, sagte sie. »Bei schlechtem Wetter drehen die Leute einfach durch. Was kann ich für Sie tun?«
Ich holte einmal tief Luft. »Ich weiß, es ist vermutlich dasselbe, worum jeder andere Sie auch bittet«, begann ich, »aber ich versuche, so schnell wie möglich nach Hause nach Toronto zu kommen. Ich nehme nicht an, dass mein Flug heute Abend noch gehen wird, und wenn Sie mir helfen könnten, eine Alternativroute zu finden, wäre ich Ihnen wirklich sehr verbunden.«
Sie nahm mein Ticket und bat mich um meinen Pass. Dann tippte sie in ihren Computer. Kurz darauf sah sie auf und schenkte mir ein Lächeln. »Alle derzeitigen Flüge nach Toronto sind ausgebucht. Ich könnte Sie vielleicht auf einen Flug nach Charleston buchen. Das ist nicht vom Schnee betroffen. Von dort haben wir einen Direktflug nach Toronto, und Sie dürften problemlos nach Hause kommen.«
»Das wäre perfekt«, sagte ich. »Vielen Dank.«
Sie druckte meine neue Bordkarte aus und reichte sie mir.
Ich rief Jane an, als ich in Charleston das Flugzeug verließ. »Ich stecke hier noch ungefähr zwei Stunden fest, aber ich bin aus New York herausgekommen.«
»Ich dachte, du würdest zum Abendessen zu Hause sein.« Sie klang enttäuscht, vielleicht sogar ein bisschen verärgert.
»Das ist das Beste, was ich ausrichten konnte. Wenn ich nicht auf diesem Weg gekommen wäre, hätte ich weiß Gott wie lange in New York festgesteckt.«
»Scheint so«, sagte sie. Diesmal klang sie eindeutig verärgert.
»Es tut mir leid. Ich wünschte, ich wäre schon da. Aber ich werde bald zu Hause sein. Das ist das Wichtigste. Ich liebe dich.«
Eine kurze Pause trat ein, und dann sagte sie: »Bis später.«
ZWEI
Ich landete um kurz vor Mitternacht zu Hause in Toronto, in der, wie sich später herausstellte, kältesten Nacht des Jahres. Schnee lag tief zu beiden Seiten der Landebahn, aber der dunkle Himmel war klar und sternenübersät. Während das Flugzeug zum Gate rollte, zückte ich mein Handy und schickte Jane eine SMS: »Bin sicher gelandet. Es ist spät. Mach dir nicht die Mühe, mich abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi.« Ich war erschöpft, aber ich wollte nicht, dass sie so spät noch das Haus verlassen musste, vor allem angesichts der Tatsache, dass es sich wie die kälteste Nacht des Jahres anfühlte. Ich musste unwillkürlich lächeln, als eine Minute später ihre Antwort kam: »Keine Sorge. Bin schon unterwegs.« Es ist erstaunlich, wie gut eine solche Kleinigkeit tun kann.
Ich stellte meine Tasche am Straßenrand ab und drehte mich mit dem Rücken in den Wind. Ich versuchte, mich zu wärmen, indem ich an den Urlaub dachte, von dem Jane und ich geredet hatten. Ich stellte mir vor, wie wir in Barbados, unserem Lieblingsurlaubsziel, am Strand lagen, zu dem Geräusch der Brandung, die an der Küste nagte, unsere Liegestühle dicht aneinandergeschoben, während wir unter der Sonne lasen, stets auf Körperkontakt bedacht – Finger, die sich knapp berührten, Beine, die träge verheddert waren. Ich hielt eine Minute an dem Bild fest, und dann schlug ich die Augen wieder auf, während schneebedeckte Wagen vorbeifuhren und salzgetränkten Matsch auf den Gehsteig hochspritzten. Beim Einatmen schienen die Härchen in meinen Nasenlöchern zu gefrieren.
Janes Ford Escape kam um die Ecke in Sicht. Eine letzte Etappe noch – eine kurze, warme Autofahrt mit der Person, die ich auf der Welt am meisten liebte –, und ich konnte meine Tasche fallen lassen, meine Jacke hinwerfen und mich mit ihr ins Bett kuscheln. Als sie vor mir hielt, grinste ich wie ein Idiot.
Ich öffnete die hintere Tür und warf meine Tasche auf die Rückbank. Dann sprang ich auf den Beifahrersitz, noch immer leicht zitternd. »Oh, Mann, bin ich froh, dich zu sehen.« Ich beugte mich zu einem Kuss zu ihr herüber.
»Willkommen zu Hause«, sagte sie, bevor sie mir einen flüchtigen Kuss auf den Mund gab. Dann drehte sie sich wieder zum Lenkrad um und fuhr los. »Wie geht es dir? Wie war dein Flug?« Sie trug ihren dicken Parka und eine Strickmütze, unter der ein paar goldblonde Strähnen hervorlugten. Sie sah süß und entzückend aus. Ich freute mich so, sie zu sehen.
»Und, wie waren deine Meetings?«
»Sie sind toll gelaufen. Wir fangen wirklich an, alles für die Show zusammenzukriegen – es ist echt spannend.«
»Das ist ja großartig!«, sagte sie, während sie den Blick für einen Moment von der Straße abwandte und mir ein Lächeln zuwarf.
Ich erzählte ihr noch ein paar mehr Details und fragte sie dann, wie ihre Tage verlaufen waren.
»Oh, es war alles gut«, tat sie die Frage mit einem Schulterzucken ab. »Hast du eigentlich Hunger? Wir haben nicht viel zu essen im Haus, aber ich kann unterwegs irgendwo anhalten.«
»Schon gut. Ich will nur noch nach Hause.«
An diesem Punkt in meinem Leben hatte »nach Hause« eine zusätzliche Bedeutung. Nie zuvor hatte irgendein anderes Haus, in dem ich gelebt hatte, sich so sehr wie ein Zuhause angefühlt. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich den Ort mit Jane verband; all unsere Erinnerungen als verheiratetes Paar waren dort gespeichert. Seine Lage – gegenüber einem Park, mit Blick auf einen Kinderspielplatz in einer stillen Einbahnstraße am östlichen Ende der City – war das, worin wir uns als Erstes verliebt hatten. Das Haus selbst war solide gebaut. Wir bekamen es zu einem anständigen Preis, da die letzten größeren Reparaturen in den Sechzigerjahren erfolgt waren. In nur dreieinhalb Monaten hatten wir das Haus von Grund auf entkernt und erneuert, hier und da unter Mithilfe von Freunden und Verwandten. Wir installierten neue Elektro- und Wasserleitungen – und erfreuten uns dank neuer Rohre an herrlich kräftigem Wasserdruck –, ersetzten alle Trockenbauwände, verwandelten drei winzige Schlafzimmer in zwei größere mit Gewölbedecken, renovierten die Küche, reparierten das Dach und die Eingangsveranda und rissen die alte Aluminiumverschalung an der Seite herunter, um das Backsteingemäuer freizulegen. Wir heuerten sogar »Backstein-Hippies« an, um den schönen alten Backstein zu säubern und auszubessern. Obwohl wir bereits seit über einem Jahr zusammenlebten, als wir es kauften, bedeutete es etwas Besonderes, das Haus zusammen saniert zu haben, anstatt andere Leute die Arbeit machen zu lassen.
Jane hatte ein Händchen für Pflanzen, das sie sich bei den Staudenbeeten zunutze machte, die wir im Vorgarten anlegten. Mein eigener Daumen war alles andere als grün, aber ich liebte es dennoch, an ihrer Seite zu arbeiten. Am Ende eines langen Sommertages, den wir mit Unkrautjäten und Bewässern verbracht hatten, saßen wir oft bei ein paar Gläsern Wein auf der Veranda und bewunderten unser Werk, während die Sonne über dem Park unterging.
An dem Abend, an dem Jane mich vom Flughafen nach Hause fuhr, wunderte ich mich, dass sie vor dem Haus vorfuhr. Eine Auffahrt führte zu der Garage im hinteren Teil unseres Grundstücks, aber sie bog nicht darauf ein. »Hey«, sagte ich, »du hast die Auffahrt verpasst.«
Sie antwortete nicht gleich, lenkte den Wagen nur langsam weiter und brachte ihn dann an der Bordsteinkante zum Stehen. Sie legte die Parkstellung ein, schaltete den Motor aber nicht aus. Beide Hände aufs Lenkrad gelegt, machte sie eine kurze Pause, und dann, den Blick fest nach vorn gerichtet, verkündete sie: »Ich gehe nicht mit hinein.«
Ein irgendwie grober Witz, den sie mir da auftischte, nach den Reisestrapazen, die ich eben erst durchgemacht hatte. »Ja, na klar«, sagte ich kichernd. »Aber im Ernst, warum stehen wir vor dem Haus?«
Die Pause dauerte beim zweiten Mal länger, aber die Antwort blieb dieselbe: »Ich gehe nicht mit hinein, Colin.«
Diesmal registrierte ich ihren Ton. Er war kalt, abgehackt, monoton, roboterartig und absolut nicht wiederzuerkennen. Das Lächeln schwand aus meinem Gesicht. »Was meinst du damit?«
»Ich meine, dass ich nicht mit hineingehe«, sagte sie noch einmal. Sie starrte weiter stur geradeaus, mit fester, unergründlicher Miene. In den 15 Jahren, die ich sie nun kannte, war es, soweit ich mich erinnern konnte, das erste Mal, dass sie mir nicht in die Augen sah, während wir redeten. »Colin, ich bin sehr unglücklich, und ich bin schon lange unglücklich. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken, und das muss ich an einem anderen Ort als hier tun. Ich werde bei einer Freundin wohnen.«
Auf einmal bekam ich keine Luft mehr. Ich fühlte mich, als wäre ich unter Wasser. Panik schlug mir genau in die Magengrube. Ich erinnerte mich an meine Studienzeit, als ich im Sommer als Rettungsschwimmer in einer Strandanlage in Nova Scotia namens Rissers Beach arbeitete. Um den Job zu bekommen, absolvierte ich Reanimations- und Erste-Hilfe-Kurse und bestand eine Reihe anspruchsvoller Fitness- und Schwimmtests. Während des Trainings wurde uns immer und immer wieder eingeschärft, dass Panik in Notfallsituationen das Schlimmste sei. Wenn man in Panik ausbricht, verschwendet man Energie – man kann sich nicht darauf konzentrieren, den Kopf über Wasser zu halten und aus der Gefahrenzone zu schwimmen. Wenn man um Hilfe schreit und Wasser schluckt, bricht man erst recht in Panik aus, und schließlich geht man unter. Es wurde uns eingetrichtert, wie wichtig es sei, einen kühlen Kopf zu bewahren, und diese Fähigkeit zu besitzen, zählte mehr als noch so viel Kraft oder Ausdauer. Als ich in diesem Wagen saß, während die Lüftungsanlage brummte und mein Puls so schnell und laut raste, dass es sich anfühlte, als ob mein Herz sich seitlich aus meiner Brust zu zwängen versuchte, konnte ich nicht klar denken. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich pure, ungefilterte Panik – als ob ich ertrinken würde.
»Was? Was sagst du da? Und wo wirst du wohnen?«, fragte ich. »Bei wem wirst du wohnen? Warum tust du das? Worüber musst du nachdenken?« Die Fragen sprudelten ebenso schnell hervor, wie sie mir kamen. Sie sagte nichts.
»Jane, das ist doch verrückt«, sagte ich. »Hör zu, wir sind vernünftige, logisch denkende Menschen. Ich liebe dich. Wir finden eine Lösung.«
»Ich habe es dir bereits gesagt.« Ihr Gesicht war eine Maske und ihre Stimme voller Schärfe. »Wir sind zu unterschiedlich. Wie ich bereits sagte, ich bin schon seit einer ganzen Weile nicht mehr glücklich, und ich habe mich entschieden zu gehen. Es hat nichts mit dir zu tun, und es hat nichts mit uns zu tun. Es ist meine Entscheidung, und ich habe sie bereits getroffen.«
Mir war schlecht und kalt, und ich war in Schweiß ausgebrochen. »Komm einfach ins Haus«, flehte ich. »Lass uns einfach ins Haus gehen. Wir können darüber reden.«
»Ich … ich … gehe, Colin.« Sie sprach jedes Wort deutlich aus, als würde sie mit jemandem reden, der unsere Sprache nicht verstand. »Es gibt nichts, was du sagen könntest. Du musst mich gehen lassen. Bitte steig aus.«
In diesem Augenblick wusste ich, dass meine einzige Hoffnung darin bestand, sie dazu zu bringen, aus dem Wagen auszusteigen und mit ins Haus zu kommen, damit ich verstehen konnte, was passierte, damit ich einfach mit ihr reden konnte, bis die alte Jane wieder da war und dieser ganze Albtraum verschwand. Aber mein Mund wollte sich nicht bewegen. Ich saß schweigend da, fix und fertig, während mir die Tränen über die Wangen liefen. Sie wandte den Kopf nicht um, sah mich nicht an, und doch schien sie etwas milder zu werden. »Es ist nur für ein paar Tage«, sagte sie. »Ich muss einfach ein paar Tage nachdenken. Ich rufe dich an.«
In meinem panischen Zustand klammerte ich mich an diese Hoffnung. Wenn es nur für ein paar Tage ist, dachte ich, na schön. Ich werde ins Haus gehen und wieder zu mir kommen, und sie kann gehen und sich über sich selbst klar werden, und dann wird sie wieder zur Vernunft kommen. Sie wird nach Hause kommen. Ich schnappte meine Tasche von der Rückbank und stieg aus. Sie fuhr los, sobald ich die Tür geschlossen hatte.
Die Haustür war kaum sechs Meter von dort entfernt, wo Jane mich hatte stehen lassen. Ich ging wie betäubt, während ich gleichzeitig einen Schrei nur mit Mühe unterdrückte. Der Schnee, der unter meinen Stiefeln knirschte, war das einzige Geräusch. Obwohl es minus 18 Grad waren, fühlte sich mein Gesicht an, als würde es brennen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchte, um die Eingangsveranda zu erreichen. Als ich es bis zur Tür geschafft hatte, griff ich nach meinen Schlüsseln, aber sie fielen mir aus der Hand. Als ich mich bückte, um sie aufzuheben, fiel mir auf, wie stark meine Hand zitterte. Ich holte einmal tief Luft und versuchte, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, aber ob vor Kälte oder Schock, ich konnte meine Hand nicht ruhig genug halten, um die Tür zu öffnen. Ich versuchte es noch einmal, dann ein drittes, viertes und fünftes Mal. Nach mehreren Minuten klickte das Schloss endlich, und die Tür zu unserem Zuhause schwang auf – Janes und meinem Zuhause.
Ich stellte meine Tasche in der Diele ab. Ich kann mich nicht erinnern, die Tür geschlossen zu haben. Ich schaltete das Licht ein, und als ich den Garderobenschrank öffnete, sah ich, dass Janes sämtliche Jacken, Schals, Pullover, Mützen und Schuhe fehlten. Ich rannte die Treppe hinauf ins Schlafzimmer, noch immer in Jacke und Stiefeln. Ich ließ mich vor unserer Kommode auf die Knie fallen und begann, Schubladen aufzuziehen. Janes sämtliche Kleider waren verschwunden. Auch der halbe Schlafzimmerschrank war leer. Ich stand auf und ging ins Badezimmer. Mein Atem ging mühsam und flach. Shampoos, Spülungen, Feuchtigkeitscremes, Salben, Lotions – nicht nur ein Vorrat für ein paar Tage –, alles verschwunden. Als ich die Treppe wieder hinunterwankte, kam ich an halb leeren Bücherregalen und hellen Flecken an den Wänden vorbei, wo Bilder gehangen hatten. Sie hatte jede Spur von sich aus unserem Zuhause getilgt. Das Einzige, was an ihrer Stelle geblieben war, war Leere.