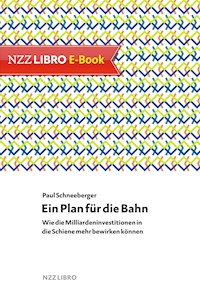
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Schweiz investiert Milliarden in den Ausbau der Eisenbahn. Doch die Investitionen bewirken weniger, als sie könnten. Während die Bautätigkeit und die Technik das Land rasant verändern, will man die Bahn nach der Devise «Mehr vom Gleichen» ausbauen. Dabei könnte sie als spurgeführtes Massenverkehrsmittel die Siedlungsentwicklung steuern und aus der Digitalisierung Nutzen ziehen. Paul Schneeberger wirft wesentliche Fragen auf: Wie kann die Bahn zum Rückgrat der Agglomeration werden? Welche neuen Infrastrukturen lassen sich daraus ableiten? Und welche Spielräume können diese für eine Integration von Massenverkehrsmitteln und baulicher Verdichtung eröffnen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Schneeberger
Ein Plan für die Bahn
Wie die Milliardeninvestitionen in die Schiene mehr bewirken können
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 NZZ Libro, Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1.Auflage 2018 (ISBN 978-3-03810-336-3)
Lektorat: Rainer Vollath, München
Titelgestaltung: TGG Hafen Senn Stieger, St.Gallen
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-383-7
www.nzz-libro.ch
Inhalt
1 Ein Plan für die Bahn?
2 Ein Plan mit Lehren aus der Vergangenheit
2.1 «Mehr vom Gleichen» als Programm
2.2 «Für alle etwas» als Prinzip
2.3 Die Software als Heilserwartung
2.4 Die Bauzonen als Herausforderung
2.5 Die deutschen «Bahnhöfe 21» als Lehrstück
2.6 Die Bahn als Motor der Siedlungsentwicklung
FOKUS: Ein Strauss alternativer Ideen
3 Ein Plan für die ganze Schweiz
3.1 Die Vorstädte und Agglomerationen als «Baustellen»
3.2 Die Hauptbahnhöfe als Wasserköpfe
3.3 Die drei wesentlichen Aspekte
3.4 Die strukturbildenden Infrastrukturen
3.5 Die Korridore als Chancenräume
3.6 Das Beispiel Basel–Zürich
FOKUS: Mehr Tangentialverbindungen
4 Ein Plan für die Städte
4.1 Die Durchmesserlinie anstelle der Untergrundbahn
4.2 Die bisherigen städtebaulichen Wirkungen
4.3 Die Knoten als Chancenräume
4.4 Das Beispiel Luzern
FOKUS: Ein zweites Stadtzentrum für Bern
5 Ein Plan für die Agglomerationen
5.1 Die Inflation der Haltestellen
5.2 Die Zufälligkeit der Haltepunkte
5.3 Die Achsen als Chancenräume
5.4 Das Beispiel Biel–Bern–Thun
FOKUS: Übersichtlichkeit durch klar definierte Zugkategorien
6 Ein Plan für das Land
6.1 Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Mass der Dinge
6.2 Das Kleben am Status quo
6.3 Die Talschaften als Chancenräume und das Beispiel Thal
FOKUS: Wo das Teilen von Autos schon begonnen hat
7 Ein Plan für ein Denken und Handeln in Alternativen
7.1 Das robuste Konzept als Ziel
7.2 Die Ideenkonkurrenz als Schlüssel
7.3 Die kreativen Entwürfe als Ausgangspunkt
7.4 Die vier strategischen Fragen
7.5 Ein neues Wirkungsmodell
FOKUS: Wettbewerb der Ideen
8 Ein Plan für den nationalen Zusammenhalt
8.1 Der Rahmen und die Trägerschaft der Ideenkonkurrenz
8.2 Die fachliche Organisation und der Ablauf der Ideenkonkurrenz
FOKUS: Ideenkonkurrenz in der Verkehrsplanung
9 Ein Plan für die Politik
9.1 Der Faktor Zeit
9.2 Die möglichen Anstösse
FOKUS: Zukunftsbild für den ÖV in den Niederlanden
10 Ein Plan für die Bahn!
Anhang
Geschichte der schweizerischen Eisenbahnplanung
Abkürzungen und Begriffe
Quellen und Literatur
Dank
Der Autor
1 Ein Plan für die Bahn?
«Erst nach der Tat hält der Schweizer Rat.»
Sprichwort, das den alten Eidgenossen zugeschrieben wird.
Fünf Milliarden Franken investiert die Eidgenossenschaft jedes Jahr aus dem unbefristeten Bahninfrastrukturfonds in den Unterhalt und den Ausbau der Eisenbahn. Allein zwischen 2020 und 2050 wird sich dieser Betrag auf 150Milliarden Franken belaufen. Der Gegenwert, den der Bundesrat für diese grossen Summen erwartet, welche die eidgenössischen Räte periodisch freigeben, ist bescheiden. Die Eisenbahn soll ihren heutigen Marktanteil von knapp 20Prozent im Personenverkehr und von 30 bis 40Prozent im Güterverkehr halten. Und das, obwohl die Höhe der verfügbaren Mittel ungefähr gleich gross ist wie jene, die in die Strasse investiert werden, auf der ein erheblich grösserer Teil des Verkehrs abgewickelt wird.
Erreicht werden soll dieses Weiterschreiben des Bisherigen mit einem Mittel, das dem kleinsten gemeinsamen politischen Nenner entspricht: der Beseitigung von «Engpässen» in den Spitzenzeiten, die sich aus den gegenwärtigen Prognosen zum Bevölkerungswachstum ergeben. Es wird weder reflektiert, welche Rolle die Eisenbahn in einer Welt spielen wird, in der die Digitalisierung neue Spielformen der Mobilität ermöglicht, noch wird ausgelotet, welchen Mehrwert und welche zusätzlichen Spielräume der Ausbau des Schienenverkehrsmittels für die Raum- und vor allem für die Siedlungsentwicklung schaffen kann. Kurzum: Es fehlt in der Schweiz an einer Ambition für die Eisenbahn. Und man fühlt sich an das Sprichwort erinnert, das am Anfang dieses Textes steht. Dieses Buch will einen Beitrag zu den Debatten über Investitionsentscheide des Parlaments für konkrete Ausbauschritte leisten. Debatten, in denen sich zunehmend ein Unbehagen, ja ein Misstrauen manifestiert.
Ein Misstrauen, das sich in unterschiedlicher Weise artikuliert und verschiedenste Kreise umtreibt: den Gemeindepräsidenten von Schmerikon am oberen Zürichsee ebenso wie die Fahrgastorganisation «Pro Bahn» und sogar die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Die SBB melden Bedenken gegen ihres Erachtens zu grosse Investitionen an, weil sie deren Folgekosten fürchten und Optimierungspotenziale bei der Software sehen, die den Ausbau von Hardware reduzieren können. Auch die Fahrgastorganisation bemängelt die Dimension des Ausbaus und vor allem die Alternativlosigkeit der bisherigen Planung. Und der Gemeindepräsident am oberen Zürichsee ärgert sich darüber, dass der Voralpen-Express zwischen Luzern und St. Gallen in Schmerikon ab 2025 aus betrieblichen Gründen nicht mehr anhalten wird und dass dadurch die Verbindungen zur anderen Seite des Zürichsees schlechter werden.
So komfortabel die Voraussetzung mit dem stets rinnenden Geldbrünnlein des Bahninfrastrukturfonds für die Finanzierung der Eisenbahn ist, so risikoreich ist die Verfügbarkeit grosser Finanzmittel, ohne dass ausreichend abgewogen wird, nach welchen Grundsätzen diese investiert werden sollen. Auszuloten ist insbesondere, welchen Mehrwert der Ausbau der Eisenbahn zugunsten des politisch gewollten haushälterischen Umgangs mit dem Boden schaffen kann. Als raumsparendes, Personen und Güter bündelndes Verkehrsmittel hat die Eisenbahn das Potenzial, im schweizerischen Verkehrssystem künftig eine grössere Rolle zu spielen als heute. Eine Rolle, durch die sie die räumliche Entwicklung der Schweiz stärker mitsteuern kann.
Um dieses Potenzial auszuschöpfen, reichen die bisherigen Planungsansätze nicht aus. Gefragt ist eine Strategie, gefragt ist ein Konzept und gefragt sind gestalterische Zugänge. Die dafür notwendige Kreativität lässt sich durch ein Denken und Handeln in alternativen Entwürfen freisetzen. In Entwürfen, aus deren Summe sich zukunftsfähige Lösungen ableiten lassen, die mehr bieten als die blosse Weiterführung des Status quo. Es ist unverständlich: Ob es darum geht, im Restaurant für 20Franken ein Essen zu bestellen oder im Kleider-Outlet für 9,95Franken ein T-Shirt zu kaufen – in allen Lebenslagen werden vor Kaufentscheiden Alternativen geprüft und einander gegenübergestellt. Aber wenn Milliarden von Franken ins Verkehrsnetz im Allgemeinen und ins Schienennetz im Speziellen investiert werden, finden solche Abwägungen nicht statt. Statt den Blick durch das Fernrohr in alle Himmelsrichtungen schweifen zu lassen, starren Politiker und Planer wie gebannt in den Rückspiegel. Sie kaprizieren sich darauf, nicht die Zukunft zu gestalten, sondern bloss die Gegenwart weiterzuschreiben. Den Fächer der Ideen öffnen sie – wenn überhaupt – nur in Bezug auf Projekte und nicht auf Konzepte. Und auch das ist in der Regel erst der Fall, wenn eine bereits eingeleitete Lösung wider Erwarten auf massiven Widerstand stösst. Beispielhaft dafür ist die Auseinandersetzung mit dem neuen Fahrzeugunterhaltszentrum der BLS in Bern. Dann aber erschweren jeweils Voreingenommenheit und Ressentiments eine nüchterne Lösungssuche.
Auf den folgenden Seiten wird denn auch nicht ein pfannenfertiger Vorschlag präsentiert, wie das Eisenbahnnetz der Zukunft aussehen soll. Vielmehr werden, basierend auf einer Masterthesis im ETH-Nachdiplom-Studiengang Raumplanung, Möglichkeiten skizziert, wie die Weiterentwicklung der Eisenbahn und der Siedlungen nicht nur koordiniert, sondern ernsthaft integriert bzw. zusammengeführt werden kann. Es ist höchste Zeit, dass die Diskussion um die Zukunft der Eisenbahn in der Schweiz unter dem Gesichtspunkt der gesamten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und vor allem baulichen Weiterentwicklung des Landes geführt wird.
Ausgehend von einer grundsätzlichen Diskussion der Rolle, welche die Eisenbahn als Bestandteil des Verkehrssystems im 21. Jahrhundert in einem verstädternden Land spielen kann, werden im ersten Teil, in den Kapiteln 2 bis 6, beispielhafte Antworten auf die folgenden Fragen umrissen:
IWie kann die Bahn die Schweiz erschliessen und Landesteile sowie Grossregionen miteinander in Beziehung setzen, um das Land zeitgemäss zu strukturieren?
IIWie kann die Bahn in Stadtregionen neue zentrale Orte schaffen und dadurch zu einem grossen Hebel für eine konzentrierte Siedlungsentwicklung werden?
IIIWie kann die Bahn den Agglomerationen ein Gesicht geben, indem sie zu einer wesentlichen Gestalterin ihrer Siedlungsentwicklung wird?
IVUnd wie kann die Bahn ländlichen Räume erschliessen und mit Verkehrsmitteln verknüpfen, die den dortigen Siedlungsstrukturen optimal gerecht werden?
Im zweiten Teil, in den Kapiteln 7 bis 9, wird konkretisiert, was sich unter einem Denken und Handeln in Alternativen verstehen lässt, das in einen konsolidierten Plan für die Bahn im 21. Jahrhundert münden kann. In einen Plan für die Bahn, der im Sinn einer Strategie mit konzeptioneller Handlungsanleitung Aufschluss über die Ziele gibt, welche die Eisenbahn in den nächsten Jahrzehnten erfüllen soll, und darüber, wie sich diese erreichen lassen. Dabei werden im Hinblick auf dieses Zukunftsbild Antworten auf die folgenden Fragen formuliert:
VWie kann ein gestalterischer Rahmen aussehen, in dem sich kreative Entwürfe für das von strukturellen Zwängen geprägte Eisenbahnnetz entwickeln lassen? Welche Faktoren sollen dabei berücksichtigt und welche Fragen beantwortet werden?
VIWie ist ein Verfahren zu gestalten, in dem aus verschiedenen Entwürfen für die Weiterentwicklung des Eisenbahnnetzes ein konsolidierter Plan für die Bahn des 21. Jahrhunderts abgeleitet werden kann?
VIIUnd welche Möglichkeiten bestehen, um eine solche Ideenkonkurrenz in den laufenden politischen Prozess zu integrieren und dadurch der Umsetzung neuer Lösungsansätze zum Durchbruch zu verhelfen?
Die Auseinandersetzung mit einem spezifischen Verkehrsmittel, zumal jenem, dessen Ursprünge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegen, mag manchen angesichts des aktuellen Hypes um die Digitalisierung und die Vernetzung aller Verkehrssysteme als archaisch erscheinen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil die Vernetzung aller Verkehrsträger zum Thema wird, ist es wichtig, auszuloten, wo und wie die teure Eisenbahn richtig eingesetzt wird. Und jenseits aller Vernetzungen gibt es weiterhin physikalische Gegebenheiten, die dort, wo viele Menschen zu transportieren sind, den Einsatz des klassischen Massenverkehrsmittels nahelegen. Das gilt umso mehr in Zeiten, in denen die Zersiedelung passé ist. Mit Blick auf die fernere Zukunft geht es auch nicht so sehr um das technische System der Eisenbahn, sondern generell um Verkehrssysteme, die viel Mobilität auf wenig Raum bündeln.
Ein Zukunftsbild für die Bahn des 21. Jahrhunderts ist weit mehr als ein technokratisches Fortschreiben der Gegenwart. Dieses Bild und der Weg zu ihm sind wesentliche Schlüssel für den angestrebten haushälterischen Umgang mit dem Boden und dafür, dass die Schweiz in ihrer Entwicklung nicht plötzlich behindert wird, weil diese Ressource endlich ist. Last, but not least ist ein Plan für die Bahn in dem Sinn, wie er hier präsentiert wird, der erste Schritt hin zu einem positiven und prospektiven Umgang mit dem Gebot der effizienten Bodennutzung, das bis jetzt noch viel zu sehr einen negativen, von restriktiven Bestimmungen geprägten Beigeschmack hat. Die Eisenbahn hat das Zeug dazu, mehr Ordnung und Orientierung in eine diffuse Siedlungsentwicklung zu bringen.
2 Ein Plan mit Lehren aus der Vergangenheit
2.1«Mehr vom Gleichen» als Programm
Die Ziele des Bundes für die Weiterentwicklung der Eisenbahn in der Schweiz sind in Artikel 48 des Eisenbahngesetzes festgehalten. Sie sehen keine direkte Verknüpfung mit der Raumentwicklung vor, und sie postulieren auch keinen Zusatznutzen, den der Bahnausbau für die Siedlungsentwicklung bringen muss.
«Der Ausbau der (Bahn-)Infrastruktur hat folgende Ziele:
a.Personenverkehr:
1.Verbesserung der Verbindungen mit europäischen Metropolitanräumen,
2.Verbesserung der Verbindungen zwischen den schweizerischen Metropolitanräumen und innerhalb derselben,
3.Verbesserung der Verbindungen im schweizerischen Städtenetz und mit den Zentren der Metropolitanräume,
4.Ausbau des Regional- und des Agglomerationsverkehrs,
5.Verbesserung der Erschliessung der Berggebiete und der Tourismusregionen;
b.Güterverkehr:
1.Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs,
2.Verbesserungen für den Binnen-, Import- und Exportverkehr,
3.Verbesserung der Trassenverfügbarkeit.»
Ergänzend hat der Bund eine grobe Langfristperspektive für das Bahnangebot mit dem Zeithorizont 2050 formuliert. Sie enthält für den nationalen Personenverkehr den Viertelstundentakt entlang des Genfersees, im Mittelland zwischen Thun, Bern, Olten und Basel bzw. Zürich und Winterthur, zwischen Brugg und Zürich sowie zwischen Luzern und Zürich. Für den nationalen Güterverkehr sind die Achsen Basel–Olten–Lausanne und Basel–Bern–Lötschberg–Simplon sowie Basel–Brugg–Gotthard–Luino/–Chiasso vorgesehen.
Basierend auf diesen Grundlagen hat der Bundesrat im Herbst 2017 unter dem Titel «Ausbauschritt 2035» ein Paket mit Investitionen von insgesamt 11,5Milliarden Franken verabschiedet. Dieser Vorschlag ging aus einer Gegenüberstellung mit einer Variante hervor, die nur einen Teil der nun vorgesehenen Massnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7Milliarden Franken bis 2030 umfasst. Die Auswahl der Projekte richtet sich nach der Nachfrage, die bei der Fortschreibung der bestehenden Trends zu erwarten ist. Die Bahn soll dort ausgebaut werden, wo in den Spitzenzeiten die grösste Überlast besteht. Die Verkürzung der Reisezeiten ist sekundär. Im nationalen Verkehr wird der Halbstundentakt auf die meisten Linien ausgedehnt. Für die Verbindungen zwischen Genf und Lausanne, zwischen Bern und Zürich, zwischen Zürich, Baden und Brugg, zwischen Zürich und Zug und zwischen Zürich, Winterthur und Frauenfeld ist jede Viertelstunde ein schneller Zug vorgesehen.
Versteht man die Eisenbahn als roten Faden der Raumentwicklung, so heisst das: Genf und Lausanne werden endgültig zu einer Stadt mit zwei Polen in 60Kilometer Entfernung, und die Stadt Zürich greift künftig nicht mehr nur bis nach Winterthur und Uster aus, sondern bis nach Brugg, Zug und Frauenfeld. Zudem verdoppelt sie ihre Kapazität als «Förderband» zwischen Zürich und Bern. An grossen Bauprojekten sieht der Bundesrat den Bau des Brüttener Tunnels zwischen Zürich und Winterthur, des Zimmerberg-Basistunnels zwischen Zürich und Zug und den Vollausbau des Bahnhofs Zürich Stadelhofen vor. Sie kosten zusammen rund 6Milliarden Franken. Der Bundesrat begründet den Fokus auf Zürich damit, dass dort die meisten Menschen leben und dort die grössten Überlasten zu erwarten seien. Eine weitere Milliarde fliesst in die Genferseeregion. Der Bund rechnet am Genfersee und auch zwischen Zürich und Winterthur mit einer Verdoppelung der Passagierzahlen bis 2040.
Der vom Bundesrat vorgesehene Bundesbeschluss für den «Ausbauschritt 2035» spurt über diese Grossprojekte sowie verschiedene punktuelle Massnahmen hinaus bereits einen «Ausbauschritt 2040» vor. Dieser, so heisst es im Entwurf des Beschlusses, soll den eidgenössischen Räten bis 2026 unterbreitet werden. In ihm, so die Suggestion, sollen jene von den betroffenen Regionen mit Prestige aufgeladenen Grossprojekte untergebracht werden, die gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag im «Ausbauschritt 2035» aussen vor bleiben: der Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels, ein wie auch immer gearteter Ausbau Aarau–Zürich, der Durchgangsbahnhof Luzern und eine neue Verbindungslinie («Herzstück») zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof in Basel.
Während der Siedlungsbau und die Technik die Schweiz rasant verändern, soll die Bahn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten also gemäss der Devise «Mehr vom Gleichen» ausgebaut werden, so als bliebe alles beim Alten. Dabei versteht der Bund in seiner offiziellen Planung unter dem Ausbau vor allem einen Abbau. Den Abbau von «Engpässen», die sich in den morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden abzeichnen, wenn man das gegenwärtige Wachstum der Bevölkerung auf Jahrzehnte hinaus ebenso weiterschreibt wie das heutige Mobilitätsverhalten. Auch wenn sich hinter den aktuellen Plänen in absoluten Zahlen eine beträchtliche Leistungssteigerung verbirgt: Der Eisenbahn wird damit auch weiterhin einfach die Rolle eines Juniorpartners im Verkehrssystem zugeschrieben. Nicht mehr und nicht weniger.
Nicht, dass die Schiene dereinst die Hälfte des gesamten Verkehrs bewältigen soll, wie das die blosse Investitionssumme nahelegen würde, die fast ebenso gross ist wie jene, die in die Strasse fliesst. Aber in einem über weite Strecken verstädternden Land muss die Eisenbahn, die auf wenig Raum viele Menschen und Güter transportieren kann, eine bedeutendere Rolle im Verkehr übernehmen als bisher. Warum soll sie dereinst nicht 30Prozent des Personenverkehrs bewältigen? Als spurgeführtes Massenverkehrsmittel kann sie zu einem wesentlicheren Steuerungsinstrument für die Siedlungsentwicklung und damit auch für die ganze Raumentwicklung werden. Der politisch gewollte Stopp der Zersiedelung – das Ende des Verbauens von grünen Wiesen und des grossflächigen Verstreuens von Bauten und Menschen – ruft nach mehr gebündeltem Verkehr. Zur Konzentration der Siedlungen gehört auch eine Konzentration des Verkehrs.
Eine ernsthafte Siedlungsentwicklung nach innen funktioniert nicht ohne eine Verkehrsentwicklung nach innen. Mehr Menschen an Orten, wo schon Menschen wohnen und arbeiten, mehr Häuser dort, wo schon Häuser stehen. Das funktioniert nicht ohne Bündelung des Verkehrs dort, wo viele Menschen in kurzer Zeit auf wenig Raum vorwärtskommen wollen. Grosse finanzielle Mittel sind also dort in die Eisenbahn zu stecken, wo sie zum Motor für eine kluge Siedlungsentwicklung werden kann. Zum Ersten, indem sie Orte und Regionen gezielt und nicht zufällig miteinander in Beziehung setzt. Zum Zweiten, indem sie durch eine gezielte Haltepolitik auf ihren Achsen ausgewählte Siedlungen zu neuen Arbeits- und Wohnzentren aufwertet, damit die Dinge anderswo so bleiben können, wie sie sind. Und zum Dritten, indem sie weiter beschleunigt wird, um nicht nur zufällig, sondern auch gezielt die Verbindungen zwischen Orten und Regionen zu intensivieren.
Wo tatsächlich nur «Mehr vom Gleichen» gefragt ist oder wo die Nachfrage eine teure Schieneninfrastruktur nicht rechtfertigt, ist die Digitalisierung dienstbar zu machen. Zum einen durch technische Assistenzsysteme, die es ermöglichen, auf dem bestehenden Netz noch mehr Personen und Güter zu transportieren. Zum anderen durch die Vermittlung lückenloser, einfach zu benützender Transportketten. Transportketten, die aus dem kollektiven Verkehrsmittel Eisenbahn und aus den individuellen Verkehrsträgern auf den letzten Meilen gebildet werden. Künftig wird nicht immer das Postauto auf die Bahn warten müssen. Mehr und mehr wird dafür auch ein Auto reichen. Ein Auto, das nicht das eigene ist, in dem aber auch Menschen mitfahren, mit denen man ausser dem Reiseziel nichts teilt.
Trotz der üppigen und nicht befristeten finanziellen Ausstattung des Bahninfrastrukturfonds sind wesentliche Fragen bis heute nicht beantwortet. Was ist zu tun, damit die Eisenbahn in einer ernsthaften Weise zum verkehrsmässigen Rückgrat des verstädternden Landes werden kann? Welche neuen Angebote und Infrastrukturen sind aus dieser Zielsetzung abzuleiten? Welche zusätzlichen Spielräume schaffen die neuen Bauten für den von der Bundesverfassung verlangten haushälterischen Umgang mit dem Boden? Und welche Arten von Verfahren sind geeignet, um die dafür notwendige Kreativität freizusetzen? Kreativität, die in konkrete Entwürfe für ein Bahnnetz von morgen münden kann. Für ein Bahnnetz, das den erwünschten Mehrwert für eine dezentral konzentrierte Siedlungsentwicklung schafft.
Richtet man den Blick auf die gegenwärtigen Debatten zur Zukunft der Mobilität, wird deutlich, dass zwei Dinge die Diskussionen prägen: Software und Hardware. Neue smarte Kommunikationstechnologien und der gute alte Beton. Forscher und Politiker, Lobbyisten und andere Verkäufer dozieren unermüdlich, wie der Verkehr wirtschaftlicher abgewickelt werden könnte. Aber sie erörtern nicht oder nur oberflächlich, welche Wirkung er in Bezug auf die Gestaltung unseres Lebens und unseres Lebensraums entfalten soll. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass irgendein Konzern, irgendeine Hochschule oder irgendein Verband verkündet, wie die Mobilität in Zukunft abgewickelt werden wird. Die Faszination und Verunsicherung, welche die neuen digitalen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten auslösen, sind gross. Das Spektrum der Meinungen ist breit und von selektiven Interessen einzelner Wirtschaftszweige getrieben – allen voran von Softwareanbietern und Automobilherstellern. Die Rede ist von einer Revolution, von einer automatisierten Mobilität, die vollumfänglich zu einer Dienstleistung wird, weil dank immer klügerer Disposition immer mehr individueller Verkehr ohne Besitz eines eigenen Fahrzeugs möglich wird.
2.2«Für alle etwas» als Prinzip





























