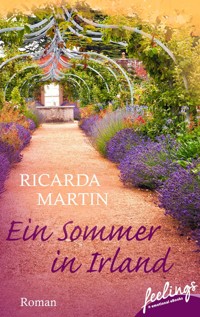
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein rührender, romantischer Roman über eine Frau, die scheinbar zufällig die tragische Lebensgeschichte einer irischen Schriftstellerin entdeckt und dabei ihre eigenen Wurzeln findet. Caroline wird von ihrem Chef nach Irland geschickt, um dort auf einem idyllischen Cottage nach einem wertvollen alten Buch zu forschen und es bei einer Auktion zu ersteigern. Da sie die Sommerferien mit ihrer jugendlichen Tochter Kim verbringen will, muss diese gegen ihren Willen mit nach Irland reisen. Die Suche nach dem alten Buch wird für Caroline und Kim zu einer Suche nach einem Familiengeheimnis und ihren eigenen Wurzeln. Die Reise und die traumhafte Umgebung Irlands helfen den beiden, wieder näher als Familie zusammenzufinden. Auch die Liebe findet Einzug in die kleine Familie, wird am Ende Irland für die beiden das große Glück bedeuten? Ein romantischer Familiengeheimnisroman von Ricarda Martin vor der grandiosen Kulisse Irlands mit viel Sommerfeeling! »Ein Sommer in Irland« von Ricarda Martin ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte – wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Ricarda Martin
Ein Sommer in Irland
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein rührender, romantischer Roman über eine Frau, die scheinbar zufällig die tragische Lebensgeschichte einer irischen Schriftstellerin entdeckt und dabei ihre eigenen Wurzeln findet.
Caroline wird von ihrem Chef nach Irland geschickt, um dort auf einem idyllischen Cottage nach einem wertvollen alten Buch zu forschen und es bei einer Auktion zu ersteigern. Da sie die Sommerferien mit ihrer jugendlichen Tochter Kim verbringen will, muss diese gegen ihren Willen mit nach Irland reisen. Die Suche nach dem alten Buch wird für Caroline und Kim zu einer Suche nach einem Familiengeheimnis und ihren eigenen Wurzeln. Die Reise und die traumhafte Umgebung Irlands hilft den beiden, wieder näher als Familie zusammenzufinden. Auch die Liebe findet Einzug in die kleine Familie, wird an Ende Irland für die beiden das große Glück bedeuten? Ein romantischer Familiengeheimnisroman von Ricarda Martin vor der grandiosen Kulisse Irlands mit viel Sommerfeeling!
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Nachwort
Mein herzliches Dankeschön
Als Mr. Hiram B. Otis, der amerikanische Gesandte, Schloß Canterville kaufte, sagte ihm ein jeder, daß er sehr töricht daran täte, da dieses Schloß ohne Zweifel verwünscht sei …
Oscar Wilde, The Canterville Ghost
Ihr ganzes Leben schon war Amy an die heftigen Regenfälle gewöhnt. Sie ließen die Flüsse über die Ufer treten, und die meist armseligen Hütten fielen den Wassermassen zum Opfer. Regelmäßig waren auch Menschenleben zu beklagen. Dennoch reagierten die Einwohner auf die immer wiederkehrenden Naturereignisse gelassen. Regen war lebensnotwendig. Er tränkte die ausgedehnten Reisfelder, denn ohne Reis konnte niemand überleben. Heute jedoch kauerte Amy zitternd unter ihrem Fenster und presste die Hände auf die Ohren, um das bedrohliche Prasseln der schweren Tropfen nicht mehr hören zu müssen. Das Haus war stabil gebaut und das Dach dicht, eigentlich hatte sie nichts zu befürchten, sie konnte aber nicht verhindern, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen. Das heutige Unwetter weckte Amys Erinnerung an den schrecklichsten Tag in ihrem zwölfjährigen Leben. Vor vier Tagen hatte es ebenfalls so stark geregnet. Auch wenn sie die Augenlider fest zusammenpresste, ließen sich die Bilder nicht aus ihrer Erinnerung verdrängen. Sie sah sie genau vor sich: ihren hochgewachsenen Vater, ihre zarte, wunderschöne Mutter mit den dunklen Haaren und den großen blauen Augen, die stets etwas melancholisch blickten. An dem verhängnisvollen Abend hatten sie gerade gegessen. Der Regen prasselte aufs Dach und schlug gegen die Fensterscheiben. Die Dienerin hatte soeben die Hauptspeise serviert, als ihr Vater aufblickte, die Stirn runzelte und nach seiner Waffe griff, die stets griffbereit neben seinem Teller lag. Amys Mutter hatte dies zwar immer missbilligt, doch war es in diesen unruhigen Zeiten besser, sich schnell verteidigen zu können, falls es notwendig werden würde. Nun hörte auch Amy die lauten Schreie und das Gegröle, das sich in das Prasseln des Regens mischte.
»Geh sofort in dein Zimmer!«, wies der Vater sie an, und Amy sprang auf, gewöhnt, den Befehlen des Vaters unverzüglich Folge zu leisten. Sie hatte gerade den Raum verlassen, als schwere Schritte über die Veranda polterten und die Tür aufgerissen wurde. Vor Schreck blieb Amy stehen und spähte durch den Türspalt, ohne selbst gesehen zu werden. Sie öffnete ihren Mund zu einem Schrei, in diesem Moment presste sich eine große Hand von hinten auf ihr Gesicht.
»Still, ganz still, sonst töten sie dich auch.«
Es war einer der Diener. Einer der wenigen verbliebenen, der es gut mit Amy meinte. Ganz im Gegensatz zu den rund zwei Dutzend Chinesen, jeder ein Gewehr im Anschlag, die nun ins Esszimmer drängten.
»Was, zum Teufel …?«, rief Amys Vater, die Pistole bereits in der Hand. Bevor er auch nur einen Schuss abfeuern konnte, mähten ihn die Gewehrkugeln nieder. Eine Sekunde später lag auch Amys Mutter in ihrem Blut.
»Lauf!« Der Diener zog die heftig strampelnde Amy zum nächsten Fenster, packte sie an der Hüfte und warf sie nach draußen in den Schlamm. »Lauf, so schnell du kannst, sonst bist du die Nächste.«
Amy rappelte sich auf. Ihr Denken war ausgeschaltet, ihre Beine bewegten sich wie von selbst. Sie hatte gerade die ersten Bäume des kleinen Waldes, der sich hinter dem Haus erstreckte, erreicht, als sie erneut Gewehrsalven und grässliche Schreie hörte. Keuchend blickte sie zurück und sah die Flammen aus den Fenstern des Hauses züngeln. Obwohl der Boden aufgeweicht war und Amy immer wieder bis zu den Knöcheln im Schlamm versank, kam sie schnell voran. Sie war jung und kräftig, und sie wusste instinktiv, dass sie schneller als die Rebellen sein musste. Es gab nur einen Ort, wo sie zumindest vorerst in Sicherheit sein würde. An die Möglichkeit, dass die Mörder auch dort gewütet haben könnten, durfte sie jetzt nicht denken …
»Wir müssen das Kind unverzüglich fortbringen …«
Die Stimme von Wu Akuma, dem Hausdiener, der ein gutes Englisch sprach und seiner Herrschaft treu ergeben war, holte sie in die Gegenwart zurück.
»Es ist zu gefährlich«, mahnte die zarte Stimme von Jane Hudson. »Sie werden auch die Bahnlinien kontrollieren und angreifen …«
»Hierzubleiben wäre der reinste Selbstmord, Missis.«
Die beiden befanden sich auf der Veranda, die rund um das Haus verlief, und ahnten nicht, dass das Mädchen direkt unter dem geöffneten Fenster kauerte und jedes Wort hörte. Jane Hudson war die Freundin ihrer Mutter und ihre Taufpatin. Die Familien hatten sich oft getroffen, da deren Häuser nur fünf Meilen voneinander entfernt lagen, was in dieser Gegend eine geringe Wegstrecke darstellte. Nach dem Massaker an ihren Eltern war Amy zu den Hudsons geflüchtet. Zu ihrer großen Erleichterung waren die Aufständischen hier noch nicht gewesen. Amy klammerte sich an die Hoffnung, dass die Rebellen, mochten sie noch so grausam und rücksichtslos sein, das Haus eines Geistlichen verschonten. George Hudson predigte nicht nur jeden Sonntag in der kleinen Holzkirche, er und seine Frau kümmerten sich auch um Alte und Kranke. Die Einheimischen respektieren die Hudsons, obwohl nur wenige den christlichen Glauben angenommen hatten.
»Sie werden kommen.« Amy meinte, das grimmige Nicken Akumas sehen zu können. Für einen Chinesen war er ein großer, kräftiger Mann. »Sie müssen mit dem Mädchen fliehen, Missis.«
»Ich gehe nicht ohne meinen Mann«, antwortete Jane bestimmt. »Der Aufstand wird bald niedergeschlagen werden, es ist ja nicht der erste seiner Art. Mein Mann hat sich zum Bleiben entschlossen, denn gerade jetzt brauchen die Menschen geistlichen Beistand.«
»Missis, bei allem Respekt …« Der Diener erhob seine Stimme. »Das ist kein gewöhnlicher Aufstand, das ist der Beginn eines Krieges.«
»Still, Akuma, du machst mir Angst!« Amy hörte die Panik in Tante Janes Tonfall. »Ich teile deine Meinung – das Mädchen muss von hier fort. Es ist furchtbar, dass sie den Tod ihrer Eltern hat mitansehen müssen. Aber wir können nicht für ihre Sicherheit garantieren. Was sind das nur für Menschen, die selbst Kinder töten?«
»Wenn sie sich im Blutrausch befinden, ist es gleichgültig, wer ihnen vor die Flinte kommt. Bis das Militär diese abgelegene Gegend erreicht hat, wird kein Brite mehr am Leben sein.«
Wu Akuma sprach emotionslos. Man hätte ihn für gefühllos halten können, aber Amy wusste, dass er ein gutes Herz besaß.
In Amys Augen traten Tränen, dabei hatte sie geglaubt, in den letzten Tagen so viel geweint zu haben, dass in ihrem Körper keine Flüssigkeit mehr vorhanden war. Im Haus ihrer Patentante hatte sie sich sicher gefühlt, jetzt wollte man sie fortbringen. Wohin sollte sie denn fliehen? Sie kannte doch niemand anderen in diesem riesigen Land!
»Heute Nacht geht ein Zug.« Akuma senkte seine Stimme, als lauerten die Rebellen direkt hinter der Hausecke. »Ich werde das Mädchen persönlich nach Tianjin bringen und dafür sorgen, dass sie auf das nächste Schiff kommt, das in Richtung Europa ausläuft.«
Europa? Amy runzelte die Stirn. Ihr war bekannt, dass ihre Mutter aus einem Land mit dem Namen Irland stammte, während ihr Vater Engländer gewesen war. Von ihren Eltern in Geografie unterrichtet, wusste sie genau, dass Europa sich am anderen Ende der Welt befand.
Jane Hudson seufzte. »Es ist wahrscheinlich das Beste und meine christliche Pflicht als Patin, alles zu versuchen, um das Kind in Sicherheit zu bringen. Amys Mutter nahm mir den Schwur ab, dafür zu sorgen, dass Amy zu ihren Verwandten nach Irland geschickt wird, falls ihr etwas zustoßen sollte.«
»Dieses Versprechen müssen Sie befolgen, Missis.«
»Ich schreibe gleich einen Brief an die Familie«, erwiderte Jane. »Ich kann nur hoffen, dass Amy von ihren Verwandten gut aufgenommen wird.«
»Da bin ich ganz sicher«, antwortete Wu Akuma im Brustton der Überzeugung. »Wer würde dieses liebreizende Mädchen nicht mögen?«
»Ach, Akuma, was sollten wir bloß ohne dich machen?«
Amy hörte den Diener bitter lachen.
»Auch ich werde Sie nicht beschützen können, wenn der Krieg hierherkommt, Missis. Sie sollten ebenfalls gehen …«
Ihre Zimmertür öffnete sich einen Spalt.
»Linh!« Erleichtert rief Amy den Namen ihrer Freundin, die sofort einen Finger auf die Lippen legte.
»Sei ruhig, sonst bemerken sie, dass wir sie belauschen.«
Ihr Englisch war beinahe ebenso perfekt wie das ihres Vaters Wu Akuma. Von ihren Eltern wurde Linh liebevoll Xiao Wu gerufen, was so viel hieß wie: Kleine aus der Familie Wu. Da die chinesische Namensregelung für Ausländer jedoch eher undurchschaubar war, nannte Amy ihre Freundin beim Vornamen, ebenso hatte es sich eingebürgert, den Diener mit Akuma anzusprechen. Die Familie Wu hatte sich seit Jahren nicht nur mit der britischen Besatzung arrangiert, sondern sie befürwortete auch die Modernisierungen, die die Fremden gebracht hatten – im Gegensatz zum Großteil der Bewohner des riesigen Landes China. Seit Monaten erhielten die Rebellen immer größeren Zulauf, die Aufstände wurden immer häufiger und brutaler, und jetzt hatten sie sogar diese abgeschiedene Gegend erreicht, die etwa einhundert Meilen westlich der Hafenstadt Tianjin lag.
Linh kauerte sich neben Amy, und die beiden Mädchen nahmen sich bei den Händen. Linh war zwei Jahre älter als Amy und eine erblühende Schönheit. Ihr Haar schimmerte wie poliertes Ebenholz, und ihre Augen, die für eine Chinesin außergewöhnlich groß waren, funkelten wie schwarze Kohle. Obwohl Amy noch ein Kind war, fragte sie sich, wann Linh wohl von ihrem Vater verheiratet werden würde. In diesem Land wurden Mädchen nicht selten mit elf oder zwölf Jahren bereits einem Mann gegeben. Amy hoffte für die Freundin, dass dieser dann nicht nur die Schönheit Linhs, sondern auch ihre außergewöhnliche Intelligenz und ihr sanftes Wesen zu schätzen wusste. Amy kannte Linh ebenso lang wie Tante Jane und Onkel George, denn die Familie Wu diente bereits in der dritten Generation dem jeweiligen Geistlichen, der versuchte, der kleinen Gemeinde das Christentum nahezubringen.
»Sie wollen mich fortschicken«, flüsterte Amy der Freundin ins Ohr.
»Ich weiß, Vater hat es mir vorhin gesagt. Heute Nacht geht ein Zug von Xushui nach Tianjin«, wiederholte sie die Worte Akumas. »Mein Vater wird uns dorthin bringen.«
»Uns?« Amys Augen weiteten sich erstaunt. »Du kommst mit nach Tianjin?«
Linhs Arme schlossen sich um Amy, und sie drückte das zarte Mädchen fest an sich.
»Nicht nur bis zum Hafen, kleine Amy. Ich werde dich nach Europa begleiten. Wie könnte ich meine beste Freundin allein in die Fremde ziehen lassen? Außerdem« – ein Schatten fiel über Linhs Gesicht – »Vater möchte auch mich in Sicherheit wissen. Es wird hier noch sehr schlimm werden.«
Amy schloss die Augen. Sie hatte furchtbare Angst. Angst, von den Aufständischen doch noch getötet zu werden, Angst vor der langen Reise – zuerst ans Meer und dann über den großen Ozean – und Angst vor den fremden Menschen und vor dem Leben, das sie am Ende ihrer Reise erwarten würde. Die Tatsache, dass Linh sie begleitete, beruhigte Amy ein bisschen. Linh war schon fast erwachsen und stark, sie würde sie beschützen, was immer auch geschah …
1
Lautes Hupen, quietschende Bremsen auf dem Asphalt und dann das knirschende Geräusch, wenn Metall auf Metall stößt …
Caroline fuhr hoch und musste sich einen Moment besinnen, wo sie war. Sie hatte geträumt, sie würde im weißen Sand am Strand liegen. Sie bedauerte, aufgewacht zu sein, und wunderte sich, dass die Sonne helle Flecke auf den bunten Flickenteppich vor ihrem Bett malte, obwohl der Wecker erst zehn Minuten nach zwei Uhr anzeigte.
Mit einem Satz sprang Caroline aus dem Bett, lief ans Fenster und schaute hinaus. Direkt vor ihrem Haus war ein Auto hinten auf einen Müllwagen aufgefahren. Wie es aussah, war keiner der Fahrer verletzt, denn zwei Männer gestikulierten und diskutierten lautstark. Caroline angelte ihre Armbanduhr vom Sidebord.
»Verflixt noch mal!«
Es war bereits acht Uhr! Der Wecker war offenbar mitten in der Nacht stehengeblieben, und sie hatte verschlafen. Rasch lief sie über den Flur in das schmale Bad, gönnte sich lediglich eine Katzenwäsche, putzte die Zähne und fuhr ein paar Mal mit der Bürste durch ihr schulterlanges, glattes Haar, dann schlüpfte sie in eine enge, dunkle Hose und in eine helle Leinenbluse. Als sie in die Küche trat, sah sie ihre Tochter auf einem Stuhl lümmeln, die nackten Füße auf einem zweiten Stuhl. Sie rührte in einer Schüssel mit Milch und Cornflakes.
»Du bist schon wach?«, rief Caroline anstatt eines Morgengrußes. »Warum hast du mich nicht geweckt?«
»Ich hab Ferien, und es ist schließlich dein Job …«
Das Mädchen sah nicht auf, sondern schob sich einen Löffel Cornflakes in den Mund. Bei dieser patzigen Antwort musste Caroline sich beherrschen. Seit einigen Monaten rebellierte Kim gegen jeden und alles, am meisten gegen sie.
»Mein Wecker ist stehengeblieben«, sagte Caroline ruhiger, als ihr zumute war. »Du weißt genau, dass ich spätestens um halb sieben aufstehen muss.«
Das Mädchen zuckte mit den Schultern, löffelte eine zweite Portion, ließ sich dann aber doch dazu herab, zu sagen: »Frischer Kaffee ist da, den hab ich vorhin gemacht.«
Eigentlich hatte Caroline keine Zeit mehr und müsste sich auf der Stelle auf den Weg mache, doch sie brauchte morgens zwei Tassen starken Kaffees, um munter zu werden. Jetzt kam es auf zehn Minuten auch nicht mehr an. Über der Spüle schenkte sie sich aus der Glaskanne Kaffee ein – schwarz und stark. Bereits nach wenigen Schlucken bemerkte sie, wie ihre Lebensgeister erwachten.
»Was hast du heute vor, Kim?«
»Was soll ich schon vorhaben?«, maulte das Mädchen. »Es ist schon jetzt schweinemäßig heiß draußen, da habe ich auf gar nichts Bock.«
»Bitte, Kim, nicht diese Ausdrücke!«, mahnte Caroline, einen gehetzten Blick auf die Uhr werfend. »Du kannst einkaufen gehen, und heute Abend kochen wir zusammen. Such dir aus, worauf du Appetit hast. Das Geld ist in der Keksdose.«
»Heute Abend?« Zum ersten Mal sah Kim ihre Mutter an und grinste ironisch. »Bis du nach Hause kommst, gehe ich schon wieder ins Bett. Ich besorge mir einen Burger oder so etwas.«
Caroline verzichtete auf den Hinweis, Fast Food wäre ungesund, stattdessen sagte sie versöhnlich: »Ich verspreche, heute pünktlich Schluss zu machen. Spätestens um sieben bin ich zu Hause, und wir verbringen einen gemütlichen Abend zusammen.«
Kim brummte etwas wie »Ja, ja, wer’s glaubt, wird selig.«
Caroline wollte ihrer Tochter durch das zerzauste Haar streichen, Kim drehte den Kopf aber schnell zur Seite und verzog ablehnend das Gesicht.
»Ich ruf dich heute Nachmittag an«, rief Caroline, schon halb zur Tür hinaus. »Übrigens – auf der Straße hat es einen Auffahrunfall gegeben.«
»Hab ich mitbekommen, bin ja schließlich nicht taub«, antwortete Kim und gähnte ungeniert, ohne die Hand vor den Mund zu halten. »Ich glaub, ich hau mich noch mal aufs Ohr.«
Im Gegensatz zu den meisten Teenagern war Kim eine Frühaufsteherin, was Caroline grundsätzlich begrüßte. Ihr blieb das Los vieler Eltern, ihre Kinder morgens aus dem Bett zerren zu müssen, erspart. Jetzt in den Ferien wusste das Mädchen jedoch nichts mit sich anzufangen. Manchmal traf sie sich mit ihren besten Freundinnen Deidre und Angie. Die Mädchen hingen aber nur zusammen ab, wie Kim sich ausdrückte, oder gingen shoppen. Im Gegensatz zu den Eltern von Kims Freundinnen musste Caroline jeden Cent zweimal umdrehen, so dass Kim keine Lust hatte, den anderen zuzusehen, wie sie sich schicke Klamotten oder Make-up kauften. Caroline wünschte, sie könnte Kim mehr bieten, vor allen Dingen mehr Zeit. Ihr Job forderte sie fünf Tage die Woche von morgens bis abends, damit sie und Kim einigermaßen über die Runden kamen.
Sie hastete durch die belebten Straßen Sohos, dann, zwei Stufen auf einmal nehmend, lief sie zur Subway-Station hinunter. Der Zug war wie üblich überfüllt. Caroline quetschte sich in die nächste einfahrende Bahn und stand eingezwängt zwischen einem jungen Mann im Anzug und einer korpulenten Frau in mittleren Jahren, die aufdringlich nach Schweiß roch. Es hob nicht gerade ihre Stimmung, als ihr Handy klingelte. Auf dem Display erkannte sie die Nummer von Brian, ihrem Ex-Mann.
»Was willst du denn?«, flüsterte sie ins Telefon, schließlich sollten nicht alle im Wagen mithören.
»Dir auch einen schönen guten Morgen, Caro.« Brian Appletons Stimme klang tief wie ein Bariton. Als sie sich damals kennenlernten, war es zuerst seine Stimme gewesen, in die Caroline sich verliebt hatte. »Du bist noch nicht bei der Arbeit?«, fragte er, da er das Rattern des Zuges im Hintergrund hörte.
»Ich hab verschlafen. Also, worum geht es? Und nenn mich nicht Caro …«
Sie hasste es, wenn er sie mit dem Kosenamen ansprach, so wie am Anfang ihrer Beziehung. Niemand sonst hatte sie je Caro genannt …
»Oh, verschlafen und mit dem falschen Fuß aufgestanden.« Sie hörte Brian lachen. »Ich wollte nur fragen, ob am Wochenende alles klargeht. Ich hole Kim am Samstag gegen neun Uhr ab.«
»So war es ausgemacht«, antwortete Caroline und fügte spitz hinzu: »Sofern du nicht einen wichtigen Auftrag bekommst und nach Timbuktu oder sonstwohin fliegen und deine Tochter mal wieder vertrösten musst.«
»Caro, bleib bitte sachlich!« Deutlich war der Ärger in Brians Stimme zu vernehmen. »Ich habe ebenso wie du einen Job, aber das Wochenende habe ich mir freigehalten. Außerdem hat Masha etwas vorbereitet. Sie freut sich schon sehr auf Kim und will mit ihr shoppen gehen. Am Samstagabend werden wir ein Barbecue machen, sofern das Wetter so warm und trocken bleibt.«
Masha! Auch nach fast vier Jahren gab es Caroline einen Stich, diesen Namen aus seinem Mund zu hören.
»Sie heißt Masha, und zwischen uns hat es einfach geknallt …«, hörte sie Brian immer noch sagen, als er damals von einem Tag auf den anderen seine Sachen gepackt und sie und Kim verlassen hatte. Es wurmte sie, dass Kim mit Masha zum Einkaufen gehen würde, während sie, Caroline, ihre Tochter kaum mal zu einem gemeinsamen Bummel überreden konnte.
»Klar, deine Masha passt ja vom Alter her viel besser zu Kim als ich. Eine Frau, kaum älter als deine Tochter …«
»Masha ist dreiundzwanzig«, unterbrach Brian sie scharf, »und wir haben das Thema längst durch. Also, neun Uhr am Samstag!«
»Okay.«
Ohne ein Abschiedswort drückte Caroline das Gespräch weg. Die Bahn ratterte gerade durch einen Tunnel, und sie betrachtete sich in der spiegelnden Scheibe. Sie war vierunddreißig Jahre alt, und wenn sie Zeit und Muße fand, sich zurechtzumachen, konnte sie ohne weiteres für ein paar Jahre jünger gehalten werden. Ihre Figur war schlank, mit Rundungen an den richtigen Stellen, ihr Haar glänzte in einem kastanienbraunen Ton, und die kleinen Fältchen um ihre Augen waren nur bei genauem Hinsehen sichtbar. Trotzdem hatte Brian sie vor vier Jahren gegen ein jüngeres Exemplar »ausgetauscht«, wie Caroline es vorgekommen war. Masha war erst neunzehn Jahre alt gewesen und Praktikantin in dem Zeitschriftenverlag, für den Brian als freier Fotojournalist regelmäßig für Storys Bilder schoss. Eine aparte, blonde Schönheit mit hohen Wangenknochen. Wenn es sich einrichten ließ, ging Caroline Masha am liebsten aus dem Weg, wobei allein wegen Kim Begegnungen nicht zu vermeiden waren. Brian war häufig auf Reisen, so dass Kim ihren Vater manchmal wochenlang nicht sah. Masha allerdings begleitete ihn öfter, denn inzwischen arbeitete sie ebenfalls als freie Journalistin. Brians Fotografien und Mashas Berichterstattungen ergänzten sich perfekt, und meist erfuhr Caroline erst durch die Artikel in einer Zeitschrift, in welchem Teil der Erde die beiden sich aufgehalten hatten.
Auch während ihrer Ehe war Brian nur selten zu Hause gewesen, hatte einmal sogar über vier Monate im Senegal leben müssen. Caroline war mit Kims Erziehung, der Hausarbeit und der Pflege des großen Gartens zwar vollständig ausgelastet, Brian hatte ihr aber immer gefehlt. Fast alle Entscheidungen hatte sie allein treffen müssen, und sogar bei Kims Einschulung – einem wichtigen Tag im Leben ihrer Tochter – fehlte Brian. Seine Arbeit bedeutete für ihn viel mehr als nur ein Beruf – sie war eine Berufung. Wenn er längere Zeit zu Hause war, wurde er unruhig und nervös. Trotzdem hatte Caroline es nie bereut, ihr Studium der Kunstgeschichte aufgegeben zu haben, als sie mit Kim schwanger geworden war. Natürlich hatten Brian und sie nicht geplant, schon so bald ein Kind zu bekommen. Es war irgendwie passiert, sie hatte aber keinen Moment auch nur in Erwägung gezogen, die Schwangerschaft abzubrechen, wie es ihr die eine oder andere Freundin geraten hatte. Brian verdiente genügend, so dass sie sofort heiraten und mit Kim eine richtige Familie werden konnten. Wenig später hatten sie sich sogar ein Haus in einer ruhigen Gegend der Stadt kaufen können. Obwohl, oder vielleicht gerade, weil Brian so wenig zu Hause war, liebte Kim ihren Vater abgöttisch. Natürlich – er sprach nie Verbote aus, tadelte sie nicht wegen schlechter Schulnoten und stellte keine Regeln auf. Diese unangenehmen Erziehungsmaßnahmen blieben Caroline vorbehalten. Sie war aber nie auf das enge Vater-Tochter-Verhältnis eifersüchtig gewesen, sondern hatte die Zeit, als sie drei noch eine richtige kleine Familie waren, genossen.
Nach der Scheidung hatte Caroline sich einen Job gesucht. Sie war zu stolz, um von Brian Geld für sich anzunehmen, sondern wollte beweisen, dass sie es auch allein schaffte. Für Kim bezahlte er natürlich Unterhalt, meistens überwies er sogar mehr als die gerichtlich vereinbarte Summe. Caroline legte das Geld jedoch für Kim an. Das Mädchen würde auf ein College gehen, danach wahrscheinlich studieren wollen. Das Geld war für eine gute Ausbildung gedacht, damit Kim sich auf das Studium konzentrieren konnte und sich nicht mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten müsste. Caroline arbeitete gern bei dem Kunsthändler, auch wenn sie nicht viel verdiente. Es reichte jedoch für die Miete und dafür, das tägliche Leben für sich und Kim zu finanzieren. Damals, als Brian sofort von Scheidung gesprochen hatte –»Du musst das verstehen, Caro, ich habe mich verliebt! Masha ist die Frau meines Lebens!« –, hatte Caroline ihre Tochter genommen und war binnen drei Tagen aus ihrem gemeinsamen Haus ausgezogen. Seitdem mied sie Greenwich und die Gegend um ihr früheres Zuhause. Na ja, ein Mal war sie dort gewesen, aus reiner Neugier, und es hatte sie entsetzt, zu sehen, dass Masha alle Rosensträucher aus dem Vorgarten herausgerissen und den Rasen durch pflegeleichte Kieselsteine ersetzt hatte. Futuristische Steinfiguren sollten wohl der Verschönerung dieser Steinwüste dienen, Caroline fand sie aber einfach nur schrecklich. Ihr Herz hatte geblutet, denn die Rosen waren ihr ganzer Stolz gewesen, auf deren Pflege sie viel Zeit und Liebe verwendet hatte. Das Haus und der Garten gehörten Brian, und nun war es Masha, die dort schaltete und waltete.
Caroline wischte sich über die Stirn, als könne sie die Gedanken an die Vergangenheit vertreiben. Sie und Kim hatten sich mit der veränderten Situation arrangiert, sich arrangieren müssen, und Brian versuchte zumindest, seinen Vaterpflichten – so gut es ging – nachzukommen. Kim und ihn verband nach wie vor ein liebevolles Verhältnis, was kein Wunder war, da sie sich nur alle paar Wochen für ein paar Stunden sahen. Brian hatte keine Ahnung, wie schwer es manchmal war, einen sechzehnjährigen Teenager mit all seinen Launen und Stimmungsschwankungen zu erziehen, ohne aus der Haut zu fahren.
Der Kunsthandel- und Antiquitätenladen befand sich in einer ruhigen Seitenstraße in Lower Manhatten, in der sich ein Geschäft an das andere reihte. Meist handelte es sich um kleine, exquisite Boutiquen, Schmuck- und Uhrengeschäfte und kleine Buchhandlungen, in denen die Kunden von den Verkäufern noch persönlich beraten wurden.
Eine altmodische Türglocke bimmelte, als Caroline in den Laden trat.
»Es tut mir leid, Jonathan, aber ich habe verschlafen«, rief sie dem hageren Mann mit der Stirnglatze zu, der, über einen Aktenordner gebeugt, Zahlen notierte.
»In einer halben Stunde müssen wir schon wieder los«, antwortete Jonathan Meyers, einen leisen Vorwurf in der Stimme. »Wir wollten zuvor die gestrige Lieferung noch katalogisieren.«
»Es kommt nicht mehr vor«, antwortete Caroline zerknirscht. »Mein Wecker ist stehengeblieben.«
Sie wusste, wie lapidar diese Entschuldigung klang, und Jonathan winkte nur ab.
»Am besten machen wir uns gleich auf den Weg«, sagte er. »Die Aufstellung schaffen wir heute ohnehin nicht mehr.«
Er schob seine Brille mit den dicken Gläsern von der Stirn auf die Nase zurück. Er war kurzsichtig, für die Nähe brauchte er aber noch keine Sehhilfe. Jonathan Meyers hatte sich vor rund zehn Jahren als Kunsthändler selbständig gemacht, und in dem Laden stapelte sich alles, was man irgendwie verkaufen konnte: Bilder, Geschirr, Vasen, Uhren, Nippes – darunter auch die eine oder andere Kostbarkeit. Heute waren sie mit den Vertretern einer Erbengemeinschaft verabredet, um die Wohnung einer kürzlich Verstorbenen nach wertvollen Gegenständen durchzusehen, bevor die Erben die Auflösung der Wohnung einer Entrümpelungsfirma übergeben würden. Während Caroline neben Jonathan zu seinem im Hinterhof geparkten Auto ging, musterte er sie besorgt von der Seite.
»Du siehst abgespannt aus, Caroline.« Jonathan Meyers sprach immer aus, was er dachte.
Caroline zuckte mit den Schultern. »Mir geht es gut«, antwortete sie ausweichend. »Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht pünktlich war, dabei habe ich gut geschlafen und sogar geträumt, ich läge im warmen, weißen Sand an einem Strand.«
»Na also, das ist ein Zeichen, dass du dringend mal ausspannen musst. Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?«
»Über Ostern hatte ich ein paar Tage frei«, erinnerte Caroline ihn.
»Im Sommer, wenn alle, die es sich leisten können, die Stadt verlassen und aufs Land fahren, ist nicht so viel los«, entgegnete Jonathan. »Du kannst dir gern ein oder zwei Wochen freinehmen, ich schaffe die Arbeit auch allein.«
»Ich werde darüber nachdenken«, antwortete Caroline. Ein paar Tage Urlaub würden ihr tatsächlich guttun. Ihr und Kim – denn dann hätte sie endlich einmal ausreichend Zeit für ihre Tochter und könnte mit ihr gemeinsam etwas unternehmen. Ihr Budget ließ eine Urlaubsreise aber nicht zu, und Brian wollte sie auf keinen Fall um einen Zuschuss bitten! Wenn sie jedoch in New York blieb, dann würde es ihr nicht gelingen, abzuschalten.
Die Wohnung der Verstorbenen befand sich in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Queens, das mal bessere Zeiten gesehen hatte. Der Verputz bröckelte von der stuckverzierten Fassade, die Fensterrahmen benötigten dringend einen neuen Anstrich, und die Gitter der winzigen Balkone waren von Rost überzogen. Mit Kennerblick stellte Caroline fest, dass das Haus etwa um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert erbaut worden war. Im Flur roch es nach fettigem Essen. Ein dunkelhäutiges Ehepaar in mittleren Jahren erwartete sie am Treppenabsatz der zweiten Etage. Trotz der großen Hitze, die wie eine Glocke über der Stadt hing, trug die Frau einen grauen Persianer, der weder zu den Temperaturen noch in die triste Umgebung passte.
»Na, endlich!« Demonstrativ sah die Frau auf ihre goldene Armbanduhr. »Sie sind zehn Minuten zu spät.«
»Es war viel Verkehr«, antwortete Jonathan Meyers unverbindlich. »Meine Mitarbeiterin, Misses Appleton«, stellte er Caroline vor.
»Mister und Misses Thompson«, erwiderte der Mann und öffnete die Wohnungstür mit der Nummer achtzehn. »Die Verstorbene war eine Tante zweiten Grades, wir haben sie kaum gekannt. Meine Frau, meine Schwester, deren Mann und ich müssen uns jetzt aber um den ganzen Kram hier kümmern, denn der Hausbesitzer will die Wohnung zum nächsten Ersten wieder vermieten.« Er sah Jonathan fest an. »Nehmen Sie, was Sie meinen, zu Geld machen zu können. Ich verstehe nichts davon, daher bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen zu vertrauen. Ihr Unternehmen ist mir aber von einem Kollegen empfohlen worden.«
»Ich werde Sie nicht enttäuschen«, antwortete Jonathan ernst. »Sie erhalten eine genaue Auflistung der Gegenstände und, wie ausgemacht, fünfzehn Prozent vom Erlös, sobald die Sachen verkauft worden sind.«
»Na ja, wenn es hier etwas gibt, das sich zu verkaufen lohnt«, sagte Mrs. Thompson zynisch. Ihr Blick schweifte abschätzend über die Wände des Flurs mit der ausgeblichenen Tapete. »Was soll die Alte schon an Wertgegenständen besitzen? Sicher taugt alles nur noch für den Müll.«
Solche Worte hörte Caroline öfter, und sie taten ihr weh. Sie enthielt sich aber eines Kommentars. Von Jonathan wusste sie, dass die Verstorbene in dieser Wohnung geboren worden war und über vierundsiebzig Jahre hier gelebt hatte. Caroline hätte sich nicht gewundert, wenn ihr Körper erst nach Wochen oder gar Monaten entdeckt worden wäre. Glücklicherweise, sofern man in diesem Fall von Glück sprechen kann, erlitt sie während eines Einkaufs im benachbarten Supermarkt einen Herzanfall und starb wenige Tage später im Krankenhaus.
»Ziehen Sie die Tür einfach hinter sich zu, wenn Sie fertig sind«, sagte Mrs. Thompson, dann waren Caroline und Jonathan allein.
Nach der Kargheit des dunklen Korridors war Caroline überrascht, als sie in das Wohnzimmer trat. Die Einrichtung passte so gar nicht zu der Tristesse des Hauses. Elegante, zum Teil kunstvoll gearbeitete Möbel aus Edwardischer, wenn nicht sogar aus Viktorianischer Zeit wechselten sich mit moderneren Stücken ab. Patchwork-Decken auf dem Sofa und fein gehäkelte Untersetzer auf der Kommode; plüschige, handbestickte, aber keineswegs kitschige Kissen schmückten die Stühle. Auf einem Sideboard aus poliertem Mahagoni stand eine gerahmte Fotografie, die einen jungen, farbigen GI im Kampfanzug zeigte. Um eine Ecke des Rahmens war schwarzer Trauerflor geschlungen.
»Für Donna – in Liebe, Peter. 1966«, las Caroline laut.
Jonathan trat an ihre Seite.
»Vietnam«, sagte er leise. »Ich nehme an, Peter war die große Liebe der Dame und fiel während des Krieges. Vielleicht hat sie deswegen nie geheiratet.«
Caroline schluckte. Immer dann, wenn sie Wohnungen auf der Suche nach Wertvollem betrat, empfand sie Scham, in das Leben eines Fremden einzudringen und dessen Intimsphäre zu verletzen. Miss Thompson hatte in diesen Räumen geliebt, gelacht und sicher auch viel gelitten. Ihr Körper lag in einem Grab, ihr Geist jedoch schwebte noch in den Räumen. Es war, als würde Caroline ihre Totenruhe stören. Unwillkürlich fragte sie sich, auf welchem Weg die Vorfahren Donna Thompsons in die Staaten gelangt waren. Vielleicht waren sie Sklaven gewesen, die ein furchtbares Schicksal erlitten hatten …
»Na also, das scheint sich doch zu lohnen«, sagte Jonathan und riss sie aus ihren Gedanken. Er nahm die neben dem Bild stehende Vase, drehte sie um und pfiff leise durch die Zähne, als er auf der Unterseite die beiden gekreuzten Schwerter und die Jahreszahl sah. »Meißen, 1845. Die Verwandten haben keine Ahnung, welche Schätze ihre Tante gehortet hat. Zum Glück für uns. Gehen wir an die Arbeit, damit wir bis zum Abend fertig sind. Du machst hier weiter, ich schaue mich mal im Schlafzimmer um.«
Caroline nahm das Klemmbrett und den Kugelschreiber zur Hand und notierte die Vase, dann prüfte sie die Kommode und datierte sie auf das frühe neunzehnten Jahrhundert. Wahrscheinlich aus Frankreich oder aus Italien. Jonathan würde eine Materialprüfung durchführen und eine entsprechende Expertise erstellen. In einer der Schubladen fand Caroline einen Stapel alter Luftpostbriefe, fein säuberlich mit einem roten Seidenband gebündelt. Die Briefmarken bestätigten Jonathans Vermutung, denn die Briefe waren in Vietnam aufgegeben worden, und Donna Thompson hatte sich auch nach über fünfzig Jahren nicht von ihnen getrennt. Das Schicksal der unbekannten Verstorbenen rührte Caroline, aber sie legte die Briefe unangetastet zur Seite. Für Donna Thompson hatten sie große Bedeutung gehabt, in wenigen Tagen würden sie jedoch zusammen mit vielen anderen Erinnerungen in einem großen Müllcontainer landen. Ein langes Leben wurde einfach ausgelöscht, als hätte es nie existiert. Früher hatte Brian sie wegen ihrer Sentimentalität geneckt, denn Caroline musste bei jedem Happyend eines Liebesfilms weinen. Schnell verscheuchte sie die Gedanken an ihren Ex-Mann und widmete sich wieder ihrer Arbeit. Caroline listete zwei weitere Vasen und ein sechsteiliges Essservice mit Goldrand auf, das zwar alt, aber nicht besonders wertvoll war, bei Liebhabern aber sicher einen guten Preis erzielen würde. Kleinigkeiten wie Vasen und Geschirr würde Jonathan gleich mitnehmen. Die Möbel sollten in den nächsten Tagen von einem Unternehmen abgeholt werden.
»Caroline, komm mal!«
Sie trat ins Schlafzimmer. Die Hände in die Hüften gestemmt, betrachtete Jonathan ein im Durchmesser etwa achtzig Zentimeter großes, über dem Bett hängendes Ölgemälde, das in bunten Farben eine Dorfstraße zeigte.
»Wow!«, entfuhr es Caroline. »Auf den ersten Blick sieht es nach einem Kandinsky aus. Glaubst du, es ist echt?«
Jonathan zog einen Stuhl heran, stieg darauf und nahm das Bild vom Haken. Der Rahmen war aus schlichtem hellem Holz.
»Wenn, dann war die Verstorbene vermögender, als ihre Familie vermutet. Ich werde es genau prüfen lassen.«
Caroline ging ins Wohnzimmer zurück und fuhr mit ihrer Arbeit fort. Einige Minuten später klingelte Jonathans Mobiltelefon. Er meldete sich, und nach einer Pause hörte sie ihn sagen: »Bleib ganz ruhig, mein Liebling, und beweg dich nicht! Ich bin sofort bei dir …«
»Ist etwas passiert?«
Voller böser Vorahnungen ging Caroline ins Nebenzimmer. Jonathan Meyers Wangen waren unnatürlich blass.
»Lenas Betreuerin hat sich wegen einer Magen-Darm-Grippe heute Morgen krankgemeldet, und jetzt ist Lena aus dem Rollstuhl gefallen, als sie zur Toilette wollte …« Jonathan hatte bereits den Autoschlüssel in der Hand. »Ich muss sofort nach Hause. Du schaffst das doch allein, nicht wahr?«
Caroline nickte. »Natürlich, kümmere dich um deine Frau und mach dir keine Sorgen.«
Seit vielen Jahren war Lena Meyers an Multipler Sklerose erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Da das Ehepaar keine Kinder hatte, kümmerte sich eine Pflegerin tagsüber um Lena, die immer wieder Schwächeanfälle erlitt. Es war selbstverständlich, dass Jonathan unverzüglich zu seiner Frau musste, auch wenn für Caroline damit ein früher Feierabend hinfällig geworden war. Sie zückte ihr Handy und wählte die Nummer ihrer Tochter, erreichte aber nur die Mailbox.
»Ich bin’s, Mum«, sprach sie aufs Band. »Kim, mein Schatz, es tut mir furchtbar leid, aber mein Chef musste dringend weg. Ich glaube nicht, dass ich es bis sieben Uhr schaffen werde, aber ich beeile mich.«
Caroline wusste, dass Kim nur mit den Augen rollen und denken würde: Ich hab’s ja gleich gesagt! Kim hatte sehr früh selbständig werden müssen, war aber erst vor vier Wochen sechzehn Jahre alt geworden. Ein Alter, in dem man seine Mutter noch brauchte … in dem man beide Elternteile brauchte. Es tröstete Caroline keineswegs, dass es Millionen von Jugendlichen wie Kim erging, denn zerrüttete Ehen gab es zuhauf. Sie hatte eine gute Mutter sein wollen, doch immer wieder musste sie ihre Tochter enttäuschen.
Es war halb zehn, als Caroline die Wohnungstür öffnete. Hinter Kims geschlossener Zimmertür dröhnte laute Popmusik, und der Küchentisch war mit leeren Pappschachteln und Papier einer Fast-Food-Kette übersät. Der Fußboden war klebrig, und Caroline entdeckte eine offene Colaflasche, deren Inhalt sich über den Fliesenboden verteilt hatte. Caroline zählte leise bis zehn, denn sie war kurz davor, Kim zur Rede zu stellen, weil sie die Schweinerei nicht aufgeputzt hatte. Mit Vorwürfen erreichte sie bei ihrer Tochter aber gar nichts, außerdem überwog Carolines schlechtes Gewissen. Sie klopfte an Kims Tür und drehte dann den Knauf, denn das Mädchen würde das Klopfen wegen der lauten Musik ohnehin nicht hören.
»Darf ich reinkommen?«
Kim lag auf dem Bett und blätterte in einem Modemagazin. Sie drehte den Kopf und seufzte. Wenigstens bequemte sie sich dazu, die Musik leiser zu stellen.
»Hey, wer sind Sie denn? Wohnen Sie etwa auch hier?«, fragte sie bissig.
»Schatz, es tut mir furchtbar leid …«
»Vergiss es!« Kim winkte ab und drehte den Kopf demonstrativ zur Seite.
»Ich habe heute mit deinem Vater telefoniert«, versuchte Caroline, ein Gespräch in Gang zu bringen. »Er holt dich am Samstagmorgen ab.«
Kim sah auf, ihre Augen leuchteten vor Vorfreude.
»Und er hat wirklich zwei Tage Zeit?«
Caroline nickte. »Er und Masha wollen am Abend grillen …«
»Cool! Endlich mal etwas anderes.«
Caroline musste sich eingestehen, dass es ihr einen Stich gab, weil Kim sich mit Masha gut verstand. Dem Mädchen gegenüber wollte sie sich aber nichts anmerken lassen, denn es wäre ungerecht, ihren Schmerz über den Verlust Brians vor Kim auszubreiten.
Sie lehnte sich gegen die Tür und sagte: »Mein Chef hat vorgeschlagen, ich solle mir ein oder zwei Wochen freinehmen. Was hältst du davon? Wir könnten etwas zusammen machen.«
Mit einem Schlag war Kims schlechte Laune verflogen.
»Deidre fliegt mit ihren Eltern in ein schickes Hotel nach Hawaii«, rief sie. »Das ist ein supergünstiges Angebot, da sind sicher noch Plätze frei.« Deidre war die einzige Tochter eines vermögenden Zahnarztehepaars.
»Langsam, mein Schatz!« Caroline hob die Hand. »Du weißt, dass ich mir eine Reise nicht leisten kann. Ich dachte, wir machen es uns hier richtig gemütlich, gehen ins Kino oder in den Zoo …«
»In den Zoo?« Kim riss entsetzt die Augen auf. »Mum, ich bin kein Baby mehr, falls du das nicht bemerkt haben solltest. Wie solltest du auch, wenn du kaum da bist …«
»Ach, mein Mädchen.« Am liebsten hätte Caroline ihre Tochter in die Arme geschlossen und ihr übers Haar gestrichen, Kims Haltung drückte jedoch Abwehr aus. »Man muss keine Fernreisen machen, um Spaß zu haben.«
Trotzig schob Kim die Unterlippe vor und murmelte: »Dann lass mich wenigstens in das Camp mitfahren.«
Caroline unterdrückte einen Seufzer. Vor ein paar Wochen hatte Kim aus der Schule Unterlagen über ein Schüler-Feriencamp in den Everglades in Florida mitgebracht und betont, dass zwei ihrer Freundinnen den Sommer dort verbringen würden. An sich eine gute Sache, denn die Jugendlichen würden von Fachkräften betreut werden. Die Kosten für das Camp überstiegen allerdings Carolines finanzielle Mittel bei weitem. Tagelang hatten sie und Kim diskutiert, und das Mädchen hatte so manche Träne vergossen. Caroline musste aber hart bleiben.
»Ich habe dir gesagt, dass es zu teuer ist, außerdem bist du noch zu jung …«
»Angie und Kristy fahren auch mit«, warf Kim ein.
»Die sind aber schon siebzehn, oder?«, erwiderte Caroline. »Lass uns im nächsten Jahr darüber sprechen.«
»Ich will aber jetzt weg!«, schrie Kim zornig, rote Flecken auf den Wangen. »Wenn du zu geizig bist, mir die kleinste Freude zu gönnen, dann frage ich eben Daddy. Der liebt mich nämlich und verbietet mir nicht ständig alles. Am liebsten würde ich ganz zu ihm ziehen. Er nimmt mich wirklich ernst und behandelt mich nicht wie ein Kleinkind.«
»Du weißt aber auch, dass dein Vater selten zu Hause ist«, erwiderte Caroline, müde von den immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen, bei denen sie und Kim sich nur im Kreis drehten.
»Dann breche ich eben die Schule ab und reise mit ihm. Daddy hätte sicher nichts dagegen.« Trotzig schob Kim die Unterlippe vor. »Da ich ohnehin Model oder Schauspielerin werde, brauche ich meine Zeit nicht länger in der Schule zu verschwenden. Das hat Daddy auch gesagt, er ist eben nicht so kleinkariert wie du.«
Hinter ihrem Rücken ballte Caroline die Hände zu Fäusten. Nach diesem langen und anstrengenden Arbeitstag war sie müde und hungrig. Seit Monaten die gleiche Leier. Brian war zwar finanziell bessergestellt als sie, das gab ihm aber nicht das Recht, sich derart in Kims Erziehung einzumischen, auch wenn sie das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht hatten. Er setzte dem Mädchen nur Flausen in den Kopf, um ja nicht zu riskieren, die Zuneigung seiner Tochter zu verlieren. Nach ihrer Trennung hatte Brian sofort ausgeschlossen, sich dauerhaft um Kim zu kümmern. Seine Reisen und die Fotoreportagen waren ihm immer wichtiger gewesen als seine Tochter. Das Defizit der mangelnden Zeit versuchte er, mit Geld auszugleichen. Caroline erinnerte sich, wie er Kim zu Ostern einen völlig überteuerten Bikini geschenkt hatte, nur weil diese Marke bei ihren Freundinnen gerade angesagt war, und dann die schicke Lederjacke zu ihrem letzten Geburtstag … In ihrem ganzen Leben hatte Caroline niemals ein so teures Kleidungsstück besessen. Sie gönnte Kim ein wenig Luxus, Brian vermittelte jedoch den Eindruck, das Geld läge auf der Straße und man müsse es nur aufheben.
Langsam setzte sie sich auf die Bettkante. Kim ließ es geschehen, ihr angespannter Körper signalisierte aber Ablehnung.
»Kim, ich weiß, dass das alles nicht leicht ist«, begann Caroline leise, »aber nicht ich bin für das Auseinanderbrechen unserer Familie verantwortlich.«
»Wenn du an Daddy ebenso herumgenörgelt hast wie an mir, dann wundert es mich nicht, dass er sich eine neue Frau gesucht hat. Schau dich doch mal an, Mum! Du läufst nur in Jeans und T-Shirt herum, die Haare bindest du einfach zurück, und wann hast du zum letzten Mal einen Lippenstift benutzt? Masha ist immer sehr gepflegt und total chic angezogen.«
Als hätte sie eine Ohrfeige erhalten, zuckte Caroline zusammen. Mühsam beherrscht sagte sie leise: »Es ist gut, dass dein Vater und du … dass ihr beide so gut miteinander auskommt und dass du dich auch mit Masha verstehst. Ich weiß, dass ich zu wenig Zeit für dich habe, aber ich bin froh, diesen Job machen zu können, um Geld zu verdienen. Nein, lass mich bitte aussprechen!« Caroline hob die Hand, als Kim sie unterbrechen wollte. »Du möchtest nicht als Baby behandelt werden? Nun gut, dann benimm dich auch nicht so! Von einem sechzehnjährigen Mädchen sollte man etwas mehr Reife und Verständnis erwarten.«
Kim kniff die Augen zusammen und, als hätten Carolines Worte sie gar nicht erreicht, presste sie hervor: »Darf ich denn jetzt in das Camp?«
Nun konnte Caroline einen Seufzer nicht mehr unterdrücken.
»Nein, in diesem Jahr nicht. Wir haben das Thema ausreichend besprochen. Ich bitte dich, meine Entscheidung zumindest zu akzeptieren, auch wenn du sie nicht verstehen willst.«
Mit einem Ruck warf Kim sich auf den Bauch und barg das Gesicht in den Kissen.
»Ich ziehe aus!«, hörte Caroline sie schluchzen. »Wenn ich nicht bei Daddy wohnen kann, dann nehme ich mir eine eigene Bude. Hauptsache, ich komme so schnell wie möglich von hier weg.«
Caroline wusste, heute würde es ihr nicht mehr gelingen, zu ihrer Tochter durchzudringen. Sie stand auf und verließ das Zimmer. Auf dem Flur lehnte sie sich gegen die Wand und strich sich fahrig über die Stirn. Ihr war zum Heulen zumute, denn es wurde ihr einfach alles zu viel. Sie liebte ihre Tochter mehr als alles andere auf der Welt, und Kim war das Beste aus ihrer Ehe mit Brian. Sie fragte sich, was sie in der Erziehung falsch gemacht hatte. Sie und Kim trennten gerade mal achtzehn Jahre. Ein Altersunterschied, in dem viele Mütter ihren Töchtern eher eine Freundin waren, aber das Mädchen blockte alles ab. Hilflos barg Caroline das Gesicht in den Händen. Sie hätte nie gedacht, einmal zugeben zu müssen, mit der Erziehung ihrer Tochter restlos überfordert zu sein.
2
Am Samstagmorgen rauschte Kim, die pinkfarbene Sporttasche mit den Sachen, die sie übers Wochenende brauchte, über die Schulter geworfen, an Caroline vorbei. Sie sah sie nicht an, sondern rief nur: »Ich warte unten auf Daddy.«
Mit einem Knall fiel die Wohnungstür hinter ihr ins Schloss. In den letzten Tagen hatten Mutter und Tochter nur das Nötigste miteinander gesprochen. Obwohl Caroline sich den gestrigen Nachmittag freigenommen hatte und mit Kim in den Central Park gegangen war, blieb ihr Verhältnis angespannt. Vielleicht würden die zwei Tage bei ihrem Vater das Mädchen wieder zur Besinnung bringen, dachte Caroline, hegte aber berechtigte Zweifel daran. Brian ließ nichts unversucht, Caroline vorzuhalten, dass sie Kim falsch erzog.
»Du musst eben mehr auf sie eingehen und Verständnis zeigen«, hatte er am Telefon gesagt, als Caroline ihm von dem Streit erzählte. »Das Mädchen macht gerade eine schwierige Phase durch.«
Dann mach es doch besser, hätte Caroline gern gesagt, sie wollte jetzt aber nicht auch noch mit Brian streiten.
Caroline räumte den Frühstückstisch ab und putzte die Küche. Die Temperaturen hatten bereits am Vormittag die Dreißig- Grad-Grenze erreicht und würden im Laufe des Tages noch ansteigen. Carolines kleine Wohnung verfügte nicht über eine Klimaanlage, und nach wenigen Minuten klebten das T-Shirt an ihrem schweißnassen Rücken und die Shorts zwischen ihren Beinen. Caroline hatte fast ihr ganzes Leben in New York verbracht und liebte die Stadt, im Sommer wünschte sie sich jedoch, für ein paar Wochen der Gluthitze entfliehen zu können. Trotzdem fuhr Caroline mit der notwendigen Hausarbeit fort, denn unter der Woche kam sie zu nicht mehr, als das Geschirr zu spülen. Sie wusch Wäsche, bezog die Betten neu, wischte Staub und staubsaugte die drei Zimmer. Dann war alles getan, und sie sprang unter die Dusche. Kalt und erfrischend lief das Wasser über ihren Körper, und Caroline begann, sich zu entspannen. Sie freute sich auf einen ruhigen Abend, an dem sie endlich das Buch, das sie sich schon vor Wochen gekauft hatte, lesen und früh zu Bett gehen würde. Seit ihrer Kindheit hatten Bücher einen festen Platz in ihrem Leben, leider hatte sie in den letzten Jahren immer weniger Zeit zum Lesen. Pläne für den morgigen Sonntag gab es keine, sie wollte den Tag aber nicht in der stickigen Wohnung verbringen. Sie griff kurzentschlossen zum Telefon und wählte eine Nummer. Hannah, eine Freundin aus ihrer Schulzeit, meldete sich sofort.
»Caroline! Wie geht es dir? Ist dir auch so furchtbar heiß?«
»Ja, die Hitze macht mir zu schaffen«, erwiderte Caroline, dann plauderten sie ein paar Minuten über das Wetter. Im Hintergrund hörte sie Kinderstimmen, dann eine lautere männliche Stimme, die streng sagte: »Hope, Nathan, hört auf zu streiten, jeder darf mal mit dem Auto spielen.«
Hannah kicherte. »Die Zwillinge sind wegen der Hitze auch schon ganz kirre. Morgen werden wir einen Ausflug ans Meer machen, dort wird es erträglicher sein, und die beiden Kurzen können im Wasser plantschen.«
»Wie schön, das freut mich«, murmelte Caroline. Es war eine dumme Hoffnung gewesen, dass ausgerechnet Hannah, Mutter von zwei Fünfjährigen, an einem Sonntag Zeit für einen gemütlichen Plausch haben würde.
»Beth und Harry kommen auch mit«, plauderte Hannah unbeschwert weiter. »Die Kinder verstehen sich glänzend und spielen gern zusammen.«
Caroline schluckte. Auch Beth und Harry hatten zu der Clique gehört, mit der Caroline in ihren letzten beiden Schuljahren viel unternommen hatte. Als sie dann Brian kennengelernt hatte, war das fröhliche Sextett zusammen um die Häuser gezogen. Selbst nachdem sie Kim bekommen hatte und Brian viel unterwegs gewesen war, war der Kontakt nicht abgerissen, auch wenn Caroline natürlich nicht mehr mit in Discotheken ging. Hannah, Beth und sie waren aber Freundinnen geblieben und hatten sich regelmäßig getroffen. Sie hatte mit Hannah gelitten und sie getröstet, als ihre erste große Liebe sie belogen und betrogen hatte, und hatte Beths Hand gehalten, als deren Mutter schwer erkrankt und gestorben war. Seit Carolines Scheidung jedoch war der Kontakt deutlich weniger geworden. Niemand sprach es aus, aber Caroline hatte den Eindruck, dass sie als Alleinstehende in dem Kreis nicht mehr willkommen war. Obwohl es Unsinn war, machten sich Beth und Hannah vielleicht Sorgen um ihre Ehemänner, denn als alleinstehende Frau war Caroline »wieder auf dem Markt«. Außerdem war sie attraktiv, und man wusste ja nie, wie die eigenen Männer tickten …
Caroline würde sich eher die Zunge abbeißen, als zu fragen, ob sie die Freunde bei dem Ausflug ans Meer begleiten könne. Hannah würde dann zwar nicht nein sagen können, Caroline wollte sich aber nicht anbiedern und auch nicht das fünfte Rad am Wagen und nur geduldet sein.
Carolines Freundeskreis war klein, der Bekanntenkreis überschaubar. Sie kannte keine Singlefrauen und noch weniger alleinerziehende Mütter. Das Internet sowie die Zeitungen waren natürlich voll von Inseraten, in denen Freizeitpartner gesucht wurden. Das war für Caroline aber nicht der richtige Weg, neue Bekanntschaften zu schließen. Noch weniger wollte sie sich in einer Flirtbörse registrieren, wie Hannah es ihr vorgeschlagen hatte.
»Mensch, Caroline, du bist jung und siehst gut aus, wenn du dich ein wenig zurechtmachst!«, hatte sie gesagt. »Eine Frau wie du bleibt doch nicht allein. Du darfst allerdings nicht zu Hause sitzen und darauf warten, dass ein Traumprinz an deine Tür klopft, sondern musst selbst etwas unternehmen.«
Caroline dachte an Kims Vorwurf, sie würde sich gehenlassen. Das Mädchen hatte nicht ganz unrecht. In ihrem Job war praktische Kleidung am bequemsten, und für wen sollte sie sich schminken und hübsch machen? Sie hatte auch kein Interesse daran, irgendeinen Mann irgendwo kennenzulernen, auch wenn sie sich manchmal jemanden wünschte, mit dem sie ihre Sorgen und Nöte, aber auch die Momente des Glücks teilen könnte. Brian war der erste Mann gewesen, mit dem Caroline geschlafen hatte, und seit der Trennung hatte es keinen anderen mehr gegeben. Sie war nicht der Typ, der mit Fremden einfach so flirtete, und noch weniger eignete sie sich für einen One-Night-Stand. Sex und Liebe waren für Caroline untrennbar. Die Vorstellung, mit einem anderen Mann als Brian das Bett zu teilen, war Caroline so fern wie der Mond.
Am Sonntag wachte Caroline früh auf und beschloss, bevor es wieder zu heiß werden würde, in den Central Park zu fahren. Diese Idee hatten aber auch einige tausend andere New Yorker gehabt, so waren die schattigen Plätze unter den Bäumen alle belegt. In einem klimatisierten Café gönnte sie sich einen Eistee und einen Donut mit Pflaumenmus und Mohn. Wenn sie sich umsah, schien sie die einzige Person zu sein, die heute allein unterwegs war. Familien mit Kindern oder zumindest Pärchen, die händchenhaltend über die Wege schlenderten – alle ausnahmslos fröhlich. Obwohl sie und Kim in den letzten Monaten regelmäßig stritten, wünschte Caroline, ihre Tochter wäre jetzt an ihrer Seite. Seit ihrer Kindheit hatte sie immer eine harmonische, glückliche Familie haben wollen. Wenn sie nachts in ihrem Bett in dem Zimmer im Waisenhaus, das sie mit drei anderen Mädchen teilen musste, lag, hatte sie sich gewünscht, ein eigenes Haus mit einem kleinen Garten zu besitzen. Einen Mann, zwei oder drei Kinder, für die sie sorgen konnte, vielleicht auch einen Familienhund, der im Regen herumtollte und schmutzige Abdrücke seiner Pfoten auf dem frisch geputzten Fliesenboden hinterließ …
Carolines Kehle wurde eng. Sie fühlte sich sehr einsam, rief sich aber schnell zur Ordnung, um nicht in Selbstmitleid zu versinken. Für ein paar Jahre hatte sie einen Zipfel des Glücks erhascht, wofür sie dankbar sein sollte. Schließlich konnten nie alle Wünsche in Erfüllung gehen, und ihr Leben hätte schlechter verlaufen können. Wenn sie heulte, würde ihr das nicht weiterhelfen. Entschlossen straffte sie die Schultern, schob das Kinn vor und schlenderte durch den Park. Sie war gesund, und sie war jung genug, dem Leben noch viele schöne Jahre abgewinnen zu können. Sie war zwar allein, nun gut, ob sie jedoch einsam war – das lag einzig bei ihr.
Als sich gegen acht Uhr am Abend der Schlüssel in der Wohnungstür drehte, eilte Caroline in den Flur. Normalerweise setzte Brian seine Tochter vor dem Haus ab, wenn er sie nach gemeinsam verbrachten Tagen zurückbegleitete, daher war sie überrascht, hinter Kim ihren Ex-Mann zu sehen. Kim strahlte über das ganze Gesicht und rief, anstatt einer Begrüßung, triumphierend: »Daddy erlaubt mir das Feriencamp, und er bezahlt es auch!«
Sie drängte sich an Caroline vorbei und verschwand in ihrem Zimmer.
»Kann ich dich einen Moment sprechen?«, fragte Brian, der unschlüssig auf der Fußmatte stand.
»Komm rein.« Caroline trat zur Seite. »Ja, ich denke, wir sollten miteinander reden.«
Sie gingen ins Wohnzimmer. Caroline bot Brian aber weder einen Platz noch etwas zu trinken an.
»Stimmt es, was Kim eben gesagt hat? Du hast ihr Hoffnung gemacht, dass sie nach Florida fliegen darf?«
»Reg dich nicht gleich wieder auf, Caro«, erwiderte Brian beschwichtigend. »Ich finde, du solltest Kim mit ihren Freundinnen in das Camp fahren lassen. Vor ein paar Tagen habe ich einen neuen Auftrag mit einem großzügigen Vorschuss erhalten, daher übernehme ich gern die Kosten.«
»Es geht nicht ums Geld«, erwiderte Caroline. »Ich finde, Kim ist noch zu jung, um vier Wochen unter Fremden zu sein …«
»Unter Freunden«, unterbrach Brian sie, »außerdem gibt es dort hervorragende Betreuer. Ich habe mir die Sache im Internet angesehen.«
Carolines Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Ich habe es Kim untersagt«, sagte sie leise. »Wie kommst du dazu, meine Wünsche zu missachten?«
»Ich bin um Kims Wohl besorgt«, wies Brian sie mit zunehmender Ungeduld zurecht.
»Du hättest es zuerst mit mir besprechen müssen, bevor du Kim ein solches Versprechen gibst.« Carolines Stimme wurde lauter. »Ich sage nein, und dabei bleibt es! Ich lasse ein sechzehnjähriges Mädchen nicht allein über tausend Meilen in ein Camp fliegen. Wer weiß, was die da machen – Betreuer hin oder her! Wir wissen doch, dass diese mit den jungen Leuten hoffnungslos überfordert sind, und ich setze meine Tochter nicht der Gefahr von Alkohol und Drogen aus.«
»Sie ist auch meine Tochter.« Nun erhob Brian seine Stimme. »Wir sind gemeinsam für Kims Wohl verantwortlich, wenn ich dich daran erinnern darf.«
»In den letzten Jahren hast du davon nur Gebrauch gemacht, wenn es dir in den Kram passte und du ausnahmsweise mal hier gewesen bist.«
»Kim hat mich gefragt, ob sie bei mir wohnen kann«, sagte Brian nun. »Sie fühlt sich von dir offenbar unverstanden, und wenn ich öfter zu Hause wäre, denke ich, es wäre eine gute Idee. Das Mädchen ist auf dem besten Weg, unglücklich zu werden. Es ließe sich einrichten, dass Masha mehr zu Hause bleibt und sich um Kim kümmert.«
»Raus!« Caroline lief zur Tür und riss sie auf. »Verschwinde, und lass dich niemals wieder hier blicken!«
Brian zögerte, kapitulierte dann aber vor Carolines Wutausbruch. An der Tür sagt er noch: »Du solltest zumindest darüber nachdenken, Caro. Wir wollen schließlich beide das Beste für unsere Tochter, und wenn sie sich bei dir nicht mehr wohl fühlt, dann kann sie gern zu uns kommen, bevor das Mädchen an falsche Freunde gerät. Man hört ja immer wieder, dass Kinder aus zerrütteten Familienverhältnissen …«
Rums! Mit einem Knall warf Caroline die Tür zu. Sie zitterte am ganzen Körper. Brian saß derzeit tatsächlich am längeren Hebel, denn Kim war alt genug, zu entscheiden, bei wem sie leben wollte. Die Vorstellung, ihre Tochter zu verlieren, war mehr, als Caroline ertragen konnte.
»Ärger?« Jonathan Meyers sah Caroline aufmerksam an, als sie am Montagmorgen den Laden betrat.
»Das Übliche«, wiegelte Caroline ab. »Kim hat mal wieder beschlossen, nie wieder ein Wort mit mir zu sprechen.« Jonathan Meyers war eher ein Freund für Caroline als ein Chef und wusste über die Spannungen zwischen Mutter und Tochter Bescheid. Caroline wollte das Thema aber nicht vertiefen, daher fragte sie: »Wie geht es Lena?«
Ein Schatten fiel über Jonathans Gesicht.
»Die Magen-Darm-Grippe der Pflegerin hat sich als Magengeschwür herausgestellt. Sie musste ins Krankenhaus eingewiesen und operiert werden.«
»Wer kümmert sich jetzt um Lena?«
»Eine Nachbarin schaut immer wieder nach ihr, das ist aber keine Dauerlösung.« Kummervoll runzelte Jonathan die Stirn. »Wir müssen jemand anderen finden, was in der Ferienzeit schwer ist. Das heißt, ich werde mehr zu Hause sein müssen.«
Caroline verstand. »Damit hat es sich erledigt, dass ich mir eine oder zwei Wochen freinehme.«
»Ja und nein.« Jonathan Meyers lächelte. »Ich habe da vielleicht eine Lösung, wie uns beiden geholfen werden kann.«
»Ja?« Erwartungsvoll sah Caroline ihn an. »Wobei – im Moment ist die Vorstellung, mit ihrer Mutter zusammen die Ferien zu verbringen, für Kim ohnehin der absolute Horror.« Sie brachte ein schiefes Lächeln zustande, und Jonathan zwinkerte ihr freundschaftlich zu.
»Besorg uns doch aus dem Café an der Ecke zwei Eiskaffee«, bat er. »Im Laden ist ohnehin nicht viel los. Es ist zu schwül, da gehen die Leute nicht einkaufen.«
Ein paar Minuten später saß Caroline ihrem Chef in dem kleinen Büro hinter dem Verkaufsraum gegenüber. Dank der Türglocke würden sie hören, wenn sich doch ein Kunde in den Laden verirrte.
»Hast du schon einmal von dem Book of Kells gehört?«, fragte Jonathan plötzlich.
»Natürlich«, antworte Caroline und nickte. »Das ist ein uraltes Buch, wahrscheinlich um das Jahr achthundert nach Christus von Mönchen geschrieben und gemalt. Es gilt als das älteste, heute noch existierende Buch der Welt und ist sehr wertvoll.«
»Vor vier Jahren wurde das Book of Kells zum Weltdokumentenerbe erklärt. Es befindet sich in der Bibliothek eines Dubliner Colleges. Dublin ist die Hauptstadt der Republik Irland, drüben in Europa.«
Caroline schmunzelte. »Ich weiß, wo Irland liegt, Jonathan.«
Er erwiderte ihr Lächeln und sagte: »Ach ja, du hast mal erwähnt, du hättest irische Wurzeln, nicht wahr?«
Caroline zuckte mit den Schultern. »Wie du weißt, ist mir über meine Familie so gut wie nichts bekannt. Als ich ein Kind war, hat mir mal jemand gesagt, ein Vorfahre aus Irland wäre in die Staaten gekommen. Da aber die meisten Amerikaner europäische Vorfahren haben, ist das nichts Besonderes.«
»Du warst noch nie in Irland?«
»Nein, wie sollte ich?« Caroline lachte. »Außerdem interessiert mich die Vergangenheit nicht. Ich habe genügend damit zu tun, mein und Kims Leben in der Gegenwart auf die Reihe zu bringen.«
»Das ist sehr schade«, erwiderte Jonathan. »Jeder Mensch sollte wissen, wo er herkommt und wo seine Wurzeln sind. Obwohl du in Waisenhäusern aufwachsen musstest, kann ich deine Ablehnung, zu erfahren, wer deine Vorfahren waren, nicht verstehen. Bist du denn kein bisschen neugierig?«
»Lass es gut sein, Jonathan. Wir haben solche Gespräche schon so oft geführt, und du kennst meine Einstellung: Wozu nach längst Verstorbenen forschen? Ich hätte jemand Lebenden gebraucht, als …«
Sie verstummte, einen bitteren Zug um den Mund. Schnell legte Jonathan eine Hand auf ihre und sagte leise: »Ich wollte dich nicht verletzten, Caroline.«
»Du wolltest mir etwas über das Book of Kells erzählen.« Damit kehrte sie zum Thema zurück. Sie hatte sich wieder im Griff und würde nicht zulassen, dass schmerzliche Erinnerungen, die tief in ihrem Inneren vergraben waren, an die Oberfläche gezerrt wurden.
Jonathan legte die Fingerspitzen aneinander und berichtete: »Vor ein paar Wochen erhielt ich Kenntnis von einem Buch mit geistlichem Inhalt, das in etwa aus der Zeit stammen soll, in der das Book of Kells entstanden ist, und sich angeblich in Privatbesitz in Irland befindet.«
»Faszinierend!«, rief Caroline. »Wer hat dir davon erzählt?«
»Es ist nicht mehr als ein Gerücht«, fuhr Jonathan fort. »In Kunstkreisen wird seit einiger Zeit darüber spekuliert, und ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Es ist mir gelungen, herauszufinden, dass sich dieses Buch in einem alten Schloss an der irischen Westküste befinden soll. Allerdings – und das macht die Sache so interessant, Caroline – wird in diesem Schloss in sechs Wochen eine Auktion stattfinden. Es könnte sein, dass dabei auch das alte Buch angeboten wird.«
»Das wäre doch unbezahlbar!« Caroline schüttelte ungläubig den Kopf. »Ein solches Werk ist ein kulturelles Erbe von staatlichem Interesse. Wenn es wirklich einer Privatperson gehört, wäre es logisch, es einem Museum zu verkaufen.«
Jonathan wiegte nachdenklich den Kopf. »Außer, die Eigentümer brauchen dringend viel Geld, denn du weißt, dass Museen nicht gerade hohe Summen bezahlen. Ich nehme an, ein Privatverkauf erzielt einen höheren Erlös. Wie ich bereits sagte, die Sache ist nicht fundiert und recht suspekt, trotzdem lässt mich der Gedanke an ein solches Kunstwerk nicht zur Ruhe kommen. Ursprünglich hatte ich geplant, selbst zu der Auktion nach Irland zu fliegen, um herauszufinden, ob ein solches Buch tatsächlich existiert und ob meine finanziellen Mittel den Erwerb erlauben. Ich kann Lena jetzt aber nicht allein lassen und auch keine Pläne machen, solange die Pflegerin krank ist. Du weißt, wie schwer es ist, kurzfristig eine kompetente Fachkraft zu finden. Daher ist es ausgeschlossen, dass ich nach Irland fliege.«
»Du meinst …?«
Carolines Augen weiteten sich ungläubig.
»Deine schnelle Auffassungsgabe habe ich immer schon zu schätzen gewusst.« Jonathan nickte lächelnd. »Du wirst diesen Auftrag übernehmen. Allerdings muss ich darauf bestehen, dass du bereits Ende dieser Woche fliegst und bis zur Auktion in Irland bleibst. Vielleicht gelingt es dir, mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen und das Buch zu erwerben, bevor es öffentlich versteigert wird.«
Carolines Begeisterung ebbte so schnell ab, wie sie gekommen war, und ein Schatten fiel über ihre Züge.
»Das geht nicht«, sagte sie leise. »Du sagtest, die Auktion ist erst in etwa sechs Wochen anberaumt. Was mache ich mit Kim in dieser Zeit? Ich habe dir erzählt, dass sie in ein Feriencamp nach Florida möchte, was natürlich eine Option wäre. Stimme ich dem jetzt aber zu, weil ich einen Job zu erledigen habe, dann würde ich meine Autorität als Mutter bei ihr verspielen. Brian kann sich um Kim nicht kümmern, er ist an einem neuen Auftrag dran und wird nicht in der Stadt sein …«
»Langsam, langsam, Caroline! Darüber habe ich mir ebenfalls Gedanken gemacht«, unterbrach Jonathan ihren Redefluss. »Natürlich wird deine Tochter dich nach Irland begleiten. Du verbindest die Recherche nach dem Buch einfach mit ein paar Wochen Urlaub, den du dir mehr als verdient hast. Gestern Abend habe ich mich im Internet über die Gegend kundig gemacht. In der Umgebung des Schlosses gibt es zahlreiche nette, kleine Feriencottages, die man mieten kann. Das wäre doch gemütlicher als in einem unpersönlichen Hotel.«





























