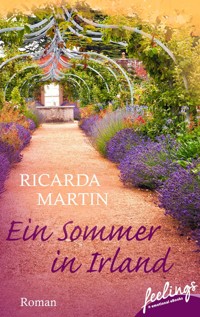6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Liebesgeschichte über Sinnsuche und Selbstfindung vor der Kulisse der britischen Kanalinsel Guernsey zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der neue Roman von Ricarda Martin. Sharon steht vor den Trümmern ihres einst so traumhaften Lebens: Ihre Beziehung ist in die Brüche gegangen und auch ihre Model-Karriere steht kurz vor dem Ende. Verzweifelt flieht sie auf die Kanalinsel Guernsey zu ihrer Ersatz-Großmutter Theodora, die ihr immer die Liebe geben konnte, zu der Sharons Eltern nicht in der Lage waren. Und wirklich, dort in der Abgeschiedenheit des Insellebens kommt Sharon langsam zur Ruhe. Selbst die Begegnung mit ihrem Jugendfreund Alec wirft sie nicht aus der Bahn. Als ein attraktiver Banker sich für sie zu interessieren beginnt, öffnet Sharon langsam wieder ihr Herz. Doch Sharons Leben droht erneut aus den Fugen zu geraten, als sie mit Theodoras Vergangenheit konfrontiert wird. Diese verbrachte ihre Kindheit und Jugend während der Besatzung der Kanalinseln im Haus eines deutschen Offiziers und musste mitansehen, wie er einen Menschen tötete ... Sharon merkt nach und nach, dass ihre eigenen Probleme klein und unbedeutend sind, und schafft es zusehends, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber kann sie Theodora den letzten großen Wunsch erfüllen? »Das Liliencottage« von Ricarda Martin ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte – wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ricarda Martin
Das Liliencottage
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwei Frauen zweier Generationen, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem eng miteinander verbunden sind. Die Geschichte einer Zeit, als die Kanalinseln von deutschen Truppen besetzt gewesen waren und sich die Besatzer und die Einwohner miteinander arangieren mussten, und die Geschichte einer großen Liebe vor der wild-romantischen Kulisse der Kanalinseln.
Inhaltsübersicht
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Die Kanalinseln sind Stücke von Frankreich, die ins Meer gefallen sind und von England aufgesammelt wurden.
Victor Hugo (1802–1885), lebte fünfzehn Jahre im Exil auf Guernsey.
1. Kapitel
Blassen Pfannkuchen gleich, pressten sich die Gesichter der Jungen an die Fensterscheibe, die Nasen breit gedrückt, die Augen aufgerissen.
»Hast du schon mal so einen Wagen gesehen?«, fragte der Rothaarige und stupste den Jungen neben ihm in die Seite.
»Solche Autos kommen sonst nie hierher«, antwortete der andere, kleiner und schmächtiger als sein Freund.
Gemeinsam beobachteten sie, wie die große, dunkelgrüne Limousine vor dem Portal ausrollte. Der Lack glänzte wie frisch poliert, Chrom blitzte, und eine silberne Frauenfigur zierte die Kühlerhaube, die aussah, als wollte sie jeden Moment herabspringen.
Der Chauffeur öffnete den Schlag im Fond. Ein älterer Mann, gekleidet in einen dunkelgrauen Anzug und mit einem Hut, stieg aus, dann half er einer Frau, den Wagen zu verlassen. Diese trug ein maulbeerfarbenes Kostüm, der Schleier ihres Hutes bedeckte ihr Gesicht.
»Die kommen, um mich zu holen«, sagte der Rothaarige und richtete sich zu seiner vollen Größe auf.
»Woher willst du das wissen?«, fragte der andere, sah den ein Jahr Älteren aber gleichzeitig ehrfürchtig an, denn es war nicht gut, dem Freund zu widersprechen. Dieser war nicht nur einen Kopf größer, sondern auch mächtig stark. Eine Stärke, die er den Kleineren gegenüber ausspielte, sie piesackte und ihnen die Äpfel wegnahm, die die Kinder manchmal zusätzlich bekamen. Die Erzieherinnen bemerkten das nicht, oder sie wollten es nicht sehen, da sie ohnehin meistens den Eindruck machten, als würden sie ihren morgendlichen Tee mit Essig anstatt Sahne trinken.
»Weil ich zu solchen Leuten gehöre«, antwortete der Rothaarige patzig.
»Du gehörst zu niemandem, ebenso wie ich«, erwiderte der Jüngere nun doch, denn immer konnte er dem Freund nicht zustimmen. »Außerdem bist du viel zu faul und zu dumm, als dass eine Familie dich mitnehmen würde.«
»Du willst wohl eins auf die Nase!« Drohend baute sich der Junge vor dem Kleineren auf, die Ankunft des Paares in dem eleganten Auto schien vergessen. »Ich kann Fußball spielen, während du nie den Ball triffst, und ich kann auf Bäume klettern. Männer wollen einen Jungen haben, der kicken und gut klettern kann.«
Mit diesen Worten hatte er recht, und der Blondschopf sackte in sich zusammen. Während die anderen Jungen bei Wind und Wetter im Hof herumtobten und den Lederball durch die Gegend kickten, saß er lieber in seinem Zimmer und sah sich die Bilder in den Büchern an. Na ja, genau genommen waren es nur zwei Bücher, die den Jungen zur Verfügung standen: eines mit Tieren, die in einem Land weit weg von hier lebten – Affen, Löwen, Zebras und Kamele –, im zweiten Buch wurden Bauern bei der Feldarbeit gezeigt, und es gab bunte Zeichnungen von Kühen, Schweinen und Hühnern. Er mochte die Bilder mit den Tieren und hoffte, bald lesen zu lernen, damit er die Texte unter den Bildern verstand.
»Pass auf, gleich werden sie mich holen«, sagte der Ältere, nachdem das elegante Paar im Haus verschwunden war. »Die haben bestimmt ein ganz großes Haus, vielleicht sogar ein Schloss, und einen riesigen Garten, in dem ich mit meinem neuen Vater jeden Tag Fußball spielen werde.«
Einerseits gönnte der Blonde dem anderen eine neue Familie, gleichzeitig spürte er jedes Mal, wenn jemand abgeholt wurde, umso mehr die Einsamkeit. Vater, Mutter, vielleicht auch einen Bruder oder eine Schwester – davon träumten sie alle hier. Regelmäßig kamen Ehepaare, die sich einen Buben aussuchten. Meistens waren das kleine Jungen, fast noch Babys, die weder laufen noch sprechen konnten. Er war vier Jahre alt, für sein Alter klein und schmächtig, die Augenbrauen und Wimpern so hell, dass man sie erst auf den zweiten Blick sehen konnte, und seine Nasenspitze ragte ein wenig nach oben. Der Junge war weder sportlich oder sonst irgendwie interessant, und auch die Misses sagten ihm immer wieder, dass ein so unscheinbares Kind niemand zu sich nehmen wollte. Es war nicht allein, dass er nicht Fußball spielen konnte. Die Leute der Insel brauchten Kinder, die in der Landwirtschaft und in den Läden mit anpacken konnten. So hatte er sich damit abgefunden, in dem Heim zu bleiben, bis er erwachsen sein würde.
Der Blick in den Hof hinunter war nun uninteressant geworden, die Jungen wandten sich vom Fenster ab. Daher bemerkten sie nicht, wie ein weiterer Wagen vor das Portal fuhr. Dieser war klein, alt und mit vielen rostigen Stellen – ein Modell, das es zuhauf auf der Insel gab.
Die Tür öffnete sich, Miss Crill trat ein und rief: »Thomas, mitkommen.«
»Ich?« Der blonde Junge sah die Miss erstaunt an.
»Natürlich du, oder ist dein Name plötzlich nicht mehr Thomas?« Mit ein paar Schritten war sie bei ihm und packte ihn am Arm. »Na los, worauf wartest du?«
»Warum er?«, schrie der Rothaarige und stampfte trotzig auf. »Ich bin für die Leute viel geeigneter als der Schwächling, ich kann nämlich …«
»Halt deinen Mund, Walter«, herrschte die Frau ihn an, musterte ihn mit einem kühlen Blick und sagte: »Wenn du weiterhin nicht lernen willst, dann will dich auch nie jemand haben.«
Hinter dem Rücken der Frau warf Walter dem Jüngeren einen wütenden Blick zu. Unwillkürlich tat er Thomas leid, auch wenn Miss Crills Aussage seine eigenen Worte dem Freund gegenüber bestätigte.
Wortlos folgte er der Erzieherin durch die hohen Korridore mit den nackten, schmucklosen Wänden, dann ging es eine schlichte Steintreppe ins Erdgeschoss hinunter. Mit jedem Schritt klopfte sein Herz schneller. Waren die Leute in dem schönen Auto wirklich gekommen, um ihn zu holen? Konnte es wirklich wahr werden? Ebenso wie Walter stellte sich auch Thomas deren Haus mit einem großen Garten vor. Sicher waren sie sehr, sehr nett, und die Frau roch bestimmt gut. Jemand, der ein solches Kostüm trug, musste gut riechen. Miss Fontaine hatte auch immer gut gerochen, wie eine blühende Sommerwiese, und sie war auch immer fröhlich gewesen und hatte mit den Jungen gespielt. Manchmal hatte sie ihm, Thomas, aus den Bilderbüchern vorgelesen, während die anderen Fußball spielten. Vor ein paar Wochen aber hatte Miss Fontaine gesagt, sie werde heiraten und bald eigene Kinder bekommen, deshalb müsse sie fortgehen. Thomas hatte ihre Beine umklammert und gerufen: »Kannst du mich nicht als dein Kind mitnehmen? Ich verspreche, auch immer ganz artig zu sein und viel zu lernen.«
Sanft hatte ihre weiche Hand auf seinem Kopf gelegen, als sie antwortete: »Das geht nicht, kleiner Thomas, aber du wirst bald Leute finden, die dir Vater und Mutter sein werden.«
»Wie können Sie so etwas sagen, Miss Fontaine?« Das war Mrs Watson gewesen. Thomas sah sie nur selten, denn die Heimleiterin verbrachte den ganzen Tag in ihrem Arbeitszimmer und wollte von den Kindern nicht gestört werden. »Sie wissen doch genau, dass niemand ein Kind mit einer solchen Vorgeschichte haben will. Ich wünschte, ich könnte den Jungen aufs Festland schicken, nach London oder in eine andere Großstadt, da hätte er vielleicht eine Chance.«
Thomas hatte nicht verstanden, was sie mit ihren Worten meinte, sondern nur, dass ihn nie jemand abholen würde. Jetzt jedoch schien sein Traum wahr zu werden.
Vor der Tür des Arbeitszimmers blieb Miss Crill stehen, musterte Thomas kritisch, spuckte in ihre Handfläche und fuhr ihm glättend übers Haar, mit wenig Erfolg. Seine hellen Haare waren struppig und standen ständig in alle Richtungen ab.
»Zeig deine Hände!«
Thomas war froh, sich Hände und Fingernägel am Morgen gründlich gesäubert zu haben. So hielten sie dieser Begutachtung stand. Dann öffnete Miss Crill die Tür und schob ihn in den Raum.
»Hier ist der Junge, Mrs Watson.«
Thomas stolperte in das Zimmer, blieb abwartend in der Nähe der Tür stehen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
»Danke, Miss Crill, Sie können gehen.« Mrs Watsons Stimme war tief und rauchig. »Das wär er dann also.«
»Er ist sehr klein für sein Alter.«
Das hatte der Mann gesagt, der hinter einer Frau, die auf einem der Sessel Platz genommen hatte, stand. Eine Welle der Enttäuschung schwappte über Thomas hinweg. Das waren nicht die Leute mit dem schönen Auto. Diese hier waren ganz einfach angezogen, die Frau mit einem schlichten braunen Kostüm, ohne feinen Schleier, und der Mann sprach ein seltsames Englisch.
Die Frau sagte nun etwas zu dem Mann, woraufhin dieser die Stirn runzelte, überlegte, schließlich nickte und ihr antwortete. Sie redeten in einer Sprache, die Thomas nie zuvor gehört hatte. Auf der Insel wurde neben Englisch auch häufig Jèrriais gesprochen, und er konnte die früher übliche Sprache Jerseys auch ein wenig verstehen und ein paar Worte sprechen.
»Der Junge wächst noch«, sagte Mrs Watson. »Ich versichere Ihnen, er ist gesund. An Leib und Seele.«
Die beiden Fremden wechselten wieder ein paar Sätze in dieser Sprache, die in Thomas’ Ohren hart und abgehackt klang. Eine Ahnung beschlich ihn, unwillkürlich wich er zurück, bis er den Türknauf an seiner Schulter spürte. Mit diesen Leuten wollte er nicht mitgehen! Er konnte sie ja nicht mal verstehen, und sie hatten bestimmt auch kein großes, schönes Haus mit Garten.
Nun wurden ein paar Schriftstücke über den Schreibtisch geschoben, auf denen der Mann unterschrieb. Als das erledigt war, lehnte Mrs Watson sich zufrieden zurück und sagte: »Miss Crill packt seine Sachen, in ein paar Minuten ist er fertig. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden? Der Inspektor des Hauses nebst Gattin ist kurz vor Ihnen angekommen. Früher als vereinbart, aber ich möchte sie nicht länger warten lassen.«
»Ich danke Ihnen, Mrs Watson«, erwiderte der Mann und nickte. »Es ist ja alles geregelt und gut, dass wir den Jungen gleich mitnehmen können.«
Thomas wurde es heiß und kalt zugleich. Er bemühte sich zu sagen, dass er lieber hierbleiben wollte, seine Zunge schien ihm aber am Gaumen zu kleben. Dann kehrte Miss Crill zurück, in der Hand einen kleinen Koffer mit abgestoßenen Ecken. Alles, was Thomas in seinem jungen Leben besaß, befand sich in diesem Koffer.
Nun stand die Frau auf, kam auf Thomas zu, ging vor ihm in die Hocke und nahm seine Hände. Sie sah ihm in die Augen und sagte dann wieder etwas in dieser seltsamen fremden Sprache. Ihre Augen waren blau, aus der Nähe erkannte Thomas graue Strähnen in ihren mittelbraunen Haaren und feine Falten um ihre Mundpartie. Sein Herz pochte jetzt so schnell und heftig, dass er glaubte, jeder im Zimmer könnte es hören.
»Wir müssen jetzt gehen, wenn wir die Fähre erreichen wollen«, sagte der Mann auf Englisch.
»Fähre?« Thomas fand seine Sprache wieder. »Wir fahren mit dem Schiff?«
Die Frau lächelte freundlich und sanft, und der Mann sagte: »Ja, wir werden auf ein Schiff gehen. Das wird dir gefallen, jeder kleine Junge will doch übers Meer fahren.«
Ich nicht!, schrie Thomas innerlich. Manchmal gingen die Erzieherinnen mit den Kindern in die Stadt hinunter, dann stand er am Hafen und sah den Schiffen nach. So jung er auch war, wusste er doch, dass man, wenn man mit einem Schiff von der Insel wegfuhr, nicht zurückkommen würde.
»Ich will nicht weg!«, platzte es aus ihm heraus.
Die Frau zuckte zusammen, und Miss Crill rief: »Wirst du wohl deinen Mund halten, du undankbares Kind!«
»Er wird sich an uns gewöhnen«, sagte der Mann und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Wir müssen aufbrechen.«
Die Frau nahm Thomas an der Hand. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als neben ihr durch den Korridor zum Ausgang zu gehen. Es nieselte, ein kalter Wind wehte vom Meer her. Thomas sah sich um. Das schöne, grüne Auto stand noch immer vor dem Portal, aber die fremden Menschen brachten ihn zu einem kleinen, grauen Wagen. Der Mann klappte den Sitz zurück und schob Thomas auf die mit billigem Plastik bezogene Rückbank. Miss Crill legte den Koffer mit seinen Habseligkeiten neben ihn. Die Frau setzte sich nach vorn neben ihren Mann, der den Motor startete.
Thomas sah hinauf zu dem Fenster. Der rothaarige Walter starrte herunter, den Mund grimmig verzogen, jetzt hob er eine Hand, ballte die Finger zur Faust und schüttelte diese drohend.
Thomas wünschte, die Leute würden nicht ihn, sondern Walter mitnehmen. Dann entschwand das Heim, das seit seiner Geburt sein Zuhause gewesen war, seinen Blicken.
2. Kapitel
Drei – acht – acht – eins – neun.
Mit der Spitze des grellrot lackierten Fingernagels tippte Sharon den Code ein, der Summer erklang, und sie öffnete die Haustür. In der weitläufigen Eingangshalle waren die Geräusche der Großstadt ausgesperrt. Endlich Ruhe! Seit dem Morgen quälten sie bohrende Kopfschmerzen, und seit Stunden hatte sie sich danach gesehnt, mit niemandem mehr sprechen und vor allen Dingen nicht fortwährend lächeln zu müssen. Die Absätze ihrer High Heels klackten auf dem Marmorboden, während sie zum Lift stöckelte. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, streifte sie die Schuhe von den Füßen. Um drei Uhr in der Nacht war nicht zu befürchten, jemandem zu begegnen, und selbst wenn – was ging es andere an, wenn sie ohne Schuhe herumlief?
Geräuschlos brachte der Aufzug sie in das Penthouse. Kaum in der Wohnung, warf Sharon die Schuhe und die Jacke achtlos in den begehbaren Kleiderschrank, dann schenkte sie sich aus der gut bestückten Hausbar einen teuren Single Malt ein. Als sie das Glas jedoch zum Mund führte, zögerte sie. Alkohol, besonders so harte Getränke wie Whisky, waren pures Gift für ihren Körper. Wenn sie hin und wieder ein Glas Champagner trank, was in ihren Kreisen kaum zu vermeiden war, sparte sie die Kalorien des Alkohols am folgenden Tag beim Essen wieder ein. Sie stellte das Glas zur Seite. Ein Glas Sodawasser in der Hand, sank sie in die weichen Polster der schneeweißen Ledercouch, hob ihre Beine und wackelte mit den Zehen. Die High Heels würden sie noch mal umbringen! Besonders lästig war der beginnende Hallux valgus an ihrem rechten Fuß. Meine Güte, sie war doch erst fünfunddreißig Jahre alt! Vor ein paar Wochen hatte Sharon einen Arzt konsultiert, der sich auf Korrekturen dieser ihrer Ansicht nach Alte-Frauen-Krankheit spezialisiert hatte.
»Für eine Operation sind Sie noch viel zu jung«, hatte der Arzt Sharons Hoffnungen mit wenigen Worten zerstört. »Die ist nicht ohne Risiko, und wenn Sie meinen Rat hören wollen: Machen Sie täglich eine auf Ihre Probleme abgestimmte Fußgymnastik und verzichten Sie auf das Tragen hoher Absätze. Gehen Sie so oft wie möglich barfuß, für gesunde Füße gibt es nichts Besseres.«
Auf High Heels verzichten? Der Quacksalber hatte doch keine Ahnung! Dann könnte sie gleich zum Amt gehen und sich arbeitslos melden, denn keiner ihrer Auftraggeber würde sie in flachen Schuhen auf dem Catwalk dulden.
So quälte sich Sharon also weiter mit den schicken, aber unbequemen Schuhen herum. Seit Tagen schmerzte ihr rechter Fuß so sehr, dass auch die Einlage, die sie sich im Internet für viel Geld bestellt hatte, keine Linderung mehr brachte.
Sharon stand auf, trat ans Fenster und blickte auf das nächtliche London. Wie ein heller Teppich lag die Stadt mit ihren Millionen von Lichtern unter ihr, dazwischen die dunklen Flächen der Kensington Gardens und des Hyde Parks, die jeweils nur einen Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt lagen. Sie liebte London. Ihr Job führte sie zu exotischen und wunderschönen Plätzen und Orten auf der ganzen Welt – dorthin, wo andere Urlaub machten. Erst kürzlich war sie für zwei Wochen auf Big Island, der Hauptinsel des Bundesstaates Hawaii, gewesen, dennoch war Sharon jedes Mal froh, wieder nach Hause zu kommen. Vor zwei Jahren hatte sie das Apartment im eleganten Stadtteil South Kensington erworben, und es war ihr ruhiger Hafen, der sie mit erlesener Eleganz empfing. Das Apartment erstreckte sich über zwei Etagen, von der Dachterrasse aus war an klaren Tagen das breite Band der Themse zu sehen. Das vierstöckige Gebäude, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts, war einst ein großzügiges und elegantes Stadthaus vermögender Aristokraten gewesen und vor etwa zehn Jahren umgebaut und in einzelne Wohnungen aufgeteilt worden.
In eine Decke gekuschelt, schaltete Sharon den Fernseher ein und zappte durch die Programme. Um diese Uhrzeit wurde nichts für sie Interessantes gesendet, schließlich blieb sie aber bei einem Musiksender hängen, auch wenn Rap und Hip-Hop nicht ihrem Musikgeschmack entsprachen. Die schnellen, lauten Rhythmen halfen ihr jedoch, nicht länger zu grübeln. Auch als sich im Osten das erste Grau des Morgens zeigte, ging Sharon nicht zu Bett. Sie war zwar erschöpft, von Kopf- und Fußschmerzen geplagt, wusste aber, dass sie sich auf eine weitere schlaflose Nacht einstellen musste. Zu viele Gedanken drückten auf ihre Seele, zu viele Fragen, auf die sie keine Antwort finden konnte. Sharon wusste: Solange sie keine Lösung gefunden, keine Entscheidung getroffen hatte, stünden ihr weitere schlaflose Nächte bevor.
Als plötzlich der melodische Klang der Klingel durch den Raum schallte, fuhr Sharon hoch. Wer, um Himmels willen, besuchte sie so früh am Morgen? Sie drückte den Knopf der Gegensprechanlage und fragte: »Wer ist da?«
»Ich bin es, mein Schatz!«
Ben! Sharons Herz klopfte schneller. Sie betätigte den Türöffner, und wenige Minuten später stand Ben vor ihr. Anstatt den Lift zu nehmen, war er die Treppen heraufgerannt, ohne auch nur ein bisschen außer Atem zu sein. In der einen Hand hielt er eine Flasche Champagner, in der anderen eine einzelne, tiefrote Baccara-Rose. Er breitete die Arme aus, Sharon warf sich an seine Brust, und er lachte, da er sie nicht umarmen konnte.
»Wo kommst du jetzt her? Ich hab dich erst morgen erwartet.«
»Überraschung, mein Schatz. Den Dreh hatten wir schneller als geplant im Kasten, da habe ich gleich die nächste Maschine genommen. Überraschung gelungen?«
»Sehr gelungen«, flüsterte sie, und ihre vollen Lippen legten sich sanft auf seinen sinnlichen Mund.
»Ich hoffe, ich hab dich nicht geweckt?« Sein Blick glitt über ihren Körper. Sharon war noch vollständig angekleidet und geschminkt. »Hast du etwa noch gar nicht geschlafen?«
»Ich bin erst gegen drei nach Hause gekommen«, antwortete Sharon, »und konnte nicht schlafen. Außerdem lasse ich mich von dir gern zu jeder Zeit wecken.«
Sharon stellte die Rose in die hohe Vase eines dänischen Designers, währenddessen öffnete Ben die Flasche. Perlend floss der Champagner in die Flöten. Sie nippten daran, stellten die Gläser dann zur Seite und umarmten sich. Zärtlich küsste Ben sie, mit einer Hand nestelte er den Kamm aus ihren hochgesteckten Haaren. Eine Flut dunkler Locken ergoss sich auf Sharons Rücken.
»Ich hab dich vermisst«, raunte er und knabberte an ihrem Ohrläppchen.
Vergessen waren die schmerzenden Füße, vergessen die Sorgen der vergangenen Tage. Jetzt gab es nur noch sie und Ben. Sie liebten sich gleich auf dem Teppich im Wohnzimmer. Wild und ungestüm, so wie immer, wenn sie sich wochenlang nicht gesehen hatten. Ihre Körper verschmolzen zu einer Einheit, vereinigten sich wie zwei alte Bekannte, gleichzeitig glich jede neue Begegnung einem vorsichtigen und ungemein zärtlichen Erkunden des anderen.
Ich werde niemals aufhören, ihn zu begehren, dachte Sharon, dann wurde sie auf den Flügeln der Ekstase und Leidenschaft davongetragen.
Die ersten Strahlen der Morgensonne malten bunte Kringel auf den Teppich, als Sharon wieder zu Atem kam. Sie stützte sich auf die Ellbogen und betrachtete sein Gesicht mit den markanten Zügen, dem eckigen Kinn, der wohlgeformten Nase. Du musst es ihm sagen, dachte sie. Heute, hier und jetzt! Ein solch intimer Moment würde vielleicht so schnell nicht wiederkommen.
Seine Lider flatterten, dann sah er sie mit seinen tiefblauen Augen zärtlich an.
»Du musst wegen des Jetlags sehr müde sein«, flüsterte Sharon und dachte: Nein, nicht jetzt, nicht, wenn Ben derart erschöpft ist. Später …
Er nickte. »In der Tat könnte ich jetzt erst mal einen starken Kaffee und dann ein weiches Bett gebrauchen. Aber nur, wenn du dieses mit mir teilst. Oder hast du heute Termine?«
»Die nächsten drei Tage habe ich frei, meine Zeit gehört einzig dir.«
Sharon ging in die Küche und ließ zwei Tassen Kaffee aus der vollautomatischen Maschine. Heiß und schwarz, ohne Zucker. Sie trank ihren Kaffee genau so wie Ben, außerdem beinhalteten Zucker und Milch Kalorien, auf die sie verzichten musste.
Während sie tranken, fragte Sharon: »Wie war es?«
Er zuckte mit den Schultern. »Heiß, feucht und anstrengend.« Er grinste und zwinkerte ihr zu. »Unter anderen Umständen habe ich es gern heiß, feucht und auch anstrengend.«
»Ach, du!«, rief Sharon gespielt empört, griff nach seiner Hand, drückte sie und fuhr leise fort: »Ich bin glücklich, dass du früher gekommen bist.«
Auch Ben war als Model in der Modebranche beschäftigt. Sein Schwerpunkt lag auf der Präsentation von Unterwäsche, auf dem Laufsteg ebenso wie in Hochglanzmagazinen. An seinem Körper war kein Gramm Fett zu viel, seine Muskeln waren gut definiert, ohne jedoch wie ein testosterongeputschter Bodybuilder zu wirken. Und für seine Gesichtszüge fiel Sharon kein anderes Wort als klassisch schön ein. Wangen und Kinn zierte ein Dreitagebart, den Ben nur widerwillig abrasierte, wenn seine Auftraggeber es von ihm verlangten. Die letzten zwei Wochen hatte Ben in Acapulco verbracht. Dort waren nicht nur neue Aufnahmen für den Katalog, sondern auch der aktuelle Werbespot eines bekannten Wäschedesigners gedreht worden. Bens makellose, glatte Haut schimmerte in einem dunklen Goldton. In Sharon erwachte erneut die Leidenschaft. Sie sah aber die Müdigkeit in seinen Augen, daher zog sie ihn an der Hand die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Kaum dass sein Kopf das Kissen berührt hatte, war Ben auch schon eingeschlafen.
Obwohl in derselben Branche beschäftigt, waren sie sich bei einer Vernissage eines aufstrebenden Gegenwartskünstlers begegnet. Sharon hatte eine Bekannte begleitet, Ben war mit dem Künstler befreundet. Beim ersten Blickkontakt hatte es sofort zoom gemacht. Nach einer angemessenen Zeit, als es nicht mehr unhöflich erschien, schlichen sie sich fort, und noch am selben Abend schliefen sie das erste Mal miteinander. Eigentlich ließ sich Sharon nicht so schnell mit einem Mann ein, obwohl es ihr an Angeboten nicht mangelte. Mit Ben und ihr war es aber etwas anderes, etwas ganz Besonderes.
Seit diesem Tag traten sie auch öffentlich als Paar auf. Nicht nur ihr Umfeld, auch die Klatschpresse feierte sie als das neue Glamour-Paar der Modebranche. Beide bekannte und gefragte Models, mit perfekten Körpern und Gesichtszügen, vermögend und unabhängig. Als aber auch nach einem Jahr noch keine Anzeichen einer Krise zu erkennen waren, änderten sich die Schlagzeilen.
Ben Cook am Miami Beach, flirtend mit einer blonden Unbekannten. Wir haben die exklusiven Bilder!
Oder:
Sharon Leclerque allein bei einem Konzert in der Royal Albert Hall. Sie wirkt einsam und traurig, denn ihr Lebensgefährte vergnügt sich mit einer anderen Frau in der Karibik.
Beide lachten über solche Meldungen. Eifersucht war ihnen fremd, denn sie vertrauten einander blind. Was die Presse schrieb, lasen sie nur in Ausnahmefällen, und keinem dieser Schmierenreporter würde es gelingen, mit haltlosen Behauptungen einen Keil zwischen sie zu treiben. Sharon hätte also uneingeschränkt glücklich sein können, wenn es nicht etwas geben würde, über das sie mit Ben sprechen musste. Vor ihnen lagen drei Tage ohne Zeit- und Termindruck, und Sharon grübelte, wie sie es anfangen sollte.
Sie schliefen bis zum Mittag, dann lockte die Sonne sie ins Freie. Nach wenigen Minuten hatten sie den Hyde Park erreicht. In der Luft lag der Geruch des Frühlings. Krokusse, Osterglocken und Forsythien blühten, und das Gras zeigte seinen ersten grünen Schimmer. Für Sharon war das Frühjahr, wenn die Natur zu neuem Leben erwachte, die schönste Jahreszeit. Hand in Hand wie Kinder liefen sie durch den Park.
»Lass uns am See etwas essen«, schlug Ben vor, und sie betraten das kleine, gemütliche Restaurant mit den karierten Tischdecken.
Ben bestellte sich eine Portion Fish & Chips mit Erbsenpüree, Sharon nur einen Salatteller mit Meeresfrüchten.
»Bitte ohne Salatsoße«, schloss sie ihre Bestellung, und Ben runzelte die Stirn. Nachdem das Essen serviert worden war, ließ Ben es sich schmecken, Sharon hingegen stocherte in ihrem Salat herum.
»Was ist?«, fragte Ben.
»Ich hab keinen Hunger.«
»Du hast vorhin auch nicht gefrühstückt, sondern nur eine Tasse Kaffee getrunken.« Ben legte das Besteck zur Seite und sah Sharon ernst an. »Du machst doch hoffentlich nicht schon wieder eine Diät?«
»Ich muss eben auf meine Figur achten.« Trotzig schob Sharon ihre Unterlippe vor, etwas, das ihr seit ihrer Kindheit anhaftete. »Du kannst anscheinend alles essen, ohne zuzunehmen, ich jedoch lese nur das Fettgedruckte in der Zeitung und habe sofort ein Pfund mehr auf den Hüften«, versuchte sie zu scherzen.
»Sharon, Schatz« – Ben griff nach ihrer Hand – »du bist sehr, sehr dünn, das ist mir sofort aufgefallen. Ich schätze, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du mindestens fünf Pfund abgenommen.«
»Na und?« Eine Falte bildete sich über ihrer Nasenwurzel. »Ben, ich werde nicht jünger und muss etwas für meinen Körper tun. Da fällt mir ein: Heute Nachmittag sollte ich noch für eine oder zwei Stunden ins Studio, mein tägliches Trainingspensum darf ich nicht versäumen.«
»Auch ich trainiere und achte auf meine Figur«, stimmte Ben zu, »das ist in unseren Jobs eben so. Allerdings finde ich, dass du es übertreibst. Du warst immer ein Model, das nicht wie ein wandelnder Hungerhaken daherkommt, und über mangelnde Aufträge kannst du dich nicht beklagen. Deine Figur muss natürlich sein, du darfst nicht krank aussehen.«
»Die Zeiten ändern sich, Ben.« Sharon schob den Teller mit dem Salat, von dem sie kaum mehr als zwei, drei Blätter und eine Muschel gegessen hatte, zur Seite. Sie wirkte dabei regelrecht angeekelt. »Die Leute wollen junge Models, je jünger, desto besser, und diese sind eben nicht so fett wie ich …«
»Jetzt mach aber mal einen Punkt, Sharon!«, unterbrach Ben sie ärgerlich und so laut, dass die Gäste am Nebentisch sich zu ihnen umdrehten. Mit gesenkter Stimme fuhr er fort: »Du brauchst mir nicht zu erklären, wie es in der Branche zugeht, ich erlebe das jeden Tag. Wie viel wiegst du?«
Sie zögerte, wich seinem Blick aus, dann murmelte sie: »Hundert Pfund.«
»Sharon, bitte!«
Sie seufzte. »Also gut, gestern Morgen waren es zweiundneunzig, aber …«
»Und du bist einen Meter achtundsiebzig groß«, stellte Ben ernst fest. Er zückte sein Handy und tippte die Zahlen ein, dann hielt er das Ergebnis Sharon vor Augen. »Das ergibt einen BMI von vierzehneinhalb. Mensch, Sharon, selbst du weißt, dass das viel zu wenig ist.«
»Können wir bitte gehen?« Sharon stand auf und nahm ihre Jacke. Ben zahlte am Tresen, und vor dem Restaurant legte er einen Arm um ihre Schultern. Durch die Kleidung spürte er ihre spitzen Schlüsselbeine.
»Es kann sein, dass Perfect Beauty meinen Vertrag nicht verlängert«, platzte Sharon heraus, kaum dass sie ein paar Schritte gegangen waren.
»Das ist es also.« Ben seufzte und drückte sie an sich. »Warum sollten sie dich nicht länger wollen? Seit Jahren bist du das Gesicht für Perfect Beauty und …«
»Sie wollen eine Jüngere«, unterbrach Sharon ihn bitter. »Sie heißt Ivana, kommt aus Moldawien, hat kugelrunde blaue Babyaugen und ist zwölf Jahre jünger als ich. Ich glaube, sie bekommt den Job nur, weil sie mit einem der Vorstandsvorsitzenden ins Bett geht.« Sie sah Ben ernst an. »Letzte Woche sagte man mir, sie würden überlegen, ob ich noch länger als Aushängeschild für Perfect Beauty geeignet bin, und du weißt genau, dass es auf dem Catwalk kein bisschen anders ist. Mit Mitte dreißig ist man weg vom Fenster, wenn man sich nicht doppelt bis dreifach ins Zeug legt.«
»Es gibt genügend Models, die sind auch im fortgeschrittenen Alter noch gut im Geschäft«, wandte Ben ein.
»Ja, für Seniorenmode, Inkontinenz-Einlagen, Hörgeräte und solchen Kram.«
Ben lachte laut auf. »Jetzt mach aber mal einen Punkt, Sharon! Es gibt tausend Möglichkeiten, kein Grund, sich zu Tode zu hungern.«
»Ich bin aber nicht so bekannt wie Heidi, Claudia, Gisele oder gar Linda. Die haben es geschafft, sich schon vor Ende ihrer Laufstegkarriere etwas anderes aufzubauen. Was habe ich?« Resigniert hob Sharon die Hände. »Ich hab nichts anderes gelernt, habe nicht einmal einen College-Abschluss, wie du weißt, und es versäumt, rechtzeitig ein zweites Standbein aufzubauen.«
Mit zwei Fingern hob Ben ihr Kinn an. Wenn er genau hinsah, dann erkannte er tatsächlich feine Fältchen um ihre Augen und über der Nasenwurzel, denen Sharon regelmäßig mit entsprechenden Botoxbehandlungen entgegenzuwirken versuchte. Sie drehte den Kopf zur Seite, als er sie küssen wollte, und murmelte: »Lass uns bitte zurückgehen, ich hab Kopfschmerzen.«
»Bist du krank, Sharon?«
»Nur Kopfschmerzen«, wiegelte sie ab. »Bitte, ich muss mich hinlegen und dann später trainieren.«
»Wenn du krank bist, solltest du dich ausruhen und nicht ins Sportstudio gehen.«
»Danke schön, Ben Cook, für deine Belehrungen, aber ich bin alt genug, um zu wissen, was gut für mich ist und was nicht.«
»Den Eindruck habe ich nicht«, beharrte Ben und runzelte die Stirn. »Du benimmst dich wie ein kleines Kind, Sharon. Bildest dir ein, zu dick zu sein, siehst in jeder Falte gleich eine Katastrophe und suhlst dich in Selbstmitleid. Nein, lass mich aussprechen.« Er erhob seine Stimme, als Sharon den Mund öffnete. »Okay, dann soll Perfect Beauty eben eine Jüngere engagieren, das bedeutet wirklich keinen Weltuntergang. Mensch, Sharon, reiß dich zusammen!«
»Du hast gut reden«, erwiderte sie. »Ein Mann wird nicht älter, er wird interessanter. Auch mit grauen Schläfen seid ihr gefragt, und mit deinem Body brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Für männliche Models gibt es immer genügend Jobs, wir Frauen sind mit spätestens vierzig weg vom Fenster.«
»Du übertreibst wirklich, Sharon …«
»Bist du eigentlich nur gekommen, um mir Vorwürfe zu machen?«, giftete sie unfreundlicher, als es eigentlich ihre Art war. Die Belastungen der letzten Wochen zerrten an ihren Nerven, und der Schmerz in ihrem Hinterkopf wurde immer schlimmer.
»Ich bin gekommen, weil ich dich liebe.«
»Es tut mir leid, Ben.« Mit diesen Worten hatte er ihr den Wind aus den Segeln genommen. »Die Sorge, wie es weitergehen soll, lässt mich nicht zur Ruhe kommen.«
Ein blauer Fußball kam plötzlich von irgendwoher geflogen und prallte gegen Bens Unterschenkel. Er lachte, hob den Ball auf und sah sich um. Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, beide etwa acht oder neun Jahre alt, stürmten auf ihn zu.
»Verzeihen Sie, Sir, das war keine Absicht.«
Spielerisch trippelte Ben den Ball und warf ihn dann dem Jungen zu, der ihn mühelos auffing.
»Danke, Sir!«, rief das Mädchen, dann stoben die beiden davon. Noch nach hundert Metern konnten Ben und Sharon sie lachen hören.
»Ich stelle immer wieder fest, wie wohlerzogen die Kinder hier in England sind«, bemerkte Ben. »Hast du gehört, wie er mich ›Sir‹ genannt hat?«
Sharon lachte und erwiderte: »Glaub mir, es gibt auch hier ganz schöne Rabauken, die es an Höflichkeit gegenüber Erwachsenen mangeln lassen. Die Erziehung heute ist viel lockerer als zu unseren Kindertagen.«
Für einen Moment dachte Sharon an ihre eigene Kindheit, verdrängte aber schnell die Erinnerung. Das war Vergangenheit.
Nachdenklich strich sich Ben über sein unrasiertes Kinn und sagte: »Was dein weiteres Leben betrifft … eventuell böte sich eine Alternative für dich.«
»Ja?« Hoffnungsvoll sah Sharon ihn an. »Hat deine Agentur vielleicht einen Job für mich, wenn Perfect Beauty mich abserviert?«
»Das nicht gerade … wie stehst du jedoch zu Kindern?«
»Kinder?«, wiederholte Sharon und wurde eine Spur blasser. »Aus dem Alter, Kindermode zu präsentieren, bin ich nun wirklich raus«, fügte sie scherzend hinzu.
»Das meine ich nicht.«
»Dann verstehe ich deine Frage nicht, Ben.«
Er steckte die Hände in die Taschen seiner Jeans, sah sie nicht an und erwiderte: »Denkst du nicht daran, eigene Kinder zu bekommen?«
»Eigene Kinder?«, wiederholte Sharon fassungslos.
»Was ist, mein Schatz? Du bist auf einmal leichenblass! Meine Frage ist doch nicht abwegig. Du bist in einem Alter, in dem sich viele Frauen Gedanken über die Familienplanung machen.«
»Ich nicht«, erwiderte Sharon entschlossen. In ihrem Kopf pochte es immer stärker. Sie griff sich an die Schläfe und stöhnte.
»Du solltest wirklich einen Arzt aufsuchen …«
»Können wir das Thema endlich beenden?« Damit schnitt Sharon ihm das Wort ab. »Ich möchte jetzt wirklich zurückgehen, sonst verpasse ich die Trainingsstunde.«
Es war Ben anzusehen, dass ihm noch einiges auf der Zunge lag, er kannte seine Freundin jedoch. Wenn sie diesen Gesichtsausdruck hatte, war es besser, das Thema ruhen zu lassen. Vorerst jedenfalls.
Seite an Seite gingen sie zurück zu Sharons Wohnung und sprachen dabei über das Wetter.
Während Sharon schweißgebadet eine Stunde auf dem Crosstrainer zubrachte und danach in der Sauna entspannte, fragte sie sich, warum Ben ausgerechnet heute das Thema Kinder erwähnte. Nur wegen des kleinen Zwischenfalls mit dem Ball? Sie hatten nie über Kinder gesprochen, im Gegenteil. Beide jetteten sie um die ganze Welt, immer von einem Termin zum nächsten. Ben lebte in den Staaten, sie in England, weil jeweils dort ihre Hauptauftraggeber ansässig waren.
Du hättest es ihm sagen sollen, dachte Sharon und legte sich die Hände auf den nackten Bauch. Heute Mittag war die Gelegenheit günstig gewesen, sie hatte jedoch die Chance verpasst. Vielleicht war es aber auch gut, wenn sie weiterhin schwieg, solange sie sich selbst bei der Entscheidung unsicher war. Ein Kind war nie auf ihrem Lebensplan gestanden, obwohl sie Kinder durchaus mochte, nur für sie selbst war es nie eine Option gewesen, Mutter zu werden. Psychologen sähen das wohl in ihrer eigenen Kindheit begründet. Einer Kindheit, in der es ihr an nichts fehlte, im Gegenteil, Geld war immer ausreichend vorhanden. Sharon hatte sich jedoch nie richtig dazugehörig gefühlt, sondern war sich eher wie ein Störfaktor zwischen ihren Eltern vorgekommen. Ihre Mutter war schon vierzig, ihr Vater sechs Jahre älter gewesen, als Sharon geboren wurde, und irgendwie hatte Sharon immer gespürt, dass sie nicht eingeplant gewesen war. Marjorie Leclerque war nicht nur eine wunderschöne Frau, sondern darüber hinaus eine erfolgreiche Konzertpianistin gewesen, Sharons Vater ihr Manager, der seine Frau nie allein gelassen hatte. Die Eltern waren auf der ganzen Welt umhergereist, von einem Konzert zum anderen gejettet, um Sharon hatten sich diverse Kindermädchen gekümmert. Manchmal, in den Ferien, wenn keine Schule war, hatte sie die Eltern begleiten dürfen. Aber auch dann waren Kindermädchen an ihrer Seite, die sie in anonymen Hotelzimmern ins Bett brachten, während ihre Eltern sich auf Empfängen und Galas zeigten. Lediglich bei Presseterminen erinnerten sich die Eltern an ihre Tochter, denn Fotos von der Familie mit dem kleinen, reizenden Mädchen kamen in den Hochglanzmagazinen immer gut an. Danach war sie wieder in die Ecke geschoben und vergessen worden. All das wollte Sharon einem Kind nicht zumuten, wollte nicht irgendwann in dessen Augen die Vorwürfe lesen, die sie ihren Eltern gegenüber erhob. Ein Kind würde automatisch das Ende ihrer Karriere bedeuten, und irgendwann würde sie dies das Kind spüren lassen. Vielleicht nicht mit Worten, aber sicherlich durch ihr Verhalten, ähnlich dem ihrer Mutter. In Sharons Kindheit und Jugend hatte es nur eine Person gegeben, die ihr das Gefühl, erwünscht und auch geliebt zu werden, vermittelte. Seltsam, dass sie ausgerechnet jetzt an Theodora denken musste. Sharon schämte sich, denn sie hatte sich seit Jahren nicht mehr um Theodora gekümmert, ihr geschrieben oder sie angerufen. Sie wusste nicht einmal, ob Theodora überhaupt noch am Leben war.
Als Sharons Eltern vor sechs Jahren bei einem Flugzeugabsturz über der Wüste von Nevada ums Leben gekommen waren, war Sharons Welt nicht zusammengebrochen. Natürlich hatte sie getrauert, sie war aber in ihrem eigenen Leben derart eingespannt, dass ihr keine Zeit für großen Schmerz geblieben war. Rasch hatte sie alle Formalitäten und die Beerdigung geregelt und das Haus ihrer Eltern verkauft. Das nicht unerhebliche Vermögen, das sie geerbt hatte, ermöglichte ihr den Erwerb der Wohnung im noblen Londoner Stadtteil South Kensington und bescherte ihr zusätzlich eine gewisse Rücklage. Eine Rücklage, auf die sie wohl bald zurückgreifen musste, wenn die Aufträge ausblieben oder es ihr nicht mehr möglich war, weiterhin zu arbeiten.
Da sie allein in der Sauna war, betrachtete sie kritisch ihre Oberschenkel, presste die Haut zusammen und starrte auf die kleinen Dellen, kaum sichtbar, aber eben doch vorhanden, obwohl sie wirklich kein Gramm Fett zu viel hatte. Cellulite traf aber nicht nur übergewichtige Frauen. Mit Grauen dachte Sharon, dass sie bei einer Schwangerschaft vermutlich hässliche Streifen und hängende Brüste bekommen würde. Das konnte das Messer eines guten Chirurgen zwar wieder in Ordnung bringen, aber Sharons Angst vor Operationen war fast ebenso groß wie die Furcht, als Model nicht mehr gefragt zu sein. Perfect Beauty war ja nicht die einzige Firma, die plante, sie durch eine Jüngere zu ersetzen. Im letzten Jahr hatte die Agentur ihr deutlich weniger Aufträge für den Catwalk vermittelt, Sharon war in erster Linie für Fotoaufnahmen gebucht worden. Fotografien konnten bearbeitet werden, hier eine Falte weg, dort verschwand ein Fettpölsterchen – ein weiteres Indiz, dass sie auf dem besten Weg war, zu alt und unattraktiv für diese Welt des Glamours und des schönen Scheins zu werden.
Dagegen musste sie unbedingt etwas unternehmen! Sie musste noch mehr trainieren, noch mehr auf ihre Ernährung achten, Kohlenhydrate vollständig und Fett weitgehend vom Speiseplan streichen, und nächste Woche stand ohnehin schon wieder eine Botoxbehandlung an. Und dann war da noch das Problem mit ihrem hässlichen Hallux valgus. Auf keinen Fall durfte sie zulassen, dass ihr Körper auseinanderging und unansehnlich wurde. Sharon schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. Im Prinzip hatte sie ihre Entscheidung getroffen, und den bohrenden Stachel des Zweifels musste sie ignorieren. Vor allen Dingen durfte Ben nichts davon erfahren. Niemals!
Es war bereits dunkel, als Sharon nach Hause zurückkehrte. Von der Straße aus sah sie den Lichtschein hinter den Fenstern des Apartments. Erleichtert atmete sie auf. Sie hatte befürchtet, Ben wäre nicht da, vielleicht sogar wieder abgereist, denn am Nachmittag hatte sie sich ihm gegenüber nicht gerade freundlich verhalten. Wenn Ben in London war, gab Sharon ihm den Zweitschlüssel für die Wohnung, fast so, als würden sie richtig zusammenleben. Irgendwie war es doch ein schönes Gefühl, nicht von einer leeren Wohnung, sondern von einem geliebten Menschen begrüßt zu werden.
Nachdem sie die Tür aufgeschlossen hatte, schlug ihr der Duft nach Rosen entgegen. Sie trat ins Wohnzimmer und sah die vielen Sträuße, es mussten mindestens ein Dutzend sein. Das Licht war gedimmt. Ben hatte Kerzen angezündet, und in den Rosenduft mischte sich der Geruch eines Rinderfilets. Der Esstisch war mit roten Rosenblättern geschmückt und mit Kerzen und Sharons bestem Porzellan gedeckt, in einem Kühler stand eine Flasche Champagner.
»Schön, dass du da bist!« Aus der Küche kam ihr Ben entgegen. »Das Essen ist gleich fertig.«
Bei den köstlichen Gerüchen lief Sharon das Wasser im Mund zusammen, und sie verspürte Hunger. Sie lachte, denn Ben hatte sich über die Jeans und das T-Shirt die rüschenverzierte Schürze gebunden, die Sharon trug, wenn sie kochte, was jedoch selten vorkam. Die Öffentlichkeit hatte keine Ahnung davon, dass Ben ein hervorragender Koch war und am Herd Entspannung fand.
Mit geschickten Handgriffen öffnete Ben die Flasche, der Champagner perlte in die Gläser, Sharon nahm aber nur einen kleinen Schluck, damit Ben nicht nachfragte, warum sie keinen Alkohol trank. Er forderte sie auf, sich zu setzen, dann servierte er die Teller, die wie in einem Gourmetrestaurant angerichtet waren: Rinderfilet an einer Rotwein-Cranberry-Soße und gedünstete zarte Romanesco-Röschen. Auf eine weitere Beilage hatte Ben verzichtet, er selbst nahm am Abend ebenfalls keine Kohlenhydrate zu sich. Das Messer glitt durch das Filet, als wäre das Fleisch aus Butter, und Sharon aß tatsächlich mit gutem Appetit. Morgen würde sie eben eine Stunde länger trainieren, um die Kalorien wieder zu verbrennen.
Als Nachtisch hatte Ben eine leichte Joghurtcreme mit Früchten zubereitet. Als er bemerkte, wie Sharon ablehnend die Stirn runzelte, sagte er: »Es ist kein Zucker drin, und selbstverständlich fettarmer Joghurt.«
Sharon aß trotzdem nur zwei Teelöffel, dann schob sie das Schälchen beiseite.
»Es war köstlich, danke, Ben. Du verwöhnst mich so sehr, und ich …« Sie räusperte sich und stieß hervor: »Es tut mir leid, ich war heute Mittag ziemlich garstig zu dir. Ich glaube, es war unser erster Streit.«
»Hoffentlich auch unser letzter.«
»Du wolltest mir einen Vorschlag machen?« Glücklich, dass die Harmonie zwischen ihnen wiederhergestellt war, lenkte Sharon ein.
Ben räusperte sich, bevor er sagte: »Ich denke, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Lass uns diese kleine Missstimmung einfach vergessen, ja?«
Seine Finger streichelten ihren Nacken, sofort erwachte das Begehren in Sharon. Sie verstanden sich ohne Worte. Er nahm sie auf seine kräftigen Arme und trug sie ins Schlafzimmer hinauf.
Ben erwachte von einem Geräusch. Zuerst glaubte er, geträumt zu haben, dann drang durch die Dunkelheit aber ein verhaltenes Stöhnen. Er knipste das Licht an. Das Bett neben ihm war leer, unter dem Spalt der Badezimmertür schimmerte Licht, und von dort kamen auch die Geräusche. Mit einem Satz war er aus dem Bett, lief nackt, wie er war, zum Bad und öffnete die Tür. Auf den Fliesen kauerte Sharon. War sie am Mittag bereits blass gewesen, so war ihr Teint jetzt aschfahl.
»Mein Gott, Sharon!« Er kniete nieder und stützte ihren zitternden Körper. »Du bist krank!«
Aus weit geöffneten Augen starrte sie ihn an. Dann sah er die Blutflecken auf ihrer Pyjamahose, auch wenn Sharon versuchte, diese mit einem Handtuch zu verbergen. Ungläubig schüttelte Ben den Kopf, und Sharon kam seiner Frage zuvor und flüsterte: »Ich brauche einen Arzt, denn ich … Ben, ich erwarte ein Kind.«
Eine verständnisvolle und freundliche Ärztin mittleren Alters erklärte Sharon, dass ein Abgang in der siebten Schwangerschaftswoche keine Seltenheit war.
»Von vielen Frauen wird es gar nicht als Fehlgeburt erkannt«, sagte die Ärztin. »Sie glauben, sie hätten lediglich eine besonders starke Regelblutung. Sie sind völlig gesund, Ms Leclerque, und können jederzeit wieder schwanger werden und ein gesundes Kind austragen. Ich rate nur dazu, mit einer erneuten Schwangerschaft ein paar Monate zu warten.«
»Es kam so plötzlich«, flüsterte Sharon. »Als ich zu Bett ging, habe ich gar nichts gespürt, allerdings hatte ich den ganzen Tag über starke Kopfschmerzen.«
»Wir werden Sie entsprechend untersuchen, ich denke aber nicht, dass Kopfschmerzen etwas mit dem Abgang zu tun haben.« Die Ärztin nickte verständnisvoll. »Ich weiß, wie Sie sich jetzt fühlen. Ein Kind zu verlieren ist furchtbar, auch wenn es noch ganz am Anfang ist. Es tut mir sehr leid.«
Auch wenn die Ärztin häufig mit solchen Vorkommnissen konfrontiert wurde, las Sharon in ihren Augen echtes Mitgefühl. Sie nickte wortlos. Nachdem Ben den Notarzt gerufen und ein Rettungswagen sie in die Klinik gebracht hatte, hatte sie eine Narkose erhalten. Als sie aus der erwachte, war alles vorüber gewesen, und sie spürte nur noch einen leichten, ziehenden Schmerz im Unterbauch, der, nach den Worten der Ärztin, völlig normal war und in ein paar Tagen abklingen würde.
Sharon griff nach der Hand der Ärztin und fragte bang: »Die Presse erfährt davon doch nichts, oder?«
Die Ärztin schüttelte den Kopf. »Wir sind an unsere Verschwiegenheitspflicht gebunden, Ms Leclerque. Wenn nicht Sie oder Ihr Lebensgefährte …«
»Auf keinen Fall!«, fiel Sharon ihr ins Wort. »Niemand darf jemals von dieser … Fehlgeburt erfahren!«
»Ich sehe, Sie werden die Sache leicht überwinden.« Sharon täuschte sich nicht, die Stimme der Ärztin war eine Spur kühler geworden. »Ruhen Sie sich noch ein paar Stunden aus, heute Nachmittag können Sie dann wieder nach Hause. In den nächsten zwei Wochen sollten Sie sich schonen, keinen Sport treiben und nichts Schweres heben. Ihr behandelnder Gynäkologe wird die Nachuntersuchungen übernehmen.«
Sharon war froh, als sie allein war, um nachdenken zu können. Noch vor wenigen Stunden hatte sie nicht gewusst, was sie tun sollte. Obwohl sie und Ben immer verhütet hatten, hatte die Erkenntnis, schwanger zu sein, sie wie mit einem Vorschlaghammer getroffen. Kondome waren eben doch nicht absolut sicher, auch wenn sie diese immer sachgemäß benutzt hatten. Als ihre normalerweise pünktliche Regel ausgeblieben war, machte sie einen Test, und als die blauen Striche das Ergebnis eindeutig anzeigten, hatte Sharon keine Freude empfunden. Sie hatte nur daran gedacht, dass sich ihr Körper verändern würde, sie als Frau mit Kind endgültig aus der Branche raus war, und Panik davor gehabt, ebenso wie ihre Eltern bei der Erziehung zu versagen. Auf der anderen Seite war da ein winzig kleines Lebewesen in ihrem Bauch – ein Teil von ihr und von Ben. Niemals hätte sie es übers Herz gebracht, die Schwangerschaft zu unterbrechen. Also hatte Sharon versucht, die Wahrheit auszublenden, als hoffte sie, dass ihr die Entscheidung abgenommen wurde. Nun, das hatte die Natur tatsächlich getan, als hätte der Embryo gespürt, dass er nicht erwünscht war. Sharon erschrak über sich selbst, als sie kein Bedauern, keine Trauer, sondern nur Erleichterung empfand.
»Wann hättest du es mir gesagt?«, fragte Ben nüchtern und sachlich, dennoch lag in seinen Worten ein vorwurfsvoller Ton. »Hättest du es mir überhaupt gesagt? Ich hab ein Recht, es zu erfahren, wenn du ein Kind von mir erwartest.«
Sharon saß, in eine Decke gehüllt, auf der Couch und trank eine warme Milch. Ben hatte sie aus der Klinik abgeholt und nach Hause gebracht, während der Fahrt hatten sie nicht miteinander gesprochen. Er hatte die Zähne fest aufeinandergepresst, und Sharon ahnte, dass er sich nur mühsam beherrschte.
»Ich wusste nicht, wie du darauf reagierst«, erwiderte sie leise. »Eigentlich hatte ich vor, es dir zu sagen, wenn du hier in London bist, aber als du dann mit dem Thema Kinder angefangen hast …« Sie zuckte mit den Schultern und stieß hervor: »Ich wusste doch selbst nicht, ob ich das Kind haben will.«
»Du dachtest über eine Abtreibung nach?« Das Entsetzen in Bens Blick war unübersehbar.
»Nein, das auf keinen Fall … ach, ich weiß nicht.« Verwirrt wischte Sharon sich über die Augen. »Aber jetzt, wo es vorbei ist …«
»Bist du froh darüber.« Ben brachte es auf den Punkt, griff dann in seine Hosentasche, holte eine kleine Schachtel heraus und sank vor Sharon auf die Knie. Er öffnete den Deckel der Schachtel, ein weißgoldener Ring mit einem funkelnden Stein blitzte im Kerzenlicht, und Ben fragte: »Sharon Leclerque, möchtest du mich heiraten?«
»Oh!«
»Ich hatte von Anfang an vor, dir bei meinem Besuch diese Frage zu stellen«, sagte Ben leise, »eigentlich gestern Abend schon, aber es war einfach nicht das richtige Timing. Was jedoch geschehen ist, sagt mir, dass wir beide zusammengehören, denn ich hatte furchtbare Angst um dich, als sie dich in den OP geschoben haben.«
Sharon nickte, Tränen traten ihr in die Augen – Tränen der Freude.
»Kannst du das bitte noch einmal sagen?«
Ben lächelte und wiederholte: »Möchtest du meine Frau werden, Sharon, und eine Familie mit mir gründen? Bitte, sag ja, denn meine Gelenke sind nicht mehr so jung, um stundenlang knien zu können.«
Sharons Lächeln erstarb, der kleine Scherz hatte sie nicht erreicht.
»Dann steh bitte auf«, forderte sie Ben auf, holte tief Luft und fuhr fort: »Ja, ich würde dich gern heiraten, sehr gern sogar, aber wegen des Themas Kinder …«
»Bitte, Sharon, wir lassen es auf uns zukommen«, erwiderte Ben. »Ich weiß, dass du im Moment verwirrt bist, und wir haben Zeit, gemeinsam darüber nachzudenken. Immer mehr Frauen bekommen mit vierzig oder noch später das erste Kind. Mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten ist das längst nicht mehr gefährlich, und …«
»Ich denke nicht, dass ich ein Kind möchte.« Sharon stellte die Tasse auf den Tisch und sah Ben offen an. »Manche haben dieses Muttergen, andere eben nicht. Ich eigne mich nicht als Heimchen am Herd, dessen Lebensmittelpunkt sich um breiverschmierte Lätzchen und volle Windeln dreht.«
»Jetzt übertreibst du maßlos«, sagte Ben mit dem Anflug eines Lächelns. »Millionen von Frauen … von Paaren bekommen Kinder und machen gleichzeitig Karriere. Heutzutage ist das doch kein Problem mehr, man hat so viele Möglichkeiten.«
»Ich werde kein Kind bekommen, um es dann fremden Menschen zu überlassen«, erwiderte Sharon. »Meine Karriere steht ohnehin kurz vor dem Ende, und wenn ich wegen einer Schwangerschaft pausiere, dann bin ich für alle Zeiten weg vom Fenster.«
»Wäre das so schlimm?«, fragte er leise. »Ist es für dich unvorstellbar, eine Familie zu gründen, dich um ein Haus mit Garten und um unsere Kinder zu kümmern?«
»Ach, jetzt sind es schon mehrere Kinder«, rief Sharon aufgebracht. »Du hast eines bei deiner Aufzählung vergessen, Ben: Ich werde mich auch um dich kümmern müssen! Wer von uns wird denn seinen Job aufgeben? Du sicher nicht, du wirst noch viele Jahre gefragt sein. Dann sitze ich in unserem Haus, ob mit oder ohne Garten, tagelang, wochenlang, wartend, bis der gnädige Herr von einem Shooting nach Hause kommt, die Füße hochlegt und bedient werden will …«
»Sharon, du bist aufgeregt und steigerst dich in eine Vorstellung rein, die nicht der Realität entspricht. Es macht mich traurig, dass das Bild, das du von mir zu haben scheinst, mich als Macho darstellt. Ich dachte, du kennst mich besser. Natürlich werden wir in den Staaten wohnen müssen, dort ist mein Dreh- und Angelpunkt, und ja, ich werde weiterhin als Model arbeiten, aber ich werde mich auch um unsere Kinder kümmern, wann immer es mir möglich ist.«
Unwillig drehte Sharon den Kopf weg, als er sich neben sie setzte und ihr einen Arm um die Schultern legte. Nachdenklich betrachtete Ben sie. In ihm stritten die unterschiedlichsten Gefühle. Leise fuhr er fort: »Ich weiß, du fürchtest dich davor, ebenso zu werden wie deine Eltern. Es tut mir leid, dass deine Kindheit nicht glücklich gewesen ist, aber gerade deswegen solltest du die Chance ergreifen, eine bessere Mutter zu sein, als es deine gewesen war.«
»Du hast doch keine Ahnung!« Sharon sprang auf, sie konnte nicht länger ruhig sitzen bleiben. »Du hast eine wundervolle Kindheit verbringen dürfen. Deine Eltern waren immer für dich da, und noch heute gehst du jeden Sommer für eine Woche mit deinem Vater zum Campen und Angeln in die Wälder, und du hast auch noch nie ein einsames Weihnachten verbringen müssen.«
»Machst du mir etwa zum Vorwurf, dass ich mit meiner Familie Glück habe?« Verständnislos schüttelte Ben den Kopf. »Ich dachte, wir kennen uns … ich kenne dich, Sharon. Offenbar habe ich mich in dir getäuscht. Niemals hätte ich gedacht, dass du derart egoistisch bist. Millionen von Frauen würden sich freuen, wenn ein Mann eine Familie mit ihnen gründen möchte.«
»Dann heirate doch eine von denen!«, entfuhr es Sharon. »Ja, du hast recht: Dutzende von Frauen würden alles dafür geben, den attraktiven und berühmten Ben Cook vor den Altar schleppen zu können.« Mit hochroten Wangen blieb sie vor Ben stehen und fügte hinzu: »Du wirfst mir Egoismus vor, und gleichzeitig stellst du die Bedingung, ich solle Kinder bekommen, wenn wir heiraten. Es tut mir leid, unter diesen Umständen kann meine Antwort nur Nein lauten.«
Sie sah den Schmerz in seinen Augen, und ihr selbst war es, als würde sie mit einem scharfen Schwert in zwei Teile geteilt. Sie bereute ihre Worte, wusste, wie ungerecht sie war. Was gesagt worden war, ließ sich jedoch nicht mehr zurücknehmen.
»Sharon, ich liebe dich und wollte mein Leben mit dir teilen«, sagte er schließlich leise und verletzt, »und zwar ganz offiziell, mit unseren Unterschriften auf dem Papier. Vielleicht erscheint dir meine Einstellung altmodisch und nicht mehr in die heutige Zeit passend, aber ja – ich möchte eine Familie haben, mit allem Drum und Dran. Ich bin fast vierzig und will kein alter Vater sein.«
Sharon wusste nicht, was sie noch sagen oder tun sollte. Nachgeben, um Ben nicht zu verlieren, und sich dabei selbst aufgeben? Seinen Antrag annehmen, die Kinderfrage hinauszögern und hoffen, seine Meinung würde sich ändern? Wenn sie Ben nun sagte, sie wäre bereit, über ein Kind nachzudenken, wäre es eine Lüge, denn Sharon glaubte nicht, dass sie ihre Meinung ändern würde. Eine denkbar schlechte Basis für eine Ehe.
»Ich kann nicht anders«, murmelte sie. »Nicht jetzt, nicht heute …«
»Es ist es wohl besser, wenn ich heute Nacht auf der Couch schlafe und morgen den ersten Flug nach New York nehme«, sagte Ben resigniert. »Ich glaube, wir brauchen Abstand voneinander.«
Sharon war nicht in der Lage, ihm zu widersprechen.
3. Kapitel
Theodora Banks gehörte zu Guernsey wie die schroffen Klippen und kleinen Buchten im Süden, wie die meilenlangen Strände mit goldenem Sand im Norden und wie die bunten, üppig blühenden Lilien, die Wahrzeichen der Insel. Auch in Theodoras Garten wuchsen die Blumen in verschwenderischer Fülle, deshalb trug das Anwesen den klangvollen Namen Liliencottage. Cottage traf nicht ganz zu, denn es war ein zweistöckiges Gebäude mit insgesamt acht Zimmern, drei davon vermietete Theodora Banks als Bed and Breakfast an Feriengäste. Die Pension schien, wie Theodora selbst, im kleinen Dorf St Martin an der Südküste der Insel immer schon zu existieren. Menschen aus Theodoras Kindheit oder Jugend waren – mit Ausnahme von Violet – keine mehr am Leben, und Violet war mit achtundachtzig ein Jahr älter als Theodora. Seit mehreren Jahren lebte Violet in einem Altenheim in St Peter Port. Theodora besuchte sie regelmäßig jeden zweiten Sonntagnachmittag. Sie tat das nicht aus Sympathie, sondern eher aus Pflichtbewusstsein. Violet war die Einzige, die ihr aus ihrer lange zurückliegenden Jugend geblieben war. Meistens erkannte Violet sie nicht, manchmal glaubte sie, Theodora wäre ihre Mutter, und fragte nach ihrer Lieblingspuppe, die sie als Kind irgendwo verloren hatte. Theodora saß dann still neben ihr, setzte die Schnabeltasse mit Tee an Violets Lippen und fütterte sie mit Scones, von denen sie kleine Stücke abbrach und der alten Frau in den Mund schob. Ein, zwei Stunden verharrte sie neben der Freundin aus Kindertagen, in der Theodora die Vergänglichkeit ihres eigenen Lebens erkannte. Nach dem Tee nickte Violet in der Regel ein und wurde von einer Pflegeschwester in ihr Zimmer gebracht. Theodora wusste, wenn Violet erwachte, hatte sie vergessen, dass Theodora sie besucht hatte.
»Sie sind die Einzige, die sich um Miss Violet kümmert«, sagte die Schwester zu Theodora. »Es ist traurig, in diesem Alter keine Angehörigen mehr zu haben, und sie freut sich immer auf Ihre Besuche.«
Theodora wusste, dass das eine freundliche Lüge war. Sie lächelte und kam alle zwei Wochen wieder. Ja, es war nicht schön, im Alter allein zu sein, besonders, wenn Körper und Geist gebrechlich wurden und man auf die Hilfe anderer angewiesen war. Auch Theodora stand allein auf dieser Welt, und sie dankte täglich ihrem Schöpfer, dass sie noch gesund und munter war. Natürlich zwickte es hier und da. Besonders morgens brauchte sie immer länger, um ihre steifen Gliedmaßen zu lockern und aufzustehen. Wer rastet, der rostet jedoch, und so scheute Theodora keine Arbeit, von der es in der Pension mehr als genug gab. An zwei Nachmittagen in der Woche erhielt sie von einer Schülerin aus dem Dorf Unterstützung bei den groben Arbeiten, aber es gab jeden Tag noch genug anderes zu tun. Manchmal ging es zwar etwas langsamer voran, aber Theodora hatte Zeit, warum sollte sie sich beeilen? Ihre Gäste zeigten in der Regel Verständnis, denn wer nach Guernsey kam, um seinen Urlaub auf dieser zauberhaften Insel zu verbringen, wollte die Hektik des Alltags hinter sich lassen. Entschleunigung lautete das Modewort, und Theodora bedauerte, dass es einen solchen Ausdruck überhaupt geben musste. In einer Welt, in der alles immer größer, immer schneller und immer perfekter wurde, waren das Liliencottage und ihre Insel wie ein ruhiger Hafen, in dem nie etwas Aufregendes geschah und sich Veränderungen, die die Zeit mit sich brachte, kaum merklich vollzogen.
Der Frühling bescherte Guernsey milde Temperaturen und viel Sonne. Geschützt in der Bucht vor der Küste Frankreichs und vom Golfstrom verwöhnt, herrschte das ganze Jahr über ein fast gleichbleibendes Klima. Im Winter waren Schnee, Eis und Frost selten, Palmen, Bananenstauden, Agaven – Pflanzen, die man eher im Mittelmeerraum vermutete – gediehen ebenso wie Orchideen und Lavendel in üppiger Pracht, allen voran die Guernsey-Lilie.
An diesem sonnigen Vormittag trat Theodora aus dem Haus und schaute in den strahlend blauen und wolkenlosen Himmel. Lediglich die regelmäßig startenden und landenden Flugzeuge störten die Harmonie. Der Flughafen befand sich nur wenige Meilen in nordwestlicher Richtung von St Martin, und auf einer Insel mit nicht einmal fünfzig Quadratmeilen Grundfläche lag eigentlich jeder Ort in der Nähe des Flughafens. Theodora wollte nicht klagen, denn die Flugzeuge brachten – ebenso wie die Fähren von der englischen Südküste oder aus Saint-Malo im nahen Frankreich – die Touristen nach Guernsey und sicherten damit auch ihren Lebensunterhalt.
Das Paar mittleren Alters, das seit einer Woche ein Zimmer im Liliencottage gemietet hatte, trat aus dem Haus und zu Theodora. Sie trugen wadenlange Hosen, leichte T-Shirts und Trekkingschuhe, die Frau hatte ein Sweatshirt um die Hüften gebunden.
»Glauben Sie, wir können heute auf Regenkleidung verzichten?«, fragte die Frau. »Wir wollen von hier aus an der Küste entlang nach St Peter Port wandern und von dort mit dem Bus zurückfahren.«
»Es wird keinen Regen geben«, versicherte Theodora mit einem freundlichen Lächeln. »Auch die nächsten Tage wird es schön und warm bleiben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.«
Die Eheleute wünschten das Theodora ebenso und gingen beschwingt los. Sie zweifelten nicht an Theodoras Worten, denn die alte Frau war verlässlicher als jede noch so moderne Wettervorhersage via Satellit. Wenn Theodoras Narben schmerzten, als wäre sie gerade frisch operiert worden, regnete es in den nächsten achtundvierzig Stunden. Wenn Nebel zu erwarten war, dann saß der Schmerz in ihren Gelenken, und sie musste sich beim Gehen auf den Krückstock stützen. Heute fühlte sich Theodora jedoch ohne das kleinste Zipperlein rundherum wohl. In den vergangenen Jahrzehnten hatte sie gelernt, ihren Beeinträchtigungen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Jammern half ohnehin nichts, und viele Menschen waren sehr viel schlechter dran als sie.
Nach dem Ehepaar verließen auch die anderen Gäste in der nächsten Stunde das Cottage. Jeder wollte diesen sonnigen Tag auskosten, niemand würde vor dem Abend zurückkehren. Theodora hatte also genügend Zeit, um die Gästezimmer aufzuräumen, den Müll hinauszutragen, die Handtücher zu wechseln und die Bäder zu putzen. Ihre Gäste waren aber allesamt reinlich, und die Arbeit würde nicht viel Mühe bereiten.
Theodora wollte gerade ins Haus gehen, um mit dem ersten Zimmer zu beginnen, als ein Taxi vorn an der Straße hielt. Das Liliencottage lag ein Stück zurückgesetzt und war von einer hohen Mauer mit einer breiten Einfahrt umgeben. Eine Frau stieg aus dem Taxi, der Fahrer hievte zwei Trolleys und ein Beautycase aus dem Kofferraum und stellte das Gepäck an den Straßenrand.
Ein neuer Gast?, fragte sich Theodora und runzelte nachdenklich die Stirn, denn ihre Gästezimmer waren bis Ende der nächsten Woche belegt. Hoffentlich hatte sie keinen Fehler bei einer Buchung gemacht oder gar vergessen, eine Reservierung einzutragen. Auch wenn Theodoras Gedächtnis fitter als ihr Körper war, verschmähte sie das Internet. Anfragen und Buchungen nahm sie telefonisch oder mit der guten alten Post an. Das Liliencottage war auch beim Touristenbüro in der Stadt gelistet, von dort erhielt sie ebenfalls Anfragen. Theodora seufzte, als das Taxi wieder abfuhr. Wahrscheinlich war die Frau auf gut Glück hierhergekommen, und sie würde ihr sagen müssen, dass sie leider kein freies Zimmer hatte. Die Frau würde sich ein neues Taxi rufen müssen. Allerdings würde es schwierig werden, eine Unterkunft zu finden, jetzt in den Osterferien herrschte Hochsaison, nahezu jedes Bett war belegt.
Die Frau sah unschlüssig auf ihre Koffer. Theodora bemerkte, wie schmal sie war, groß gewachsen, aber ausgesprochen mager. Meine Güte, ein stärkerer Wind haut die ja von den Füßen, dachte sie. Ihr dunkles Haar war zu einem Zopf geflochten, der ihr bis auf die Mitte des Rückens fiel. Obwohl es warm war, trug die Frau eine dunkelblaue Steppjacke, zusätzlich hatte sie ein gemustertes Tuch um den Hals geschlungen. Nun kam sie langsam auf Theodora zu, das Gepäck ließ sie einfach am Straßenrand stehen.
»Es tut mir leid, aber ich …«, begann Theodora, dann weiteten sich ihre Augen ungläubig, und sie rief: »Sharon? Mein Gott, Sharon! Du bist es wirklich!«
»Theodora!« Sharon rannte ihr entgegen und sank in die ausgebreiteten Arme. »Ich bin so froh, dass du noch lebst«, murmelte sie, das Gesicht an Theodoras Schulter gepresst.
»Mir geht es gut«, antwortete Theodora leise und dachte: Ja, es wäre durchaus möglich gewesen, dass ich nicht mehr am Leben bin, das wäre in meinem Alter völlig normal, und du hättest es nicht erfahren. Jetzt und hier war aber kein guter Zeitpunkt, Sharon zu fragen, warum sie so lange nichts von sich hatte hören lassen, oder der jungen Frau gar Vorwürfe zu machen. Mit einem Blick hatte Theodora erkannt, dass es Sharon nicht gut ging. Nicht nur, dass sie sehr mager war, unter ihren Augen lagen dunkle Schatten, und ihr Teint war unnatürlich blass.
»Kann ich hierbleiben?«, flüsterte Sharon. Der flehende Blick schnitt Theodora ins Herz.
»Das Cottage ist voll belegt«, murmelte sie.
Sharon lächelte bitter und zuckte die Schultern.