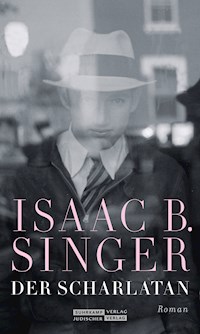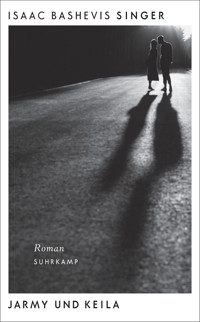13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wenn Gott eine koschere Welt haben will, dann muss Er sie selber erschaffen.« – Eine Mutter überlegt, wie sie ihrer Tochter den Verlobten ausreden kann ... Ein Mann, der einem anderen dessen geliebte Frau ausgespannt hat, schlägt nun vor, mit ebendieser bei ihm einzuziehen – samt seiner eigenen Exfrau. Eine vertrackte Vierecksgeschichte nimmt ihren Lauf ...
In diesen und zwanzig weiteren tragikomischen wie federleichten Geschichten von der Liebe erzählt Isaac Bashevis Singer auf rasant hinreißende Weise von diesem schönsten aller Gefühle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe, die dieser Übersetzung zugrunde liegt, erschien erstmals 1985 unter dem Titel The Image and Other Stories bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Isaac Bashevis Singer
Ein Tag des Glücks
und andere Geschichten von der Liebe
Aus dem Amerikanischen von Ellen Otten
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Informationen zum Buch
Titel
Inhalt
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Sperrvermerk
Titel
Inhalt
Der Ratgeber
Ein Tag des Glücks
1
2
3
4
Das geheime Band
Das Interview
Die Scheidung
Stark wie der Tod ist die Liebe
Wozu wurde Heuschreck geboren?
Der Feind
1
2
Überreste
Auf dem Weg ins Armenhaus
Loschikel
Die Tasche erinnerte sich
1
2
Das Geheimnis
Ein Notgroschen für das Paradies
Die Konferenz
Wunder
Die Prozessparteien
Ein Telefonanruf am Jom Kippur
Fremde
Der Fehler
Verwirrt
1
2
3
4
5
6
7
Das Phantom
Nachwort
Glossar
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Der Ratgeber
In den Jahren, in denen ich als Ratgeber an einer jiddischen Zeitung in New York arbeitete, hörte ich viele phantastische Geschichten. Die Ratsuchenden waren in der Regel Leser, nicht Schriftsteller. Aber einmal war der Ratsuchende ein Dichter, der von Beruf Buchhalter war, den ich oft bei den Versammlungen des Vereins jiddischer Schriftsteller wie auch in der literarischen Cafeteria am East Broadway getroffen hatte. Er hieß Morris Pintschower – ein kleiner Mann mit gelblichen Haarbüscheln um die Glatze. Er hatte eingefallene Backen, ein spitzes Kinn, eine kurze Nase und bernsteinfarbene Augen. Morris Pintschower kleidete sich wie ein altmodischer Künstler aus Europa. Er trug einen breitrandigen Hut, einen flatternden Schlips und selbst im Sommer Gamaschen über seinen Schuhen. Pelerinen – lange Umhänge für Männer – waren schon viele Jahre aus der Mode gekommen, aber Morris Pintschower trug immer eine, wenn er zu unseren literarischen Versammlungen kam. Er hatte sie zu Anfang des Jahrhunderts aus Warschau mitgebracht. Als er mein Büro betrat, sagte er zu mir: »Sie sind erstaunt, was? Ich bin auch einer Ihrer Leser, und ich habe das Recht, Ihren Rat zu erbitten wie alle anderen. Oder nicht?«
»Setzen Sie sich. Was kann ich Ihnen sagen, das Sie nicht selbst wissen?«
»Ach, es ist nützlich, Dinge zu besprechen. Was ist schließlich die Psychoanalyse? Und warum sind Katholiken so begierig zu beichten? Und was ist die Literatur? Eine Anzahl großer Schriftsteller nannte ihre Werke Bekenntnisse: Rousseau, Tolstoi, Gorki. Ich liebe Strindbergs ›Beichte eines Toren‹. Es gibt in allen Bekenntnissen einen törichten Zug, meine ich. Sie haben gehört, was mir zugestoßen ist, nehme ich an.«
Morris Pintschower lächelte traurig und entblößte zwei Reihen gelblicher Zähne. Ich wußte von seinem Fall durch den Klatsch im Café Royal. Seine Frau, Tamara, eine Dichterin, die nie einen Verleger gefunden hatte, hatte Morris verlassen und lebte mit einem Mann namens Mark Lenschner zusammen, einem bekannten Schriftsteller und Kommunisten, dessen Frau drei Selbstmordversuche gemacht hatte, weil er sie dauernd betrogen hatte. Mark Lenschner war als Schnorrer und Zyniker bekannt. Tamara war klein, fett, mit einem hohen Busen. Ihr Haar war in Locken gedreht und karottenfarben getönt. Auf ihrer Oberlippe wuchs ein flaumiger weiblicher Bart. Sie erzählte kleine Anekdoten, über die niemand außer ihr lachte. Seit Jahren führte sie Krieg gegen die Redakteure jiddischer Zeitungen und Zeitschriften und verfluchte sie hinter ihrem Rücken mit den gemeinsten Worten. Was Mark Lenschner an ihr fand, konnte niemand verstehen. Einige Besucher der literarischen Cafeteria behaupteten, was er an ihr finde, sei der Notgroschen von ein paar tausend Dollar, die sie gespart hatte durch den Verkauf ihrer privat veröffentlichten Gedichte, die sie im Café Royal und in den Hotels in den Catskills feilgeboten hatte. Das Paar hatte keine Kinder. Ich hörte mich zu Morris sagen: »Ja, ich habe etwas über die Sache gehört.«
»Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, daß Tamara jetzt ganz offen, vor aller Welt, mit Lenschner zusammenlebt«, sagte Morris.
»Ja, auch das habe ich gehört.«
»Es ist so weit gekommen, daß Humoristen Witze über mich in den Zeitungen veröffentlichen.«
»Idioten. Ich lese die Witzseite nie.«
»Mein lieber Freund, ich weiß sehr gut, was die Leute in einem wie mir sehen – einen Schlemihl, einen Hahnrei, einen Mann, dem man Hörner aufgesetzt hat. Sie wissen so gut wie ich: Wenn jemand eine Ungerechtigkeit begangen hat, dann lassen die Leute statt an dem Schuldigen an dem Opfer kein gutes Haar mehr. Es ist nicht das erstemal, daß Tamara mich gegen irgendeinen Scharlatan ausgewechselt hat. Ich habe gelitten und geschwiegen, nicht weil ich glaube, daß man auch noch die andere Wange hinhalten soll, sondern weil ich das Unglück habe, sie zu lieben. Die Liebe ist eine Krankheit – etwas Pathologisches, das nicht zu erklären ist. Wenn ein Mensch einen Tumor hat, so ist er nicht nur damit geschlagen – er muß ihn auch noch nähren. Jedenfalls ist es so, daß ich weder essen noch schlafen kann, seitdem Tamara mich verlassen hat. Ich mache schwere Fehler in meiner Arbeit, und ich fürchte, meine wenigen Klienten auch noch zu verlieren. Seit dieses Durcheinander begann, habe ich nicht eine einzige Zeile schreiben können. Was ich Ihnen sagen möchte, wird Sie vielleicht abstoßen, aber ich hoffe, daß Sie mehr Verständnis für menschliche Schwächen haben als die Kiebitze im Café Royal. Seit sie mich verlassen hat, brennt meine Liebe zu dieser verräterischen Frau mit einem Feuer, von dem ich fürchte, es könnte mich physisch verzehren. Ich habe ein gewisses Interesse für das Übersinnliche. Es sind Fälle bekannt, in denen Menschen sich spontan entzündet haben und verbrannt sind. Natürlich spotten Rationalisten über solche Ereignisse, weil sie nicht in ihre Klischees passen. Wenn Gefühle das Blut ins Gesicht treiben können, Verstopfung, Diarrhöe, Ekzeme und hohen Blutdruck erzeugen können, warum sollten sie dann nicht auch ein Feuer verursachen? Habe ich recht oder nicht?«
»Ich bin bereit, allem zuzustimmen«, sagte ich. »Aber womit kann ich Ihnen helfen?«
»Mein Freund, ich komme nicht zu Ihnen, um mich zu beschweren, sondern um Ihren Rat zu erbitten«, sagte Morris Pintschower. »Wenn Sie hören, was ich Sie fragen möchte, dann werden Sie davon überzeugt sein, daß ich den Verstand vollkommen verloren habe. Aber auch Geisteskrankheit ist menschlich. Die Geschichte geht folgendermaßen. Dieser Mark Lenschner, dieser Auswurf von einem Menschen, und seine Frau Nescha – eine Heilige von einer Frau – hatten eine Wohnung, für die er nie Miete zahlte, außer vielleicht für den Monat, in dem sie eingezogen waren. Fragen Sie mich nicht, wie er das anstellte. Der Besitzer des Hauses war so etwas wie ein Jiddischist und noch dazu ein Linker. Er spielte die Rolle eines Menschenfreundes und Mäzens. Es war ein elende Wohnung. Die Decke war undicht, und wenn es regnete, mußte Nescha Eimer und Schüsseln auf den Boden stellen. Aber was kümmerte das Lenschner. Er war selten da – zog immer mit irgendwelchen Flittchen herum. Solange der Hausbesitzer lebte, blieb es so. Als er gestorben war, prozessierten die Erben gegen Lenschner und verlangten die Miete, und jetzt sind sie dabei, ihn mitsamt seinem Gerümpel hinauszuwerfen. So bösartig er auch ist, er kann Nescha nicht einfach auf die Straße setzen lassen. Außerdem hat er noch seine Bücher und Manuskripte dort. Vor einigen Tagen bekam ich einen Anruf von Tamara. Ich war ganz erschlagen. Sie hat mich nie angerufen, seitdem sie mich verlassen hat. Ich will es kurz machen. Mark Lenschner, dieser Schuft, hat ihr vorgeschlagen, daß er, Lenschner, und Nescha und Tamara zu mir ziehen sollten. Ich habe eine große Wohnung, und er kam auf die Idee, daß wir vier alle zusammenleben sollten. Er möchte, daß wir uns versöhnen, hat er gesagt. Er würde auch gern endlich seine Memoiren oder weiß Gott was noch schreiben. Ich flehe Sie an, sehen Sie mich nicht so ironisch an. Ich weiß genau, daß Lenschner nicht zu trauen ist. Erst hat er mir meine Frau weggenommen, und jetzt versucht er, mir meine billige Wohnung wegzunehmen – ein gutes Geschäft. Andererseits, was habe ich zu verlieren? Da ich ohne Tamara nicht leben kann, kann ich so wenigstens mit ihr unter einem Dach wohnen. Wenn ein Mann unter dem Galgen steht mit der Schlinge um seinen Hals und man ihm die gute Botschaft bringt, daß die Hinrichtung verschoben sei, dann stellt er keine Fragen und auch keine Bedingungen. Nescha ist eine bescheidene Frau, sanft wie eine Taube. Sie wird tun, was er ihr sagt. Was ist Ihre Meinung?«
Eines von Morris' Augen schien zu weinen, das andere lachte.
Ich fragte: »Warum wollen Sie meine Meinung wissen? Sie werden meinem Rat doch nicht folgen.«
»Möglich. Trotzdem möchte ich ihn hören.«
»Meine Ansicht ist die: Eine Liebe dieser Art ist die schlimmste Form der Sklaverei. Ich glaube immer noch, daß der Mensch die freie Wahl hat.«
»Was? Ich wußte, Sie würden etwas Derartiges sagen. Wie auch immer, vielleicht hatte Spinoza recht, daß alles vorbestimmt ist. Vielleicht ist vor Billionen von Jahren die Entscheidung gefallen, daß Tamara, Nescha und Mark Lenschner und ich zusammenleben sollen, ganz gleich wie unsinnig und pervers die Sache anderen erscheinen mag. Vielleicht ist die freie Entscheidung genau das, was Spinoza darin sah, eine Illusion.«
»Wenn die freie Entscheidung eine Illusion ist und alles vorbestimmt ist, warum hat er dann eine ›Ethik‹ geschrieben?« fragte ich. »Was hat es für einen Sinn, die amor dei intellectualis, politische Freiheit und alles andere zu predigen, wenn wir nichts als Mechanismen sind? Dieser Spinoza war so voller Widersprüche, wie der Granatapfel Kerne hat.«
»Und was war Kant?« fragte Pintschower. »Und was Hegel? Und alle die anderen Philosophen? Sie haben recht. Da ich wußte, daß ich nicht auf Sie hören würde, hätte ich nicht Ihren Rat suchen sollen. Aber ein Mann in meinem Geisteszustand kann nicht der Logik entsprechend leben. Sie wissen bestimmt, daß Sehnsucht eine unerträgliche Qual ist. Es ist durchaus möglich, daß die Hölle aus Sehnsucht besteht. Die Bösen werden nicht auf einem Nagelbrett geröstet, sie sitzen auf bequemen Stühlen und werden mit Sehnsucht gefoltert.«
»Nach wem sollen sie sich denn sehnen?«
»Nach denen, die sie auf der Erde zurückgelassen haben – jeder nach seiner Tamara oder seinem Lenschner. Lassen Sie es sich gutgehen, und verzeihen Sie mir.« Morris Pintschower streckte mir eine weiche und feuchte Hand entgegen. Er lächelte, zwinkerte und sagte: »Ich danke Ihnen für Ihren Rat. Adieu.«
Ein Jahr ungefähr war vergangen, und ich hatte gehört, daß Mark Lenschner eine Einladung in die Sowjetunion erhalten hatte, dorthin gereist war und Nescha zurückgelassen hatte. Stalin war noch am Leben, aber in Interviews behauptete er jetzt, daß Kommunismus und Kapitalismus nebeneinander bestehen könnten. Man wußte schon, daß er die meisten der jiddischen Schriftsteller in Rußland liquidiert hatte, obwohl die kommunistische jiddische Zeitung in New York ihren Lesern versicherte, daß all diese Anklagen von den Feinden des Volkes, den Lakaien des Faschismus verbreitet würden. Die jiddischsprechenden Kommunisten sammelten noch immer Beiträge für die nicht existierende autonome jüdische Region in Birobidschan. Man hatte mir erzählt, daß die Schriftsteller in Moskau Lenschner einen großen Empfang bereitet hatten und daß er von dort nach Birobidschan weitergeflogen war. Das geschah während der Zeit, als die jüdischen Ärzte in der Sowjetunion angeklagt worden waren, mehrere russische Führer vergiftet zu haben. Ich war von New York weggezogen und hatte Morris Pintschower fast vergessen. Ich hatte in Israel, in Frankreich und in der Schweiz gelebt. Jemand in Tel Aviv oder in Paris hatte mir erzählt, daß Morris Pintschower gestorben sei, oder hatte vielleicht einen ähnlichen Namen erwähnt. Als ich nach einigen Jahren nach New York zurückkehrte, ging ich nicht mehr in das Büro meiner Zeitung am East Broadway, sondern schickte meine Manuskripte mit der Post. Ich hatte aufgehört, zu den Versammlungen der Jiddischisten und ihren Vorträgen zu gehen. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von der Sekretärin des Redakteurs. Der Setzer hatte eine Seite von einem meiner Artikel verloren, und ich mußte zum East Broadway fahren und die fehlende Seite ersetzen. Um dorthin zu gelangen, mußte ich drei Busse benutzen. Der dritte fuhr vom Union Square zum East Broadway.
Ich fuhr durch eine Gegend, in der sich die Bevölkerung verändert hatte – Puertoricaner und Neger lebten jetzt dort statt der eingewanderten Juden. Alte Häuser waren abgerissen worden. Neue waren im Bau. Hier und da konnte man noch die Wände der früheren Wohnungen sehen, mit verblichenen Tapeten oder abblätternder Farbe. An einer dieser Wände hing ein Bild von Sir Moses Montefiore. Die Kugel der Abbrucharbeiter schien die Wände durch leichte Berührung niederzureißen. Krane hoben Balken für die Neubauten. An einer der Ruinen hatten sich vier Katzen versammelt und hielten stumme Beratung ab. Ich hatte das Gefühl, unter den Trümmern seien Dämonen beerdigt – Kobolde und Teufelchen, die sich in der Zeit der großen Einwanderung nach Amerika hineingeschmuggelt hatten und durch den Lärm von New York und an dem Mangel an Jüdischkeit eingegangen waren.
Nachdem ich mein Manuskript in der Setzerei ergänzt hatte, entschloß ich mich, nicht mit dem Bus zurückzufahren, sondern zum Union Square zu laufen und von dort die Untergrundbahn nach Hause zu nehmen. Ich ging die Second Avenue entlang. Die literarischen Cafeterias gab es noch, aber das Café Royal, das lange Zeit ein Treffpunkt für Schriftsteller und Schauspieler gewesen war, hatte geschlossen, und an seiner Stelle war jetzt eine chemische Reinigung etabliert. Ich blieb vor einem Schaufenster stehen, das einige längst vergessene jiddische Bücher mit verblichenen Einbänden zeigte sowie Schallplatten alter jiddischer Lieder. Nach einiger Zeit ging ich weiter die Avenue entlang. Und wer kam mir entgegen? Morris Pintschower – klein, gebeugt, eingeschrumpft und schäbig gekleidet. Das wenige Haar, das noch auf seinem Schädel wuchs, war weiß geworden. Eine Spur von Gelb war noch in den Brauen sichtbar. Er schlurfte beim Gehen und stützte sich auf einen Stock. So viele meiner Kollegen waren in Amerika gestorben oder in Europa umgekommen, daß ich nicht wußte, wer am Leben und wer gestorben war. Er streckte mir eine knöcherne Hand entgegen und sagte: »Ich hoffe, Sie erkennen mich.«
»Ja.«
»Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen. Obwohl wir in derselben Stadt wohnen, haben wir uns entfremdet. Um die Wahrheit zu sagen, New York ist keine Stadt, sondern ein ganzes Land. Trotzdem, ich war mit Ihnen in Kontakt – geistig, meine ich. Ich lese Sie. Schließlich, was ist denn ein Schriftsteller? Nur seine Werke. Ich habe zwei Gedichtbände veröffentlicht – privat, natürlich. Ich bezweifle, daß Sie sie zu sehen bekommen haben.«
»Wenn Sie sie mir schicken, so werde ich sie lesen. Es gibt ja kaum noch jiddische Buchhandlungen.«
»Ja, wir sind in Schwierigkeiten, aber der schöpferische Instinkt bleibt bis zum letzten Atemzug erhalten. Ich hätte Ihnen meine Arbeit geschickt, aber ich hatte Ihre Adresse nicht. Wenn ich Bücher an Ihre Zeitung schicke, so verschwinden sie. Es scheint, daß es immer noch Leute gibt, die scharf darauf sind, ein jiddisches Buch zu stehlen. Das allein ist ein Wunder.«
»Ja, das ist wahr«, murmelte ich.
»Ich glaube, Sie erinnern sich nicht an meinen Namen. Ich bin Morris Pintschower.«
»Ich erinnere mich sehr gut an Sie. Ich habe oft über Sie nachgedacht«, sagte ich.
»Wirklich? Das ist gut zu wissen.«
Ich wollte ihn nach seiner Frau fragen, aber ich hatte ihren Namen vergessen. Außerdem hatte ich zu oft die gleiche Auskunft bekommen – »gestorben«. Als ob Morris Pintschower meine Gedanken gelesen hätte, sagte er: »Tamara ist nicht mehr am Leben. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Sie bekam Krebs und verließ mich. In der alten Heimat gab es etwas wie galoppierende Schwindsucht. Man könnte sagen, Tamara ist an galoppierender Krebskrankheit gestorben. Eines Tages wurde sie krank, und nach ein paar Wochen war alles vorbei. Sie verließ dieses Tal der Tränen wie eine Heilige. Vielleicht war es gar nicht Krebs. Wenn die Ärzte keine Diagnose stellen können, dann nennen sie es Krebs. Gott schickt mehr Krankheiten auf die Welt, als die Mediziner benennen können. Erst gestern las ich, daß Millionen von Viren in einem Kubikzentimeter Gewebe leben können. Und trotzdem bestehen sie aus vielen Molekülen. Der Mikrokosmos ist noch viel phantastischer als der Makrokosmos. Inmitten all dieser Wunder kommt der Engel des Todes und löscht alles aus. Darf ich fragen, wohin Sie gehen?«
»Union Square«, antwortete ich.
»Gehen Sie zu Fuß?«
»Ja, ich gehe zu Fuß.«
»Darf ich Sie begleiten?«
»Ja, mit Vergnügen.«
Wir gingen, und Morris hielt alle paar Schritte inne. Ich wollte ihn nach Lenschners Frau fragen, aber ich wußte, daß er es mir früher oder später erzählen würde. Er sprach zu mir und zu sich selbst: »Eine ganze Welt ist verschwunden, was? Als ich ein Junge war, hatte die jiddischistische Bewegung erst begonnen. Unsere Klassiker waren alle noch am Leben – Mendele, Scholem Alejchem, Perez. Ich erinnere mich recht gut an die Konferenz in Czernowitz. Was für ein Optimismus! Es war wie ein neuer Frühling. Als ich nach Amerika kam, gab es nicht ein jiddisches Theater, sondern zwanzig. Diese Gegend hier kochte wie ein Kessel mit Ideen und Idealen. Jetzt ist alles verändert, alles ist anders – die Menschen, die Häuser, Geschäfte und der Stil. Vor einiger Zeit lag ich in der Nacht wach, und mir fiel ein: Wenn es einen Gott gibt und er ewig existiert, was kann er alles in dieser Zeit erlebt haben? Was würde geschehen, wenn er sich entschließen würde, seine Memoiren zu schreiben? Wo würde er beginnen? Würde er eine Billion Jahre zurückgehen? Zehn Billionen? Hundert Billionen? Es ist gespenstisch, über solche Dinge nachzudenken – besonders in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann. Ja, und wer würde sein Verleger sein? Er würde sein eigener Verleger sein müssen, genauso wie ich.«
Morris Pintschower lachte und entblößte zwei Reihen neuer falscher Zähne. Er sagte: »Vielleicht würden Sie gern die Avenue B. entlanggehen. Dort wohne ich.«
»Allein?«
»Nein, mit Nescha, Lenschners Witwe.«
»Aha.«
»Sie haben wahrscheinlich gehört, daß Lenschner ohne sie nach Rußland gegangen ist. Er versprach, sie in Stalins Paradies nachkommen zu lassen, aber was bedeutet einem Mann wie Lenschner ein Versprechen? Sie bekam eine Postkarte von ihm – nicht aus Birobidschan, sondern aus Moskau. Die Einladung war nur eine Falle gewesen, um ihn loszuwerden. Was sie gegen ihn hatten, weiß ich nicht. Er diente ihnen treulich. Er verteidigte all ihre Missetaten. Bis zum letzten Tag versicherte er allen in New York, daß die jiddischen Schriftsteller in Rußland eitel Freude erlebten – Bergelson, Markisch, Fefer, Charik, Kulbak. Er beschimpfte uns alle hier in Amerika, weil wir den großen Wohltäter, den Genossen Stalin, verdächtigten. Lenschner wußte wohl, daß er log, aber er hoffte, diese schamlosen Lügen würden seine Haut retten, falls die Genossen in Rußland ihn der Abweichung anklagen sollten. Wer weiß, was in den Gehirnen solcher Schufte vor sich geht? Da er wußte, was ihn dort erwartete, was mußte er dorthin gehen? Im griechischen Drama gibt es das: Der Held weiß, daß er in den Abgrund stürzen wird, aber das Schicksal zwingt ihn dazu, den Tod zu wählen, da er sich nicht helfen kann. Vielleicht erinnern Sie sich daran, daß ich einmal zu Ihnen gekommen bin, um Sie um Ihren Rat zu bitten. Ja, Tamara und Lenschner und Nescha zogen zu mir in meine Wohnung, und ein paar Wochen lang glaubte ich, glücklich zu sein. Ja, Sklaverei. Unsere Gefühle regieren uns. Sie fallen uns an wie Räuber und spotten all unseren Entschlüssen. Meine Nachbarn machten sich über mich lustig und klatschten über mich. War ich wirklich glücklich? Wir stürzen uns in das tiefste Leid und nennen es Vergnügen. Als Lenschner fortging, wurde ich sozusagen der König. Tamara kam, endlich ernüchtert, aus ihrer Verrücktheit zu sich. Wie lange kann man betrunken sein? Ich verzieh ihr. Hatte ich denn eine Wahl? Nichts ist so heftig wie die Heftigkeit der Liebe. Meine Theorie ist, daß der Mensch eine heimliche Liebschaft mit dem Engel des Todes unterhält.«
Wir blieben vor einem heruntergekommenen Haus stehen, und Morris sagte: »Hier wohne ich. In diesem Haus, im dritten Stock. Wir haben keinen Lift. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, die Treppen hinaufzusteigen. Jetzt, wo Tamara in der wahren Welt ist, ist Nescha mir alles geworden – Frau und Schwester und Mutter. Natürlich ist alles zwischen uns platonisch. Sie ist eine getreue Leserin von Ihnen.«
Wir betraten einen dunklen Eingang und stiegen die Treppen hinauf; auf jedem Absatz hielt Morris an und keuchte. Er deutete auf die linke Seite seiner Brust. »Die Pumpe will nicht mehr so recht funktionieren«, sagte er. »Sie hat das nun achtzig Jahre lang getan. Wie lange kann sie das noch? Genug ist genug.«
Im dritten Stock läutete Morris an seiner Wohnung, aber niemand kam. Er sagte: »Entweder ist sie nicht zu Hause oder sie hört nicht. Warten Sie. Ich habe einen Schlüssel.«
Wir betraten einen engen Korridor. Morris öffnete die Tür zum Wohnzimmer. Es roch nach Staub, Medizin und etwas Ranzigem. Über einem zerrissenen Sofa, dessen Sprungfedern herausstachen, hing ein Porträt von Lenschner – jung, mit lockigem Haar, einem schwarzen Schnurrbart und leuchtenden Augen, die mit der Arroganz und der Selbstzufriedenheit jener blickten, die ein für allemal die Wahrheit gefunden haben. Morris Pintschower bemerkte: »Das ist er. Was Tamara in diesem Schwindler gesehen hat, werde ich nie verstehen. Aber sie hat ihn bis zu ihrem letzten Atemzug verteidigt. Was Nescha angeht, sie war eine echte Märtyrerin. Aber wo ist sie nun schon wieder hingelaufen? Wir sind nur zwei alte Leute, und sie kauft Lebensmittel ein, als ob wir zehn wären. Dreiviertel von allem wird fortgeworfen. Sie hat eine Art Kaufwahn. Wieviel können wir schon essen? Ein Stück Toast und ein Glas Tee genügt uns für den ganzen Tag. Dank Gott und der Sozialversicherung haben wir mehr als genug von allem. Setzen Sie sich. Was kann ich Ihnen anbieten?«
»Absolut nichts«, sagte ich.
»Nichts? Ein Mensch muß doch irgend etwas wollen.«
Lange Zeit saßen wir schweigend. Dann sagte Morris Pintschower: »Sie hatten recht damals. Ich hätte sie niemals aufnehmen sollen. Aber was würde ich jetzt ohne Nescha machen? Sie ist die einzige, die Tamara wirklich gekannt hat und Zeugin unserer großen Liebe war.«
Ein Tag des Glücks
1
In allen drei Zimmern, nur nicht in der Küche, waren die Rouleaus heruntergezogen. Denn Mendel Bialer liebte die Sonne nicht. Jetzt, da er älter war, verbrachte er die meiste Zeit liegend. Was hatte er denn zu tun? Er bekam schon seine Pension. Und außerdem schmerzten ihn die Füße. Nachts warf er sich schlaflos im Bett herum, aber den ganzen Tag über döste er. Die Sommersonne war so glühend heiß, daß sie sogar durch die Rouleaus drang. Auf seiner Stirn landete eine Fliege. Er wischte sie fort, aber sie setzte sich gleich wieder auf seine rötliche Nase. Obwohl er halb schlief, machte er sich Sorgen. Die Pension, die er nach fünfunddreißig Jahren als Buchhalter in der Mühle bezog, war zu klein, um davon leben zu können. Er war die Miete schuldig. Außerdem hatte er ein unverheiratetes Mädchen im Haus, seine Tochter Feigele oder Fela, wie man sie in der Schule genannt hatte. Obwohl sie schon vierundzwanzig Jahre alt war, benahm sie sich noch wie ein Mädchen von sechzehn, las dumme Bücher und suchte sich keine Arbeit. Die Heiratsvermittler hatten versucht, einen Mann für sie zu finden, aber sie war wählerisch und benahm sich, als wäre sie die Tochter eines reichen Mannes und eine Schönheit dazu, während sie in Wirklichkeit keinen Groschen hatte und außerdem noch häßlich war. Mitten im Halbschlaf griff Mendel an seinen grauen Bart und runzelte die Stirn, als ob er fragen wollte: »Was soll werden? Worauf wartet sie?«
Mendels Frau Malka schälte in der Küche Kartoffeln. Das Wasser machte jedesmal ein Geräusch, wenn sie eine Kartoffel hineinwarf. Im Schlafzimmer schrieb Fela einen Brief. Am Morgen hatte sie ein goldgerändertes Blatt Papier gekauft, einen Umschlag und eine neue Stahlfeder mit einer feinen Spitze, die nicht klecksen würde. Seit Wochen hatte sie sich Tag und Nacht den Inhalt des Briefes ausgedacht. Sie wußte jeden Satz auswendig. So lautete der Brief:
»Hochverehrter und geliebter General,
von Gott inspirierter Dichter:
Was ich jetzt tue, ist verrückt oder noch etwas Schlimmeres, aber ich kann mir nicht helfen. Eine stärkere Macht als ich treibt mich dazu, Ihnen zu schreiben. Ich bin fast sicher, daß Sie mir nicht antworten werden. Ich bin nicht einmal sicher, daß Sie meinen Brief lesen werden, denn ich weiß, daß Eure Exzellenz hundert oder tausend solcher Briefe von verlorenen Seelen (haha!) empfängt. Ich möchte Ihnen gleich sagen, daß ich ein jüdisches Mädchen bin, arm und nicht schön (ich lege mein Bild bei). Aber ich liebe Sie mit brennender Liebe, die ich selbst nicht verstehe. Ich bin buchstäblich verzehrt von dieser tragischen – Sie werden sie vielleicht komisch nennen – Liebe. Ich denke die ganze Zeit an Sie, und nachts träume ich nur von Ihnen. Ich könnte Ihnen erzählen, wie dies alles begonnen hat, aber ich habe Angst, Sie ungeduldig zu machen. Ich schneide alle Bilder von Ihnen aus Zeitungen und Magazinen aus. Ich habe sogar Ihretwegen, mein Geliebter – gestohlen, indem ich im Café die Seiten eines Magazins herausriß. Sie sind mein ganzes Leben. Ich kann all Ihre herrlichen Gedichte auswendig. Ich lese immer wieder Ihre Bücher, besonders die über Ihre Tapferkeit an der Front. Ich lebe nur für Sie: um Ihre metallische Stimme am Radio zu hören; Sie während der Paraden zu beobachten.
Einmal, im Café Rzymianska, haben Sie mich angesehen. Das Glücksgefühl, das mir dieser Blick gab, die Inspiration, die mein ganzes Wesen durchdrang, kann keine Feder beschreiben – nur jemand mit Ihrem Talent könnte das tun. Mir ist klar, daß mein Brief schon zu lang ist und daß ich endlich zur Sache kommen muß. Ich weiß, Sie sind nicht nur ein Nationalheld und ein großer Dichter, Sie sind auch ein Mann, der ein Herz hat für die, die Ihre Talente bewundern. Ich bitte Sie daher demütig, mir eine halbe Stunde Ihrer Zeit zu gewähren. Wenn Sie mir das Privileg, einige Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen, bewilligen, so wäre das mein heimlicher Schatz, den ich bis zu meinem letzten Atemzug bewahren und hüten werde. Leider haben meine Eltern kein Telefon, so kann ich Ihnen nur meine Adresse geben. Ich bin gewöhnlich den ganzen Tag zu Hause. Während ich diesen Brief schreibe, bin ich mir bewußt, wie gering meine Chancen sind, wie närrisch ich bin und vielleicht auch egoistisch. Adieu, mein großer Held, Dichter und König meiner Seele.
Mit einer Liebe, die nie sterben wird,
Fela Bialer
P. S. Meine Eltern sind altmodisch und dürfen von der Verrücktheit ihrer Tochter nichts wissen.«
Als das letzte Wort geschrieben war, seufzte Fela. Die ganze Zeit, während der sie schrieb, hatte sie gezittert, einen Fleck auf das Papier zu machen. In der Schule hatte sie eine gute Handschrift gehabt, aber seitdem war sie schlechter geworden: Sie schrieb zu groß, die Linien waren krumm. Sie war in der Schule auch gut im Aufsatz und in der Orthographie gewesen, aber jetzt machte sie oft dumme Fehler. Das kam alles von ihren Nerven. Sie hatte nie ihren Schulabschluß gemacht, da sie an der Mathematik gescheitert war. Zuerst hatte sie nach einer Arbeit gesucht, möglichst in einem Büro, hatte aber keine gefunden. Schließlich hatte sie als Verkäuferin in einem Spielwarengeschäft angefangen, wurde aber schon am ersten Tag entlassen, da sie das Geld nicht richtig herausgegeben hatte. Ihre Mutter nörgelte dauernd an ihr herum, und ihr Vater nannte sie seine »verrückte Prinzessin«. Fela war klein und dunkel, mit breiten Hüften, krummen Beinen, einer Hakennase und großen, hervortretenden schwarzen Augen. In ihrem Tagebuch verglich sie sich selbst mit einer überreifen Frucht. Sie hatte einen Hängebusen, und ihre Arme waren fleischig und wabbelig. Andere Mädchen würden versucht haben, Gewicht zu verlieren, aber in Felas Elternhaus gab es zuviel stärkehaltiges Essen – Kartoffeln, Klöße und Kascha. Außerdem hatte sie ein unbezwingliches Verlangen nach Schokolade. Zudem war sie immer hungrig, als ob sie einen Bandwurm hätte. Wenn sie manchmal des Nachts wach lag, konnte sie ihren Körper anschwellen fühlen, als sei er Teig. Ihre Haut glühte, ihre Brüste strafften sich, als seien sie mit Milch gefüllt. Und obwohl Fela Jungfrau war, fürchtete sie manchmal, sie könne plötzlich gebären. Sie fühlte Flüssigkeiten durch ihren Körper zirkulieren, wie die Säfte einer Pflanze vor dem Aufblühen. Ihr Atem wurde heiß, in ihrem Inneren zog und drückte es sie, und in der Nacht mußte sie dauernd auf die Toilette. Kürzlich hatte sie angefangen, an starkem Durst zu leiden. Ihre Mutter rief oft aus: »Was ist mit diesem Mädchen los? In ihrem Inneren brennt ein Feuer, Gott bewahre!«
Felas Liebe zu Adam Pacholski hatte sie verwirrt. Sie sah alles um sich herum durch einen Nebel. Sie konnte nicht durch das Zimmer gehen, ohne über Stühle, den Tisch und die Kommode zu stolpern. Wenn ihre Mutter ihr ein Glas Tee reichte, so ließ sie es fallen. Sie konnte den Milchtopf nicht auf den Herd stellen, ohne ihn zu vergessen und die Milch anbrennen zu lassen. Keines ihrer Kleider paßte ihr mehr. Ihr Hüftgürtel schnitt in ihr Fleisch. Die Schuhe drückten. Und wie häufig sie auch ihr Haar wusch und kämmte, es sah immer klebrig und unordentlich aus. Ihre Periode war unregelmäßig, manchmal zu spät, manchmal zu früh, und von einer Stärke, die sie erschreckte. Diesen Brief ohne einen Klecks oder Fehler zu schreiben war eine Anstrengung gewesen, die fast ihre Kräfte überstieg. Gott sei Dank war es gutgegangen! Hier und da hatte sie sogar einen Schnörkel zustande gebracht.
Fela las den Brief durch, dann ein zweites und drittes Mal. Nach langem Zögern faltete sie ihn, schob ihn in den Umschlag, schrieb die Adresse, klebte eine Marke darauf und schloß ihn. Ihre Hände flatterten, ihre Knie zitterten. Sie hörte ihren raschen Atem. Im Wohnzimmer war ihr Vater eingeschlafen. Fela wollte das Zimmer unhörbar durchqueren, auf Zehenspitzen, aber die Tür hinter ihr quietschte und ihre Absätze lärmten widerspenstig auf dem Boden. Ihr Vater schreckte auf.
»Warum machst du solchen Lärm, du wildes Geschöpf?«
»Ach, Papa, entschuldige. Ich bin so ungeschickt. Ich habe es doch nicht absichtlich getan.«
»Warum lungerst du so faul herum? Andere Mädchen haben in deinem Alter schon Kinder.«
Tränen stiegen in Felas Augen auf. »Ist das meine Schuld?«
Ein Schluchzen verengte ihre Kehle, als ob sie erbrechen müßte. Sie bedeckte den Brief, damit ihre Tränen ihn nicht naß machten, und flüchtete ins Badezimmer. Dort konnte sie weinen, husten, sich beruhigen. Sie trocknete ihr Gesicht mit Zeitungspapier, das dort als Toilettenpapier hing. Sie zog an der Spülung und sagte laut: »Vater im Himmel, Du kennst die Wahrheit.«
2
Die Ereignisse folgten schnell aufeinander. Am Montag hatte Fela den Brief abgeschickt. Am Dienstag gegen Abend erhielt sie ein Telegramm. Gott sei Dank war niemand zu Hause. Sie wollte dem Boten zehn Groschen geben, fand aber kein Kleingeld und gab ihm statt dessen einen halben Zloty. Sie strich ein Zündholz an und las: »Warten Sie morgen um vier Uhr an der Ecke Marszalkowska-Boulevard und Wspolnastraße.« Fela konnte sich nicht fassen und lief ins Badezimmer. Dort zündete sie eine Kerze, die auf einem Wandbrett stand, an und las das Telegramm wieder und wieder. In der engen Wohnung war dies der einzige private Raum für sie. Sie wollte lachen; gleichzeitig war ihr, als müsse sie erbrechen. Sie hatte keine so schnelle Antwort erwartet. Sie war nicht bereit. Sie hatte kein Kleid, keine Schuhe. Ihr Haar war weder gewaschen noch gelockt. »Es ist ein Traum«, schrie eine Stimme in ihrem Kopf. »Du bist ein Idiot. Du wirst jeden Augenblick aufwachen.« Fela kniff ihre Backen und biß auf ihre Lippen. Sie hatte angefangen, heftig zu schwitzen, mit dem süßlichen Geruch wie dem eines Pferdes. Wie kann ich zu ihm gehen? dachte sie. Ich bin unrein. Oh, ich werde ohnmächtig!
Sie kämpfte gegen den Schwindel an. Ihr Kopf drehte sich, als sei sie betrunken. Eine widerliche Flüssigkeit erfüllte ihren Mund, und sie spie aus. Sie ging in die Küche. Sie beugte sich zu dem Wasserhahn und trank halb, halb wusch sie sich das Gesicht mit kaltem Wasser, um zu sich zu kommen. Sie erblickte auf einem Brett eine Flasche Essig, öffnete sie, roch daran und trank einen Schluck. »Laßt mich nicht mich vergiften vor zu großem Glück«, flehte Fela die höheren Mächte an.
Gewöhnlich waren ihre Eltern zu Hause, aber heute waren sie einen kranken Freund besuchen gegangen. Was sollte sie zuerst tun? Was konnte sie anziehen? All ihre Kleider waren zerrissen, fleckig, verschossen, zu eng und altmodisch. Die Stangen in ihrem Korsett waren zerbrochen. »Ich werde nicht hingehen. Ich kann nicht. Ich werde Schande über mich bringen«, sagte Fela laut. Sie brauchte jemanden, der ihr half, aber wen? Früher hatte sie Freundinnen gehabt, aber die Studentinnen waren jetzt an der Universität, oder sie hatten geheiratet. Nachdem sie durch das Schlußexamen gefallen war, hatten sie sich entfremdet. Einige der Mädchen hätten viele Cousinen in der Nähe gehabt, aber Felas Eltern hatten schon vor langer Zeit die Provinz verlassen. »Verlier nicht den Kopf«, sagte sich Fela. »Wenn du das tust, wirst du ganz kaputtgehen.«
Sie mußte ein Kleid kaufen. Bei Gebrüder Jablkowski konnte man fertige Kleider bekommen. Aber woher sollte sie das Geld nehmen? Und würde sie ein Kleid finden, das ihr paßte? Und wie sollte sie sich vor den Verkäuferinnen ausziehen, mit ihrem zerrissenen Unterrock und Büstenhalter? Man würde sie anspucken. »Ach, Träume eines abgehauenen Kopfes!« murmelte Fela. »Es ist unmöglich, ich bin verloren – verloren!« Ihr Leib fing an, sich auszudehnen, bis er hart wie eine Trommel war; sie hörte die Säume ihres Kittels platzen; sie bekam einen Schluckauf. »Gott im Himmel, steh mir bei«, betete Fela. »Du hast mir ein Wunder beschert, gib mir noch ein anderes!« Sie schwieg, als ob sie die Antwort Gottes erwartete. Plötzlich fiel ihr ein, daß sie vergessen hatte, die Kerze im Badezimmer auszulöschen. Ein Feuer könnte ausbrechen. Sie lief, die Kerze auszumachen. Als sie im Dunkeln in das Schlafzimmer ging, stieß sie an einen Stuhl und verletzte sich am Knie. Sie warf sich mit solcher Gewalt auf ihr Bett, daß irgend etwas unter ihr zerbrach, wahrscheinlich das Brett, das die Matratze stützte. Sie lag unbeweglich. Plötzlich sprang sie auf. Wo war das Telegramm? Sie hielt es umklammert in ihrer Faust.
Während sie dort lag, machte Fela sich einen Plan. Sie würde ein Verbrechen begehen müssen und die Goldkette stehlen, die ihre Mutter nur zu Rosch haschana und Jom Kippur trug. Sie würde nie herausbekommen, daß Fela sie versetzt hatte. Lange vorher würde sie die Kette ausgelöst haben. Fela stand auf, suchte nach Streichhölzern und zündete die Gaslampe an. Aus der Schublade im Kleiderschrank, einem schweren Möbelstück mit reich geschnitztem Oberteil und Löwenköpfen als Griffe, nahm sie das Holzkästchen heraus, in dem ihre Mutter den Schmuck verwahrte. Obenauf lag die Goldkette mit dem gleitenden Verschluß, ein Erbstück von ihrer Großmutter Jetta. Fela hob sie auf und war erstaunt über das Gewicht. Ich werde nicht einen Groschen weniger als zweihundert Zloty dafür nehmen, beschloß sie.
Die Nacht war ein einziger langer Alptraum. Fela schlief unruhig, wurde wach und schlief wieder ein. Einmal war ihr heiß, dann wieder kalt. In einem Bein zuckte es, eine Hand verkrampfte sich. Ihre Kehle brannte, und sie ging ein Glas Wasser holen; wieder im Bett, mußte sie sogleich auf die Toilette. Ehe sie erneut die Augen schloß, wurde sie von Träumen überschwemmt. Sie erhielt nicht ein Telegramm, sondern einen ganzen Haufen, jedes mit einer anderen Adresse, einem anderen Datum, einige waren mit Adam unterzeichnet, andere mit Pacholski, wieder andere einfach mit General, andere mit Dichter. Was war das für ein Spiel? Wollte er sie verwirren? Hatte es etwas mit militärischen Geheimnissen zu tun? Fela zitterte und wachte auf. Sie suchte unter ihrem Kopfkissen nach der Kette, aber sie war verschwunden. War ein Dieb eingedrungen? Hatte ihre Mutter sie vermißt? Im Traum suchte Fela weiter. Sie wurde gefangen, verhaftet, mit Handschellen in ein Verlies geworfen. Eine alte Frau brachte ihr einen Krug mit Wasser und ein Stück schwarzes Brot, aber als Fela zu trinken versuchte, brannte die Flüssigkeit wie Gift.
Um neun Uhr am nächsten Morgen erwachte Fela. Unten im Hof verkauften die Händler bereits Kirschen, Pfirsiche, geräucherte Heringe und frisches Gebäck. Durch das offene Fenster kamen die Gerüche von Pech, Obst und Abfall. Fela sprang aus dem Bett. Von neun Uhr bis vier – sieben Stunden! In sieben Stunden mußte sie alles erledigen. Um Adam Pacholski zu treffen, mußte sie sich in eine elegante Dame verwandeln – gewaschen, gebadet, gekämmt, mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein Geschenk. Was für ein Geschenk sollte sie mitnehmen? Aber nein, es gehörte sich nicht für eine Dame, einem Herrn beim ersten Treffen ein Geschenk mitzubringen. Die Etikette war dagegen. Eine Dame muß sich würdevoll benehmen, selbst wenn sie ein Rendezvous mit einem Engel hat.
Sie hörte ihren Vater im Nebenzimmer schimpfen, wußte aber nicht, weshalb. Sie lief konfus zu ihm. »Papa, du weißt doch, daß ich dich liebe. Es gibt keinen Mann auf der ganzen Welt, der dich ersetzen könnte.« Sie griff nach seinem Bart, hielt ihn fest und küßte ihn, so wie sie es als kleines Kind getan hatte. Auf dem Weg in die Küche hörte sie ihn hinter ihr herrufen: »Verrückt, verrückt! Verrücktes Mädchen!« Sie drehte sich um. »Du kannst mich umbringen, und ich werde dich doch vergöttern.« Wie gewöhnlich begann ihre Mutter mit Vorwürfen. Warum hatte sie so lange geschlafen. Warum ging sie nicht auf Arbeitsuche. Warum hatte sie am Abend vorher nicht das Geschirr gespült. Auf alles antwortete Fela nur: »Wenn du mich nicht magst, so suche dir doch eine andere Tochter. Ich will nur dich.«
Und sie umarmte ihre Mutter, küßte ihre Backen, ihre Nase, ihre Stirn, selbst ihre Perücke.
»Bei meiner Liebe zu Gott, das Mädchen hat den Verstand verloren.«
»Ja, ja, Mutter. Deine Tochter ist verrückt. Ich bin so glücklich, ich wünschte, ich könnte sterben.«
»Laß deine Feinde so reden!«
Fela aß, wußte nicht was, tat Salz in den Tee und rührte ihn mit der Gabel statt mit dem Löffel. Als sie aufstand, stieß sie gegen das Küchenbuffet und verletzte ihre Schulter. Eine Zeitlang stand sie am Fenster. Draußen schien die Sonne, die Vögel zwitscherten. Im Hof führte ein Zauberer seine Tricks vor. Ein als Clown verkleideter Mann schluckte Feuer von einer Fackel und wirbelte ein Glas Wasser in einem Reifen. Ein Mädchen mit kurzgeschnittenem Haar und in Samthosen lag auf dem Rücken und ließ ein Faß auf ihren Füßen rotieren. »Ach, Mutter, es ist so wunderbar zu leben«, babbelte Fela. »Warum bin ich so glücklich? Ach, warum? Ich bin so glücklich, daß ich aus dem Fenster springen könnte.« Fela hörte ihre Mutter murmeln: »Entweder bist du verrückt, oder du versuchst, dich verrückt zu machen.«
»Ich versuche es nicht, liebe Mutter, ich bin es. Sag mir die Wahrheit. Hast du Papa geliebt? Ich meine mit der Art von Liebe, die wie Feuer brennt?«
»Wen sollte ich denn sonst geliebt haben? Vielleicht den Kaminfeger? Aber sieh nur, wie es geendet hat.«
»Es wird alles gut werden, liebe Mutter. Du wirst noch viel Freude erleben.«
»Wann? Bald werde ich sie nicht mehr brauchen.«
3
Alles ging so glatt, daß Fela lachen mußte. Es war merkwürdig. Jahrelang war sie niedergedrückt gewesen. Plötzlich war ein Tag des Handelns gekommen. Sie ging ins Pfandhaus und verpfändete die Kette ihrer Mutter für einhundertvierzig Zloty. Sie nahm eine Droschke zum Marszalkowska-Boulevard, wo sie ein neues Kleid kaufte, Hut und Schuhe und Unterwäsche. Als sie an einem Bad vorüberkam, ging sie hinein und badete. Gott im Himmel, es war erstaunlich, was man in sieben Stunden tun konnte, wenn man Geld hatte. In ihrem neuen milchkaffeefarbenen Kleid war Fela nicht wiederzuerkennen. Der Strohhut mit dem braunen Band ließ sie damenhaft erscheinen. Die neuen Schuhe waren eng, aber die hohen Absätze und spitze Form sahen elegant aus. Das Korsett beengte sie zwar, aber ihre Figur war dadurch fest und proportioniert. Das heiße Bad hatte das Jucken und die Gerüche beseitigt. Fela ging wie auf Federn. Ihr Herz flatterte wie ein Vogel in ihrer linken Brust. Sie ging in ein Café und bestellte eine Tasse Kaffee. Als sie bezahlt hatte, blieb von den einhundertvierzig Zloty nur einer übrig, und damit würde sie die Droschke zu ihrem Treffpunkt bezahlen. Fela blätterte in dem Magazin, das der Kellner ihr hingelegt hatte, sie versuchte zu lesen, aber sie konnte die Worte nicht verstehen; sie konnte auch die Bilder nicht klar erkennen. Nun, ein einziger Tag des Glücks ist genug, sagte sie sich. Alle paar Minuten sah sie auf ihre Armbanduhr. Es wäre nicht richtig, zu früh zu sein, aber zu spät zu kommen wäre gefährlich. Sie mußte die Zeit genau beachten, so daß er nicht länger als eine oder zwei Minuten auf sie zu warten hatte. Vielleicht war das Ganze für ihn nur ein Scherz. Er könnte die Polizei verständigt haben, und die würde auf sie warten. Oder er kam mit einer Gruppe von Offizieren, um sie auszulachen. Andererseits, vielleicht würde er ihr Blumen bringen. Alles war möglich. »Dies ist mein Schicksalstag.« Sie saß benommen da. Plötzlich blickte sie wieder auf die Uhr. Es war spät. Sie zahlte eilig und ging auf die Straße. Der Tag, der so sonnig begonnen hatte, war jetzt bewölkt, und es sah nach Regen aus. Vögel flogen niedrig über die Dächer und krächzten. Glücklicherweise kam eine Droschke vorbei. Fela stieg ein und sagte atemlos: »Ecke Marszalkowska und Wspolna.«
Der Kutscher kehrte um, und Fela wurde schwindlig, alles drehte sich, Häuser, Pflaster und Menschen. Der Kaffee war ihr wie Likör zu Kopf gestiegen. Sie war schon spät dran. Er würde nicht nur eine Minute auf sie zu warten haben, sondern mindestens fünf. Nun, er ist ein Mann, und ich bin eine Dame. Soll er warten. Sie war am Rande des Lachens oder der Tränen. Was für ein Abenteuer! Vielleicht hatte ihre Mutter die fehlende Kette entdeckt. Vielleicht hatte sie die Polizei verständigt. Und wenn der Kutscher mehr als einen Zloty verlangte, was dann? Was sollte sie dann tun? – Sich lebendig begraben!
Gott im Himmel, was jetzt. Eine lange Reihe von Trolleybussen versperrte die Straße, Feuerwehrwagen hatten den Verkehr zum Stillstand gebracht. Die Sirenen einer Ambulanz heulten. Brannte es irgendwo? Aber wo? Eine Menschenmenge hatte sich angesammelt. Der Kutscher drehte den Kopf mit der Wachstuchmütze ihr zu.
»Junge Frau, wenn Sie es eilig haben, steigen Sie hier aus. Es ist nicht mehr weit bis zur Wspolnastraße.«
Fela gab ihm den Zloty und stieg aus. Sie zerriß beinahe ihr Kleid an der eisernen Stufe. Sie drängte sich durch die Menge so schnell sie konnte und eilte nach der Wspolnastraße. Sie rutschte fast aus auf ihren hohen Absätzen. Das fehlt mir noch, daß ich im Dreck lande, dachte sie. Adam Pacholski in Zivil stand an der Ecke, ein junger Mann in einem hellen Anzug, das blonde Haar mit Bürstenschnitt. Konnte er das sein? Er lächelte Fela zu und schwang eine Zeitschrift. Er eilte auf sie zu, nahm ihre Hand und küßte flink ihr Handgelenk über dem Handschuh. Er begrüßte sie, als sei sie eine alte Bekannte.
»Sie sind spät«, sagte er. »Aber das ist das Privileg des schönen Geschlechts.«
»Es brannte irgendwo. Die Droschke konnte nicht durchkommen.«
»Folgen Sie mir, bitte.« Er führte sie durch ein Tor und öffnete die Glastür des Haupteingangs mit einem Schlüssel. Sie betraten einen holzgetäfelten Lift. Als sie hinauffuhren, fühlte Fela, die noch nie in einem Aufzug gewesen war, ihr Herz klopfen. Sie wußte wohl, daß ein Mädchen nicht mit einem Mann in seine Wohnung gehen sollte, aber er hatte ihr keine Chance gegeben, nein zu sagen. Ihr Herz hämmerte; sie konnte kein Wort herausbringen. Die Bewegung verursachte ihr Schwindel. Gott im Himmel, flehte sie, laß mich nicht ohnmächtig werden. Adam Pacholski öffnete die Tür zu einem Korridor voller Bilder. Auf einem Bügel hing der Mantel des Generals, die Generalsmütze und ein Säbel. In einer Vase standen Blumen. Goldfische schwammen in einem Aquarium.
Das Zimmer, das sie betraten, war wie ein Museum. Porträts polnischer Helden blickten von den Wänden herunter, da waren Medaillen, Bänder, allerlei Diplome und Belobigungsschreiben. Eine Wand war mit den Köpfen ausgestopfter Tiere bedeckt und mit Pistolen, Gewehren und Säbeln. Es roch nach Leder und nach Mann. Adam Pacholski bat Fela, sich zu setzen, und sie dankte ihm. Er öffnete einen Glasschrank und füllte zwei Gläser mit einem rötlichen Likör.
»In Ihrem Brief schrieben Sie, daß Sie nicht gut aussehen«, sagte er. »Aber Sie sind eine Schönheit.«
»Der Herr General macht sich lustig über mich.«
»Nennen Sie mich nicht Herr General. Ich bin Adam, und Sie sind Fela«, sagte er in vertraulichem Ton. »Auf Ihr Wohl!« Er stieß mit ihr an und lächelte das Lächeln, das man in ganz Polen, vielleicht sogar in der ganzen Welt kannte. Er war zweiundvierzig Jahre alt, aber Fela hielt ihn für nicht älter als dreiundzwanzig. Der Likör war stark. Süßigkeit durchdrang ihre Glieder. Sie spürte die Schärfe in der Nase, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Sie wissen nicht, wie man trinkt«, bemerkte Pacholski, brachte ihr einen Keks und füllte ihr Glas nach. Er blickte auf seine Armbanduhr. Im Nebenraum läutete das Telefon; er erledigte den Anruf schnell. »Alle rufen mich an«, sagte er, als er zu Fela zurückkam. »Diese Langweiler.«
»Vielleicht hat der Herr General keine Zeit?«
»Für eine gutaussehende Frau habe ich immer Zeit«, antwortete er.
Pacholski sah Fela in die Augen und fing an, wie ein Wahrsager zu sprechen. »Sie sind ein Mädchen, das zu lieben versteht. Sie erinnern mich an die Zeilen in Heines Gedicht, wo er von dem Stamm derer spricht, ›Die sterben, wenn sie lieben‹. Was finden Sie an meinen Gedichten? Manchmal kommen sie mir ganz wertlos vor. Sie sind jüdisch, aber Sie sind anders als die anderen jüdischen Mädchen, ganz anders. Die sind realistisch, käuflich, aber Sie sind romantisch, eine Träumerin. Sie leben völlig in Ihren Phantasien. Der Adel alter Völker lebt in Ihnen. Sie sind eine orientalische Schönheit. Es ist durchaus möglich, daß eine Ihrer Urgroßmütter im Harem des König Salomo lebte … Was wissen wir über die Generationen? Wir Slawen sind jung und sind eben erst aus den Wäldern gekommen, während Sie einer alten Rasse angehören. Vielleicht gibt es deshalb keinen Frieden zwischen uns. Außer, wenn wir lieben, denn dann verschwinden alle Grenzen. Dann wollen wir miteinander verschmelzen, man könnte sagen, wir wollen unseren Wein in eure Schläuche füllen. Kommen Sie, ich kann nicht länger warten. Ich muß Sie küssen.«
»Herr General!«
»Sagen Sie nichts. Sie gehören mir.«
Er stand von seinem Stuhl auf, küßte sie und zwang ihre Lippen auseinander. Sie fiel, da ihre Knie nachgaben, und er trug sie halb, halb führte er sie in ein anderes Zimmer. Fela versuchte Widerstand zu leisten, aber Pacholski wurde wild. Er riß ihr den Hut vom Kopf, warf sie auf das Bett, mühte sich mit ihrem Kleid ab. Sie wollte schreien, aber er bedeckte ihren Mund mit seiner Hand. Alles geschah so schnell, brutal, mit einer solchen Gewalt, wie sie es sich nicht hatte vorstellen können. Er zog an der Schnur der Vorhänge, und das Schlafzimmer wurde dunkel. Er warf sich auf sie.
»Du Hure! Du jüdische Dirne!«
4
Das Telefon läutete und hörte nicht auf. Pacholski, halbnackt, riß sich von Fela los und nahm den Hörer ab. Es war eine Frau, und er stritt sich mit ihr, bis er schließlich schrie: »Blitz und Donner und die Cholera über dich!« Das Telefon läutete wieder, offenbar war es dieselbe Frau, denn Pacholski warf den Hörer krachend auf die Gabel. Seine Unterhosen waren blutbefleckt. Fela blutete heftig, fast als hätte sie einen Blutsturz. Blut war auf dem Bett, auf dem Teppich.
»Ich habe viele Jungfrauen gehabt, aber keine von denen hat so geblutet wie du«, sagte Pacholski.
Er küßte Fela und schalt sie. Bald werde ein Vertreter des Generalstabs kommen, sagte er, und er müsse ihn empfangen. Er zog seine verschmutzte Unterwäsche aus und warf sie auf den Boden. Es läutete an der Tür. Pacholski öffnete einen Spaltbreit und nahm ein Telegramm entgegen. Er ging in das Badezimmer, um frische Wäsche zu holen, aber das Telefon läutete wieder, und er kam zurück, ohne seine Blöße zu bedecken.
Fela weinte. Pacholski schrie: »Heule nicht, du Angsthase. Auf dem Schlachtfeld haben wir viel mehr Blut verloren. Ich lag einmal blutend in einem Fuchsloch, und die Krähen warteten darauf, mir die Augen auszuhacken.« Er hatte ihr Kleid zerrissen. Er brachte ihr ein anderes, das im Schrank gehangen hatte, aber zu lang für Fela war. Er suchte nach Nadel und Faden, aber wieder läutete das Telefon. Als er aufgelegt hatte, wandte er sich ihr zu.
»Du mußt hier verschwinden.«
»Bitte verlassen Sie das Zimmer für ein paar Minuten.«
»Du brauchst dich vor mir nicht zu schämen.«
»Bitte, gehen Sie.«
Er verließ das Zimmer, und Fela versuchte, sich in Ordnung zu bringen. Ihr Kleid war sowohl zerrissen wie verfleckt. Ihre Unterwäsche war unbrauchbar, und sie stopfte sie in ihre Handtasche. Sie versuchte, ihr Korsett anzuziehen, aber es gelang ihr nicht. Ohne anzuklopfen, kam Pacholski wieder in das Zimmer, bereits angekleidet, aus einem Mundwinkel hing eine Zigarette. Er schrie sie an: »Benimm dich nicht wie eine tragische Heldin. Du wirst schon einen Mann finden, und das ist alles. Basta!«
Bei dem Wort »Mann« ließ Fela ein Jammern hören. Mit einer Stimme, die ihr selbst fremd war, schrie sie: »Hetzen Sie mich nicht. Ich bin kein Hund.«
»Die Generäle dürfen dich hier nicht finden.«
Mit Gewalt zwängte er sie in ihr Korsett und brachte eine Sicherheitsnadel für das Kleid. Er steckte die Hand in die Hosentasche und zog einen Haufen Banknoten heraus. Fela griff nach ihrem Haar und wies das Geld zurück.
»Wir werden uns wiedertreffen«, sagte er. »Ich liebe dich. Aber jetzt mußt du gehen. Wenn nicht, bin ich ruiniert.«
»Wie kann ich so auf die Straße gehen?«
»Nimm ein Taxi. Geh in ein Hotel.«
»Man wird mich nicht hineinlassen. Lassen Sie mich wenigstens warten, bis es dunkel ist.«
»Pilsudski persönlich kommt her!«
Er nahm sie bei den Schultern, schob sie den Korridor entlang, küßte dabei ihre Hand und ihr Gesicht. Er gab ihr sein Taschentuch. Als er die Tür geöffnet hatte, gab er ihr einen letzten Stoß und küßte sie auf den Nacken. Er rief ihr nach: »Ich werde immer an dich denken« und schlug die Tür zu.
Fela ging die Stufen hinunter, Blut tropfte auf den Marmor und den Teppichstreifen in der Mitte. Sie zerknüllte das Taschentuch und schob es in die offene Wunde. Sie weinte und konnte nicht aufhören. Als sie durch das Tor gegangen war, sah sie sich um, unsicher, in welcher Richtung ihr Haus lag. Im Dämmerlicht schien der Marszalkowska-Boulevard diesig zu sein, und das Pflaster schien aufwärts zu gehen. Menschenmassen verließen Kinos, Warenhäuser und Ausstellungen. Trolleybusse klingelten; Autos hupten. Die Zeitungsjungen schrien die Schlagzeilen aus. Gott im Himmel, wie lang wird dieser Tag noch dauern! Fela ging blind drauflos und wußte nicht, ob sie in der Richtung des Stadtzentrums, in dessen Nähe ihre Wohnung lag, ging, oder in die Richtung des Vorortes Mokotow. Hätte ich nur fünfzehn Groschen für den Trolleybus, dachte sie. Leute starrten sie an, aber sie kniff die Augen zu und blickte auf das Pflaster. Ihr schien, Männer riefen laut hinter ihr her, und Frauen lachten. Sie hörte die Trillerpfeife eines Polizisten und fürchtete, daß man sie verhaften wolle. Sie erreichte den Jerusalem-Boulevard. Wenigstens war sie in die richtige Richtung gegangen. Sie wollte sich auf eine Bank setzen, aber sie waren alle besetzt. Die Wunde schmerzte, und das Taschentuch war nach unten gerutscht und dabei herauszufallen. Die Sicherheitsnadel hatte sich geöffnet und stach in ihren Schenkel. Ihre Füße in den engen Schuhen taten weh, und sie konnte kaum das Gleichgewicht halten mit den hohen Absätzen. Sie stand still. Plötzlich rutschte sie aus und fiel fast hin. Ihre Strümpfe hingen herunter. Die Nähte ihres Kleides rissen. Sie konnte die Handtasche nicht schließen, und die Unterwäsche war zu sehen. Wenn ich nur Gift bei mir hätte – wenn ich nur sterben könnte, gleich hier, gleich jetzt an diesem Punkt. Sie ging weiter. Sie mußte nach Hause!
Es wurde dunkel, Gott sei Dank! Die Straßenlampen wurden angezündet. Fela ging blindlings weiter. Das wichtigste war, nicht hinzufallen. Endlich kam sie zur Heilig-Kreuz-Straße und ging in Richtung der Panskastraße, wo sie wohnte. Was soll ich Mutter sagen? Was kann ich sagen? Es wird einen Skandal geben. Fela wollte zu Gott beten, aber wofür? Selbst Gott konnte ihr nicht mehr helfen. Sie erblickte ein Geschäft mit heruntergelassenen Rolladen und setzte sich auf die Türschwelle. Jetzt sah sie, was mit ihren Füßen geschehen war. An einer Ferse war die Haut aufgerieben, und der Strumpf war blutgetränkt. Sie sah sich nach einem Stück Papier um, mit dem sie den Druck etwas mildern konnte, fand aber keines. Ein Betrunkener kam ihr entgegen, sah sie lüstern an, als ob er sich gleich auf sie stürzen wollte. Sie stand schnell auf und lief davon. Sie kam zur Panskastraße. Die Gaslampen brannten. Kinder spielten im Halbdunkel. Obwohl Fela hier geboren war, schien ihr die Straße fremd. Sie kam zu ihrem Haus, ging über den Hof und begann, die Treppen hinaufzusteigen. Niemand hielt sie an! Eine kleine Gaslampe gab schwaches Licht. Fela ging Stufe für Stufe. Erst jetzt wurde ihr klar, wie erschöpft sie war. Ihre Knie zitterten, und sie mußte sich am Geländer festhalten. Wenn sie nur den Schlüssel mitgenommen hätte, so daß sie hinein könnte und sofort ins Badezimmer. Sie würde klopfen müssen, und ihre Mutter würde sofort alles erraten.
Wunderbarerweise stand die Tür offen. Der Korridor war dunkel, auch die Küche. War eingebrochen worden? Aber nein, ihre Mutter mußte fortgegangen sein und die Tür offengelassen haben. Im Wohnzimmer konnte Fela ihren Vater an der Ostwand im Dunkel stehen sehen, sich verneigend, offenbar mitten in seinen Abendgebeten. Sie eilte ins Badezimmer. Erst nachdem sie sich eingeschlossen hatte, wurde ihr klar, daß sich hier zu verstecken keine Rettung war. Sie mußte doch herauskommen. Sie mußte das fremde Kleid ausziehen und die verfleckte Unterwäsche verstecken. Ihre Mutter konnte jeden Augenblick zurückkommen. Sie war wahrscheinlich nur zu einer Nachbarin gegangen und hatte deshalb die Tür offengelassen. Fela wurde übel. Ihr Magen zog sich zusammen, und sie mußte urinieren. Das Taschentuch war verschwunden. Warmes Blut lief ihre Schenkel entlang und tropfte auf den Boden. Sie hatte kein Streichholz, um den Kerzenstummel anzuzünden. Sie stand auf und erbrach sich. Vor ihren Augen drehten sich Feuerräder. In ihrem Schädel brannte ein Licht. Fela streckte die Hand aus, um auf dem Wandbrett Papier zu suchen, und berührte eine Schere.
Augenblicklich wußte sie, was sie tun mußte: Sie mußte sich die Pulsadern aufschneiden. Gott selbst hatte dies Instrument für sie dorthin gelegt. Fela zitterte. Sie hatte immer gewußt, daß es so enden würde. Sie hatte es vorausgesehen, aber sie konnte sich nicht mehr erinnern, ob es in einem Traum oder in der Wirklichkeit gewesen war.
Fela wollte ein Gebet sprechen, ein paar jüdische Worte aus der Bibel hersagen, oder aus dem Gebet, das ihre Mutter mit ihr zu lesen pflegte, als sie noch ein kleines Mädchen war, aber sie konnte sich an nichts erinnern. »Gott, gnade meiner Seele«, murmelte sie. Auf der Toilette sitzend, schnitt sie in ihr Handgelenk, als sei es ein Stück Stoff. Dann machte sie einen zweiten Schnitt und dann einen dritten. Es tat nicht wirklich weh. Gott sei Dank, niemand wird mich noch lebend sehen!
Im Dunkeln auf der Toilette sitzend, lehnte sie ihren Kopf gegen die Wand, bereit zu sterben. Sie konnte das Blut aus ihrem Handgelenk fließen spüren und auch die Blutung unten. Sie war benommen und fühlte, wie sie schwankte. Glocken läuteten in ihren Ohren. Vor den Augen sah sie leuchtende Farben. Sie war noch da, aber schon woanders. Die Angst war verschwunden. In ihrem Innern pumpte ein Blasebalg. Etwas in ihr blähte sich auf und fiel dann zusammen – ein Wesen nicht von dieser Welt. Sie wußte nicht, war es mehr wie ein Frosch, eine Lunge, eine Taube … Von irgendwoher kam eine Menschenmenge auf sie zu. Trommeln erklangen, die wie Hufschläge widerhallten. Dann gab es einen großen Lärm und dicht neben ihr einen Aufschrei.
Die Tür wurde eingedrückt. Felas Vater schrie; ihre Mutter jammerte. Nachbarn kamen herbeigeeilt. Man schleppte Fela heraus, hob sie hoch und trug sie. Handtücher wurden um ihren Arm gewickelt, und jemand lief, den Arzt zu holen. Fela lag auf dem Sofa, während über ihr die Leute schrien, ihre Arme schwenkten und sich herunterbeugten, um sie zu betrachten. Fremde Männer hoben ihr Kleid hoch, entblößten sie. Ich kann mich nicht einmal schämen, dachte Fela. Aber ich sterbe glücklich. Ich verzeihe ihm. Ich verzeihe. Sie öffnete ein Auge und erblickte einen Soldaten, der mit einem Strauß blutroter Rosen ins Zimmer trat. Trotz ihrer Qual lächelte Felas Seele. War er der Engel des Todes?
Sie hörte ihre Mutter fragen: »Wer sind Sie? Was wollen Sie? Die sind nicht für uns.«
»Für Fräulein Fela, mit Empfehlungen«, sagte der Soldat, »vom Herrn General.«
Das geheime Band
Wir saßen im Garten eines Cafés. Es war Sommer, wenn die Abenddämmerung in Warschau lange andauert. Die Sonne geht unter, aber der Himmel bleibt noch hell im frühabendlichen Leuchten. Vögel zirpten noch auf den Zweigen der Bäume. Weißgeflügelte Insekten kreisten um die Glaskugeln der Lampen. Der süße Duft der Blumen vermischte sich mit dem Aroma von Kaffee, Kakao und frischen Bäckereien. Am Himmel wurde der Mond sichtbar, und in der Nähe ein heller Stern.
Wir waren eine kleine Gruppe – mehrere Schriftsteller, ein Maler und ein Bildhauer. Bald gingen alle außer einem jiddischen Schriftsteller, Reuben Berger, und mir. Reuben war früh als großes Talent bekannt geworden, hörte dann aber auf zu schreiben. Wir tranken Kaffee, aßen Gebäck mit Marmelade und unterhielten uns über Frauen. Reuben erzählte Geschichten und rauchte eine Zigarette nach der anderen. In einer entfernten Ecke des Cafés schlug jemand die Tasten des Klaviers an. Von den Feldern und Obstgärten auf dem anderen Ufer der Weichsel wehten die Düfte des späten Sommers herüber.
Reuben Berger schnippte die Asche seiner Zigarette in den Aschbecher und sagte: »Es gibt Fälle, wo ein Mann gezwungen ist, eine Frau zu schlagen. Ganz gleich wie rücksichtsvoll er von Natur aus sein mag, er hat keine Alternative. Sie wissen, daß ich in dem Ruf stehe, dem schönen Geschlecht gegenüber besonders zartfühlend zu sein, aber die Geschichte, an die ich denke, ist so verrückt und mir so unähnlich, daß ich jedesmal lachen muß, wenn sie mir einfällt. So etwas ist nur im Leben möglich, nicht in Romanen. Es ist so lächerlich, daß es unglaubhaft ist.«
»Genug der Spannung. Erzählen Sie«, sagte ich.
»Gut. Sie wissen, daß ich mich schon im Alter von vierzehn Jahren mit Frauen einließ. Ich liebte sie, und sie liebten mich. Dieses Ereignis trug sich vor ungefähr acht Jahren zu, vielleicht vor zehn. Ich lebte mit einer Frau, die wahnsinnig in mich verliebt war. Mit dieser Art Frauen wird die Liebe zur Besessenheit. Ihre krankhafte Eifersucht machte mir das Leben zur Hölle. Tausendmal brach ich mit ihr, und jedesmal kam sie wieder zurück. Ihr Vater war ein frommer Jude, er besaß ein Haus. Sie hieß Bella. Sie bewegte sich in unserem literarischen Kreis, lange ehe Sie in den Schriftsteller-Klub kamen. Sie war in ein sehr exklusives Gymnasium gegangen und hatte die Manieren einer wohlerzogenen Dame. Sie war auch schön. Aber meinetwegen begann sie zu trinken. Zu der Zeit war ich noch verheiratet. Bella saß allein in ihrem Zimmer, trank Wodka aus der Flasche, rauchte und stritt sich am Telefon mit mir, wenn sie meiner habhaft werden konnte. Ich mußte vor ihr davonlaufen. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Sie versuchte mehrmals, sich das Leben zu nehmen.
Wenn sie einen solchen Anfall hatte, gab es wüste Szenen. Nur eine Sache konnte ihre wahnhaften Ausbrüche beenden – eine Ohrfeige. Ich war mehrfach gezwungen, sie zu schlagen, nur dann kam sie sofort wieder zu sich. Sie nahm dann wieder Haltung an, dachte logisch und ruhig. Ich habe oft die Analogie zum Krieg gezogen. Wenn eine Nation zerstörerisch kriegerisch wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sie zur Vernunft zu bringen – die Niederlage. Wenn ein Pazifist mich hören würde, würde er mich in Stücke reißen, aber es ist wahr.