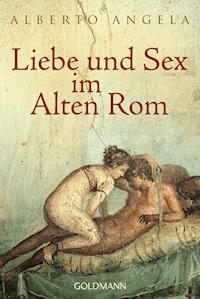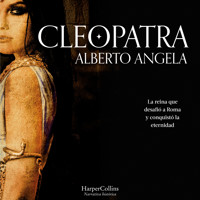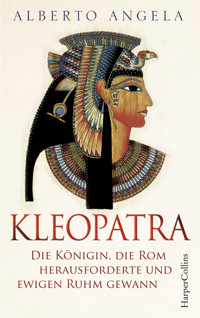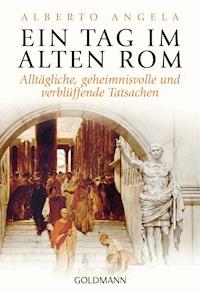
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riemann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Alte Rom wird lebendig: eine faszinierende Zeitreise in die antike Welt
Wie wickelt man eine Toga? Wie teuer ist ein Sklave? Was bedeutet römisches Kamasutra? Wie bereitet man den besten Flamingo-Braten zu? Alberto Angela nimmt seine Leser mit auf einen faszinierenden Spaziergang durch das Rom der Antike und wirft einen Blick in prächtige Patrizierhäuser, Kochtöpfe und Schlafzimmer. Dabei entdeckt er erstaunliche, geheimnisvolle und spannende Details aus dem Alltagsleben der alten Römer. Geschichte, wie sie lebendiger und anschaulicher nicht sein könnte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Alberto Angela nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise ins antike Rom. Im Laufe eines Tages erleben wir hautnah mit, wie es sich anfühlt, ein echter Römer im Jahr 115 n. Chr. zu sein: Frühmorgens erwachen wir in einem Patrizierhaus, streifen durch die in Kerzenlicht getauchten Räume, bewundern die geschmackvolle Einrichtung und beobachten die Dame des Hauses bei der Morgentoilette. Vormittags flanieren wir an betriebsamen Werkstätten vorbei und über den gut besuchten Sklavenmarkt. Mittags lauschen wir den Poeten auf dem Forum, später den trivialen Witzen, die man sich in den öffentlichen Latrinen erzählt. Nachmittags erleben wir im Kolosseum ein blutiges Spektakel, und in den Thermen erwarten uns anschließend wohltuende Ölmassagen. Abends werden rauschende Feste am Ufer des Tibers gefeiert, und die Betrunkenen torkeln nachts aus den Tavernen. Wenn wir am Ende unserer Reise um Mitternacht im Mondlicht auf einer menschenleeren Gasse stehen, wissen wir: Vieles, was wir an diesem gewöhnlichen Tag im antiken Rom erlebt haben, war für uns ganz anders, als wir es uns immer vorgestellt haben.
Alberto Angela ist eine fulminante Rekonstruktion gelungen: Mit allen Sinnen nehmen wir am Alltag der Alten Römer teil, und stürzen uns in das bunte Treiben der pulsierenden antiken Metropole – zu einem Zeitpunkt, da sich das Imperium Romanum auf dem Höhepunkt seiner Macht befindet, und die Ewige Stadt in voller Blüte steht. Selten war Geschichte so lebendig.
Autor
Alberto Angela wurde 1962 in Paris geboren und studierte in Rom Naturwissenschaften. Als Paläontologe nahm er an zahlreichen Ausgrabungsprojekten in Afrika und Asien teil. In Italien ist er ein beliebter Fernsehmoderator für naturwissenschaftliche Sendungen. Er ist außerdem Mitglied des Istituto Italiano di Paleontologia in Rom sowie des Centro Studi e Ricerche Ligabue in Venedig. Gemeinsam mit seinem Vater Piero Angela – einem bekannten Archäologen, Journalisten und Autor – hat er bereits drei Bücher veröffentlicht.
Für Monica,Riccardo, Edoardo und Alessandro. Und für das Licht, das sie in mein Leben gebracht haben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wie lebten die alten Römer? Was geschah tagtäglich in den Straßen Roms? Wir alle haben uns schon Ähnliches gefragt. Diese Neugier ist es, die Sie dazu bewogen hat, dieses Buch aufzuschlagen.
Tatsächlich übt Rom eine unbeschreibliche Faszination aus. Sie ist jedes Mal spürbar, wenn man eine Ausgrabungsstätte aus römischer Zeit besichtigt. Leider jedoch geben die Beschilderungen und Reiseführer meist nur allgemeine Hinweise zum täglichen Leben in der Gegend, die Sie gerade erkunden, und konzentrieren sich auf architektonische und historische Daten.
Es gibt aber einen »Trick«, um sich das Alltagsleben an diesen Stätten wirklich vorstellen zu können. Er besteht darin, sein Augenmerk vor allem auf die Details zu richten: die Abnutzung der Treppenstufen, die Inschriften im Mauerputz (in Pompeji gibt es unzählige davon), die Furchen, die die Wagen in den Straßen hinterlassen haben, oder die von der ständigen Benutzung einer (mittlerweile verschwundenen) Tür hervorgerufenen Kratzer im Marmorboden einer Wohnstätte.
Wenn Sie sich in diese Einzelheiten vertiefen, erwacht jede Ruine schlagartig zu neuem Leben, und Sie »sehen« die Menschen von damals vor sich. Genau das ist der Ansatz dieses Buches: die große Geschichte anhand von vielen kleinen zu erzählen.
Während der vielen Jahre meiner Fernseharbeit bin ich auf außergewöhnlich viele Geschichten und Details aus dem Leben der Menschen zur Zeit der römischen Kaiser gestoßen, die jahrhundertelang vergessen waren und erst von den Archäologen wiederentdeckt wurden. Es sind Anekdoten, Dokumente, Kuriositäten das tägliche Leben oder die gesellschaftlichen Regeln betreffend wieder aufgetaucht, die einer verschwundenen Welt angehören. Als ich mit Archäologen über ihre Ausgrabungen sprach, ihre Publikationen las oder ihre Schriften konsultierte, passierte dasselbe.
Mir wurde bewusst, dass diese wertvollen Informationen über die Welt der alten Römer so gut wie nie bei den Menschen draußen ankommen und häufig in Fachpublikationen oder an Ausgrabungsstätten ein verstecktes Dasein fristen. Also habe ich versucht, sie zu erzählen.
Dieses Buch hat zum Ziel, das Alte Rom anhand von Schilderungen über das Alltagsleben wiederauferstehen zu lassen, indem es sehr einfachen Fragen nachgeht: Wie war es, durch die Straßen zu gehen? Wie sahen die Gesichter der Menschen aus, die man dort traf? Was konnte man von den Balkonen aus sehen? Wie schmeckte das Essen? Welche Art Latein wurde auf den Straßen gesprochen? Wie sahen die Tempel auf dem Kapitolshügel aus, wenn die ersten Sonnenstrahlen sie trafen?
In gewisser Weise wollte ich die Orte wie mit einer Fernsehkamera erkunden, so wie sie vor 2000 Jahren gewesen sein mussten, und dem Leser damit ein Gefühl vermitteln, als befände er sich in den Straßen des Alten Roms, als atmete er seine Gerüche und Düfte, träfe die Blicke der Menschen, träte in die Geschäfte ein, in die Häuser oder ins Kolosseum. Nur so kann man wirklich verstehen, wie es sich angefühlt hat, in der Hauptstadt des Römischen Reichs zu leben.
Da ich selbst in Rom wohne, war es ein Leichtes für mich, zu beschreiben, wie das Sonnenlicht im Laufe eines Tages Straßen und Monumente erhellt, oder mich an Ort und Stelle zu begeben und von den vielen kleinen Details Notiz zu nehmen, die im Buch beschrieben werden – zusätzlich zu denen, die ich in Jahren der Fernseharbeit und Ortsbesichtigungen sowieso schon gesammelt habe.
Natürlich sind die Szenen, die sich während unseres Besuchs im Alten Rom vor Ihren Augen abspielen werden, nicht einfach erfunden, sondern Forschungsergebnissen, archäologischen Entdeckungen, historischen Quellentexten und Laboranalysen von Fundstücken oder Skeletten entnommen.
Die beste Methode, diese Fülle an Informationen zu ordnen, schien mir darin zu bestehen, einem normalen Tagesablauf zu folgen. Jeder Stunde des Tages korrespondieren ein Ort und ein Gesicht der Ewigen Stadt mit ihren jeweiligen Aktivitäten. Und so entfaltet sich Augenblick für Augenblick das tägliche Leben im Alten Rom.
Es bleibt noch eine letzte Frage: Warum überhaupt ein Buch über das antike Rom? Weil unsere heutige Welt sich aus der altrömischen herleitet. Wir wären nicht dieselben, hätte es das Römische Reich nicht gegeben. Bedenken Sie: Üblicherweise definiert man die römische Zivilisation über ihre Herrscher, ihre marschierenden Legionen und die hohen Säulengänge ihrer Tempel. Aber ihre wahre Kraft lag in etwas anderem. In etwas, das es ihr erlaubte, eine unvorstellbar lange Zeit zu überleben: das Weströmische Reich über tausend Jahre und das Oströmische, das seine eigene Fortentwicklung von Konstantinopel bis Byzanz durchmachte, sogar noch länger, über 2000 Jahre, fast bis zur Renaissance. Keine Legion, kein politisches oder ideologisches System könnte je eine solche Langlebigkeit garantieren. Das Geheimnis Roms war sein täglicher Modus Vivendi: seine Art, Häuser zu bauen, sich zu kleiden, zu essen, mit den anderen umzugehen, innerhalb und außerhalb der Familie, und das Ganze in einem festen Rahmen von Gesetzen und sozialen Regeln. Dieser Modus Vivendi ist im Wesentlichen über Jahrhunderte unverändert geblieben, hat sich höchstens graduell weiterentwickelt und es der römischen Zivilisation erlaubt, so lange zu überleben.
Können wir demnach überhaupt sicher sein, dass jene Epoche wirklich erloschen ist? Das Römische Reich hat uns nämlich nicht nur Statuen und außerordentliche Bauwerke hinterlassen. Es hat uns auch eine Software hinterlassen, die unser ganzes tägliches Leben bestimmt. Das Alphabet, das wir benutzen, auch im Internet, ist das römische. Die italienische Sprache entspringt dem Lateinischen, ebenso wie weite Teile des Spanischen, Portugiesischen, Französischen und Rumänischen (und sogar unzählige Wörter im Englischen, Deutschen usw.). Ganz zu schweigen von unserem Justizsystem, unseren Hauptverkehrsadern, der Architektur, der Malerei, der Bildhauerei, die ohne die Römer ganz anders aussähen.
Wenn man es genau betrachtet, ist ein Gutteil unserer westlichen Lebensart im Grunde nichts anderes als die moderne Weiterentwicklung der römischen. Also genau dessen, was sich tagtäglich auf den Straßen und in den Häusern des Alten Roms abspielte.
Ich habe versucht, das Buch zu schreiben, das ich in den Buchhandlungen immer vergeblich gesucht habe, um damit meine Neugierde auf das antike Rom zu befriedigen. Ich hoffe, auch die Ihrige befriedigen zu können.
Alles beginnt in einer Gasse im Rom des Jahres 115 n. Chr., während der Herrschaft Kaiser Trajans, zu einem Zeitpunkt, in dem Rom meines Erachtens den Höhepunkt seiner Macht und vielleicht auch seiner Schönheit erlebte. Es ist ein Tag wie jeder andere. Kurz vor Sonnenaufgang …
Die Alte Welt
Das Römische Reich erlebte im Jahr 115 n. Chr. unter Kaiser Trajan seine größte Ausdehnung. Die Gebietsgrenzen verliefen über eine Entfernung von mehr als 10 000 Kilometern, ihre Länge entsprach also einem Viertel des gesamten Erdumfangs. Das Reich erstreckte sich von Schottland bis zu den Ausläufern des heutigen Iran, von der Sahara bis zur Nordsee.
Es vereinigte sehr unterschiedliche Völkerschaften unter sich, auch physiognomisch gesehen: von den blonden Nordeuropäern bis zu den Bevölkerungsgruppen aus dem Nahen Osten, von den Asiaten bis zu den Nordafrikanern.
Stellen Sie sich vor, man würde heute die Bevölkerungen Chinas, der Vereinigten Staaten und Russlands zusammenlegen: Die Bevölkerung des Römischen Reiches war im Vergleich dazu noch größer, wenn man in die Berechnung einbezieht, dass die Weltpopulation insgesamt damals noch viel kleiner war.
Und vor allem versammelte es ganz unterschiedliche Landschaften in seinen Grenzen: Reiste man von einem seiner äußersten Winkel zum anderen, überquerte man eisige, von Robben bewohnte Meere, endlose Nadelwälder, Prärien, verschneite Berggipfel, große Gletscher und dann Seen und Flüsse, bis man an den heißen Stränden des Mittelmeers und bei den Vulkanen Italiens ankäme. Wenn man die Reise auf der anderen Seite des Mare Nostrum, des Mittelmeers, fortsetzte, gelangte man bis an eine grenzenlose Wüste (die Sahara) und sogar noch weiter bis an Korallenriffs, nämlich die des Roten Meers.
Kein Reich in der gesamten menschlichen Geschichte hat je so unterschiedliche Landschaften umschlossen. Und überall war die offizielle Sprache Latein, überall zahlte man mit Sesterzen, überall wurde nur ein Recht angewandt, das römische.
Auffällig ist, dass die Bevölkerungsdichte in diesem riesigen Reich relativ gering war: Die Gesamtbevölkerung erreichte kaum fünfzig Millionen Einwohner, ungefähr so viele Menschen, wie heute Italien bewohnen. Sie lebten in kleinen Dörfern, mittleren Ortschaften, einzelnen Bauernhäusern, die auf das immense Territorium verteilt waren wie Krümel auf einer Tischdecke, und in ein paar großen Städten.
Wie man weiß, waren die wichtigsten Orte durch ein hoch effizientes Straßennetz miteinander verknüpft, das tatsächlich fast 100 000 Kilometer lang war und das wir heute noch nutzen, wenn wir in unsere Autos steigen. Es ist vielleicht das größte und beständigste Monument, das die alten Römer uns hinterlassen haben. Aber gleich abseits dieser Straßen erstreckten sich enorme Gebiete intakter Natur, mit Wölfen, Bären, Hirschen, Wildschweinen. Auf uns, die wir nur noch an den Anblick kultivierter Flächen und großer Industriegebiete gewöhnt sind, hätte dies den Eindruck gemacht, als lägen grenzenlose Naturschutzgebiete vor uns.
Zur Verteidigung jener Welt waren Legionen an den empfindlichsten Stellen des Imperiums stationiert, was meist entlang der Grenzen war, dem berühmten Limes. Unter Trajan zählte das Heer 150 000 bis vielleicht 190 000 Mann, die in dreißig Legionen aufgeteilt waren, mit Namen, die aus der Geschichte bekannt sind, wie Legio III Ulpia Victrix, die am Rhein stationiert war, Legio II Adiutrix an der Donau, Legio XVI Flavia Firma am Euphrat, nicht weit vom heutigen Irak.
Zu den Legionären kamen noch die Hilfstruppen dazu; das waren Soldaten, die aus den Bevölkerungen der verschiedenen Provinzen rekrutiert wurden, was die Größe des Heeres de facto verdoppelte: Insgesamt kam man so auf 300 000 bis 400 000 bewaffnete Männer, die dem Befehl des Imperators unterstanden.
Das Herz von alldem war Rom. Es lag genau in der Mitte des Reichs. Es war der Nabel der Welt.
Es war natürlich ein Machtzentrum, aber auch eine Stadt, reich an literarischer, philosophischer und juristischer Kultur. Und vor allem auch eine kosmopolitische Stadt, vergleichbar heute mit New York oder London. Hier trafen sich Vertreter der unterschiedlichsten Kulturen. Auf den Straßen hätten Sie damals reiche Matronen in Sänften gesehen, griechische Ärzte, gallische Kavallerieoffiziere, italische Senatoren, spanische Seeleute, ägyptische Priester, zypriotische Huren, orientalische Geschäftsleute, germanische Sklaven.
Rom hatte sich mit fast anderthalb Millionen Einwohnern zur bevölkerungsreichsten Stadt der Welt entwickelt, zu einer Größe, die seit dem Erscheinen des Homo sapiens noch nie da gewesen war. Wie schafften sie es, alle zusammen zu leben? Dieses Buch möchte zeigen, wie sich der Alltag im antiken Rom im Augenblick seiner größten Ausdehnung und Macht gestaltete.
Das Leben von zig Millionen Menschen im gesamten Römischen Reich hing davon ab, was man in Rom beschloss. Aber wovon hing seinerseits das Leben in Rom ab? Es war das Ergebnis eines weit verzweigten Netzwerks von Beziehungen zwischen seinen Bewohnern. Ein erstaunliches, in der Geschichte nicht wiederholbares Universum, das wir kennenlernen werden, indem wir uns einen x-beliebigen Tag ansehen. Sagen wir einfach: einen Dienstag vor 1894 Jahren.
Einige Stunden vor Sonnenaufgang
Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet, als wäre sie tief in Gedanken versunken. Das schwache Leuchten des Mondes enthüllt ein entspanntes, schneeweißes Gesicht, ein kaum angedeutetes Lächeln. Sie hat ein Band um die Stirn und das Haar zusammengebunden, aber die eine oder andere Locke fällt neckisch auf ihre Schultern herab. Ein plötzlicher Windstoß wirbelt Staub um sie auf, aber ihre Haare bewegen sich nicht. Wie könnten sie auch, sie sind aus Marmor. Ebenso wie ihre nackten Arme und die tausend Falten ihres Gewandes. Der Bildhauer, der sie erschuf, hat eine der kostbarsten Marmorsorten verwendet, um eine von den Römern sehr verehrte Göttin in Stein zu meißeln. Es ist die Mater Matuta, die »morgendliche Mutter«, Göttin der Fruchtbarkeit, des Neubeginns und des Sonnenaufgangs. Jetzt steht ihre Statue schon seit vielen Jahren auf ihrem imposanten Marmorsockel und beherrscht eine Straßenkreuzung des Viertels.
Um sie herum ist es noch dunkel, aber das diffuse Licht des Mondes lässt vor ihren Armen aus Marmor eine breite Straße erkennen, auf deren beiden Seiten eine lange Reihe Geschäfte verläuft. Um die Nachtzeit sind sie mit schweren, in den Boden eingelassenen Holztüren und kräftigen Riegeln verschlossen. Sie bilden den unteren Teil riesiger dunkler Gebäude. Diese schwarzen Schatten sind überall um uns herum, es scheint fast, als befänden wir uns in einer Schlucht, über uns nur der Sternenhimmel. Es sind große Wohnquartiere, die insulae, ähnlich unseren Mehrfamilienhäusern, nur sehr viel weniger komfortabel.
Was überrascht, ist die fehlende Beleuchtung dieser Gebäude und der Straßen Roms allgemein. Aber vielleicht haben wir uns auch nur zu sehr an unsere modernen Zeiten gewöhnt. Jahrhundertelang sind die Städte dieser Welt bei Einbruch der Dämmerung in tiefe Dunkelheit versunken, durchbrochen nur von ein paar wenigen Öllampen, die zu einem Wirtshaus oder geheiligten Stätten gehörten, die sich wegen der nächtlichen Passanten meist an strategischen Orten wie bestimmten Straßenecken und Wegeskreuzungen befanden. Und auch im Alten Rom ist es so. In der Dunkelheit errät man die örtlichen Gegebenheiten nur anhand dieser wenigen Lichter oder des Scheins der einen oder anderen nicht gelöschten Lampe im Inneren eines Hauses.
Ebenso erstaunlich ist die Ruhe. Während wir durch die Straße gehen, herrscht eine fast unwirkliche Stille, die nur vom Plätschern eines Brunnens ein paar Meter weiter durchbrochen wird. Der Brunnen ist simpel: vier dicke Travertinplatten bilden ein quadratisches Becken, über dem ein Säulenstumpf angebracht ist. Der Einfall des Mondlichts zwischen zwei Häusern lässt erkennen, dass in den Stumpf das Antlitz eines Gottes gemeißelt ist. Es ist Merkur, mit großen Flügeln an den Seiten seines Helms; seinem Mund entspringt ein Wasserstrahl. Tagsüber kommen Frauen, Kinder und Sklaven mit Holzeimern, um Wasser zu holen. Aber jetzt ist alles verlassen, und das Plätschern des Wassers ist das Einzige, was uns Gesellschaft leistet.
Seltsam, diese Stille – und etwas sehr Seltenes. Denn wir befinden uns mitten in einer Millionenstadt. Normalerweise werden nachts die Waren angeliefert, und die Metallbeschläge der Wagenräder rattern über das Straßenpflaster, es ertönen Schreie, Gewieher, die unvermeidlichen Flüche. Und genau diese Geräusche kann man in der Ferne hören. Irgendwo antwortet ein Hund mit seinem Bellen. Rom schläft nie.
Vor uns verbreitert sich die Straße ein bisschen und bildet dabei eine Oase des Lichts. Der Mond bescheint die Basaltplatten, die den Weg pflastern, und lässt sie fast so aussehen wie den Stein gewordenen Panzer einer riesigen Schildkröte.
Ein wenig weiter weg, am Ende der Straße, bewegt sich etwas. Es ist eine menschliche Gestalt, die innehält, dann etwas weiterläuft und sich schließlich schwankend an einer Mauer festhält. Das muss ein Betrunkener sein. Er brabbelt etwas Unverständliches vor sich hin und lenkt den schaukelnden Gang in Richtung einer Seitengasse. Wer weiß, ob er es bis nach Hause schafft. Tatsächlich sind die Straßen Roms des Nachts so furchterregend wie ein Raubtier auf nächtlichem Beutezug. Es gibt Diebe, Verbrecher und viele Verrückte, die nicht zögern würden, wem auch immer einen Dolch in den Bauch zu bohren, solange sie sich nur einen Gewinn davon versprechen. Wenn man bei Tagesanbruch einen erstochenen, ausgeraubten Mann findet, wird es schwierig werden, seine Mörder aufzuspüren, dafür ist die Stadt viel zu chaotisch und überbevölkert.
Bevor er in der Gasse verschwindet, stolpert der Betrunkene über ein Bündel an der Straßenecke. Er schimpft und nuschelt noch etwas, um dann seinen Weg fortzusetzen. Das Bündel bewegt sich, es ist lebendig: einer der vielen Obdachlosen der Stadt, der hier irgendwie zu schlafen versucht. Seit ein paar Tagen lebt er auf der Straße, nachdem der Eigentümer des schäbigen Zimmers, in das er sich eingemietet hatte, ihn rausgeworfen hat. Damit ist er nicht allein: Gleich neben ihm hat sich eine ganze Familie notdürftig eingerichtet, mit den paar Sachen, die sich noch in ihrem Besitz befinden. Rom ist zu bestimmten Zeiten des Jahres voll von solchen Leuten, weil am Ende jedes Halbjahres die Mietverträge erneuert werden. Viele Menschen finden sich von heute auf morgen auf der Straße wieder.
Auf einmal zieht ein gleichförmiger Krach unsere Aufmerksamkeit auf sich. Erst undeutlich, dann immer bestimmter. Sein Widerhall von den Häuserfassaden lässt uns nicht klar erkennen, aus welcher Richtung er kommt. Das plötzliche Geräusch eines Riegels, der zurückgeschoben wird, und das Licht einiger Öllampen erklären alles: die Patrouille der vigiles (Wächter) auf ihrem Rundgang. Wie kann man ihre Funktion erklären? Eigentlich sind sie Feuerwehrleute, aber da sie sowieso fortwährend Kontrollen machen müssen, um Brände zu verhindern, haben sie auch die Aufgabe, die öffentliche Ordnung zu überwachen.
Die vigiles sind militärisch organisiert, und das sieht man auch. Es sind neun an der Zahl: acht Rekruten in der Ausbildung und ein Ranghöherer. Schnell gehen sie die Stufen eines großen Bogengangs hinab. Sie haben die Befugnis, überall einzudringen, um Brandherde, gefährliche Situationen oder Unachtsamkeiten zu identifizieren, die eine Tragödie auslösen könnten. Gerade haben sie eine Inspektion durchgeführt, und der Vorgesetzte sagt etwas zu seinen Untergebenen. Er hält seine Lampe weit nach oben, damit die Rekruten ihn sehen können. Er hat eine massige Gestalt und harte Gesichtszüge, die gut zu seiner rauen Stimme passen. Als er mit seinen Erläuterungen fertig ist, fixiert er die anderen vigiles noch einmal mit dem durchdringenden Blick seiner dunklen Augen, die unter seinem Lederhelm hervorschauen, bellt einen Befehl, und alle setzen sich in Bewegung. Sie marschieren übertrieben exakt, was für frisch ausgebildete Rekruten typisch ist. Der Vorgesetzte sieht ihnen nach, schüttelt den Kopf und folgt ihnen. Das Geräusch ihrer Schritte entfernt sich langsam, bis es wieder von dem des Brunnens abgelöst wird.
Ein Blick nach oben verrät, dass der Himmel sich verändert hat. Er ist noch immer schwarz, aber man kann die Sterne nicht mehr sehen. Es ist, als bedecke ein hauchdünner, unsichtbarer Schleier nach und nach die Stadt und wolle sie vom Sternenhimmel trennen. In wenigen Stunden beginnt ein neuer Tag. Aber es wird ein Morgen sein, anders als alle anderen, in der Hauptstadt des mächtigsten Imperiums der Antike.
Die Ewige Stadt in Zahlen
Im zweiten Jahrhundert n. Chr. erlebt Rom seinen glänzenden Höhepunkt. Es ist wirklich der beste Moment, ihm einen Besuch abzustatten. Ebenso wie das Römische Reich hat auch seine Hauptstadt ihre größte geografische Ausdehnung erreicht: Sie umfasst ein Gebiet von 1800 bis 2000 Hektar, mit einem Umfang von etwa 22 Kilometern. Und das ist noch nicht alles. Sie zählt zwischen einer und anderthalb Millionen Einwohnern (nach manchen Schätzungen sogar zwei Millionen, also fast so viel wie zu modernen Zeiten!). Sie ist die bevölkerungsreichste Stadt der Erde und der gesamten Antike.
Eigentlich ist dieser Bevölkerungs- und Bauboom nicht verwunderlich: Rom ist seit vielen Generationen in kontinuierlicher Ausweitung begriffen. Jeder Herrscher hat die Stadt mit neuen Bauwerken und Denkmälern verschönert und ihr Gesicht dabei jedes Mal ein wenig verändert. Manchmal hat sie sich jedoch auch radikal verändert, nicht zuletzt aufgrund der recht häufigen Brände. Diese ständige Transformation Roms hat sich über die Jahrhunderte hinweg fortgesetzt, mit dem Ergebnis, dass es schon in der Antike ein wunderbares »Freilichtmuseum« voller Kunstwerke und architektonischer Schätze war.
Unter diesem Aspekt ist es eindrucksvoll, sich eine unter Kaiser Konstantin erstellte Liste der Gebäude und Monumente anzusehen. Sie wird natürlich hier nicht in ganzer Länge zitiert, aber selbst wenn man sich nur auf die wichtigsten Bauwerke beschränkt, gerät man ins Staunen – immerhin war die damalige Stadt noch sehr viel kleiner als heute:
40 Triumphbögen12 Foren28 Bibliotheken12 Basiliken11 große Thermen und fast 1000 öffentliche Bäder100 Tempel3500 Statuen berühmter Männer in Bronze und 160 von Gottheiten in Gold oder Elfenbein, zu denen noch 25 Reiterstatuen hinzukommen15 ägyptische Obeliske46 Lupanare (Bordelle)11 Aquädukte und 1352 Straßenbrunnen2 Arenen für Wagenrennen (die größte, der Circus Maximus, fasst beinahe 400 000 Zuschauer)2 Amphitheater für Gladiatorenkämpfe (das größte, das Kolosseum, bietet Platz für 50 000 bis 70 000 Zuschauer)4 Theater (das größte, das Theater von Pompeji, verfügt über 25000 Plätze)2 große Naumachien (künstlich angelegte Seen, auf denen Seeschlachten inszeniert wurden)1 Stadion für athletische Wettkämpfe (das Stadion des Domitian mit 30 000 Plätzen)und so weiter
Und wie steht es mit Grünflächen? Es ist wirklich unglaublich, aber in dieser mit Monumenten und Häusern dicht bebauten Stadt fehlte es daran nicht. Ein Viertel der Fläche Roms war mit Vegetation bedeckt, es gab also ca. 450 Hektar öffentliche und private Grünflächen, heilige Haine, Peristylen (»Innengärten«) von Patrizierhäusern etc.
Eine andere interessante Frage: Welche »Farbe« hatte Rom eigentlich? Welche Farbtöne sah man, wenn man die Stadt von Weitem betrachtete? Wahrscheinlich gab es zwei dominierende Farben: das Rot der Dachziegel und das strahlende Weiß des Marmors, der die Häuserfassaden und Kolonnaden der Tempel zierte. Hier und da hätte man unter all den rötlichen Ziegeln das eine oder andere grün-golden in der Sonne schimmernde Dach ausgemacht: die vergoldeten Bronzedachplatten der Tempel und einiger herrschaftlicher Gebäude. Mit der Zeit oxidierten sie und setzten eine grünliche Patina an. Sicherlich wären uns auch ein paar goldene Statuen auf den Spitzen von Säulen oder auf Tempeln aufgefallen, die aus der Stadt hervorragten. Weiß, Rot, Grün und Gold: Das waren die Farben Roms.
6.00 Uhr
Domus, die Wohnstatt der Reichen
Wo leben die alten Römer? Und wie sehen ihre Häuser aus? Aus Kino- und Fernsehfilmen sind wir an helle Häuser mit Säulengängen, Innengärten, mit Fresken verzierte Zimmer, kleine Brunnen und Triklinien (»Speisezimmer«) gewöhnt. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Nur die Reichen und Adligen, von denen es nicht viele gibt, können es sich leisten, in Villen mit Sklaven zu leben. Die überwältigende Mehrheit der Einwohner Roms lebt zusammengepfercht in großen Wohnquartieren, und das häufig unter schwierigen Bedingungen, die einen an die Armenviertel in Bombay denken lassen könnten.
Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit den Häusern, in denen die Elite Roms wohnt, den Häusern der Reichen, den sogenannten domus. Unter Kaiser Konstantin hat man in Rom 1790 davon gezählt, eine sicher beachtliche Zahl. Sie sahen nicht alle gleich aus: Manche waren groß, andere klein, was auf den chronischen Platzmangel im Rom Trajans zurückzuführen war. Das domus,1 das wir jetzt besuchen, hat aber die klassische, »antike« Gestalt, die ihrem Eigentümer vor Stolz die Brust schwellen lässt.
Was an diesem Stadthaus am meisten überrascht, ist sein Anblick von außen: Es scheint in sich selbst gekehrt zu sein, wie eine Auster. Und tatsächlich, man muss sich das typische römische Stadthaus wie eine kleine Festung der Fremdenlegion vorstellen: Es hat keine Fenster, höchstens ein paar kleine, immer ganz oben. Es hat keine Balkone, und seine Außenmauer schirmt es von der restlichen Welt ab. Seine Struktur spiegelt die der archaischen, mit einer Umfassungsmauer umgebenen familienbetriebenen Bauernhäuser aus den Anfängen der latinischen und römischen Kultur wider.
Der Abstand vom städtischen Chaos wird schon an der Eingangstür deutlich, die sich quasi anonym der Straße zeigt. Zu ihren Seiten befinden sich zahlreiche Läden, die aber um diese Uhrzeit alle noch geschlossen sind. Den Haupteingang bildet ein hohes, zweiflügliges Holztor mit großen Bronzebeschlägen. Im Zentrum jedes Flügels ist ein Wolfskopf angebracht, ebenfalls aus Bronze, der einen großen, als Türklopfer dienenden Ring im Maul hält.
Hinter dem Tor beginnt ein kurzer Korridor. Mit unseren ersten Schritten betreten wir ein Mosaik, auf dem ein bedrohlicher Hund abgebildet ist und darunter der Schriftzug Cave canem, Vorsicht vor dem Hund. Für dieses Motiv haben sich sehr viele entschieden, auch wenn wir es vornehmlich aus den Villen in Pompeji kennen. Tatsächlich waren auch schon zu Zeiten des Alten Roms Diebe und Hausierer ein Problem.
Nach wenigen Schritten erblicken wir auf einer Seite des Korridors ein kleines Zimmer, in dem ein Mann auf einem Stuhl eingenickt ist. Es ist der Portier des Hauses, der Sklave, der den Eingang bewacht. Neben ihm, wie ein Hund auf der Erde, schläft ein Junge: Es wird wohl sein Assistent sein. Im Haus schlafen noch alle; und das gestattet es uns, die Villa ungestört zu erkunden.
Nach ein paar weiteren Schritten öffnet sich der Korridor in einen mächtigen Raum: das Atrium. Es ist ein rechteckiger, großzügiger, bunter Saal, geschmückt mit lebhaften Fresken, die schon langsam vom Licht der Morgendämmerung erhellt werden. Doch woher kommt dieses Licht, wenn es doch keine Fenster gibt? Ein Blick nach oben gibt uns die Antwort: In der Mitte der Decke fehlt ein ganzes Stück vom Dach. Es ist eine große, quadratische Öffnung, in die das Licht fällt wie in einen Innenhof. Es ist eine wahre Kaskade aus Licht, die senkrecht ins Atrium fällt und sich dann seitlich in die verschiedenen Zimmer ergießt.
Aber diese Öffnung ist nicht nur dazu gedacht, das Licht hereinzulassen. Sie lässt auch noch etwas anderes herein, nämlich das Regenwasser. Wenn es regnet, sammeln sich die einzelnen Tropfen auf dem großflächigen Dach über dem Atrium und werden wie in einem Trichter in Richtung der Öffnung geleitet. Dort strömen Bäche von Wasser aus den Mündern einiger Tonfiguren, die längs der Dachränder aufgestellt sind, und fallen tosend ins Atrium hinab. Während eines Gewitters kann dieses Geräusch ohrenbetäubend sein.
All dies Wasser ist aber nicht vergeudet: Es fällt mit großer Präzision genau in die Mitte eines breiten quadratischen Wasserbeckens im Zentrum des Raums. Es ist das impluvium, eine sehr sinnvolle Erfindung der Antike: Es sammelt das Regenwasser und befördert es in eine unterirdische Zisterne, das Wasserreservoir des Hauses. Ein kleiner Ziehbrunnen entnimmt ihm das täglich benötigte Wasser, und das seit Generationen. Sein Rand hat schon tiefe Rillen vom Hochziehen des Seils.
Das impluvium hat aber auch eine dekorative Funktion: In ihm spiegeln sich der blaue Himmel und die Wolken, sodass es beinahe aussieht wie ein in den Boden eingelassenes Gemälde. Für jeden, der das Haus betritt, sei er Bewohner oder Besucher, ist es ein erster, sehr angenehmer Blickfang.
Aber das impluvium, das wir vor uns haben, hat sogar noch mehr zu bieten: Auf seiner Oberfläche schwimmen Blüten. Sie sind Überbleibsel des Banketts, das gestern Abend in diesem Haus gegeben wurde.
Wie ein Spiegel reflektiert das Wasser im Becken das frühe Morgenlicht überallhin. Die leichte Kräuselung des Wassers, ausgelöst von einer zarten Brise, wirft tanzende Wellen auf die Wände des Hauses, die sich in die Fresken mischen. Wenn man genau hinsieht, gibt es in diesem Raum keine einzige farblose Wand. Überall sind Tafeln mit mythologischen Figuren, kleinen Fantasielandschaften oder geometrischen Mustern angebracht. Die Farben sind leuchtend: Hellblau, Rot, Ockergelb.
Dies alles führt uns zu einer wichtigen Beobachtung: Die Welt der Römer ist sehr bunt, viel bunter als die unsere. Das Innere der Häuser, die öffentlichen Bauwerke, selbst die Kleider der Menschen sind extrem bunt. Letztere stellen zu wichtigen Gelegenheiten ein wahres Feuerwerk verschiedener Farbtöne zur Schau, während wir zumeist ein dunkles oder graues Kleidungsstück als Gipfel der Eleganz empfinden. Es ist schade, dass wir all diese Farbigkeit ganz verloren haben, vor allem auch in unseren Häusern, wo das Weiß der Wände dominiert. Ein alter Römer würde sie wie ein unbemaltes Gemälde empfinden, wie eine weiße Leinwand in ihrem Rahmen.
Setzen wir unseren Erkundungsgang fort. Zu den Seiten des Atriums öffnen sich einige Zimmer. Es sind die Schlafzimmer, die sogenannten cubicula. Im Vergleich zu unseren sind sie extrem klein und dunkel; sie erinnern eher an Zellen als an Schlafzimmer. Niemand von uns würde dort freiwillig schlafen: Es gibt keine Fenster, und als Beleuchtung dient nur das schwache Licht der Öllampen. So sind die meisterhaften Fresken oder Mosaiken nur vage zu erkennen, die diese Zimmer häufig schmücken und die sich heute in Museen befinden, wo sie hell erleuchtet werden. Die alten Römer haben sie nicht so gesehen. Wenn sich ihre Augen aber erst einmal an das Halbdunkel im cubiculum gewöhnt hatten, tauchten die Flämmchen der Öllampen diese Werke in stimmungsvolles Licht und hoben die Landschaften und dargestellten Gesichtszüge plastisch hervor.
In einem Winkel des Atriums beginnt eine Treppe: Sie führt ins obere Stockwerk, wo sich die Sklaven und ein Teil der weiblichen Familienangehörigen aufhalten. Das Erdgeschoss, sozusagen die »Beletage«, ist das Territorium der Männer und vor allem des pater familias (Hausvaters).
Wir gehen weiter, vorbei am Wasserbecken und hin zur gegenüberliegenden Wand. Sie ist zu großen Teilen von einer breiten Holztafel verdeckt, die sich durch Auffalten öffnen lässt. Wir rücken sie zur Seite. Hier befindet sich das tablinum, das »Büro« des Hausherrn. Hier empfängt er seine Klienten. In der Mitte thront ein großer Tisch mit einem beeindruckenden Sessel, während an den Seiten einige Schemel stehen. Alle haben gedrechselte und mit Knochen-, Elfenbein- oder Bronze-Intarsien verzierte Beine. Wir entdecken auch Öllampen auf hohen Kandelabern, ein Holzkohlebecken auf der Erde (an dem man sich aufwärmen kann), wertvolle Silbergegenstände auf dem Tisch, die zweifellos Wohlstand demonstrieren sollen, und Schreibinstrumente.
Durchqueren wir diesen Raum. Dahinter sehen wir einen großen Vorhang. Wir schieben ihn zur Seite und betreten den »intimsten« Teil des Hauses. Bisher haben wir nur den repräsentativen Bereich gesehen, der auch für Fremde einsehbar ist. Hinter dem Vorhang aber gelangt man in den privaten Bereich: das Peristyl, einen geräumigen Innengarten des domus, die kleine grüne Lunge des Hauses. Es ist von einem wunderschönen Säulengang umgeben, von dessen Decke zwischen den einzelnen Säulen Marmorscheiben hängen. In sie eingraviert sind bunte mythologische Figuren. Ihr Name ist bezeichnend, oscilla (Schwingungen), und der Grund dafür ist einsichtig: Wenn es windig ist, schwingen sie sanft hin und her und setzen der Strenge des Säulengangs etwas Bewegtheit entgegen.
Zu dieser frühen Morgenstunde herrscht im Peristyl eine sehr angenehme Atmosphäre. Man ist von einer außergewöhnlichen Vielfalt verschiedenster Gerüche umgeben, die von den Zierpflanzen und aromatischen Heilkräutern herrühren, die im Garten wachsen.
In diesen Gärten finden sich zum Beispiel Myrte, Buchsbaum, Lorbeer, Oleander, Efeu, Akanthus … Aber auch größere Pflanzen wie Zypressen und Platanen. Dazu kommen Blumen wie Veilchen, Narzissen, Lilien, Schwertlilien. Häufig begegnen einem auch weinbewachsene Pergolen. Das Peristyl ist wirklich eine Oase des Friedens. Eine Oase voller Kunstwerke: Die Pflanzen sind nicht willkürlich angeordnet, sondern geometrisch, in Laubengängen, Blumenrabatten und manchmal sogar kleinen Labyrinthen. Außerdem beschneiden die Gärtner die Pflanzen häufig so, dass sie aussehen wie Tiere. Und nicht selten trifft man zwischen den Pflanzen auch echte Tiere an wie Fasane, Tauben oder Pfauen.
Im Licht der Morgendämmerung machen wir zwei unbewegliche menschliche Formen aus: Es sind kleine Bronzestatuen, die die Ecken des Gartens zieren. Es handelt sich um zwei Putten, von denen jede eine Ente im Arm hält. Wir gehen näher heran. Eine von ihnen macht ein seltsames Geräusch, fast wie ein Gurgeln. Plötzlich, nach zwei kurzen blubbernden Spritzern, entströmt den Schnäbeln der Enten ein Wasserstrahl. Es sind Brunnenfiguren. Ihr Strahl trifft genau in eine runde Schale und kreiert damit ein kleines Wasserspiel. Es ist nicht das einzige. Wir wenden uns um: Im Garten steigt noch aus drei weiteren kleinen Brunnen ein Wasserstrahl auf.
Es ist klar, dass in diesem Haus das Wasser nicht nur aus dem impluvium kommt, sondern seit einiger Zeit auch woandersher: aus den Aquädukten. Dem Hauseigentümer ist es dank seiner Beziehungen und einer gehörigen »Spende« gelungen, sich eine eigene Leitung legen zu lassen. Er ist einer der wenigen Glücklichen, die in ihrem Haus fließendes Wasser haben. Ein seltener Fall in Rom. Und er nutzt sein Glück aus, um mit diesen kleinen Wasserspielen seine Gäste zu überraschen.
Es erscheint ein Sklave, der einen hinter den Pflanzen versteckten Wasserhahn schließt. Er ist groß, schlaksig, hat dunkle Haut, schwarze Locken und kommt ganz sicher aus dem Orient oder aus Nordafrika. Jetzt sammelt er vertrocknete Blüten und Blätter ein. Es muss der Gärtner sein.
Aus einem kleinen Raum auf der anderen Seite des Säulengangs dringen Fegegeräusche. Wir folgen ihnen, sie kommen aus dem Triklinium. Hier wurde gestern Abend das Bankett abgehalten. Die Liegen, auf denen sich die Gäste ausgestreckt hatten, sind schon wieder in Ordnung gebracht worden, die schmutzigen Laken durch frische ersetzt. Ein weiterer Sklave beseitigt die letzten Überreste der Nacht. Er sammelt auch die Scheren von Krustentieren ein. Es ist üblich, während eines Banketts die Speisereste nicht auf den Teller zu legen, sondern auf den Boden zu werfen.
Auch in der Küche hört man schon jemanden arbeiten. Es ist eine Frau, ebenfalls eine Sklavin. Ihre Haare werden von einem Kopftuch aus Lumpen zusammengehalten, aber man kann sehen, dass sie blond ist: An ihrem Hals sind ein paar goldene Locken sichtbar. Vielleicht kommt sie aus Germanien oder auch aus Dakien (dem heutigen Rumänien), einer neuen Eroberung Trajans. Der Raum ist sehr klein. Seltsamerweise messen die alten Römer, die ja berühmt für ihre Bankette sind, der Küche keine große Bedeutung bei; sie betrachten sie als einen unwichtigen Raum. Sie hat eine ähnliche Funktion wie unsere heutige Küchenzeile, daher ist ihr kein bestimmter Platz im Haus zugeordnet. Manchmal findet man sie hinten in einem kleinen Korridor, manchmal auch im Raum unter einer Treppe. Wirklich sehr eigenartig, aber es gibt keinen Grund, sich zu wundern: In den Häusern der Reichen existiert so etwas wie die »Hausfrau« nicht. In der Küche arbeiten die Sklaven, sie ist also ein reiner Nutzraum, folglich macht man sich nicht die Mühe, sie gemütlich oder geräumig einzurichten oder zu dekorieren. In den Haushalten der unteren Bevölkerungsschichten hingegen kocht die Frau, aber ihre Stellung ähnelt eher der einer Dienstmagd als der einer Ehefrau.
Ein sehr vertrauter Anblick in den römischen Küchen ist das Kupfergeschirr: Die Pfannen und Töpfe aus Kupfer (oder auch aus Bronze) sind an der Decke aufgehängt und geben ein schönes Bild ab. Hier und da sieht man Siebe mit so feinen Maschen, dass sie fast wie Schmuckstücke wirken. Dann gibt es noch Marmorstößel, Spieße, Tonpfannen, aber auch Backbleche in Fisch- oder Kaninchenform, in die sehr beliebte Gerichte gefüllt werden. Die Form dieser Gegenstände zu betrachten ist, als würde man eine Speisekarte aus jener Zeit studieren.
Das Essen wird auf einem gemauerten Herd gekocht. Er wird mit Holzkohle gefüllt, wie bei einem Barbecue. Wenn die Glut angefacht ist, wird ein Grillgitter darübergelegt oder ein Dreifuß aufgestellt, und darauf kommen dann die Pfannen und Töpfe.
Sehr oft stehen diese Steinöfen auf kleinen gemauerten Bogen, die als Holzspeicher fungieren. Hier bewahrt man das Holz auf, um es zum Gebrauch bereitzuhalten; sozusagen die antike Form der Gasflaschen.
Jetzt zündet die Sklavin das Feuer an. Aber wie machen das die alten Römer? Wir gehen näher hin und sehen ihr neugierig über die Schulter: Und so entdecken wir, dass sie einen Feuerstein benutzt. Er hat die Form eines kleinen Hufeisens, und sie hält ihn so, wie man den Henkel eines Kruges umgreift. Mit ihm schlägt sie gegen ein Stück Quarz, das sie mit der anderen Hand fest umklammert. Man sieht Funken sprühen, und einer davon trifft ein dünnes Stück Pilz, der als Zunder dient (er gehört botanisch zu den Fomes, einer holzigen Pilzart, die auf Bäumen wächst). Das Mädchen pustet vorsichtig darauf, und der Zunderschwamm beginnt zu glühen: Jetzt nimmt sie etwas Stroh zur Hand, um es mit der Glut des Pilzes anzustecken. Sie pustet weiter. Erst geht vom Stroh eine Rauchwolke aus, dann plötzlich eine züngelnde Flamme. Es ist geschafft. Jetzt kann sie den Grill in Gang setzen.
Halten wir einen Moment inne. Der Besuch des domus hat uns einiges über die Gewohnheiten der alten Römer gelehrt: Es sind wunderschöne Häuser, sicherlich, aber sie sind auch weniger komfortabel als unsere. Im Winter ist es kalt, es zieht überall, und man muss sich mithilfe der in den Zimmern aufgestellten Holzkohlebecken warm halten (dem Äquivalent unserer kleinen Elektroöfen). Außerdem sind die Häuser dunkel, in allen Zimmern ist es schummrig. In den seltenen Fällen, wo es Fenster gibt, sind sie kleiner und weniger durchscheinend als unsere: Die »Scheiben« bestehen aus Talk oder Glimmer oder mitunter auch Glas, während die Armen sich mit durchscheinenden Fellen, wenn nicht gar mit Holzläden behelfen.
Folglich wird man, wenn man sich das Leben in römischen Häusern vorstellen will, auch in denen der Reichen wie diesem, an die Bauernhäuser unserer Zeit erinnert, an breite Betten mit dicken Decken, Türen, durch deren Ritzen das Licht fällt, an den Geruch von Brennholz, an Staub und Spinnweben.
6.15 Uhr
Der Einrichtungsstil der Römer
Im Haus beginnt das tägliche Leben. Wie jeden Morgen sind die Sklaven als Erste auf den Beinen. Es gibt deren elf, und sie bilden das, was man die familia nennt, also die Gesamtheit der Sklaven im Besitz eines Hausherrn. Das mag viel erscheinen für ein einziges Haus, ist aber durchaus gewöhnlich. Jede wohlhabende römische Familie hat im Durchschnitt zwischen fünf und zwölf Sklaven!
Aber wo schlafen sie alle? Denn im Grunde geht es ja darum, eine ganze Fußballmannschaft in einem Haus unterzubringen … Die Sklaven haben keine eigenen Zimmer. Sie schlafen in den Fluren, in der Küche oder alle zusammen in einem kleinen Kämmerchen. Der, dem man am meisten traut, schläft auf dem Boden vor dem Schlafzimmer des dominus, genau wie ein Hund bei seinem Herrchen.
Im Laufe des Vormittags werden wir noch Gelegenheit haben, die Welt der Sklaven besser zu verstehen: wer sie sind, wie sie in Sklaverei gerieten und wie sie von ihren Herren behandelt werden. Aber jetzt erkunden wir erst einmal weiter das langsam zum Leben erwachende Haus.
Eine Sklavin schiebt einen schweren, purpurfarbenen Vorhang beiseite und nähert sich einem Marmortisch mit Füßen in Delfinform. Er steht direkt neben dem Beckenrand des impluvium. Es ist eindeutig ein repräsentatives Möbelstück, erst recht, wenn man sich auch den silbernen Krug ansieht, der ihn ziert und den die Sklavin gerade vorsichtig hochhebt, um ihn abzustauben. Wir blicken uns um. Wo ist der Rest der Einrichtung?
Was bei römischen Häusern am meisten verwundert, ist der Kontrast zwischen der Üppigkeit der Wanddekorationen in Form von Fresken und Mosaiken und der Kargheit des Mobiliars. Im Grunde stellt dies das genaue Gegenteil zu unseren modernen Häusern dar. Es fehlen tatsächlich die üblichen Sofas, Sessel, Teppiche und Regale, die unsere Wohnzimmer füllen. Man hat den Eindruck, als stünde man in einem kahlen Raum, der auf das Nötigste reduziert ist.
Die alten Römer richten ihre Häuser vollkommen anders ein als wir. Anstatt ihre Möbel und die Inneneinrichtung ihrer Zimmer sichtbar herauszustellen, verstecken sie sie für gewöhnlich und reduzieren sie auf ein Minimum. Betten und Stühle zum Beispiel verschwinden häufig unter Kissen und Tüchern. Im Gegenzug zieren die Wände oft falsche Türen, fingierte Vorhänge, sogar gemalte Landschaften (die sich vielleicht mit echten Maueröffnungen zum Garten hinaus abwechseln: In dieser Hinsicht ist die berühmte Villa Oplontis in Torre Annunziata, in der vielleicht Poppaea Sabina, die zweite Frau Kaiser Neros, gewohnt hat, ein wahres Meisterwerk).
In vielen domus ist dieser eigenartige Geschmack der Römer spürbar: die Lust am Spiel mit Wirklichkeit und Illusion, am Verschwindenlassen von Gegenständen und Erschaffen von anderen, bis hin zu ganzen Landschaften an den Wänden. Angesichts der Zeit eine extrem raffinierte und »moderne« Vorliebe.
Das wenige Mobiliar allerdings, das man in römischen Häusern findet, ist erlesen. Tische sind die vielleicht gängigsten Einrichtungselemente. Es gibt sehr viele verschiedene Arten; die häufigste Tischform ist rund mit drei Beinen in Katzen-, Ziegen- oder Pferdefußform (die drei Beine sind kein Zufall, sondern die einfachste Lösung, damit ein Tisch nicht wackelt).
Wir sind überrascht zu sehen, dass es schon in der Antike für vieles »moderne« Lösungen gab, wie zum Beispiel Klapptische oder halbrunde Modelle, die man an die Wand schieben konnte. Beeindruckend sind auch die Stühle: Sie sind alles andere als bequem! Die alten Römer kennen keine Polstertechnik, so wie wir sie heute für Sessel und Sofas anwenden. Aber diesem Mangel begegnen sie mit Kissen. Sie sind wirklich überall: auf den Betten, den Triklinien, den Stühlen.
In diesem Haus mag einem ein Schrank in einer Ecke normal erscheinen, in Wirklichkeit aber ist dies für die Antike eine neue »Erfindung«. Die alten Römer waren in der Tat die Ersten, die Schränke benutzten; den Griechen und Etruskern waren sie unbekannt. Kurioserweise benutzen sie sie aber nicht so wie wir, um Kleidung darin unterzubringen. Sie heben darin in erster Linie empfindliche oder kostbare Gegenstände auf wie Kelche und Glasschalen, Toilettenartikel, Tintenfässer, Waagen usw.
Kleidung und Wäsche werden in speziellen Möbelstücken aufbewahrt, den arcae vestiariae. Dabei handelt es sich um Holztruhen mit kleinen Löwenfüßen. Diese Art Möbel wird man viele Jahrhunderte lang benutzen, das ganze Mittelalter hindurch und bis zur Renaissance.
Vorhänge spielen in der Einrichtung des herrschaftlichen Hauses eine große Rolle. Sie schützen vor Sonne und Wind, sie erschaffen kleine warme Inseln im Winter und kühle im Sommer, sie halten Staub, Fliegen und indiskrete Blicke fern. In diesem Zusammenhang hat man bei Ausgrabungen in den Ruinen eines römischen Hauses in der türkischen Stadt Ephesos, die von einem Erdbeben zerstört und jahrhundertelang verschüttet war, eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Während der Grabungsarbeiten haben die Archäologen sehr viele interessante Einzelheiten in Sachen römischer Einrichtungsgewohnheiten entdeckt. Im Säulengang, der den Garten dieses aristokratischen Hauses umgab, dem Peristyl, konnte man noch die Reste eines Systems aus Bronzestangen erkennen, mit deren Hilfe zwischen den einzelnen Säulen Vorhänge eingezogen wurden. Tatsächlich schloss man den Säulengang mit einem Vorhang ab und schuf damit einen kühlen, schattigen Laubengang, durch den man während der heißen Sommer in Ephesos wandeln konnte. Andere Bronzestangen, die über den Türpfosten angebracht waren, bestätigen die Vermutung, dass die Nutzung von Vorhängen, ähnlich wie man sie heute an Eingängen zu Lokalen oder Geschäften hat, verbreitet war (es ist nicht auszuschließen, dass einige Vorhänge im Alten Rom aus bunten Stoffstreifen bestanden oder aus langen Kordeln mit vielen Knoten, wie wir sie heute noch kennen).
Bleibt noch hinzuzufügen, dass es in dem römischen domus zuweilen auch sehr dekorative Wandbehänge, Bodenmatten und sogar Teppiche gab, aber das war eine Modeerscheinung, die eindeutig aus dem Orient kam.
Silbergeschirr, Tresore und Antiquitäten
Im Haus der Reichen haben einige Einrichtungsgegenstände die Bedeutung eines Statussymbols, unter ihnen Büsten oder Statuen aus Marmor und natürlich Silbergeschirr, das immer in Sichtweite ist. Ganze Service, Krüge und Schalen werden auf extra dafür vorgesehenen Tischen ausgestellt, damit Gäste und Besucher sie bewundern können.
Wer sich kein Silberzeug leisten kann, nimmt mit Objekten aus Bronze, Glas oder hochwertiger Keramik vorlieb. Auf jeden Fall aber muss irgendetwas zur Schau gestellt werden, das ist eine soziale Norm. Im Grunde ist dies eine Gewohnheit, die sich bis in unsere Zeiten gehalten hat: Der Brauch, sein »gutes Service« im gläsernen Geschirrschrank im Wohnzimmer aufzubewahren, ist immer noch weit verbreitet.
Ein anderes Statussymbol einer gut situierten Familie ist ihr Tresor. Während wir unseren Safe lieber in der Wohnung verstecken, gilt für die alten Römer genau das Gegenteil: Der Geldschrank steht häufig an einem Ort, an dem ihn alle bewundern können, wie zum Beispiel im Atrium.
Er ist Zeichen von Wohlstand und Reichtum. Selbstverständlich ist er sehr sicher im Boden oder an der Wand angebracht, und es wird sogar extra ein Sklave bestimmt, der atriensis, dessen Aufgabe es ist, wie ein Nachtwächter die Bewegungen der Menschen im Raum zu überwachen, besonders wenn Unbekannte kommen, um mit dem Hausherrn über Berufliches zu sprechen, oder wenn Feste oder Bankette abgehalten werden.
Der Tresor ist kein Safe im eigentlichen Sinne, sondern erinnert eher an eine gepanzerte Truhe mit Metallbeschlägen. Aber er hat ein äußerst raffiniertes Verschlusssystem, das eines James Bond würdig wäre: falsche Bronzegriffe, Hebel oder Ringe, an denen man vergeblich ziehen würde … Und hat man ihn erst einmal geöffnet, was sieht man dann in seinem Inneren? Sicherlich die wertvollsten Gold- und Silberschätze der Familie, aber auch die wichtigsten Dokumente wie Testamente, Verträge, Besitzurkunden, die alle auf Holztäfelchen oder Papyri geschrieben sind und stets das mit dem Ringsymbol des Hausherrn versehene Siegel tragen (heute würden wir »Logo« dazu sagen).
Eine verblüffende Tatsache am Rande: Schon im Alten Rom findet man Geschmack an Antiquitäten, also an alten Objekten und kleinen Meisterwerken der Vergangenheit, die man im Haus ausstellt. Aber da wir uns ja schon in der Antike befinden, welche Gegenstände gelten dann als »antik«? Die Antwort darauf haben die Archäologen gefunden. Bei ihren Ausgrabungen sind sie auf Statuetten, Spiegel und etruskische Schalen gestoßen, die auch damals schon als antike, wertvolle Stücke galten. Außerdem hat man Objekte aus dem alten Ägypten entdeckt. Für einen Römer der Trajanzeit war die altägyptische Zivilisation tatsächlich eine wahre »Antike«: Ramses II zum Beispiel lebte 1400 Jahre vor ihm! Eine gar nicht so viel kürzere Zeitspanne als die, die uns von dem Rom trennt, das gerade unser Thema ist.
Der Ursprung unserer Mehrfamilienhäuser
Eine letzte Anmerkung. Das Patrizierhaus, das wir soeben besucht haben, hat einen »klassischen« Grundriss ähnlich dem, den Touristen an Ausgrabungsstätten wie Pompeji zu Gesicht bekommen. Aber in einer Stadt wie Rom, die wegen ihrer baulichen Enge nicht viel Platz bietet, können nicht alle Häuser diese Form haben. Eine Überraschung hat sich bei den Ausgrabungen und Untersuchungen des nahe gelegenen Ostia Antica ergeben, die Prof. Carlo Pavolini geleitet hat. Hier sind die Häuser (Ergebnis einer städtischen Neuplanung in trajanischer Zeit, also genau der Epoche, die wir hier betrachten) im Gegensatz zu Rom, wo alles über die Jahrhunderte hinweg immer wieder mit neuen Konstruktionen überbaut wurde, noch gut sichtbar.
Dort ist man auf Häuser ohne Atrium gestoßen, also ohne den großen Saal mit dem Regenwasserbecken. Der chronische Platzmangel und das Vorhandensein von Aquädukten in der Stadt (die den eigenen Brunnen im Haus überflüssig machten) haben die Hausbesitzer oft dazu veranlasst, diesen Raum einfach wegzulassen.
Woanders, wie zum Beispiel in Pompeji, tauchen sogar zweite Stockwerke mit eigenem Eingang auf. Man kann sich vorstellen, dass wohlhabende Familien Mieter in den oberen Stockwerken nicht ungern gesehen haben. Man büßte vielleicht ein bisschen seiner Privatsphäre ein, kassierte dafür aber saftige Mieten.
Diese Häuser wurden irgendwann nicht mehr nur noch von der Elite bewohnt, sondern bevölkerten sich nach und nach auch mit Vertretern der mittleren und unteren Schichten. Das Leben in der Stadt hat schließlich im Laufe der Generationen eine fundamentale Veränderung der Häuser mit sich gebracht und führte dazu, dass die Gebäude immer höher wurden, immer mehr Stockwerke bekamen, immer mehr voneinander unabhängige Apartments für immer mehr Familien bis hin zur Entstehung richtiger Mietshäuser.
Die Mehrfamilienhäuser von heute, in denen viele von uns wohnen, haben ihre Wurzeln also in diesen 2000 Jahre alten weiterentwickelten Wohnformen Roms und anderer wichtiger Städte des römischen Imperiums.
6.30 Uhr
Der dominus erwacht
Aus dem Zimmer des dominus, des Hausherrn, dringt tiefes Schnarchen. Langsam schieben wir die Tür zur Seite, und ein Lichtstrahl fällt in den Raum und auf ein Bett, das in einer Art in die Wand eingelassener Nische steht. Der Hausherr liegt darin. Er ist in bestickte, purpurfarben, blau und gelb gestreifte Decken gehüllt, die bis zur Erde fallen und dabei viele Falten schlagen.
Wir wundern uns über die Größe des Bettes. Es ist traditionell sehr hoch, so hoch, dass man einen kleinen Schemel braucht, um hineinzusteigen. Da steht auch der Schemel, halb begraben unter Decken, und obenauf liegen noch die Sandalen des Hausherrn, die er sich ausgezogen hat, bevor er unter die Decken geschlüpft ist.
Es ist ein Bett mit drei Lehnen, nach alter Art, und sieht ein bisschen aus wie ein Sofa. Die Holzbeine sind gedrechselt und mit Elfenbeinintarsien und vergoldeten Bronzeplaketten verziert. Am Kopf- und Fußende heben sich Katzen- und Satyrköpfe ab, die vom schräg einfallenden Licht beschienen werden. Es gibt keine Sprungfedern, die Matratze ruht auf Lederriemen, dem Rost des Bettes. Diese Betten sind definitiv unbequemer als die unseren.
Der dominus wälzt sich herum, brummt etwas und rückt das Kissen zurecht. Sein Kopf versinkt fast vollständig darin. Es muss sich also um ein Federkissen handeln. Aber womit füllen die alten Römer ihre Matratzen? Soviel man heute weiß, mit Stroh oder auch mit Wolle, wie dieses hier.
Doch es gibt auch Ausnahmen, wie den Fall einer unglaublicherweise erhalten gebliebenen Wiege in Herculaneum. Unter dem Skelett eines Säuglings, der beim Ausbruch des Vesuvs ums Leben kam, hat man Reste einer mit Blättern gefüllten Matratze gefunden (es ist nicht auszuschließen, dass die Blätter eine schützende Funktion für die Gesundheit des Neugeborenen hatten oder eine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme bildeten).
Der dominus befindet sich allein im Zimmer, wo ist seine Frau? In unserer heutigen Gesellschaft schlafen Mann und Frau gewöhnlich in einem Bett. Im Alten Rom ist das nicht immer so. Normalerweise schlafen Eheleute zwar in Ehebetten, aber unter wohlhabenden Paaren gilt es als vornehm, in getrennten Betten zu schlafen. Also schläft die Frau des dominus (die domina) in ihrem eigenen cubiculum.
Es ist Zeit aufzustehen. Die Römer stehen früh auf, im Morgengrauen, und gehen früh zu Bett. In einer Epoche, in der es noch keine Elektrizität gibt, folgt man dem natürlichen Rhythmus der Sonne. Und so wird es über viele Jahrhunderte bleiben. Im Grunde sind wir es, die die Ausnahme bilden.
Der treueste der Sklaven ist mit der Aufgabe betraut, seinen Herrn behutsam zu wecken. Nach ein paar Minuten verlässt dieser noch etwas verschlafen sein Zimmer. Er ist ein großer, stämmiger Mann mit grauen Haaren und blauen Augen. Die hervorspringende Nase betont die Vornehmheit seines Gesichts.
In edles blaues Tuch gehüllt, geht er langsam auf ein kleines Holzobjekt zu, das an einer Wand angebracht ist. Es sieht aus wie ein kleiner Schrein, hat eine dreieckige Giebelfläche, ein sogenanntes Tympanum, und wird von zwei Säulen gestützt. Es ist die heilige Stätte des Hauses: das Lararium. Hier werden die Laren verehrt, die Schutzgötter der Familie. Sie werden von zwei Figuren in der Mitte des Schreins dargestellt: Es sind zwei tanzende, langhaarige junge Männer. Daneben stehen Statuen von zwei weiteren Göttern: Merkur und Venus. Der Sklave reicht seinem Herrn einen kleinen Teller mit Opfergaben. Der dominus legt sie mit feierlicher Geste vor den Statuetten in eine Schale ins Lararium und spricht dabei rituelle Sätze. Dann verbrennt er bestimmte Essenzen.
Jeder Morgen beginnt mit diesem Ritual. Und dasselbe passiert in tausenden anderen Haushalten. Man darf die Macht dieser kleinen Gottheiten nicht unterschätzen. Denn sie sind es, die die Aufsicht über die Angelegenheiten des täglichen Lebens in den römischen Häusern haben. Das Ritual ist also gleichbedeutend mit einer Versicherung gegen Diebstahl und Hausbrand und bewahrt die einzelnen Familienmitglieder vor Schicksalsschlägen.
7.00 Uhr
Die römische Art, sich zu kleiden
Es ist Zeit, sich anzuziehen. Wie kleiden sich die alten Römer? Aus Fernsehen und Kino kennen wir sie eingehüllt in bunte, lakenähnliche Togen. Aber tragen sie die immer? Einem ersten Impuls folgend könnte man meinen, diese Gewänder seien unbequem, behinderten einen in seinen Bewegungen und ließen es nicht zu, darin zu laufen, Treppen zu steigen oder auch nur sich zu setzen, ohne sich in ihnen zu verfangen. In Wirklichkeit sind sie aber sehr bequem. Es gibt sogar noch heutzutage Leute, die sich so anziehen: Blickt man nach Indien oder in andere asiatische oder auch arabische Länder, begegnet einem im Grunde ein dem römischen nicht unähnlicher traditioneller Kleidungsstil: lange Gewänder, Tuniken, Roben und Sandalen. Es ist alles nur eine Frage der Gewohnheiten.
Beginnen wir mit der Unterwäsche. Tragen die alten Römer Unterhosen? Die Antwort lautet ja. Es sind keine Unterhosen, wie wir sie kennen, sondern eine Art Lendenschurz aus Leinen, genannt subligaculum, den man sich um die Hüfte schlingt und um seinen Schambereich wickelt.
Es mag verwundern, dass er nicht immer das Erste ist, was man morgens anzieht. Es ist nämlich ziemlich üblich, sich nicht ganz auszuziehen, wenn man zu Bett geht, sondern dies noch halb bekleidet zu tun. Man zieht sich den Umhang aus, legt ihn auf einen Stuhl (oder benutzt ihn als Decke) und lässt den Lendenschurz und die Tunika an. Und so geht man dann zu Bett. Die Tunika, die man tagsüber getragen hat, fungiert also zugleich als Pyjama. Das mag uns als eine wenig hygienische Angewohnheit erscheinen, aber eigentlich hat man das bis ins letzte Jahrhundert bei uns auf dem Land auch so gemacht. Mit einem Unterschied: Die alten Römer sind sehr viel sauberer, weil sie jeden Tag in die Thermen gehen. Also hat man sich, einige Stunden bevor man ins Bett geht, gründlich gewaschen. Das Problem ist nur, dass die Kleidung dreckig bleibt.
Kein reicher Römer würde das Haus ohne seine Toga verlassen. Sie ist so lang (bis zu sechs Meter), dass es häufig der Hilfe eines Sklaven bedarf, um sie anzulegen. Entscheidend für das Maß der Eleganz ist, wie sorgfältig die Falten gelegt sind.
Das wichtigste Grundkleidungsstück der römischen Mode ist die berühmte Tunika. Wie praktisch sie ist, versteht man, wenn man sich vorstellt, man würde einen knielangen Pullover anziehen (sagen wir: der Größe XXL) und dann auf Taillenhöhe einen Gürtel darumlegen. Bis auf ein paar Details ist die Tunika mehr oder weniger genau das. Eigentlich benutzen wir im Grunde immer noch (besonders im Sommer) eine ähnliche Kleiderform wie in der Antike. Wir haben ihr nur einen anderen Namen gegeben: T-Shirt.
Selbstverständlich sind die Materialien nicht dieselben. Während wir Baumwolle benutzen, trägt der Römer gewöhnlich Leinen oder Wolle. Ungefärbte Wolle, die von einem intensiven Beige ist: genau die richtige Farbe, um Staub und Flecken zu vertuschen.
Das Leinen hat eine Besonderheit: Es wird vornehmlich in Ägypten hergestellt und gewebt, von wo aus es dann in das gesamte Römische Reich exportiert wird. Folglich kleidet sich jeder Römer (ein bisschen wie wir) in Gewänder, die in fernen Ländern produziert wurden, was eine Begleiterscheinung der ersten großen »Globalisierung« der Geschichte darstellt, die von Rom ausging und in den gesamten Mittelmeerraum ausstrahlte. Wir werden dieses Thema noch vertiefen, wenn wir die Märkte des Imperiums besuchen.
Die Tunika trägt man zu jeder Gelegenheit. Man benutzt sie als Nachthemd, als Unterkleid für die Toga oder – in den niederen Schichten – als Hauptkleidungsstück. Die Armen ziehen sie an, schlüpfen in ihre Sandalen und verlassen das Haus. Die Reichen nicht, denn jetzt ist der Moment gekommen, wo sie sich das bedeutendste Kleidungsstück des römischen Bürgers anziehen, die Toga.
Man könnte sie als »Anzug und Krawatte« der Antike bezeichnen, also als repräsentative Kleidung, mit der man sich in der Öffentlichkeit zeigt, besonders bei wichtigen Anlässen. Sie wird schon seit der frühesten Antike getragen und hat im Laufe der Zeit eine starke Entwicklung durchgemacht. Am Anfang war sie noch relativ klein, wurde dann aber immer größer. Wenn man sie auf dem Boden ausbreitet, hat sie die Form eines Halbkreises (aus Leinen oder Wolle) und einen Durchmesser von sechs Metern!
Es überrascht also nicht, dass häufig die Hilfe eines Sklaven nötig ist, um sie anzulegen. So wie gerade bei unserem dominus. Ihm beim Ankleiden zuzusehen, wird uns helfen zu verstehen, wie das funktioniert.
Der Hausherr steht unbeweglich da und fixiert einen unbestimmten Punkt in der Ferne. Der Sklave legt ihm die Toga auf die Schultern, fast so, als sei sie eine Decke, wobei er darauf achtet, sie nicht genau mittig zu teilen, sondern so, dass ein sehr viel längeres Stück übrig bleibt, das bis zum Fußboden reicht. Vorsichtig nimmt er dieses Stück auf und führt es von hinten unter den Achseln durch und vorn wieder über den Oberkörper bis zum Hals, wie einen Patronengurt. Dann bindet er es noch einmal wie einen Schal um den Hals herum und befestigt es auf Höhe des Schlüsselbeins mit einer Sicherheitsnadel.
Aber das reicht noch nicht. Das verbleibende Stück ist immer noch so lang, dass es ein weiteres Mal um den Oberkörper herumgelegt werden muss. Zum Schluss tritt der Sklave einen Schritt zurück, um sein Werk zu prüfen. Er ist zufrieden. Sein Herr ist nun sehr elegant, vor allem wegen des gelungenen Faltenwurfs, der ihm ein nobles Aussehen verleiht. Einer seiner Arme ist frei, während der andere halb von Tuch bedeckt ist. Der dominus muss es immer ein bisschen hochhalten, um zu vermeiden, dass die Toga über den Boden schleift und schmutzig wird. Das ist etwas unbequem, aber man gewöhnt sich schnell daran.