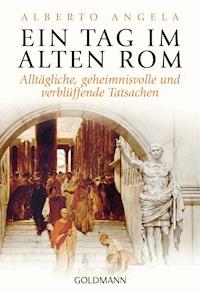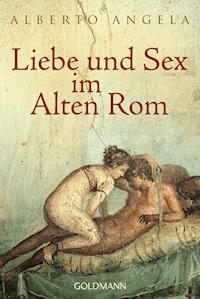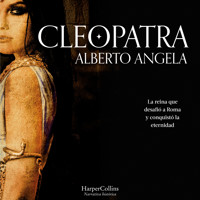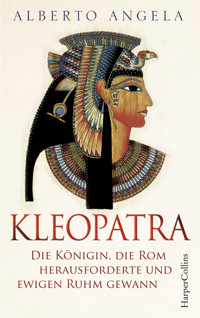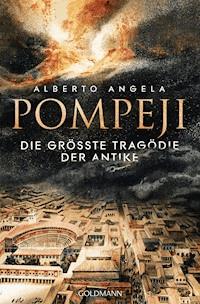
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch nie wurde das Leben in der antiken Stadt kurz vor dem Untergang so anschaulich und unmittelbar erzählt
Am 23. Oktober 79 n. Chr. feiert die illustre Gesellschaft Pompejis ein opulentes Fest. Der bebende Vesuv wird das bunte Treiben jäh beenden. Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse rekonstruiert der renommierte Wissenschaftsjournalist Alberto Angela in einem hochspannenden Countdown Stunde um Stunde den Untergang der Stadt, den eine Handvoll Menschen tatsächlich überlebte.
Alberto Angela führt durch belebte Gassen, in prächtige Salons, kleine Läden und an erst kürzlich versiegte Brunnen. Eine sinnliche Reise in die Welt der Antike, die tiefen Einblick gibt in das faszinierende Alltagsleben am Golf von Neapolis vor 2000 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Am 23. Oktober 79 n. Chr. lädt eine reiche und elegante Adelige aus Herculaneum zu einem opulenten Bankett in ihre Villa ein. Ein ehrgeiziger Politiker, eine berühmte Schauspielerin, ein skrupelloser Geschäftsmann … die illustre Gesellschaft Pompejis trifft sich zu heiterer Zerstreuung.
Nur vierundzwanzig Stunden später sollte die größte Naturkatastrophe der Antike das bunte Treiben jäh beenden. Der bebende Vesuv entlädt sich mit gewaltiger Kraft und begräbt die Stadt und Tausende Menschen in einem höllischen Inferno unter vulkanischem Steinhagel, Asche und Lavaschlamm.
Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erzählt Alberto Angela so anschaulich und sinnlich wie keiner vor ihm vom tragischen Ende einer wundervollen, einzigartigen Stadt und ihrer Bewohner. Er rekonstruiert die letzten Stunden im Leben einiger real existierender historischer Persönlichkeiten aus Pompeji und dem angrenzenden Herculaneum im Reportage-Stil ganz unmittelbar und lebendig. Wir tauchen ein in die Atmosphäre der Hafenstadt, ihre Farben, Geräusche und Gerüche, und wir begleiten die Personen Schritt für Schritt auf ihren mutmaßlich letzten Wegen. Eine atemberaubend emotionale Reise in die Welt der Antike, die tiefen Einblick gibt in das faszinierende Alltagsleben am Golf von Neapolis vor 2000 Jahren.
Weitere Informationen zu Alberto Angela sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Alberto Angela
POMPEJI
Die größte Tragödie der Antike
Aus dem Italienischen von Elisabeth Liebl
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel»I tre giorni di Pompei« bei Rizzoli, Mailand.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. AuflageCopyright © der Originalausgabe 2014 by RCS Libri S.p.A., Milano.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur München
Covermotiv: Getty Images (DEA/G. DAGLI ORTI) und Getty Images (Louis Jean Desprez)
Redaktion: Ralf Lay
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17945-8V002
www.goldmann-verlag.de
NUNC EST IRA RECENS NUNC EST DISC(EDERE TEMPUS)SI DOLOR AFUERIT CREDE REDIBIT (AMOR)
Jetzt ist der Zorn noch frisch, jetzt ist es Zeit zu gehen.Ist der Schmerz erst überwunden, glaub mir, wird die Liebe zurückkehren.
Properz1Graffito auf einer Mauer in Pompeji
Inhalt
Pompeji: Karte der Ausgrabungen
Karte: Küstenregion um den Vesuv
Bevor Sie zu lesen beginnen: Auf ein Wort!
Dramatis personae
»Erzähle, Rectina!«
Die Aristokratin und der General
Traumvillen
Das Bankett: Wer überlebt, wer stirbt?
Pompeji erwacht
Schönheitspflege in Pompeji
Licht über der Stadt
Das »Beverly Hills« von Pompeji
Die pompöse Behausung zweier ehemaliger Sklaven
Ein Hotel in Pompeji
Panta rhei – alles fließt … bis aufs Wasser
Gespräch auf dem Forum
Machinationen in der Stadt
Cäsarmörder, indische Götter und leichte Mädchen
Alles, was ich dir nie gesagt habe …
Herculaneum: die Perle am Golf
Verabredung in der Villa der Papyri
Das Landhaus mit dem Schatz
Wein fürs Imperium
Spielhallen, Sex und Bordelle
Der Anfang vom Ende
Die Stunde null: Der Ausbruch beginnt
Schreckensstarr
Diese immer höher steigende Wolke
Die Hölle im Himmel
Weglaufen oder sterben? Die Schicksalspfade kreuzen sich
In der Falle: Die ersten Häuser stürzen ein
Vergebliches Harren
Die untergehende Sonne reißt das Leben mit sich
Die letzte Fahrt des Admirals
Die ersten Todeswolken
Herculaneum: Wo sind deine Bewohner?
Ein Todesengel – schweigend und feurig
Ein gelebter Albtraum
Surge 3: Der Tod umzüngelt Pompeji
Surge 4: Lebendig begraben von einer Wolke
Surge 5: Ein weiterer Schlag für Pompeji
Surge 6: Der Mörder des Admirals
Der Admiral kehrt heim
»The Day After«
Anhang
Das wirkliche Datum der Eruption
Dank
Literatur
Anmerkungen
Bildteil I
Bildteil II
Bildnachweis
Bevor Sie zu lesen beginnen: Auf ein Wort!
In den Berichten über den Vulkanausbruch, der 79 n. Chr. Pompeji, Herculaneum, Oplontis, Boscoreale, Terzigno und Stabiae zerstörte, ist stets nur von den Opfern die Rede und davon, wie sie wohl den Tod gefunden haben. Dieses Buch tut genau das Gegenteil: Es erzählt von der Tragödie, indem es sich den Überlebenden nähert. Denn tatsächlich gab es einige Menschen, die unbeschadet an Leib und Leben davonkamen. Die in langwieriger Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse lassen jedenfalls mindestens sieben der Überlebenden von damals ins Rampenlicht treten.
Was haben diese Menschen erlebt? Was könnten sie uns erzählen, wenn sie heute unter uns weilten?
Leider hat nur einer von ihnen, Plinius der Jüngere, das Drama beschrieben, dessen Augenzeuge er war. Sein Brief an Tacitus ist berühmt geworden. Unter unseren sieben ist es ausgerechnet Plinius, der am weitesten vom Ort des Unglücks entfernt war, nämlich circa dreißig Kilometer. Doch selbst noch in dieser Entfernung hatte er Angst, im Ascheregen zu sterben, den die Eruption ausgelöst hatte. Und die anderen? Sie befanden sich weit näher am Vulkan, haben uns aber keine Zeugnisse hinterlassen. Wir kennen ihre Namen, wissen, wie alt sie waren, zum Teil sogar, wo sie wohnten. In wenigen Fällen können wir die Panik nachfühlen, die sie empfanden, und wissen, wie sie diese schrecklichen Stunden verbrachten.
Dass wir nach zweitausend Jahren immerhin sieben Überlebende kennen, ist schon viel, dennoch ist dieses Material nicht ausreichend. Doch daneben gibt es noch andere Quellen, die uns Aufschluss darüber geben können, wie man in Pompeji lebte, ehe sich eine der größten Tragödien der Geschichte ereignete. Diese Quellen gestatten uns, bei denen, die an der Seite jener sieben waren, die fehlenden Informationen zu ergänzen.
Daher begegnen Ihnen in diesem Buch neben den Überlebenden weitere Protagonisten, deren Existenz historisch belegt ist. Von einigen kennen wir Name, Alter und Beruf. Manchmal wissen wir sogar, wie sie ausgesehen haben und welche Familiengeschichte sich hinter der Gestalt verbirgt! Aber wir wissen nicht, ob sie dem Vulkan zum Opfer fielen oder vielleicht auch mit dem Leben davonkamen.
Neben ihnen gibt es die große Zahl derer, über die wir so gut wie gar nichts wissen – bis auf die Tatsache, dass sie der Tod bei dem Inferno ereilte. Sie starben, weil es ihnen nicht gelang, sich in Sicherheit zu bringen. Ihre sterblichen Überreste wurden von Archäologen entdeckt und umsichtig geborgen. Manche sind sogar für Besucher zugänglich hinter Glas ausgestellt.
Bei unserer Beschäftigung mit dieser Katastrophe werden wir also die Überlebenden hören, die »möglicherweise Überlebenden« und die Toten. Unsere Geschichte entfaltet sich um reale Menschen, nicht um fiktionale Charaktere, wie sie uns im Film oder Roman begegnen (als da wären der Held, die Heldin, der Schurke, der gute Sklave, den man an die Muränen verfüttert, die beiden rivalisierenden Gladiatoren, die schließlich Freunde werden, und dergleichen mehr). Denn man braucht sich keinen Film anzusehen oder einen Roman zu lesen, die der Anschaulichkeit halber von der Fantasie Gebrauch machen, wenn es doch Menschen gibt, die alles real miterlebt haben. Ist ihre Geschichte nicht viel authentischer und damit interessanter?
In diesem Buch folgen wir auch den Spuren »gewöhnlicher Leute«. Wir begleiten sie an ihren Arbeitsplatz und schauen ihnen bei ihren sonstigen Verrichtungen in den zwei, drei Tagen vor dem Vulkanausbruch über die Schulter, um herauszufinden, wie sie die wenigen schrecklichen Stunden vor der Tragödie verbracht haben.
Natürlich werden auch wir das nie ganz genau erfahren, das wäre nicht möglich. Was Sie hier lesen werden, sind faktenorientierte Rekonstruktionen dessen, was diese Menschen sehrwahrscheinlich getan, gesehen und am eigenen Leib erlebt haben. Wir werden ihnen an ganz bestimmte Orte folgen, werden mit ihnen durch die Straßen gehen, ihren Villen und Häusern einen Besuch abstatten, mit ihnen zu den Gutshöfen an den Hängen des Vulkans hinaufsteigen.
Die Fresken, die wir dabei entdecken, sind dieselben, die Sie heute noch in Pompeji sehen können. Und so werden wir auf unseren Rundgängen Pompeji (antike Schreibweise: Pompei) erkunden, Herculaneum und Oplontis sowie die nähere Umgebung dieser Orte. Und wir werden dabei das wahre Leben jener Zeit kennenlernen, das doch recht verschieden ist von dem, was man in den einschlägigen Romanen so präsentiert bekommt. In jede einzelne Zeile dieses Buches sind die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen eingegangen, welche die Archäologen aus ihren Ausgrabungen gezogen haben, damit Sie eintauchen können in das Leben jener Zeit in Pompeji und der Küstenregion, die vom Vulkanausbruch betroffen war. Forschungsergebnisse von Vulkanologen, Historikern, Botanikern, Anthropologen und Forensikern vervollständigen das Bild.
Bevor Sie sich aber in die Lektüre vertiefen, möchte ich Ihnen noch zwei »Gebrauchsanweisungen« mit auf den Weg geben.
Was die Datierung des Vulkanausbruchs angeht, den man normalerweise auf den 24. August 79 n. Chr. legt, habe ich mich für die »Herbst-Hypothese« entschieden. Forschungsarbeiten zufolge fand nämlich der Ausbruch wohl eher am 24. Oktober desselben Jahres statt. (Mehr dazu finden Sie im Anhang.)
Die verschiedenen Phasen des Ausbruchs habe ich mithilfe von Vulkanologen und Berichten von Zeitzeugen rekonstruiert. Leider sind die schriftlichen Zeugnisse aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. nicht sehr ausführlich, daher habe ich bei der Beschreibung einiger der hier geschilderten Phänomene wissenschaftliche Beobachtungen herangezogen, die bei den jüngsten Vulkanausbrüchen gemacht wurden.
Und nun wünsche ich Ihnen eine ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreise!
Dramatis personae
Auf den folgenden Seiten finden Sie nach der Reihenfolge ihres Auftretens geordnet eine Liste der wichtigsten Akteure, deren Weg wir nachzeichnen werden, ob er nun ins Leben führt oder in den Tod.
Rectina: zur römischen Elite gehörige Aristokratin. Wenige Stunden vor dem Vesuviusausbruch organisiert sie ein Bankett für die »High Society« von Pompeji. Sie überlebt.
Gaius Plinius Secundus (Plinius der Ältere): Admiral, Naturforscher und Schriftsteller. Wir werden ihm am Hafen von Misenum begegnen, da er die kaiserliche Flotte befehligt.
Gaius Plinius Caecilius Secundus (Plinius der Jüngere): Ihm begegnen wir erstmals im Haus seines Onkels Plinius des Älteren. Er überlebt.
Eutychus: Rectinas Sklave und Vertrauter, der ihr fast überallhin folgt.
Felix: Fischer aus Herculaneum, der dank des Vulkans prall gefüllte Netze nach Hause bringt.
Gaius Cuspius Pansa: junger Politiker mit verschlagenem Blick. Wir begegnen ihm bei einem Bankett mit einflussreichen Persönlichkeiten Pompejis.
Gaius Iulius Polybius: Er hat die Geschäfte Pompejis in der Hand. Er läuft uns in einem Etablissement im Rotlichtviertel der Stadt über den Weg.
Lucius Caecilius Iucundus: Bankier im fortgeschrittenen Alter, der den sprichwörtlichen »Riecher« fürs Geschäft hat. Er empfängt in seinem Büro auf dem Forum eine reiche und attraktive Frau. Möglicherweise hat er überlebt.
Pomponianus: vermögender Besitzer einer Villa in Stabiae. Er sucht ein kleines »Casino« in Pompeji auf, um sich beim Würfelspiel zu entspannen. Er überlebt.
Flavius Chrestus: Der Freigelassene (libertus) griechischer Herkunft hat sich mit dem Seehandel einen Namen gemacht.
Lucius Crassius Tertius: Besitzer einer sogenannten villa rustica, eines Landgutes. Im Augenblick der Eruption eilt er, um seinen »Tresor« zu retten.
Novella Primigenia: berühmte Schauspielerin (mima). Wir folgen ihr, während sie sich an der Seite eines mächtigen Mannes in einer Sänfte durch Pompeji tragen lässt.
Marcus Holconius Priscus: wurde dank der Unterstützung des Bankiers Lucius Caecilius Iucundus zum Duumvir ernannt. Verschwindet beim Vulkanausbruch spurlos.
Aulus Furius Saturninus: junger Mann aus einer der angesehensten Familien Pompejis. Er macht Geschäfte mit Rectina. Und überlebt.
Caesius Bassus: sensibler Dichter und Freund Rectinas. Lebt in Pompeji in einem »Fünf Sterne«-Hotel, das A. Cossius Libanus gehört.
Titus Suedius Clemens: unbeugsamer Präfekt, der von Kaiser Vespasian nach Pompeji gesandt wurde. Wir sind an seiner Seite, als er in Pompeji wichtige Nachforschungen anstellt. Er überlebt.
N. Popidius Priscus: durch den Handel mit Wein und die Herstellung von Dachziegeln reich geworden. Er besitzt außerdem einen Backofen. Ob er wohl überlebt hat?
Aulus Vettius ConvivaundAulus Vettius Restitutus: Sklaven und Brüder, die beide freigelassen wurden und im Anschluss daran reich wurden. Sie leben in einer der schönsten domus von Pompeji.
A. Cossius Libanus: Freigelassener hebräischen Ursprungs. Beherbergt Caesius Bassus in seinem eleganten Hotel in Pompeji.
Apollinaris: Leibarzt von Kaiser Titus. Ist in Pompeji auf der Durchreise.
Marcus Epidius Sabinus: der »Quintilian Pompejis«. Er stellt sich zur Wahl als Duumvir. Ihm gehört eines der prunkvollsten Häuser in Pompeji, in dem Titus Suedius Clemens logiert.
Stallianus: der Installateur von Pompeji. Man ruft ihn, um die Wasserleitungen zu reparieren, die bei dem Erdbeben kurz zuvor beschädigt wurden.
Clodius: verkauft in seinem Laden am Eingang zur Therme Togen und Umhänge. Wagt mit seiner Familie einen verzweifelten Fluchtversuch.
Marcus Calidius Nasta: fliegender Händler für Götterstatuen. Schlägt seinen Stand gern unter dem Quadriportikus auf, der dem Andenken des Geschlechts der Holconier gewidmet ist.
Lucius Vetutius Placidus: Besitzer eines der schönsten Speiselokale in der Via dell’Abbondanza: Wo versteckt er sein Geld?
Ascula: Gemahlin von Lucius Vetutius Placidus, die sehr eifersüchtig ist.
Zosimus: verkauft in seinem chaotischen Laden Amphoren, Öllampen und Tongefäße.
Aulus Furius Saturninus: Ritter und Priester des Jupiterkults. Er gehört zu den Wohltätern von Herculaneum.
Iulia Felix: Unternehmerin mit modernen Vorstellungen. Wir lernen sie kennen, als sie sich in der Villa der Papyri mit Rectina unterhält.
Gemahlin von Lucius Caecilius Iucundus: Ihr Entschluss, den Abend auf dem Landgut außerhalb von Pompeji zu verbringen, wird ihr Tod sein.
Lucius Caecilius Aphrodisius: Ihm schenkt der Bankier und Schatzmeister sein Vertrauen. Er versucht, sich in eine Zisterne zu retten.
Tiberius Claudius Amphius: ist mit der Verwaltung des Landgutes des Bankiers betraut. Versucht, mit seinem Leib seine Herrin zu schützen.
Lucius Brittius Eros: Freigelassener der Villa della Pisanella. Versucht bis zum Schluss, sich zu retten.
Faustilla: Wucherin. Versucht noch im allgemeinen Durcheinander der Flucht, Geld einzutreiben.
»Erzähle, Rectina!«
Einige Jahre nach dem Ausbruch
SI MEMINIWenn ich mich erinnere.2
Dunkle Augen blitzen im Schatten auf. Wer ihrem Blick begegnet, ist sofort angetan von der Wärme, die darin liegt: die mediterrane Wärme einer Frau aus der Region rund ums Mittelmeer. Ihr tiefschwarzes Haar umrahmt das vollendete Oval ihres Gesichts. Locken schwarz wie die Nacht legen sich um das hellere Antlitz wie Wellen, die am Ufer auslaufen. Wie an der Küste Kampaniens, von der sie stammt.
Das breite Goldgeschmeide mit Perlen und Smaragden, das sich über der Brust hebt und senkt wie ein Boot auf dem Meer, ist eigentlich nur Beiwerk, ebenso wie die beiden Schlangen aus massivem Gold mit smaragdenen Augen, die sich um ihre Unterarme schlingen. Selbst die kostbaren Gewänder aus goldbestickter Seide, die geschickt ihre Kurven betonen, während sie auf dem Triklinium liegt – einem jener dreigliedrigen »Speisesofas«, nach denen auch das Speisezimmer benannt wurde –, tragen nur wenig zu dem Zauber bei, mit dem sie das ganze Bankett erhellt.
Ihr linker Arm stützt sich elegant auf dem ockerfarbenen Speisesofa ab, das sie sich mit einem Mann teilt, dem sie aufmerksam lauscht. Sein breitschultriger Körper neigt sich zu ihr, während ihr Blick über seine dunkle Haut gleitet. Wenn er lacht, durchziehen Fältchen das sonnengebräunte Gesicht unter dem graumelierten Haar.
Die beiden sind nicht allein auf diesem Bankett. Viele geladene Gäste gruppieren sich um sie auf den anderen Speisesofas unter strenger Einhaltung der römische Etikette. Sind mehr Gäste geladen, als es Triklinien gibt, lagern die Feiernden sich sozusagen im Fischgratmuster nebeneinander.
Alle plaudern angeregt und lassen sich verzaubern von der fröhlichen Atmosphäre in diesem Raum mit seinen bunt bemalten Wänden, die mit scheinarchitektonischen Elementen, imaginären Landschaften und anderen Motiven geschmückt sind.
Die Welt der Römer ist, von der Kleidung angefangen bis hin zu den Häusern, eine Welt der Farben. Zumindest sehr viel farbenfroher als unsere, kennen wir doch meist nur weiß getünchte Wände und in dunklen Tönen gehaltene Kleidung (siehe Bildteil I). Selbst der Fußboden ist bedeckt mit farbigen Mosaiken, die geometrische Muster bilden, und kleinen Paneelen aus winzigen Steinen, die sich zu Bildwerken gruppieren.
Der Bankettsaal öffnet sich auf einen weitläufigen Innengarten, um den ein Säulengang verläuft. Dort wachsen duftende Pflanzen, die geschickte Gärtner in mannigfaltige Formen geschnitten haben. Dazwischen promenieren Pfauen, welche sich gelegentlich an einem der kleinen bronzenen Brunnen laben, deren zarter Wasserstrahl sich im Herabfallen in kleinen Marmorschalen verliert.
Bedienstete reichen riesige Silbertabletts mit allen möglichen Köstlichkeiten umher: Straußenhäppchen, Muränenwürfelchen in würziger Soße, Zicklein in Honig gebacken, Früchte der Saison, Feigen, Nüsse, Datteln aus Nordafrika. Vor den Liegesofas stehen kleine Tische, die Teller und hauchdünn geblasene Glaskelche aufnehmen. Von den kleinen Bronzestatuen ganz zu schweigen: nackte Greise mit übergroßem erigierten Glied. Sie nehmen die kleinen Silbertabletts auf, mit denen die Süßigkeiten gereicht werden. Diese Statuen stehen für Fruchtbarkeit und Glück. Da und dort hängen silberne Skelette von etwa zehn Zentimeter Länge. Man nennt sie die »larvae conviviales«: Sie sollten die Feiernden daran erinnern, dass das Leben kurz ist, ein Geschenk, das es zu nutzen gilt. Also lacht und seid fröhlich! So schafft man die rechte Atmosphäre, die es für ein Bankett braucht.
Eine Hand pflückt getrocknete Feigen von einem der Silbertabletts. Es ist Herbst. Auch in dem Gedicht, das vom Poeten persönlich hingebungsvoll rezitiert wird, obwohl ihm kein Mensch zuhört.
Doch die Melodie kriecht wie Gift ins Ohr der faszinierenden Dame: Sie kennt diese Musik. Sie ist ihr nicht fremd. Irgendeine uralte Erinnerung versucht, sich in ihr Bewusstsein zu schieben. Da ist diese Hand, die nach den Feigen greift … Irgendwo hat sie diese Szene schon mal gesehen, aber wo? Plötzlich wird das allgemeine Stimmengewirr des Banketts zerrissen von einer gewaltigen Lachsalve. Einer der Gäste, weißhaarig und korpulent, der nicht weit von ihr auf einem der Sofas liegt, redet mit einem anderen Mann. Er reißt den vollen Mund weit auf und redet auf den anderen ein. Auch dieses Lachen hat die Frau schon mal gehört, in einer ähnlichen Situation. Bei einem anderen Bankett … Ja, jetzt fällt es ihr wieder ein.
Das letzte Bankett in ihrem Haus vor der großen Tragödie. Die Geräusche, die Stimmen, die Musik – alles tritt zurück und verebbt. Sie sieht sich um, auch die Gesichter verblassen. Mit einem Mal zerren ihre Erinnerungen sie zurück in eine andere Zeit, ohne dass sie sich dagegen wehren könnte. Andere Gesichter schieben sich über die der Anwesenden – die Gesichter der Menschen, die an jenem Abend vor dem Vulkanausbruch bei ihr zu Gast waren. Sie wirken heiter, gelassen. Die Menschen lachen und plaudern entspannt. Warum plötzlich befallen sie diese Erinnerungen? Was wohl aus ihren Gästen von damals geworden ist? Ihr Blick sucht etwas, an dem er sich festhalten kann, doch er bleibt an einem der silbernen Skelette hängen mit den leeren Augenhöhlen und den Rippen, die sich wie ein Käfig wölben, aus dem das Leben entflohen ist. Und an einer der Greisenstatuetten mit den eingefallenen Wangen und dem weit aufgerissenen Mund, als wollte er etwas hinausschreien, doch der Schrei bliebe ihm im Halse stecken. Und mit einem Mal sieht Rectina keine Statue mehr. Sie kennt diesen Ausdruck, hat ihn bereits gesehen: Gesichter voll unsagbaren Schmerzes, voll tiefer Verzweiflung. Denn sie hat dem Tod schon ins Auge geblickt.
Lange Zeit hat sie versucht, alles zu vergessen, hinter sich zu lassen, zu verdrängen … Nie hat sie mit irgendjemandem darüber gesprochen. Sie wollte niemandem erzählen, was sie gesehen und erlebt hat während dieser schrecklichen Stunden, in denen der Vulkan zum Leben erwachte. Sie verbarrikadierte sich förmlich hinter einer Mauer des Schweigens. Zu gewaltig war der Schmerz, zu groß die Tragödie. Doch Traumata lassen sich nicht auslöschen oder zur Seite schieben. Sie müssen ans Licht des Tages geholt und verarbeitet werden. Der Schmerz muss in Worte gefasst und hörbar gemacht werden. Und zwar bald und bevor er von innen heraus den Körper zerfrisst wie ein Parasit.
Ihr geht es da nicht anders: Die Erinnerungen, die sie tief begraben glaubte, drängen plötzlich aus dem hintersten, dunkelsten Winkel ihres Geistes ans Licht. Wie ein Hai, der sich langsam aus den Tiefen des Meeres in die Höhe schiebt. Ihre dunklen Augen weiten sich. Alle Wärme und Sinnlichkeit ist mit einem Mal wie weggewischt. Sie hebt den Blick wie eine Ertrinkende, die zwischen den sich auftürmenden Wellen nach irgendetwas sucht, woran sie sich klammern kann. Ihre Augen wandern von einem zum andern, ein Gesicht, ein Wort, irgendetwas – vergeblich. Ihr schwirrt der Kopf, kalter Schweiß bedeckt ihre Stirn, Übelkeit überfällt sie. Sie kann sich nicht mehr bewegen, ihre Arme scheinen schwer wie Blei. Und dann dieses Gefühl, als müsste ihr Herz zerspringen, als müsste sie untergehen in der Welle des Schmerzes, die erbarmungslos auf sie zurollt.
Einige der Gäste merken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Erstaunt blicken sie auf, als ihre steif gewordene Hand den Silberkelch fallen lässt und dieser hart auf dem Marmorboden aufschlägt. Der Mann, der neben ihr auf dem Triklinium lag, steht auf und legt ihr schützend die Hand auf die Schulter. Doch in ihren Augen malt sich bereits der Schrecken. Ihr Blick weilt in einer anderen Welt. Sie ist zurück in diesen schrecklichen Stunden. Es war ihr bestimmt, irgendwann einmal in dieses Inferno zurückzukehren, es noch einmal zu erleben. Erst dann würde sie es hinter sich lassen können. Der Mann versteht das. »Erzähle, Rectina. Jetzt ist der Moment gekommen.« Alle Anwesenden verstummen und lagern sich um das Sofa der Frau. Sie wissen, dass sie zu den wenigen Menschen gehört, die der Hölle des Vulkanausbruchs entkommen sind.
Nun wird ihr von allen Seiten die Aufforderung zu reden entgegengehalten – gleich dem Schlüssel zu einer Tür, die allzu lang verschlossen war. Und nun weit aufschwingt. Sie entlässt uns in einen Morgen des Jahres 79 n. Chr. Wir befinden uns an Bord eines Segelschiffs, das von den Meereswellen sanft umschmeichelt wird. Über uns schreien die Möwen. Vor uns breitet sich die berauschende Küste Kampaniens aus …
Die Aristokratin und der General
Tyrrhenisches Meer vor Misenum22. Oktober 79 n. Chr., 8.00 UhrNoch 53 Stunden bis zum Ausbruch
AVE PU(EL)LASei gegrüßt, schönes Mädchen.
Die sehnigen Hände des Steuermanns umfassen die arg strapazierten Leinen, mit deren Hilfe die beiden Ruder des Schiffes gesteuert werden: Sie durchschneiden das Wasser wie Pflugscharen. In antiker Zeit hatten Schiffe kein Mittel-, sondern zwei Ruder, die seitlich am Heck angebracht waren wie große vertikale Paddel. Sie werden von einem Mann in einer kleinen Kabine bedient, einer echten »Kommandobrücke«.
Während des Manövers, welches das Schiff um das Kap von Misenum herumführt, vibrieren die gestrafften Seile in den Händen des Steuermannes wie die Zügel eines Pferdegespanns, wenn der Wagenlenker im Circus Maximus eine Kurve nimmt. Das Schiff bäumt sich einen Augenblick auf, als weigerte es sich zu drehen, doch dann gehorcht es und ändert seinen Kurs. Rectina und die übrigen Passagiere spüren den Kurswechsel, auch weil der Wind jetzt aus einer anderen Richtung weht. Die Sonne, die ihnen vorher auf der Haut brannte, hat sich nun hinter dem Segel versteckt. Der Wind treibt das leichte Schiff mit Macht übers Meer. Linker Hand, nur wenige Meter entfernt, türmt sich das Kap von Misenum auf, ein gewaltiger steinerner Riese. Die Wellen brechen sich an seinen Felsen, die allen schrecklich nah erscheinen.
Weißer Schaum überzieht das Deck mit einem feinen Sprühnebel. Der Wind peitscht das Meer auf, der Salzgeruch beißt in der Nase. Der Schaum ist so weiß wie der imposante Leuchtturm, der sich auf dem Felsvorsprung mehrere Stockwerke hoch über ihre Köpfe erhebt. Er sieht aus wie ein Turm aus übereinandergeschichteten Bausteinen. Die strahlend weiße Farbe und die ungewöhnliche Form erinnern ein wenig an Arabien. Zwischen den quadratischen Häusern der arabischen Mittelmeerküste würde er jedenfalls nicht weiter auffallen. Tatsächlich haben die Orte um Pompeji, aber auch Straßen und Plätze der Stadt selbst eine Anmutung, die wir heute als »arabisch« oder »nordafrikanisch« beschreiben würden. Und das ist schon die erste Überraschung, die uns auf unserer Reise begegnet.
Der Steuermann mit dem gekräuselten schwarzen Bart lenkt das Schiff von seiner Kabine aus mit unglaublicher Geschicklichkeit. Er ist einer der Besten auf dieser Route. Sein Blick fixiert die Neptunstatue, die sich an der Einfahrt zum Hafen von Misenum auf der Mole erhebt. Die vergoldete Bronze gleißt im Sonnenlicht, sodass sie die Näherkommenden schier blendet. Doch allen Seeleuten dient sie als Orientierungspunkt, der sie in den Hafen geleitet.
Denn der Hafen von Misenum ist nicht irgendein Hafen. Dort liegt die kaiserliche Flotte vor Anker, die Classis Misenensis, eine der beiden Prätorianerflotten. Die andere ist in Ravenna stationiert.
Dass wir uns dem mächtigsten Marinehafen des römischen Kaiserreichs nähern, merken wir auch an dem gewaltigen Schiff, das auf uns zuhält. Die fast vierzig Meter lange Quadrireme schiebt sich bedrohlich vorwärts, angetrieben von einem Wald von Rudern, die sich gemeinsam aus dem Wasser heben und wieder senken. Über dem Geräusch der Wellen erhebt sich die Stimme des Antreibers, der den Ruderern den Rhythmus vorgibt. Wie eine dunkle Wolke gleitet sie übers Wasser, während die beiden Augen auf dem Bug unheilschwanger zu funkeln scheinen. (Dieses Symbol dient dem Schutz des Schiffes und ist auch heute noch häufig anzutreffen, zum Beispiel in der Türkei.) Der Rammsporn aus Bronze taucht zwischen den Wellen auf, drei tödliche horizontale Klingen, die die Wand jedes feindlichen Schiffes aufreißen können.
Weniger bekannt ist es, dass der Rammsporn eines Schiffes so konstruiert war, dass er in dem feindlichen Schiff stecken blieb wie der Stachel einer Biene und mit ihm zusammen versank. Die spezielle Art der Konstruktion sowie der niemals rechtwinklig, sondern immer diagonal ausgeführte Rammstoß sorgten dafür, dass der Rammsporn nicht allzu tief eindrang und das angreifende Schiff nicht Gefahr lief, selbst unterzugehen. Außerdem riss der spitzwinklige Rammstoß eine viel größere Wunde in den Bauch des gegnerischen Schiffes und machte so viele Ruder unbrauchbar. Auf diese Weise wurde das Schiff manövrierunfähig.
Die Quadrireme kehrt von einer Erkundungsfahrt an der Küste zurück, die sie im Verband mit einigen Triremen unternommen hat. Beim »Endspurt« werden die Ruderer angetrieben, alles aus sich herauszuholen, um sie auf die Probe zu stellen.
Die kaiserliche Flotte in Misenum hat mittlerweile keine Feinde mehr im Mittelmeer. Die Zeit der großen Seeschlachten wie der bei Actium von Octavian gegen Marcus Antonius und Cleopatra oder der Schlacht bei den Aegates (Ägadischen Inseln) gegen die Flotte Karthagos ist vorüber. Und Piraten gibt es nicht mehr. Die kaiserliche Flotte ist stets bereit, übernimmt aber hauptsächlich friedliche Missionen wie den Transport von Waren, Nachschub oder Personen.
Auch Rectina befindet sich an Bord einer Liburne, die in Friedenszeiten für den Transport von Angehörigen der römischen Regierung von und nach Misenum benutzt wird. Aus Gründen, die Historiker entdeckt haben und von denen wir später noch lesen werden, gilt Rectina zu jener Zeit sozusagen als »VIP«.
Natürlich musste die Liburne der Quadrireme bei der Einfahrt in den Hafen den Vorrang überlassen. Jetzt aber darf auch das Schiff Rectinas einlaufen.
Der Bootsmann steuert das Schiff zwischen dem felsigen Inselstreifen der heutigen Isola Pennata und der langen Mole hindurch, welche die Bucht verschließen wie die Scheren einer Zange. Dann entzündet er ein Licht auf dem kleinen Bordaltar und bringt Opfergaben dar, wobei er halblaut heilige Formeln rezitiert. Formeln, welche die Seeleute an Bord und einige der Passagiere nachsprechen. Denn Seeleute in der Antike sind wie in späteren Zeiten extrem abergläubisch. Sie danken den Göttern, dass sie wohlbehalten und gesund angekommen sind. Ein Ritus, der uns heute ein wenig überkommen erscheint, der jedoch, wenn man genauer darüber nachdenkt, auch in unserer hochtechnisierten Zeit noch existiert. (Sicher haben Sie es schon einmal erlebt, dass nach der Landung eines Charterflugzeugs geklatscht wird und der eine oder andere Passagier sich bekreuzigt. Und außerhalb Europas werden immer noch gern Gebete oder Segenssprüche rezitiert.)
Der Admiral und Naturforscher
Der Hafen von Misenum scheint von der Natur selbst für die kaiserliche Flotte geschaffen worden zu sein. Er besteht aus zwei aneinandergrenzenden Buchten, die eine liegende Acht bilden. Unser Schiff legt in der ersten Bucht an. Es hält direkt auf einen kleinen Felsvorsprung zu, den man heute als Punta Scarparella kennt. Der Flottenverband jedoch steuert die zweite natürliche Bucht an, die von der ersten durch ein enges Nadelöhr getrennt ist. Darüber spannt sich eine Holzbrücke. Vermutlich handelt es sich um eine bewegliche Brücke. (Diese Brücken sind an den Flüssen des Römischen Reichs recht häufig. Zu ihnen gehört auch die berühmte Brücke von Londinium [London], die es schon in römischer Zeit gab.)
Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was dann an der beweglichen Brücke am Hafen von Misenum geschah: Sämtlicher Verkehr vor der Brücke hält an. Auf ein Signal hin hebt sich die Brücke, damit das gewaltige Kriegsschiff mit seinen zahllosen, jetzt eingezogenen Rudern unter ihr hinweggleiten kann. In der zweiten Bucht liegen viele Schiffe vor Anker. Rammsporn an Rammsporn schiebt sich zwischen den zahllosen gemalten Augen hervor. Dort liegt Roms Macht zur See vor Anker, jederzeit bereit, im Mittelmeer eingesetzt zu werden.
Das Schiff, auf dem Rectina gereist ist, liegt nun sicher an der Hafenmauer vertäut. Diese säumt ein langer Säulengang, der weiße Häuser mit ziegelgedeckten Dächern beschattet. Hier sind Büros und Ladeschuppen untergebracht. Dahinter klettern die Häuser des Orts die Anhöhe hinauf bis zur Festung.
In einem dieser Häuser lebt der Admiral und Oberbefehlshaber der Flotte. Man begegnet dem allseits geschätzten Mann des Öfteren auf den Straßen. Er ist sofort erkennbar an seiner massigen Statur und seinem gravitätischen Gang, aber auch an seiner Höflichkeit und den geschliffenen Manieren, die zeigen, dass er ein gebildeter Mensch ist. Und nicht zuletzt an seiner gelassenen Haltung, seinem strahlenden und selbstsicheren Lächeln. Sein Name ist in die Geschichte eingegangen. Es handelt sich um Gaius Plinius Secundus, den die Historiker »Plinius den Älteren« nennen, um ihn von seinem Neffen Plinius dem Jüngeren zu unterscheiden. Beide sind, wie Sie bald sehen werden, zentrale Figuren in unserer Erzählung. Einer wird auf dramatische Weise das Leben verlieren, während der andere, noch jung, gerettet wird und das Geschehen der Nachwelt überliefern kann.
Tatsächlich ist es Admiral Plinius der Ältere (den auch wir so nennen werden), der Rectina am Hafen abholt. Was wissen wir von ihm? Er ist zu jener Zeit sechsundfünfzig Jahre alt und in Novum Comum, dem heutigen Como, zur Welt gekommen. (Andere Historiker geben das antike Verona als Geburtsort an.) Als junger Mann diente er zwölf Jahre lang in den am Rhein stationierten Legionen, wo er eine Kavallerieschwadron befehligte. Dann stagnierte seine Karriere eine ganze Zeit lang, weil er der Herrschaft Neros ablehnend gegenüberstand. Doch als Nero das Zeitliche segnete, nahm das Schiff Plinius’ des Älteren unter Kaiser Vespasian wieder Fahrt auf, denn wie der Zufall es so wollte, hatte Plinius in Germanien zusammen mit Titus gedient, dem Sohn des Kaisers. Die drei einte eine ausgesprochen pragmatische Einstellung zum Leben, vielleicht, weil sie alle in den vordersten Kampfreihen gedient und dort gelernt hatten, was es heißt, Risiken und Gefahren ausgesetzt zu sein und Verantwortung zu tragen. Und so wurde Plinius sogar persönlicher Ratgeber Vespasians. Kurz vor dem Vesuviusausbruch ist Vespasian gestorben. Titus selbst ist nun Kaiser, und Plinius gehört zu seinen engsten Vertrauten.
Plinius hat also verstanden, sich zu gedulden. Dank seiner persönlichen Qualitäten ist er ohne jeden Zweifel ein mächtiger und einflussreicher Mann geworden. Aber er ist auch unglaublich gebildet. Seine Gesellschaft wird allgemein hoch geschätzt. Der Mann, der da am Hafen auf Rectina wartet, hat nur zwei Jahre zuvor ein großartiges Werk veröffentlicht, das selbst heute noch konsultiert und zitiert wird: die Naturalis Historia, eine Enzyklopädie des menschlichen Wissens jener Zeit über so unterschiedliche Sachgebiete wie Anthropologie, Geografie, Zoologie, Botanik, Astronomie, Medizin und Mineralogie. Auch aus diesem Grund gilt Plinius der Ältere als der erste Naturforscher im modernen Sinne. Leider sind alle anderen seiner Werke verlorengegangen.
Plinius war Anwalt und mit Verwaltungsaufgaben in den Provinzen Gallia Narbonensis, Africa und Hispania Tarraconensis betraut, wo es bedeutende Goldvorkommen gab. Es waren dies höchste Ämter, die viel Fingerspitzengefühl erforderten, doch Vespasian und später Titus setzten ihr ganzes Vertrauen in Plinius, der ein zutiefst redlicher Mensch war, sowohl in praktischer als auch in intellektueller Hinsicht.
Eine Frage aber bleibt offen: Wieso steht an der Spitze der wichtigsten kaiserlichen Flotte ausgerechnet ein Naturforscher? Vielleicht hat Vespasian Plinius diese Aufgabe ebendeshalb anvertraut, weil es sich dabei zu jener Zeit sozusagen um einen »ruhigen Posten« handelte, der ihm somit mehr Zeit für seine Studien ließ …
Rectina beugt sich über die Reling. Ihr dunkles Haar bedeckt ein feiner Schal aus Seide, die palla. Sie lässt ihren Blick an der Hafenmauer entlanggleiten, die im Moment vor Menschen nur so wimmelt. Es werden alle möglichen Waren ausgeladen, meterhohe Amphoren, große Säcke in dichtgeknüpften Netzen werden aus den Laderäumen gehievt. Doch wo der Admiral voranschreitet, macht ihm die Leibwache den Weg frei. Daher fließt der Strom von Menschen um Plinius herum.
Da, Rectina hat ihn entdeckt und verhüllt ihr Gesicht mit dem Schleier, was üblich ist für eine Matrone, eine weibliche Angehörige der Oberschicht. Eine Sklavin hilft ihr, von Bord zu gehen. Heute würde ihr jeder »Offizier und Gentleman« natürlich entgegeneilen, um ihr die Hand zu reichen, sobald sie die schmale Planke herunterbalanciert. Vor zweitausend Jahren aber war es verboten, einer römischen Aristokratin den Arm zu reichen, ja sie auch nur zu berühren. Außer in Notfällen wäre dies tatsächlich ein »Fauxpas« gewesen. Die Frauen der Oberschicht, die zur römischen nobilitas – zur Aristokratie – gehörten, waren in der Öffentlichkeit unantastbar.
Die Begegnung mit dem Admiral verläuft warmherzig. Denn die beiden kennen sich vermutlich schon seit einiger Zeit. Mancher Historiker meint gar, es sei mehr zwischen ihnen gewesen als nur Freundschaft. Doch das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Rectina war noch jung, schön, und sie war Witwe. Sicher aber wissen wir nur eines: Als der Vulkan ausbricht, wird Rectina eine Botschaft an Plinius den Älteren schicken und ihn anflehen, sie zu retten. Woher wir das wissen?
Nun, hier müssen wir uns kurz die Quellenlage vergegenwärtigen, denn vieles von dem, was Sie auf den folgenden Seiten zu lesen bekommen, geht auf zwei Briefe zurück, die Plinius der Jüngere, Neffe des Admirals, viele Jahre nach der Tragödie an Tacitus geschrieben hat. Darin beschreibt er alle Phasen des Ausbruchs und wie sein Onkel reagierte. Es handelt sich um außergewöhnliche Dokumente, die uns allerdings nur in Kopien erhalten sind, die die fleißigen Mönche des Mittelalters in zahlreichen Abschriften erstellt haben.
In diesen Briefen wird Rectina erwähnt, allerdings nur dem Namen nach, ohne weitere Hinweise auf ihre Person. Dies sagt uns, dass man sie in den Kreisen der römischen Oberschicht vermutlich kannte. Unter anderem, weil »Rectina« zu jener Zeit ein höchst seltener Name war. Wenn man also von einer Aristokratin mit diesem Namen spricht, die in einer großen Villa zwischen Pompeji und Herculaneum lebte, kann es sich nur um ebenjene Rectina handeln. Natürlich sind das alles Annahmen, wie ich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, anfügen muss. Doch Sie werden sehen, dass es viele Elemente (und auch archäologische Funde) gibt, die sich um diese Figur und um das ranken, was sie in den Stunden getan hat, die hier beschrieben werden. Und daraus lässt sich eine durchaus plausible Rekonstruktion der Ereignisse gewinnen.
Vieles von dem, was zwischen zwei belegten historischen Ereignissen geschah, ist nur durch Hypothesen zu erschließen, wie die folgende Begegnung kurz vor der Eruption.
Plinius der Ältere bringt Rectina in seine Unterkunft, die vermutlich in der Festung liegt, dem Hauptquartier seiner Flotte am Hafen. Er will sich entschuldigen, dass er nicht am Bankett teilnehmen kann, das Rectina in ihrer prächtigen Villa über dem Meer zwischen Herculaneum und Pompeji geben wird: Leider lassen es Studien und Pflichten nicht zu, Misenum zu verlassen.
Die beiden liegen sich auf Sofas gegenüber und nehmen eine leichte Mahlzeit zu sich, begleitet von köstlichem Falernerwein, der in dieser Region angebaut wird. Rectina fallen die vielen volumina auf, die »Bücher«, die damals aus langen Schriftrollen bestehen und über den ganzen Raum verteilt sind – zwischen geografischen Karten, Kaiserbüsten, Schädeln und Fellen exotischer Tiere.
Plinius ist ein wissbegieriger Mensch. Heute wäre er sicher Naturwissenschaftler und Forscher, ist er doch in der Lage, jedwedes Thema rational zu analysieren, ob es sich nun um Natur, Wissenschaft, Geschichte oder Literatur handelt. Außerdem ist er ein großartiger Redner: »Primetime-geeignet« sozusagen.
Doch unsere Spekulationen werden unterbrochen vom Erscheinen des Neffen. Plinius der Jüngere, damals gerade mal siebzehn Jahre alt, begrüßt Rectina höflich. Er kommt in Begleitung seiner Mutter, Plinius’ Schwester, die natürlich Plinia heißt. Der junge Mann wurde vom Onkel adoptiert, und dieser sucht in jeder erdenklichen Weise, ihn zum Lernen anzuhalten.
»Gehst du heute in die Therme von Baiae?«, will der Mann mit der sonoren Stimme wissen.
»Ja, aber nur kurz für ein entspannendes Bad. Vielleicht ein schöner Spaziergang …«, antwortet der Junge.
»Du könntest dich doch auch in der Sänfte hintragen lassen …«, meint lachend der Admiral.
Ein alter Witz zwischen den beiden. Aus den überlieferten Briefen wissen wir, dass der Onkel den Neffen häufig aufzog wegen dessen tiefverwurzelter Gewohnheit, alle Wege zu Fuß zurückzulegen. »Dann würdest du nicht so viel Zeit verlieren«, sagt er, der jeden Augenblick, der nicht der Lektüre und dem Studium gewidmet ist, als verloren betrachtet …
Plinius der Ältere arbeitet so viel, dass er grundsätzlich eine Sänfte benutzt, weil er dort seine Arbeit fortsetzen kann. Vor allem in Rom, wo schon damals der »Verkehr« jeden Ausflug endlos in die Länge zog.
Rectina lächelt. Sie weiß sehr gut, dass Plinius der Ältere nicht unbedingt der Norm entspricht.
Tatsächlich hat man über ihn einiges herausgefunden, das ihn aus der Masse hervorhebt. Er war ein echter »Workaholic«, süchtig nach Arbeit. Sein gesamter Tagesablauf war der Ansammlung von Wissen gewidmet. Er ließ sich Bücher vorlesen, zu denen er dann Notizen machte – schon morgens, wenn er gleich nach dem Erwachen ein Sonnenbad nahm. Oder während er sich nach dem Bad in den Thermen massieren ließ. Oder beim Abendessen. Jede Sekunde war kostbar und jedes Buch ebenso. Einer seiner Lieblingssprüche lautete: »Kein Buch ist so wenig wert, dass es nicht irgendwo einen Nutzen hätte.«
Dabei half ihm eine große Gabe: Er brauchte wenig Schlaf und konnte auch die ganze Nacht lang wach bleiben. Am Morgen dann marschierte er schnurstracks zu Kaiser Vespasian (wie sein Neffe berichtet), der ebenfalls eine Nachteule gewesen sein muss. Dann arbeiteten die beiden zusammen. Sobald er wieder zu Hause war, nahm er erneut seine Studien auf, unterbrochen lediglich von kurzen Schlafpausen (wie Napoleon dies auch tat). Seine Fähigkeit, jederzeit und überall in Schlaf sinken zu können, war sprichwörtlich. Doch möglicherweise war es gerade dies, was ihm während des Vulkanausbruchs zum Verhängnis werden sollte.
Rectina verabschiedet sich von der Familie. Sie muss wieder los. Wenige Minuten später sieht sie Plinius’ Antlitz in der Ferne immer kleiner werden, während ihre Liburne von der Mole ablegt und auf die See hinaussteuert. Der Admiral hat dafür gesorgt, dass sie schnell in ihre Villa zurückgebracht wird. Sie wirft einen Blick zurück und sieht ihn in eine Sänfte steigen. Er gibt den Trägern ein Zeichen. Sein Sekretär folgt ihm auf dem Fuße und liest ihm etwas vor. Die kleine Gruppe entfernt sich rasch vom Hafen. Nur der lesende Sekretär stolpert von Zeit zu Zeit.
Eine Karte aus Neapel – ohne den Vesuv!
Die Liburne ist ein Schiff mit zwei Reihen von Ruderern und daher ziemlich schnell. Ursprünglich wurde dieser Schiffstyp von den Piraten der östlichen Adria benutzt, die damit schnelle Raubzüge durchführten. Die Römer befreiten die Adria von Piraten und übernahmen später den Schiffstyp. Er wurde nur leicht verändert und an militärische Erfordernisse angepasst. Da die Liburne gut zu manövrieren war, erreichte sie die Anlegestelle bei Rectinas Villa sehr viel schneller, als dies ein klassisches Segelschiff vermocht hätte. Die Bireme hatte nämlich nicht nur Ruderer, sondern auch Segel zur Verfügung. Übrigens: Wie die spätere Untersuchung der Ablagerung aus Asche und Lapilli (erbsen- bis nussgroßem Vulkangestein) ergab, wehte zu der Zeit, als Rectina nach Hause zurückkehrte, eine steife Brise aus Südost, die sie relativ schnell zu ihrer Villa getragen haben dürfte.
Rectina spürt, wie das Schiff die Wellen durchpflügt. Die Küste Kampaniens fliegt förmlich an ihr vorbei. Schon liegt Misenum in weiter Ferne. Auch den Golf von Puteoli, heute Pozzuoli, mit seinen Villen und Palästen, in denen Roms »High Society« ihre berühmt-berüchtigten zügellosen Bankette feiert, hat das Schiff schon hinter sich gelassen.
An diesem Küstenabschnitt liegen zahlreiche Orte, die sich einer gewissen Berühmtheit erfreuen. Die Liburne schießt an der kleinen Insel Nisida vorbei und taucht ein in den Golf von Neapel. Rectinas Blick wandert zerstreut über den Hügel, der linker Hand ansteigt, von Villen bedeckt. Die berühmteste ist sicher die des Publius Vedius Pollio, die er Kaiser Augustus vererbte. Dort erhebt sich heute Posillipo, der schönste Stadtteil Neapels. Selbst wenn Sie noch nie dort waren, kennen Sie das Panorama, denn dort werden sämtliche Postkartenbilder von Neapel und dem Golf von Pozzuoli aufgenommen, in der Ferne der Vesuv und seitlich die unvermeidliche Pinie … Der Ort hatte schon in der Antike etwas Bezauberndes, denn Pollio nannte seine Villa »Pausilypon«, aus dem dann das italienische »Posillipo« entstand. »Pausilypon« aber bedeutet »Atempause vom Leiden«.
Nur bietet sich Rectina ein ganz anderes Bild. Lassen Sie uns näher treten und schauen, was sich in ihren Pupillen spiegelt. Stimmt, da ist etwas merkwürdig: Die Pinien, der Golf, alles ist da – doch etwas fehlt … tatsächlich, der Vesuv! Wir drehen uns um und lassen unseren Blick über die Küstenlinie wandern. Weit und breit kein Vulkan in Sicht! Wie kann das sein?
Warum es noch keinen Vesuv gab: Die »echte« Ansichtskarte von Neapel vor zweitausend Jahren
Das ist die erste Überraschung, die uns erwartet, wenn wir uns mit der Geografie jener Zeit beschäftigen: Zur Zeit Pompejis war der Vesuv tatsächlich nicht sichtbar. Um zu verstehen, was ein Römer im Jahr 79 n. Chr. dort sah, müssen Sie sich das klassische Panorama ohne den Kegel des Vulkans vorstellen. So sah die Küste von Kampanien damals aus.
Die zweite Überraschung (die sich logisch aus der ersten ergibt) ist, dass der Vulkan, der sich heute so bedrohlich über der Stadt auftürmt, nicht derselbe ist, der Pompeji unter sich begraben hat. Zu jener Zeit gab es diesen Kegel noch gar nicht! Nicht gerade das, was man aus Reiseführern, Filmen und Romanen kennt. Aber was hat dann Pompeji, Terzigno, Herculaneum, Boscoreale, Oplontis und Stabiae zerstört?
Es war ein anderer Vulkan an derselben Stelle, der jedoch sehr viel älter war als der heutige: der Somma. Und Sie kennen ihn, zumindest, wenn Sie schon mal Ansichtskarten von Neapel gesehen haben. Darauf ist schön zu erkennen, dass der Vesuv links eine »Einkerbung« hat. Wenn Sie ihn im Hubschrauber überfliegen, sehen Sie, dass diese Delle in Wirklichkeit eine halbkreisförmige Anhöhe ist, die den aktuellen Vesuv teilweise umschließt, als würde sie ihn umarmen. Dieser Halbkreis ist das, was vom Krater des alten Vulkans übrig geblieben ist. Dieser war seit Jahrhunderten verschlossen, bevor er sich unvorhergesehen öffnete und in Pompeji und Umgebung Tausenden Menschen den Tod brachte.
Und wie kam es nun zur Entstehung des neuen Vesuvs, wie wir ihn heute kennen? Der bildete sich nach dem Ausbruch des alten Vulkans, und zwar genau in der Caldera, dem Einsturzkrater, des Somma. Die Eruption von 79 n. Chr. war seine Geburtsstunde. In diesem Sinne ist der heutige Vesuv das Kind der Tragödie von Pompeji. Aber es dauerte Jahrhunderte, bis er seine aktuelle Größe erreichte. Auf einigen mittelalterlichen Fresken, die den heiligen Gennaro neben dem Vesuv zeigen, ist der jüngere Vulkan noch niedriger als der Somma.
Und noch eine Kuriosität: Die Römer nannten den alten Vulkan nicht »Somma«, wie wir das heute tun. Für sie war er der »Vesuvius« oder »Vesbius«. Dieser alte Name wurde dann auf den neuen Vulkan übertragen. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man antike Texte liest, anderenfalls kann es zu Verwirrung führen. Korrekterweise müssten wir also den antiken Vulkan »Vesuvius« nennen und dürften nur den neuen als »Vesuv« bezeichnen.
Nun wissen wir also, dass der Vesuv, den wir heute vor Augen haben, nicht derselbe ist, den die Menschen von Pompeji kannten. Wenn es aber doch schon einen Vulkan in der Antike gab, wieso haben die Römer dann nicht bemerkt, wie gefährlich er war? Schließlich bleibt sich die Form eines Vulkans immer ziemlich gleich, und sie löst gewöhnlich doch gewisse Ängste aus, vor allem, wenn man an seinen Abhängen lebt.
Hier habe ich noch eine Überraschung für Sie und einen weiteren Mythos, den es zu widerlegen gilt. In den berühmten Filmen und den Büchern über Pompeji zufolge erhebt sich immer ein gewaltiger Vulkankegel über der Stadt (meist noch größer als der aktuelle Vesuv). In Wirklichkeit aber hatte der Vulkan diese Dimensionen nur in der Vorgeschichte, als der Mensch vor der letzten Eiszeit noch in Höhlen lebte und diese bemalte: Damals hatte ein ständiger Lavaausstoß den Kegel auf eine enorme Größe anwachsen lassen. In der Folge aber kam es immer wieder zu Ausbrüchen von gewaltiger Stärke, die diesen Riesen schließlich sukzessive schrumpfen ließen. Übrig blieb nur die Basis des Kraters.
Was also sahen die Römer zu jener Zeit? Einen breiten, eher niedrigen Berg, der von einer Hochebene gekrönt war und nur an den Rändern ein paar Zacken aufwies. Auch die »Decke« verschleierte seine wahre Identität, denn Wälder, Weingärten und Felder überzogen den gesamten Berg. Auf den ersten Blick sah er genauso aus wie die Erhebungen der Umgebung. Er hatte sich gleichsam camoufliert wie ein militärisches Erkundungskommando, das sich hinter Blättertarnnetzen verbirgt. Nach heutigem Erkenntnisstand waren die einzigen vegetationslosen Bereiche tatsächlich der Gipfel (der aktuelle Monte Somma mit seinen zerklüfteten felsigen Abhängen im Inneren) und ein »Mittelstück«, auf dem gar nichts wuchs. Dies war offensichtlich der »Pfropfen«, der den Vulkan verschloss und bei dessen Eruption explodierte. Doch dieses Mittelstück war nicht besonders groß, denn gewöhnlich werden erloschene Vulkane schnell von Vegetation überzogen.
Daher waren sich die Römer nicht darüber im Klaren, dass sie an den Abhängen eines gewaltigen Höllenschlunds lebten. Sie bauten Wein an, gingen spazieren, küssten und liebten sich auf der Oberfläche eines mächtigen verborgenen Killers.
Einige Gelehrte römischer Zeit wussten allerdings um die wahre Natur dieses Berges: Der berühmte griechische Geograf Strabo zum Beispiel, der fünfzig Jahre vor Ausbruch des Vesuvius starb, hatte erkannt, was sich dahinter verbarg. Ihm war aufgefallen, dass sich an den Abhängen zwar fruchtbare Felder befanden, der Gipfel aber kahl war und nach Asche aussah. Außerdem sei der Berg bedeckt von Höhlen und Spalten, ja, das Gestein schien geschmolzen zu sein … Daraus schloss der hellsichtige Strabo, dass dieser Berg wohl einmal ein Vulkan gewesen sei, mittlerweile jedoch erloschen. Auch der Historiker Diodorus Siculus war zum selben Schluss gelangt: Ein Jahrhundert vor dem Ausbruch, der Pompeji zerstören sollte, schrieb er, dass dieser Berg einst Feuer gespuckt habe wie der Ätna und dass er immer noch Zeichen einstiger Aktivität zeige.
Wie bei so vielen historischen Tragödien gibt es immer Leute, die vorher begreifen, was geschehen wird. Beide Gelehrte hatten den richtigen Riecher, auf keinen von beiden hat man gehört. Und so konnten Tausende von Menschen nicht gerettet werden. Nicht einmal Plinius der Ältere, Naturforscher und einer der klügsten Köpfe seiner Zeit, sah die Gefahr, obwohl er an den Hängen des Vulkans lebte.
Und dennoch auf römischen Fresken zu sehen: Der Vesuvius
Aus heutiger Sicht ist es kaum fassbar, dass man in Pompeji und Herculaneum den Killer auf Fresken darstellte, ohne zu bemerken, dass es sich dabei um einen Vulkan handelte! Für uns sind diese bildlichen Darstellungen allerdings schon aus dem Grund wertvoll, weil wir daraus die Gestalt des Vesuvius vor dem Ausbruch rekonstruieren können.
Wie gesagt sah man von dem vollkommen zerstörten prähistorischen Vulkan nur noch die Basis des breiten Kraters als gezackte Linie. Man muss sich das vorstellen wie einen Aschenbecher mit unregelmäßigem Rand und einer deutlich niedrigeren Seite. Ein bisschen wie heute das Kolosseum.
Außerdem sah der Vulkan je nach Perspektive anders aus. Wer in Herculaneum lebte, befand sich auf dieser niedrigeren Seite und sah daher den »Sporn« des Monte Somma gut: eine vertraute Form, die sich gegen den Morgenhimmel abzeichnete. Den Blick, den die Bewohner von Herculaneum hatten, machte ein Fresko unsterblich, das 1879 entdeckt wurde. Es schmückte einen Hausaltar (ein Lararium) in der Villa eines Pompejaners namens Rustius Verus. Bacchus tritt uns darauf entgegen, geschmückt mit Trauben. Hinter ihm zeichnet sich ein stilisierter steiler Berg ab, der von Weingärten bedeckt ist. In Reiseführern wird dieser Berg meist als Vesuv bezeichnet. In Wirklichkeit ist es der aktuelle Monte Somma, also der Kraterrand des prähistorischen Vulkans, von der Seite gesehen, wie der Querschnitt einer Welle. Man erkennt sehr schön darauf, wie der Berg von Herculaneum aus ausgesehen haben musste – wie eine spitze Nadel. Er ist ganz von Weingärten bedeckt und wurde sicher als Geschenk der Natur wahrgenommen, nicht als mörderisches Monstrum. Wir sehen hier sozusagen einen der Fangzähne des gewaltigen Raubtiers, das bald ganze Städte verschlingen würde.
Wer in Pompeji oder Stabiae wohnte, also im Südosten, hatte die platte, offene Seite des Vulkans vor Augen, die wir mit der »niedrigen« Seite des Kolosseums verglichen hatten. Dort gab es keine natürliche Barriere, nichts, was die schrecklichen Ströme aus Glut, Asche und Gas aufgehalten hätte, die so viele Menschen das Leben kosteten. Wer den Vulkan vom Osten aus betrachtete, vom heutigen Nocera Inferiore aus, sah einen niedrigen Bergrücken (der durch Erosion und frühere Ausbrüche abgetragen worden war), eine wenig bemerkenswerte Erhebung am Horizont.
Hätte der Vesuvius seinen Krater behalten, zumindest seine runde Form, hätten die Römer vermutlich erkannt, dass es sich bei diesem Berg um einen Vulkan handelte. Doch sein jahrhundertelanges Schweigen täuschte am Ende alle. Noch eine Kuriosität am Rande: An den zerklüfteten Hängen des Aschenbechers versteckte sich einst eine berühmte Persönlichkeit. Im Jahr 73 v. Chr. zog sich der thrakische Gladiator Spartacus, der den berühmten Sklavenaufstand anführte, mit seinen Gefolgsleuten auf den Monte Somma zurück und verbarg sich mit ihnen am höchsten Punkt des Kraters. An diesen wilden, unwegsamen Ort folgte ihnen niemand. Der römische Prätor Appius Claudius Pulcher verbarrikadierte den einzigen Zugangsweg und hoffte, die Aufständischen so aushungern zu können. Doch Spartacus suchte sich auf der steilen Seite seinen Weg nach unten. Seine Leute knüpften Seile aus den Weinreben und seilten sich von den Abhängen ab. Dort überraschte er seine Gegner und setzte sie außer Gefecht.
Der »Ground Zero« der Eruption
Ein Faktum, das in Filmen, Bestsellerromanen, Fernsehserien und -dokumentationen unweigerlich falsch dargestellt wird, ist der genaue Ort der Eruption. Wir wissen, dass alles begann, als der »Pfropfen« aus dem Vesuvius geschleudert wurde. Im Film zeigt man dann gewöhnlich eine Explosion am Gipfel des Vulkans. Das sieht natürlich beeindruckend aus – aber so war es nicht. Wie wir wissen, hatte unser Vulkan ja keine Spitze. Er sah vielmehr aus wie eine geschmolzene Eistüte.
»Ground Zero« befand sich also nicht oben, an einem »Gipfel«, sondern unten, im flachen Becken, das von den Überresten des einstigen Kraters umschlossen war, den man aufgrund seiner kesselförmigen Struktur »Caldera« nennt (spanisch für »Kessel«).
Wir wissen nicht, ob auf dem »Pfropfen« jemand lebte. Heute geht man im Allgemeinen davon aus, dass dieser Bereich trocken wie eine Mondlandschaft und deshalb verlassen war. Aber welche Ausdehnung hatte diese Zone? In einigen antiken Quellen wird sie zwar erwähnt, allerdings finden sich keine Angaben zur Größe. Nahm sie den gesamten Innenraum des Kraters ein oder wirklich nur sein Zentrum?
Möglicherweise gibt es darauf eine Antwort. Vielleicht steht sie uns ja schon seit Jahrzehnten vor Augen, wurde bislang aber einfach nicht gesehen. Denn in dem bereits erwähnten Bacchus-Fresko gibt es rechts einen dunklen ovalen Bereich im oberen Teil des Berges.
Einige Wissenschaftler wie der Archäologe Virgilio Catalano gehen davon aus, dass der zerstörte prähistorische Vulkan einen weiteren kleineren Kegel in seinem kesselförmigen Krater hatte. Dieser kleinere Kegel war wohl selbst teilweise erodiert. Vielleicht war er bei einer jüngeren Eruption entstanden, die sich etwa zwölfhundert Jahre vor dem Ende Pompejis ereignet hatte.
Möglicherweise können wir mit dieser Information den Ausbruch im Inneren des Vesuvius rekonstruieren. Es ist möglich, dass die von Strabo beschriebene trockene Ascheregion nur auf diesen kleineren Kegel begrenzt war. Und rundherum? Da der Vesuvius so ausgesprochen fruchtbar und seit Jahrhunderten inaktiv war, hatte sich ringsumher vermutlich ein Waldgürtel gebildet, der vom Regenwasser gespeist wurde, das sich in ebenjenem Becken sammelte, das von der alten Caldera übrig geblieben war.
Wir wissen, dass es an den Abhängen des Vesuvius von Ziegen und Wildschweinen nur so wimmelte. Man hat in Pompeji auch Hirschgeweihe gefunden. Möglicherweise hat sich also in einigen Zonen rund um den Berg eine wilde Flora und Fauna angesiedelt.
Wenn das so ist, wohnte dem Ort sicher ein tiefer Zauber inne: eine Art natürliches Amphitheater voller windgeschützter Wälder, das sich an seiner niedrigsten Stelle aufs Tyrrhenische Meer hin öffnete und den Blick auf einen berauschenden Sonnenuntergang freigab. Wir wissen, dass sich auf der zum Meer hin abfallenden Seite zahlreiche Villen und Landgüter befanden. Das beschreibt auch Plinius der Ältere so. Und im Inneren? Wäre es nicht möglich, dass es dort auch Felder gab, kleine Bauernhöfe, Lehmpfade? Natürlich, aber wir wissen nicht genau, ob das wirklich so war.
Also halten wir inne und legen unserer Fantasie die Zügel an. Wir haben keinen Beweis dafür, und es gibt keine Hinweise auf Wohnsiedlungen in dieser Gegend. Das ist nur eine Hypothese. Sollte es diese tatsächlich gegeben haben, so wären sie innerhalb von Sekundenbruchteilen vom Antlitz der Erde weggewischt worden …
Ein prähistorischer Serienkiller
Der antike Vesuvius hat schon früher getötet. Mindestens drei seiner Ausbrüche müssen apokalyptische Ausmaße angenommen haben, die dem des Jahres 79 n. Chr. gleichkamen.
Von einem dieser Ausbrüche ist uns ein beredtes Zeugnis überliefert: die Reste eines Dorfes aus der Bronzezeit, das sich in Croce del Papa bei Nola befindet. Vor etwa viertausend Jahren überzog der Vesuvius das Land mit Asche (man kennt diesen Ausbruch als »Avellino-Eruption«) und einem Regen von Lapilli-Steinen. Das fragliche Dorf wurde von einem sogenannten »Lahar« verschüttet, einer Schlammlawine, die vom Vulkan herunterrollt. Diese Schlammlawine hat das Dorf vor dem Verfall bewahrt.
Mittlerweile sind zwar mehr als viertausend Jahre vergangen, doch die Archäologen konnten zahllose Gebrauchsgegenstände, ja sogar fein gearbeitete Vasen sicherstellen. Selbst die Umfriedung des Dorfes, die aus Stroh und Binsen geflochten war, ist erhalten geblieben: sozusagen ein Pompeji der Bronzezeit. In den Hütten fanden sich noch viele Gegenstände an ihrem Ort. Es gab Zäune rund um die Bereiche, in denen Schweine oder Schafe gehalten wurden. Sogar Pferde nutzte man schon für die Landwirtschaft.
Dass keine menschlichen Körper gefunden wurden, nimmt man als Beleg dafür, dass die Bewohner dieses Dorfes fliehen konnten. Einige allerdings schafften es nicht. Auch der gewaltige Vulkanausbruch vor viertausend Jahren forderte seine Opfer. Zwei davon fand man in San Paolo Bel Sito. Es handelt sich um die Skelette eines Mannes zwischen vierzig und fünfzig Jahren von etwa einem Meter siebzig Körpergröße. Der Mann war ausgesprochen muskulös. Neben ihm lag eine anderthalb Meter große Frau von etwa zwanzig Jahren, die schon mehrere Kinder geboren hatte. Die beiden flohen durch einen wahren Platzregen von Steinen. Obwohl sie mehr als sechzehn Kilometer vom Vulkan entfernt waren, konnten sie sich nicht retten. Als die Archäologen sie fanden, hatten sie noch die Hände vorm Gesicht, wodurch sie sich vor den Steinen hatten schützen wollen.
Ihre Haltung im Augenblick des Todes ähnelt der anderer Vulkanopfer in Pompeji. Vielleicht waren auch sie von einer Gas-und-Asche-Wolke überrascht worden. Oder es waren die Steine, die aus einer Höhe von mehreren Dutzend Kilometern mit einer geschätzten Geschwindigkeit von hundertfünfundzwanzig bis hundertsiebzig Stundenkilometern auf die Erde niederprasselten! Ihre Körper waren mehr als einen Meter hoch von Steinen bedeckt. Der Vesuvius hatte damit auch ihnen ein Grab geschaffen.
Die lange Tradition von Tod und Zerstörung, die mit dem alten Vulkan begonnen hatte, wurde fortgesetzt vom heutigen Vesuv, der quasi am Tag der Pompeji-Eruption entstand. Zu jenem Datum fand die Wachablösung statt. Der neue Vulkan war geboren und stieß seinen ersten Schrei aus.
Er brauchte Jahrhunderte, um heranzuwachsen, sichtbar zu werden und seine heutige Größe zu erreichen. Er wuchs in Schüben, legte Pausen ein, brach wieder in sich zusammen. Kleine, aber immer wieder stattfindende Eruptionen hatten zur Folge, dass Lava sich ansammelte und den heutigen Kegel bildete. Viermal wuchs er mit großer Wucht: Er erhob sich zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert n. Chr., danach wurde es ruhig. Erst zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert kam es erneut zu erhöhter vulkanischer Aktivität und 472 zur Pollena-Eruption, bei der Asche bis nach Konstantinopel geschleudert wurde. Dabei wurde die gesamte Gegend um das alte Pompeji von Asche bedeckt, sodass sich die Höhenlage des Areals veränderte. Zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert kam es erneut zu Ausbrüchen. Die letzte Zeit intensiver vulkanischer Tätigkeit gipfelte im Ausbruch von 1631. Seit dem letzten Vesuvausbruch von 1944 »schweigt« der Vulkan bis heute.
Doch jetzt wollen wir nach all diesen vulkanologischen Erläuterungen zum Vesuv wieder zu unserer Erzählung zurückkehren.
Traumvillen
22. Oktober 79 n. Chr., 13.00 Uhr
Noch 48 Stunden bis zum Ausbruch
O FELICEM MEO ich Glücklicher!
Das Schiff setzt seine Fahrt fort, der Tag ist wunderschön. Die Liburne hat beide Segel gesetzt, um den guten Wind zu nutzen. Keiner der Menschen an Bord weiß zu diesem Zeitpunkt, dass ebenjener Wind während des Ausbruchs zum ruchlosen Helfershelfer des Vulkans werden soll. Er wird den Bimssteinregen in die Stadt tragen, dem Tausende von Pompejanern zum Opfer fallen.
Es ist schon erstaunlich, wie wenig diese eleganten Schiffe den unseren ähneln, obwohl sie unter demselben Wind dieselben Meere befahren. Heutige Segelschiffe haben eine Bugspitze, die mehr oder weniger hoch aus dem Wasser ragt. Die Bugspitze römischer Segler hingegen erhebt sich kaum über die Wasseroberfläche. Sie sieht aus wie eine Nase, die die Wellen zerteilt. Darüber prangen rechts und links am Bug zwei gemalte Augen. Der Bug des Schiffes sieht aus wie die Schnauze eines Tieres. Darüber rollt sich dann eine Art Locke (fast wie bei Elvis Presley) aus bemaltem Holz.
Auch das Heck ist anders, als wir es kennen: Es ragt weit aus dem Wasser heraus, und über die Brücke wölbt sich etwas, was aussieht wie der aufgestellte Schwanz eines Skorpions. Bizarr, nicht wahr? Manchmal wird dieses Element ausgeführt wie ein Schwanenhals, sodass das Schiff einem Vogel ähnelt, der seinen Hals S-förmig wölbt. Bei anderen Liburnen wiederum ist der Skorpionschwanz aufgefächert wie ein Grasbüschel, oder er endet in einer großen Kugel. Auf den ersten Blick hält man das Ding für reinen Zierrat, dann aber fängt man an zu überlegen: so viel Material, so viel Aufwand, so viel Gewicht? Natürlich, man könnte es auch benutzen, um das Zelt zu halten, das auf der Brücke aufgespannt ist und vor Sonne und Regen schützt. In Wirklichkeit ist es aber eher eine Art festes Ruder, das half, die Liburne am Wind auszurichten.
Um seine Funktion zu verstehen, müssen wir uns die Wetterfahnen auf alten Kirchtürmen oder Palästen vergegenwärtigen, die häufig die Form eines Wappens oder Hahns hatten und die Windrichtung anzeigten. Bei einem Schiff hilft diese Heckverlängerung, einen günstigen Wind zu finden, der das Schiff vom Heck her antreibt.
Römische Schiffe haben ein Rahsegel, daher sind sie schnell, wenn sie vor dem Wind segeln. Auch aus diesem Grund konnten die Römer ihre Handelswege bis nach Indien ausdehnen. Der Wind vom Heck her sorgte dafür, dass sie dort sicher ankamen, und die Monsunwinde halfen ihnen, den Weg zurück zu finden.
Der Steuermann richtet das Schiff aus (natürlich auch dem Seegang entsprechend), das feste Ruder am Heck aber leistet einen wichtigen »passiven« Beitrag. Weht der Wind nicht direkt in Fahrtrichtung, können die Seeleute die Segel entsprechend ausrichten, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Kommt der Wind von vorn oder von der Seite, dann ist mit Windkraft nicht mehr voranzukommen, und die Ruderer übernehmen. Oder man läuft einen Hafen an und wartet auf günstigere Winde.
Die berühmten dreieckigen Segel, die den Seitenwind als Antrieb nutzen können, verbreiten sich erst im Mittelalter. Ihnen verdanken wir das Regattafeeling und das Windsurfen. Ein römischer Seemann wäre verblüfft gewesen ob der Manövrierfähigkeit heutiger Segelboote, die bei jedem Wind vorwärtskommen.
Auch diese Dinge sind wichtig zu wissen, um die Tragödie von Pompeji zu verstehen, denn die Rahsegel bringen es mit sich, dass römische Schiffe nur Fahrt aufnehmen können, wenn sie günstige Winde haben. Das hat zur Folge, dass viele Menschen während der Eruption in Pompeji und Stabiae festsitzen. Stellen wir uns all die fliehenden Menschen vor, die es bis zum Hafen schaffen. Sie sehen die Schiffe vor sich, die sie retten könnten, doch sie können nicht auslaufen. Die Seeleute sind machtlos. Sie können nicht »im Wind« oder »am Wind« segeln, wie man das heute nennt, also gegen den Wind oder mit Seitenwind. Aber natürlich war es nicht nur der Wind, der die Schiffe am Auslaufen hinderte, sondern auch das Meer, das er zu hohen Wellen aufpeitschte.
Noch eine Anmerkung zu den Schiffen aus römischer Zeit: Sie haben keine Kabinen für Reisegäste, tatsächlich gibt es noch keine Passagierschiffe. Die großen Schiffe, die in der Antike das Mittelmeer befahren, sind Transport- oder Kriegsschiffe. Reisende machen es sich auf der Brücke mehr oder weniger bequem und schlafen dort auch. Was sie zum Essen brauchen, müssen sie sich selbst mitbringen. Und dann gibt es da noch die Fischerboote und … die Privatjachten. Diese höchst eleganten Schiffe werden von reichen Römern für Kreuzfahrten oder Feste auf See benutzt, wie wir später noch sehen werden.