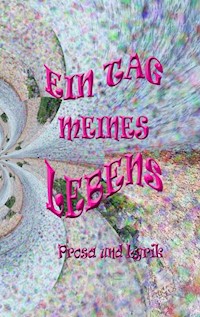
Ein Tag meines Lebens E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Leben jedes Menschen findet sich eine Reihe unvergesslicher Tage, seien sie mit realen oder seelischen Ereignissen ausgefüllt. Wenn man so einen Tag beschreibt, ähnelt diese Geschichte einem Ausschnitt aus einem Tagebuch. Warum wählen Schriftsteller für ihre Romane so oft die Form eines Tagebuches? Nach Ernst Jünger ist ein Tagebuch das ideale Genre, um eine scharfe Beobachtungsgabe mit ungebändigter Sinnlichkeit zu verbinden. Nach Stephen King beginnt man beim Schreiben mehr und schärfer zu denken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT:
Vorwot von Claudia Taller
Vorwort von H.M.Magdalene Tschurlovits
Beppo Beyerl
Sophia Benedict
lse Viktoria Bösze
Cornelia Divoky
Anna Eckardt
Christl Greller
Jadranka Klabučar Gros
Jürgen Heimlich
Bernhard Heinrich
Josef Helmreich
Ernst Karner
Emma Klinger
Margit Lashofer
Anton Marku
Elmar Mayer-Baldasseroni
Walter Meissl
Mostafa Mirchi
Peter Mitmasser
Traute Molik-Riemer
Eva Novotny
Mërgim Osmani
Georg Potyka
Roswitha Perfahl
Elisabeth Schawerda
Elisabeth Schöffl-Pöll
Karin Seidner
Ingrid Schramm
Martina Sens
Michael Stradal
Claudia Taller
H. M. Magdalena Tschurlovits
Horst Weber
Peter Paul Wiplinger
Hannes Vyoral
Besim Xhelili
Worte von Einst ähneln der Spur ferner Sterne:
Ein Stern, längst verglüht,
ist noch am Himmel zu sehen.
Worte, die wir in Tränen auf Papier vergossen,
Haben längst keinen Besitz mehr von uns.
Wozu also stecken ahnungslose Leute
Ihre Nase in ein fremdes Tagebuch?
(A.M. Ostrowskaja,
übersetzt von Anna Maria Platzgummer)
‚EIN TAG MEINES LEBENS’
Von Claudia Taller
Ein Leben ist Fülle – gewesene, gegenwärtige, zukünftige.
Ich lebe in meinem Leben – ansatzlos, zäsurlos, gleich einem Strom.
Greif in einen Strom, versuch das Wasser zu greifen, zu halten, du wirst scheitern. Einen Tag herausnehmen aus des Lebens Fülle? Einen nur?
Wie kann ein Tag mich zeigen? Was kann ein Tag von mir sagen?
Das ist Willkür, ich verweigere!
Und doch wandern die Gedanken durch die Jahre, gab es da nicht Tage . . .?
Tage, die leuchteten, Tage, nach denen dir graute?
Auch ein Tag ist dein Tag, jeder Tag ist dein Tag, er spiegelt dein Leben.
Die Gedanken wandern zurück, verweilen hier, verweilen dort.
Das habe ich erlebt? War das ich? War das mein Ich?
Ich schaue auf meine Tage wie aus weiter Ferne, meine Tage waren schön, meine Tage waren schwer. Gab es wichtigere? Gab es entscheidende dafür, wie nach ihnen mein Leben geworden? Die Frage ist müßig. Wir haben nur ein Leben, doch viele Tage.
Trau dich, schau genauer hin, auf einen Tag, sei es ein schrecklicher, sei es ein schöner. Wähl einen und wandere durch diesen Tag, Stunde für Stunde. Lass sie lebendig werden die Stunden, lebe sie noch einmal.
Deine Erinnerungen werden die Stunden neu erschaffen, werden sie verfälschen, in die eine oder andere Richtung.
Sie werden sie in ein sanfteres Licht tauchen oder in ein grelleres. Es wird Lücken geben in deinen Erinnerungen und du wirst sie auffüllen, absichtslos. Es wird gut sein, so oder so, du darfst nicht nur dein Leben gestalten, du darfst auch deine Erinnerungen gestalten.
Und du gestaltest sie jetzt, heute; auch heute ist ein Tag in deinem Leben.
Gestalte den einen Tag – vielleicht findest du einen verborgenen Sinn - vielleicht birgt er Sinn für einen anderen.
Gestalte ihn und dann leg ihn beiseite und lebe den heutigen Tag.
‚DAS LEBEN GLEICHT EINEM FLUSS‘
Von H. M. Magdalena Tschurlovits
Das Leben gleicht einem Fluss.
Irgendwo beginnt er als kleines Rinnsal, wird allmählich zum größeren Gewässer, mit Stromschnellen, Untiefen, Strömungen, Wirbeln, Fällen, Sandbänken, Schotterbänken, stillen Buchten.
Er bahnt sich seinen Weg, überwindet Widerstände, die seinem natürlichen Verlauf im Wege stehen.
Kein Tag verläuft für ihn wie der andere, er selbst muss sich jeden Tag beweisen, durchsetzen mit der Kraft, die ihn ausmacht. Manchmal trägt er andere auf seinen Wellen, reißt mit oder spült sanft ans Ufer.
Irgendwann ist sein Lauf zu Ende, mündet ins Meer, vereinigt sich mit anderen Wassern oder versickert, trocknet aus.
Manchmal erreicht er ungeahnte Länge, wird mächtig und stark, verästelt sich zur Lebensader. Ein andermal verläuft sein Weg kurz und unbemerkt.
Das Leben gleicht einem Fluss.
Diese Erzählungen und Gedichte spiegeln Empfindungen, Eindrücke, die dem Menschen, der sie hier mit uns teilt, wichtig waren, die Spuren hinterließen. Spuren, die manchmal erst nach Jahren aus den Abgründen der Erinnerung wiederauftauchen, wo sie versenkt oder vergessen, eingebettet lagen.
Panta rhei, alles ist in Bewegung, alles fließt.
Wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen, erkannte Heraklit.
Aber wir können die Erinnerung abrufen, die die Zeit für uns festhielt.
Sei es Sekunde, Stunde, Tag oder Zeitraum.
Zeitspannen, die für uns wichtig waren.
Lassen wir uns treiben auf dem Fluss des Lebens, im Boot der Erinnerungen.
BEPPO BEYERL
Geboren 1955 in Wien, schreibt Reportagen und Bücher über die Insassen Wiens und die Bewohner der restlichen Welt. Hat drei Heimaten: Wien, Böhmen, und den Karst. Letzte Bücher: „Die Straße mit sieben Namen“, „26 Verschwindungen“, „Die Triester Straße“, „Eine mährisch-böhmische Bierreise, „Es wird a Wein sein“, „Typisch Wien“ „Die Stadt von gestern“.
WENN DER WÜRFEL FÄLLT
Der Arzt in der Intensivstation hat mir gesagt, ich soll mit dir reden. Vielleicht verstehst du etwas, hat der Arzt gemeint, man kann das bei Komapatienten nicht restlos ausschließen. Da hab ich dem Arzt geantwortet, dass ich mein ganzes Leben lang mit dir nicht viel gesprochen habe. Was soll ich also angesichts deines Todes mit dir reden.
Freilich weiß ich, dass es dem Hansonkel in den Zwanzigerjahren in Karlsbad viel besser ging als euch. Ein Geschäft hatte er in der Badgasse 3, direkt am Ufer der Tepl. Einen Kolonialwarenladen mit Orangen, Zitronen und Paradeiser, und die Küchenchefs vom Imperial und vom Grandhotel Pupp ließen bei ihm einkaufen. Wahrscheinlich wirst du recht froh gewesen sein, in so einem exquisiten Laden mitten in der Karlsbader Kurzone deine Lehre zu absolvieren.
Dein Vater, also mein Großvater, der hatte es nur zu einer kleinen Garage gebracht, der Weinmanngarage, dort hatte der Großvater seine Spenglerwerkstatt eingerichtet. In den späten Zwanzigerjahren hatte er sich auf Karosseriespengler spezialisiert, weil er geglaubt hatte, dass er damit beim aufkommenden Autoverkehr genug Geld verdienen könnte.
Warum der Großvater 1932 nach Wien übersiedelte, hast du mir nie erzählt. Darüber hast du stets geschwiegen. Glaubte der Großvater, dass in Wien das Geld von den Bäumen fällt? Oder wollte er einfach von seiner Frau flüchten, deiner Mutter? Babička byla Češka, sie war eine Tschechin, aber das war vermutlich nicht der Grund für die Eheprobleme. Oder doch?
Jedenfalls mietete der Großvater in der Längenfeldgasse im zwölften Wiener Gemeindebezirk eine Garage, die er als Werkstatt einrichtete. Mit Werkbank, Schraubstock und Deckzange. Zum Wohnen mietete er eine Zimmer-Küche-Wohnung im Arbeitervorort Hernals. Als er 1936 die Miete für seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte, übernachtete er von nun an auf einem schmuddeligen Matratze in der Garage. Als er die Miete für die Garage nicht mehr bezahlen konnte, bettelte er brieflich bei seiner Frau in Karlsbad um Geld. Als die kein Geld schickten wollte, schrieb er an dich: „Von mir soll nichts mehr überbleiben, das ist mein letzter Wille. Wenn du zur Polizei gehst und nach mir suchen willst, so ist das deine Sache.“ Dem Brief legte er ein penibles Inventarverzeichnis bei, mit Dreikantfeile, Greifzirkel und Handschere gerade. Um euch keine Scherereien zu bereiten, schrieb er gleich den Schillingwert der Werkzeuge dazu, mit einem harten Bleistift übrigens. Ich weiß das, weil ich habe den Brief mit dem Inventarverzeichnis zwei Tage nach deiner Einlieferung ins Spital gefunden, er lag in deinem Aktenschrank. Und ich habe mir den Brief gleich mitgenommen, weil du ja nach ärztlichem Ermessen nicht mehr die Gelegenheit haben wirst, den Aktenschrank zu öffnen und den Brief zu studieren.
Deine Mutter, also meine Großmutter, hatte ja schon ab 1930 mit dem Hansonkel ein Verhältnis, deswegen hieß er ja: der Hansonkel. Als dann dein Vater 1932 endlich nach Wien auswanderte, schaute sie praktisch jeden Tag im Kolonialwarenladen in der Badgasse 3 vorbei, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Mitzitante überhaupt nichts davon bemerkte. Aber mit der Mitzitante bekam der Hansonkel aus irgendwelchen Gründen kein Kind. Schon im Jahr 1932 brachte hingegen deine Mutter einen Sohn vom Hansonkel auf die Welt, den kleinen Hansl. Von dem hast du mir aber erst erzählt hat, als wir im Frühling 1990 zusammen nach Karlovy Vary gefahren sind und ihn dort getroffen haben.
1936 bist du das erste Mal nach Wien gefahren: Du hast die Leiche deines Vaters identifizieren müssen, die durch einen eines Donaustrudels in der Stopfenreuther Au an Land geschwemmt wurde. Deine Mutter weigerte sich, diese Reise zu unternehmen, und sie schärfte dir ein, ja nicht ihren Namen oder ihre Adresse den Behörden gegenüber zu erwähnen. Vor allem wollte sie keine einzige Krone ausgeben, um etwa die Gerichtskosten oder die Überführung der Leiche zu berappen.
Nach deiner Rückkehr in die westböhmische Kurstadt hast du einen schweren Fehler gemacht: Weil ja die Welt rundherum so böse war, hast du dich fest an die Kittelfalten deiner Mutter geklammert. Und geklammert an ihre Kittelfalten solltest du bis zu ihrem Tode verharren. Freilich, das konnte sich auch positiv auswirken. So ist es dir erspart geblieben, dich unter dem Schutz und Schirm des böhmischen Gefreiten stellen und der Nazipartei beizutreten.
Warst du eigentlich dabei, als am 24. April 1938 der spätere Gauleiter Konrad Henlein im Karlsbader Bad III unter stetigem Heilhitlergebrülle sein nationalsozialistisches Bekenntnis formulierte? Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten ihn die tschechoslowakischen Behörden als Staatsfeind verhaften und zu lebenslänglich verurteilen müssen. Warst du dabei, als nach dem so genannten „Münchner Vertrag“ vom 30. September die Deutsche Wehrmacht unter dem Jubel der deutschen Bewohner die Kurstadt vom „tschechischen Zwangsjoch“ befreite und die Tschechen ins Landesinnere flüchten mussten? Bist du auf dem Theaterplatz gestanden, als am 4. Oktober 1938 der Führer vom Balkon des Theaters aus „Karlsbad ist tschechenfrei“ verkündete und die Karlsbader brüllten: „Führer, wir danken dir!“ Wo warst du, als am 9. November 1938 die deutschen Karlsbader die jüdischen Geschäfte plünderten?
Die einzige Tschechin, die nicht vor den Deutschen flüchtete, das war deine Mutter. Sie stand als bewährte Mitarbeiterin des Export-Import-Ladens in der Badgasse 3 unter dem persönlichen Schutz des Hansonkel. Als hoher NS-Funktionär und stellvertretender Leiter des Reichssiedlungsamtes sah er seine große Zeit kommen. Erst arisierte er das Haus in der Badgasse drei. Was passierte mit dem Juden, dem er das Haus gestohlen hatte? Weißt du überhaupt noch, dass im Jahre 1930 in Karlsbad 2120 Juden lebten? Was passierte mit deren Häusern und Geschäften? Und wohin wurden die Juden transportiert? Dann requirierte der Hansonkel alte Bauernmöbel aus dem 18 Jahrhundert, und als er stolz und reputierlich im dritten Stock seines neuen Hauses einzog, da konnte er seinen arischen Freunden bereits mit einer wild zusammengestohlenen Möblierung imponieren.
Aber jetzt zu dir. Ist dir aufgefallen, dass ich nie Vater und Papa zu dir gesagt habe? Zu groß war einfach die Distanz. Und jetzt, ich muss es zugeben, der Anblick ist nicht gerade erfreulich, mit aufgedunsenem Gesicht hängst du an allerhand Schläuchen, die mit irgendwelchen Geräten verbunden sind, und wenn ich jetzt Papa sage, dann müsste ich mich wahrscheinlich mit söhnlichen Gefühlen an die fürchterlichen Geräte wenden und nicht mehr an dich.
Aber im Krieg ist es nicht schlecht, wenn man ein Muttersöhnchen ist, die Haudegen und Draufgänger überleben die Kriege eher selten. So hast du den Krieg mehr oder weniger unbeschadet in der Etappe überstanden, und als du in sowjetische Gefangenschaft …
Freilich war 1945 alles ganz anders. Am 10. Mai 1945 wurde Karlsbad von der Roten Armee befreit. Die ersten, die beizeiten abhauten, das waren Leute wie der Hansonkel. Auf Armeelastern schleppten sie alles, was nicht niet- und nagelfest war, hinüber ins Altreich. Und genau diese Typen sollten dann in Deutschland ihre Forderungen erheben: Dass die Tschechen ihnen die Häuser zurückgeben müssen. Dass die Tschechen ihnen die Wertgegenstände ersetzen müssen. Und dass sich die Tschechen für den Genozid am deutschen Volk entschuldigen müssen.
Die Großmutter blieb aber mit ihrem Hansl, der hieß ab nun Jan, in Karlsbad, das wiederum hieß ab jetzt Karlovy Vary, zu deutsch übrigens Karlssuden. Schon als sich 1944 die Niederlage der Deutschen abzeichnete, fiel ihr auf einmal ihre tschechische Herkunft ein. Ihre schlimmste Befürchtung war, dass sie nach der Niederlage der Deutschen unter den Tschechen als Deutschenhure galt. So erzählte sie ab dem Winter 1945, dass der tatsächliche Vater des kleinen Jan ihr angetrauter Mann sei, der aber im Jahr 1938 blöderweise in der fernen Stadt Wien verstorben wäre, und dass ein brutaler Okkupant sein Arbeitsverhältnis in einem Kolonialwarenladen unverschämt ausgenutzt und sie mehrmals entehrt habe. Sicherheitshalber schickte sie im Märt 1945 den damals 14-jährigen Jan zu den Partisanen.
In der sowjetischen Gefangenschaft hast du beim Verhör den Soldaten der Roten Armee erzählt, dass du nur durch einen Zufall nach dem Münchner Verrat von 1938 als reichsdeutscher Staatsbürger gegolten hast und in Wirklichkeit ein strammer Tscheche bist. Warum die Russen dir geglaubt haben, das weiß bis heute kein Mensch, vielleicht weil du so überzeugend tschechisch gesprochen hast. Jedenfalls wollten die Russen von dir nichts mehr wissen und haben dich aus der Gefangenschaft nach Hause nach Karlovy Vary geschickt. Und jetzt hast du tatsächlich vom Hansonkel profitiert, weil du bei ihm vor dem Krieg in seinem Kolonialwarenladen die amerikanische Buchhaltung gelernt hast. Also bist du ohne Probleme mit deinen perfekten Kenntnissen der deutschen sowie der tschechischen Sprache in der Stadtkassa der Gemeinde untergekommen. In diesem Job ist ein weiterer deiner Vorzüge wunderbar zur Geltung gekommen: Ein Akt ist für dich sakrosankt. Den muss man devot und untertänigst behandeln, das dauert seine Zeit, und sodann wird der Akt mit der Geste der höchsten Verehrung geschlossen. Und der Aktenschrank, den ich am zweiten Tag nach deiner Spitalseinlieferung bei dir zu Hause gefunden habe, der ist, wie ich nach zweistündigem Stöbern festgestellt habe, dein Tabernakel gewesen.
Deine Mutter erzählte nun den Behörden wiederholt allerhand Greueltaten, die der Hansonkel an sie und an andere verübt hatte, und sie ließ sich als spravce, als Verwalterin, des Hauses in der Lazenska 3, früher Badgasse 3, einsetzen. Nun fiel es ihr auch nicht schwer, den Kolonialwarenladen im Erdgeschoß für ihren Jan zu reservieren. Leider gab es in ganz Karlovy Vary keine Orangen und Zitronen mehr, sondern nur noch ein paar Birnen oder Erdäpfel, deshalb stand auf dem Schild über dem Eingang jetzt ovoce a zeleniny, also Obst und Gemüse.
Die Chancen standen also nicht schlecht für euch im nachkrieglichen Karlovy Vary. Bis euch ein gewisser Klement Gottwald einen Strich durch die Rechnung machte. Der rief nämlich am 25. Februar vom Balkon des Palac Černin in Prag die sozialistische Volksrepublik aus, auf seinem Kopf trug er damals den typischen Russentschako. In der Folge wurden die Verwaltungen in der Tschechoslowakei von allen antisozialistischen Kräften gesäubert, und du hast in Karlovy Vary deinen Job in der Amtskassa verloren. Vom Arbeitsamt bist du als Hilfsarbeiter einem Tischler, einem gewissen Pecl, zugewiesen worden. Jetzt bist du total sauer gewesen, bei einem tschechischen Tischler als Hilfsarbeiter arbeiten zu müssen, wo du doch die amerikanische Buchhaltung aus dem efef beherrscht hast.
Warum du ausgerechnet nach Wien übersiedelt bist, in die Stadt, in der schon dein Vater gescheitert ist? - Auch im Leben hast du dich immer um eine Antwort gedrückt, und jetzt wird es höchstwahrscheinlich zu spät sein. Jedenfalls hast du mit deiner Mutter alles mitgenommen, was die Spedition auf den Eisenbahnwaggon im Karlsbader Bahnhof verladen konnte. Dann seid ihr selbst in den Personenzug gestiegen, und du bist das zweite Mal nach 1934 in deinem Leben nach Wien gereist. Vor der Grenze habt ihr noch gezittert vor den tschechoslowakischen Zöllnern. Deine Mutter hat nämlich die Hitlerbriefmarken in ihre Unterwäsche eingenäht. Weil sie geglaubt hat, dass deren Wert steigen wird, wenn man über die Grenze fährt, und dass man sie in Österreich teuer verkaufen könne. Wenn die Zöllner das gemerkt hätten, dann hättet ihr beide lebenslang das Lager von Jachymov ausgefasst. Und mit mir wär’s demnach nichts geworden, lieber Papa, aber das nur so nebenbei. Übrigens muss deine Mutter bei der Übersiedlung auch die Briefe irgendwo versteckt haben, die ich in deinem Aktenschrank gefunden habe. Briefe aus den Dreißigerjahren an den Hansonkel, in denen sie schrieb, Heil Hitler, teď bude všechno lepši. Wieso habt ihr die Briefe nicht weggeschmissen? Habt ihr die auch verkaufen wollen?
Dann seid ihr in der idyllischen Wienerwaldgemeinde Mauerbach in einem Lager für Vertriebene aufgenommen worden, obwohl ihr damals eigentlich typische Wirtschaftsemigranten gewesen seid, aber nach dem Krieg hat man im Gegensatz zu heute nicht genau zwischen den beiden Einwanderungsarten unterschieden. In der jungfräulichen Abgeschiedenheit einer Zelle des ehemaligen Kartäuserklosters hast du mit deiner Mutter und den Karlsbader Möbeln und den Hitlerbriefmarken gehaust. Glücklich warst du, als du bei einem Tischler, einem gewissen Kostka, als Hilfsarbeiter arbeiten durftest. Der Würfel ist gefallen, hast du mehrmals am Tag gesagt, weil der Kostka nämlich auf tschechisch der Würfel ist.
Zurück blieb in Karlovy Vary nur der Jan, der in Wirklichkeit mein Onkel ist, sozusagen der Janonkel. Weil er schon in jungen Jahren seine Sporen bei den Partisanen verdiente und 1945 auch dem Jugendverband der siegreichen Partei beitrat, konnte er ohne Probleme das Haus in der Lazenska 3 von seiner Mutter erben. Wie er mir 40 Jahre später erklärte, betrachtete er den Erwerb des Hauses als Entschädigung, da ja sein richtiger Vater abgehaun sei und seither sich niemals um ihn gekümmert und auch nie Alimente gezahlt habe.
Zu seinem Glück entdeckte der Jan im Archiv der Gemeinde, dass im Haus der Lazenska 3 ausgerechnet ein gewisser Karl Marx zu Gast war, und zwar in den Jahren 1874 und 1876. Im dritten Stock dieses Hauses ordinierte nämlich damals der Arzt Ferdinand Fleckles, der wiederum der Kurarzt des Gründers des wissenschaftlichen Sozialismus war. Dieser Karl Marx schimpfte zwar in seinen Briefen fürchterlich über die rigiden Sitten der Kurverwaltung, am meisten ärgerte er sich, dass er seinen geliebten Rotwein nicht trinken durfte, nichtsdestotrotz strotzte Onkel Jan vor Stolz, dass der Schöpfer des dialektischen Materialismus und der Urahn aller Werktätigen in seinem Haus übernachtet hatte. Ein Jahr später hieß die Straße třida Karla Marxe, und im dritten Stock war ein Museum zu Ehren des großen Kurgastes eingerichtet.
Bis 1954 hast du in der Keuschheit deiner mütterlichen Zelle gelebt. Auf der Kostka-Säge hast du meine Mutter kennengelernt, eine verarmte Mauerbacherin, die den alten Kostka um Reisig und Rinde anschnorrte. Ihrem Vater, einem gelernten Maurer, fehlten drei Finger der rechten Hand, sodass er nach dem Kriegsende fast immer arbeitslos war und durch ein paar Pfuschereien ab und zu ein paar Hunderter nach Hause brachte. Im Jahr 1955 habt ihr dann geheiratet, aber auch nach der Heirat habt ihr euch keine gemeinsame Wohnung leisten können. Du bist bei deiner eifersüchtigen Mutter in der Klosterzelle geblieben, und deine Frau bei ihrem arbeitslosen Vater. Jeweils von Samstag auf Sonntag habt ihr ein Zimmer im einzigen Gasthaus des Oberortes gemietet, im Gasthaus Kadiera. Das war’s auch schon. Und am Faschingsamstag des folgenden Jahres hast du meiner Mutter zwei Achtel Rotwein spendiert. Das Resultat des nächtlichen Geschlechtsaktes mit meiner willigen Mutter sitzt jetzt vor dir und hat leider nicht die geringste Ahnung, ob du seines Worten ein bisschen folgen kannst.
Eines möchte ich dir noch sagen, bevor ich für heute gehe. Im Jahr 1970 holte uns der Hansonkel nach München, wo auf der Theresienhöhe der „Sudetendeutsche Tag“ stattfand. Dort lernte ich ihn kennen. Er leitete damals eine Export-Import-Handelsgesellschaft, rauchte dicke Zigarren und trank kein Bier, sondern Weißwein. Mir erzählte er, dass er 1945 gottseidank die Möbel mitgenommen habe, aber wegen des Hauses in Karlsbad müsse er sich noch etwas einfallen lassen, aber solang die Kommunisten drüben an der Macht sind, habe er leider keine Chance.
Dann setzten wir uns zu einem Festvortrag in eine der unzähligen Hallen. Als prominenter Gastredner trat ein Doktor Otto von Habsburg auf, der vom Moderator als erster Heimatvertriebener Mitteleuropas bezeichnet wurde. Gleich zu Beginn seiner Rede musste ich aufs Klo flüchten. Ich kotzte die Bratwurst und das Achtel, zu dem mich der Hansonkel vorher eingeladen hatte. Dann wartete ich auf dem Gang das Ende der Veranstaltung ab. Möglich, dass dieser Tag unsere Wege trennte.
1990 waren wir beiden zum ersten Mal in Karlovy Vary. In der Zwischenzeit hat sich unser nördliches Nachbarland wieder einmal gewendet, und zwar gleich um 180 Grad. Du hast mir deinen Halbbruder vorgestellt, den Jan, ich glaub, du hast ihn das erste Mal getroffen seit 1948, als du von Karlovy Vary nach Wien emigriert bist.
Jedenfalls war der Janonkel schon in Pension. Er wohnte in bescheidenen Verhältnissen im Haus mit der Nummer drei in jener Straße, die seit kurzem nicht mehr Třida Karla Marxe, sondern Lazenska hieß, zu Deutsch Badgasse. Er erzählte, dass er schon 1950 als Deputierter in den tschechoslowakischen Jugendverband entsendet wurde und einer rasanten Karriere nun nichts mehr abträglich schien. Bis dann 1952 irgendwer seine halbdeutsche Herkunft entdeckte und er als Verräter und Spion denunziert wurde. Beim Prozess hatte er keine Chance, er saß dann sechs volle Jahre in einer tatsächlichen Zelle. In der Jungfräulichkeit dieser Gefängniszelle muss sein Lebensmut gebrochen sein. Denn als er 1958 entlassen wurde, schaffte er es gerade noch bis zum Hilfsarbeiter und zu einer zweizimmerigen Wohnung im Erdgeschoß.
Dann erzählte der Janonkel nichts mehr, weil er sehr misstrauisch war und nicht wusste, warum wir so plötzlich aufgetaucht waren.
Wir beide, du und ich, wir haben in einem der beiden ebenerdigen Zimmer geschlafen. Leider war das Klosett defekt. Ich kann es nicht reparieren, meinte der Janonkel, und einen Trupp bekommt man heute nicht. Also mussten wir in den Garten hinaus zu einem Plumpsklo gehen. Da du schon unter gewissen Problemen gelitten hast, bist du dreimal in der Nacht in den Garten und dann wieder zurück marschiert, und am nächsten Tag hast du zu mir beim Frühstück: to je prdel Evropy. Das ist der Arsch Europas. Ich habe dir zugestimmt, weil ich hatte am Vorabend um neun am Abend kein Bier mehr bekommen hatte, dann konnte ich die Billeteurin im Kino überreden, mir ein Bier zu verkaufen, aber das Kino sperrte um zehn zu.
Des Janonkels Misstrauen stieg beim Frühstück an, weil er nicht wusste, was wir von ihm wollten, vielleicht das ganze Haus, oder am Ende irgendwelche Möbel, oder vielleicht glaubte er, wir wollten seine Vergangenheit bei der Partei ausspionieren. So bleib die Unterhaltung starr, und nach dem Frühstück hast du zu deinem Halbbruder gesagt, du denkst daran, wieder nach Hause zu fahren, weil du jetzt genug gesehen hast. Ich habe dich dann überredet, im Nachbarort Douby in einem Wirthaus ein Zimmer zu nehmen. Dort habe ich nämlich am Abend mein Bier bekommen, und du hast an diesem Abend mit mir getrunken. Und als du die dritte Flasche geleert hast, bist du aufs Klosett gegangen. Und als du zurückgekommen bist, hast du leise zu mir geraunt, Karlovy Vary jsou prdel světa. Karlsbad ist der Arsch der Welt.
Und jetzt werd ich gehen. Die Ärzte werden mich anrufen, wenn mit dir etwas passiert. Und wenn es in der Nacht passiert, dann werden sie um sechs in der Früh anrufen. Und wenn sie innerhalb der nächsten 2 Tage nicht anrufen, dann werde ich dich wieder besuchen. Ist es jetzt vermessen, wenn ich mich mit einem „lebe wohl“ von dir verabschiede?
SOPHIA BENEDICT
Geboren in der UdSSR. Universitätsabschluss mit dem Diplom für Publizistik. Arbeitete in Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernseher. Weiterbildung in Wien, wo sie seit 1984 lebt und arbeitet. Langfristige Akkreditierung als Journalistin und Pressefotografin beim Österreichischen Bundeskanzleramt. Gleichzeitig widmete sie sich der Wissenschaftsjournalistik. Zahlreiche Publikationen in Zeitungen und Fachzeitschriften, über 20 Buchveröffentlichungen in Deutsch und Russisch (Sachbücher, Übersetzungen, Lyrik und Prosa).
DEKAMERON BOCCACCIO
Der Flohmarkt. Ich meine nicht den beim Naschmarkt, wo man nascht, sondern den anderen, in Groß-Enzersdorf, im Autokino. Samstags ist er geöffnet.
Alte Bücher, das ist es was mich anzieht. Während die Pornohefte gut sichtbar und griffbereit auf den Tischen ausgelegt sind, stehen die Schachteln mit den Büchern auf dem Boden herum, man muss sich hinhocken um darin zu kramen. Das bedeutet, dass nach fünf Minuten die Beine taub sind und das Kreuz schmerzt. Des Menschen Wille aber ist sein Himmelreich, oder wie die Russen sagen – dein Wunsch wäre dein sicherstes Gefängnis.
Ich schau mir die Bücher an. Eins nach dem anderen. Wenn ein Buch in einem schlechten Zustand ist, beschmutzt und beschädigt, dann will ich es nicht, nicht einmal umsonst. Solchen Büchern sollte man ein feierliches Begräbnis veranstalten, und die Täter mit lebenslanger Verachtung strafen. Das zerlesene Buch hingegen, das ist etwas ganz anderes! Alte Bücher haben etwas Heimeliges, Anziehendes, etwas das protzig-vulgäre Polyäthylenumschläge niemals haben. Das alte Buch ist bescheiden, du spürst seine Wärme, wenn du es in die Hand nimmst. Zwischen den vergilbten Seiten verstecken sich die Schatten derjenigen, die es einmal lasen. Das alte Buch hat eine Seele, zusammengesetzt aus Seelenteilchen, die seine Leser in ihm zurückgelassen haben.
Ich hatte eine Cousine, die las alles, was sie in die Hände bekam. Sie mochte aber nur neue Bücher, und sie fühlte sich betrogen, wenn sie entdeckte, dass ein eben erst gekauftes Buch bereits von jemandem durchgeblättert worden war. Mit ihren Kleidern verhielt sie sich ebenso. Nie sprach sie darüber, was sie gerade las, nie teilte sie ihre Gedanken über Lektüre mit. Gelesenes landete direkt in den Vorratskammern ihres phänomenalen Gedächtnisses, wo niemals etwas verloren ging. Sie war imstande, einen Roman, den sie zehn Jahre zuvor gelesen hatte, in allen Details nachzuerzählen. Meine Cousine bewahrte die Bücher nicht auf, wozu auch, sie waren ja in ihrem Gedächtnis sicher verwahrt! Ihre Kleider trug sie auch nie lange, nach ein paar Mal verkaufte sie sie weiter, und die gelesenen Bücher verschenkte sie an ihre Freunde.
Ich hingegen mag keine ungelesenen Bücher. Immer wenn ich ein neues gekauft hatte, bat ich meine Cousine, es zuerst zu lesen. Der Geruch von frischer Druckerfarbe ist mir unangenehm, ich will, dass ein Buch nach einem Menschen riecht. Stellen Sie sich vor – Adam bevor Gott ihm seine Seele einhaucht, oder Galatea, von Pygmalion als Skulptur vollendet, aber noch nicht zum Leben erweckt.
Aus den Tiefen einer Schachtel mit alten Zeitschriften fische ich etwas in dunkelgrauem Buchbinder-Kaliko heraus - es ist das deutsch-russische Militärwörterbuch. Geboren…, pardon, erschienen 1936.
Der Zauber des Flohmarktes besteht auch darin, dass man hier handeln kann. Wie billig die Sache auch angeboten wird, du kannst immer versuchen, den Preis noch zu drücken. Wiener Flohmärkte unterscheiden sich von östlichen Märkten vor allem dadurch, dass Österreicher sich nicht ärgern. Sie werden nicht nervös, wenn der Käufer handeln will, sie halten sich an die Spielregeln, bleiben freundlich und lächeln. Es ist aber schwierig, die eigene Begeisterung zu verbergen - wenn du etwas heiß Ersehntes gefunden hast und dir dein Entzücken anmerken lässt, kannst du dir den Rabatt gleich abschminken.
Ich fördere auch noch das kleine englische Taschenwörterbuch zutage, in einem entzückenden dunkel-roten Umschlag. Brauche ich das denn? Wozu? Es ist aber so hübsch. Geritzt! Gekauft! Gleich danach finde ich ein Schulwörterbuch zu „Ilias“ und „Odyssee“, herausgegeben im Jahre 1919. Was für Illustrationen! Was für Zeichnungen! Ich zittere fast vor Begeisterung und vergesse zu handeln.
Es schien also der Tag der Wörterbücher zu sein, die für mich als Übersetzerin natürlich einen besonderen Reiz haben. Meine Schatzsucher-Freude ist aber noch nicht restlos befriedigt. Irgendwas fehlt mir noch.
Dieser Flohmarkt ist so groß wie ein Stadion, nicht so beengt wie der am Naschmarkt. Österreicher verkaufen hier ihre Trophäen zahlloser Weihnachten, Chinesen und Vietnamesen bieten Plastikfeuerzeuge, Brieftaschen, Damenunterwäsche an. Sie leben davon. Zigeuner handeln mit fast neuen Kleidungsstücken, die oft von überraschend hoher Qualität und Unversehrtheit sind, was auf die Gedanken bringt, wo haben sie diese Schätze her? Die professionellen Antiquitätenhändler kaufen am frühen Morgen den Unbedarften alles objektiv Wertvolle ab und legen Provisionen fest. Ihre Bücherbestände sind erstklassig, ihre Preise auch. Wie im hochangesehenen „Dorotheum“.
Und dann noch ein Fundstück. Der gedämpfte korallenfarbige Umschlag ist mit einer feinen Zeichnung verziert: Ein riesiges Bett unter dem Baldachin, das ich im ersten Moment für eine Bühne mit halboffenem Vorhang halte. Ein kleines Format, aber doch ziemlich dick, scheinbar Dutzende Male gelesen, es war konkurrenzlos in seiner Zeit.
Zum ersten Mal hatte ich von diesem Buch gehört, als ich zwölf war. Meine Mutter unterhielt sich darüber mit ihrer Freundin, mit leiser, verhaltener Stimme. Diese Stimme hat mich hellhörig gemacht. Der Titel des Buches schien mir seltsam - „Dekamerobokatscho“, er hat sich mir eingeprägt, die Süße der verbotenen Frucht...
Das Papier, war es von vornherein so zart-gelblich oder ist es auf wunderbare Weise gealtert? Hauptsache, die Stiche sind da! Sie sind voller ausdrucksvoller Details. Gleichzeitig fühlen sie sich fein und bescheiden an. Ein Buch voller wunderbarer Geheimnisse. Der Verkäufer will nicht viel für dieses Buch. Als ich aber zahle, begreift er, dass er zu wenig verlangt hat - für dieses Buch wäre ich bereit gewesen, eine beliebige Summe zu zahlen...
Ich drücke den neu erworbenen Schatz an meine Brust, und mir ist gar nicht bewusst, dass ich bereits zielstrebig Richtung Ausgang unterwegs bin. Nichts mehr interessiert mich, ich habe endlich gefunden wonach ich lange gesucht hatte. Eine tiefe Befriedigung und ein Gefühl angenehmer Entspannung überkommt mich. Ein zauberhaftes Gefühl, irgendwie vertraut…
Endlich zu Hause, blättere ich andächtig die Seiten durch... wonnevoll… Boccaccio. „Dekameron“...
ILSE VIKTORIA BÖSZE
Geboren 1942 in Wien, lebt in Bad Deutsch Altenburg. Haushaltungsschule Baden, Handelsschule, Gesangsstudium. Veröffentlichungen: „Tatort Schule“, „Enrico und das Dorf im Wald“, „Geburtstag auf dem Dachboden“, „Die geheime Werkstatt“, „Die verschluckte Trompete“, „Mein Osterhasenbuch“, „Hundegeschichten mit Rex“, Kurzgeschichten in div. Anthologien und in geschichtenbox.com.
Schon als Fünfjährige habe ich gerne fabuliert. Das bezeugt auch ein Brief meiner Schweizer Pflegemutter an meine Eltern. Demnach soll ich Geschichten aus dem dortigen Telefonbuch „gelesen“ haben. Die erste Geschichte, die ich in den Weihnachtsferien in der ersten Volksschulklasse niederschrieb, war, nach meinem Lehrer, eine „Robinsonade“. Später führte ich Tagebuch und verfasste meine ersten Gedichte. Robert J. Koc gab mir die Chance, in seinen Bändchen „Blätter für das Wort“ Gedichte zu veröffentlichen. Mit dem Kinderroman „Tatort Schule“ gelang mir der Durchbruch. Für den Jugendroman „Enrico und das Dorf im Wald“ erhielt ich den Internationalen Literaturpreis der Stadt La Spezia. Es folgten weitere Veröffentlichungen sowie Lesungen in Schulen, die ich in der Folge wegen meiner Erkrankung (Muskeldysthrophie) nicht mehr halten konnte.
Mein literarisches Augenmerk liegt nach wie vor auf dem Kinder- und Jugendbuchsektor, auf Tiergeschichten und der Lyrik.
ABSCHIED
Eine Woche vor Schulschluss. Es rumort in der Klasse. Irgendetwas ist anders als sonst. Wir lachen, stecken die Köpfe zusammen, tun geheimnisvoll. Nun ja, in ein paar Tagen ist die Schulpflicht für uns zu Ende. Dann werden die Leute „Fräulein“ und „Sie“ zu uns sagen und nicht mehr „Mäderl“ oder gar „Kleine“. Einige von meinen Mitschülerinnen sehen ohnehin bereits wie sechzehn oder achtzehn aus. Ich gehöre nicht dazu. Trotzdem bin ich schon seit Februar vierzehn.
Sechsunddreißig sind wir in der Klasse. Ich habe keine Ahnung, was eine jede von uns nach der Schule machen wird. Die meisten werden wohl eine Lehre anfangen, andere bleiben im Betrieb oder auf dem Bauernhof ihrer Eltern, ein paar wollen auf eine weiterführende Schule gehen. Ich auch. Mein Vater wollte zwar, dass ich eine Bürolehre mache, aber ich habe keine Lust, den älteren Kollegen den Wurstel zu machen, wie man so hört. Sollen sie sich doch ihre Wurstsemmeln selber holen!
Es ist heiß geworden und schwül wegen der Gewitter. Acht haben sich wegen Grippe krank gemeldet. Heute sind fünf wieder zum Unterricht gekommen. Es tut sich zwar nichts mehr, aber wir haben trotzdem Anwesenheitspflicht. Gerti, unsere Klassenbeste, ist auch wieder gesund. Sie hat mich gebeten, ihr mein Kochheft zum Nachschreiben zu borgen; sie weiß, dass ich immer mitschreibe. Klar, mach ich. Ich fahre ja auch noch in den Ferien nach Berndorf zu meiner Klavierlehrerin. Da kann ich bei Gerti vorbei schauen und mein Heft zurückholen.
Schulschluss. Ferien. Freiheit!
Ich habe heute etwas ganz Verrücktes erlebt. Nach der Klavierstunde war ich bei Gerti. Sie wohnt in einem der von Krupp errichteten Arbeiterhäuser. Zwischen den eintönigen roten Ziegelbauten liegen kleine Vorgärten und mitten drinnen stehen ein paar alte Bäume. Ich habe das Haus, in dem Gerti mit ihren Eltern wohnt, auf Anhieb gefunden.
Ich hatte den Finger noch nicht auf dem Klingelknopf, da meldete der Hund schon durch lautes aufgeregtes Bellen meinen Besuch an. Trotzdem musste ich eine Weile warten, bis sich nach dem Läuten die Tür einen Spalt breit öffnete und Gerti herauslugte.
„Ach, du bist es, Ilse!“, rief sie fröhlich, und mich an der Hand in die Stube ziehend, flüsterte sie verschämt: „Ich dachte schon, es sei der Gerichtsvollzieher. Die Mutter hat kein Geld mehr, und der Vater vertrinkt alles mit den Weibern. Jetzt wollen sie uns pfänden. Mein neues Akkordeon, das die Mutter für mich zusammengespart hat, halte ich versteckt, auch vor dem Vater.“
So vertrauensselig ist Gerti nie gewesen, wenn sie zu mir auch immer recht offen war. Vielleicht spürt sie, dass ihr Geheimnis bei mir gut aufgehoben ist und ich sie nie verspotten würde. Hier, in der Enge der Stube, begann Gerti sich mir zu offenbaren, mir, die mich Welten von der Vorzugsschülerin trennen, die lediglich in Deutsch, Musik, Russisch und Naturgeschichte überdurchschnittliche Leistungen erbracht hatte, während Gerti in allen Gegenständen glänzte.
Gerti erzählte mir von ihrer Mutter, die schon ganz krank vom vielen Arbeiten sei, nur um ihr den Start in ein anderes, besseres Leben zu ermöglichen. Schilling um Schilling lege sie beiseite, ängstlich bemüht, es vor ihrem Mann geheim zu halten. Aber oft erwarte er die Mutter am Zahltag vor dem Fabrikstor, um ihr das Geld abzuknöpfen. Nebenbei gehe sie Wäsche waschen und in die Bedienung; trotzdem fehle es oft am Nötigsten.
Davon hatten wir in der Schule nichts bemerkt. Gerti war stets ordentlich und sauber gekleidet, sie besuchte die angebotenen Freigegenstände, nahm Akkordeon-Unterricht und fuhr bei den Schulausflügen mit. Sogar die wenigen Bücher, die wir benötigten, hatte sie nicht aus der Schülerlade.
Ich war betroffen.
„Jetzt mache ich erst einmal die Handelsakademie.“
„Hast du die Aufnahmeprüfung bestanden?“, platzte ich dazwischen.
Gerti strahlte. „Mit Auszeichnung!“
„Gratuliere!“
„Vier Jahre“, sagte Gerti, „dann werde ich arbeiten und hole meine Mutter hier heraus. Am Abend kann ich immer noch auf die Uni gehen. Wissen bringt uns mit Sicherheit weiter, und ich will weiterkommen.“
Sie hatte ein festes Ziel. Ich hatte meines mit dem Eintritt in die Hauptschule aufgegeben. Vater wollte keine „studierte“ Tochter. Deshalb hatte er mich auch in die Hauptschule geschickt, obwohl das Gymnasium im selben Ort war und näher zum Bahnhof. Ich war eine Auswärtige und musste eine Dreiviertelstunde mit dem Zug in die Schule fahren.
Gerti sprach ohne Bitterkeit. Sie redete leise, immer wieder mit einem scheuen Blick zur Tür, als könne der Gerichtsvollzieher oder der betrunkene Vater kommen.
„Das schönste“, sagte Gerti ohne Übergang, „ist mein Apfelbaum.“ Sie deutete zum Fenster, in das die knorrigen Zweige eines alten Baumes hereinschauten.
„Von meinem Zimmer aus siehst du ihn besser, komm!“
Tatsächlich! Der alte Baum mit dem dicken, schrundigen Stamm, stand so nah am Fenster, dass sich der eine Flügel gar nicht mehr ganz öffnen ließ. Die Sonne stand hinter dem Baum und leuchtete durchs Geäst. Die Blätter schimmerten, an den Rändern hatten sie einen funkelnden Glorienschein. Die noch grünen unreifen Äpfel wirkten wie aus Glas.
Ich war überwältigt. Daheim hatte ich Wald und Wiese vor der Haustüre, zusätzlich zu unserem großen Garten; von meinem Fenster aus konnte ich die beiden hohen alten Bahnhofslinden und den Brunnen sehen, und nachts hörte ich die Linden rauschen, aber so unmittelbar und greifbar wie Gertis Apfelbaum, nein – fast beneidete ich sie um ihn, ich, die ich im Vergleich zu ihr alles hatte, während sie nur diesen Apfelbaum hatte, ihre Musik und ihre stillen Hoffnungen und Träume.
„Du solltest ihn im Frühling sehen, mit all den tausend rosa Blüten!“, schwärmte Gerti. „Weißt du“, sie beugte sich vertraulich an mein Ohr, „manchmal, wenn meine Eltern streiten, bekomme ich ganz unsinnige Angst. Da male ich mir aus, wie ich auf das Fenster steige und von da auf den Apfelbaum.“
„So schlimm wird es schon nicht sein“, beschwichtigte ich sie.
Ein Schatten huschte über ihr Gesicht. Doch gleich lachte sie wieder. „Nein“, sagte sie, „so schlimm nicht.“
Langsam wurde es Zeit für mich aufzubrechen. Ich bat Gerti um mein Heft. Wir gingen wieder zurück in die Stube, die Vorzimmer, Küche und Elternschlafzimmer in einem war.
Gerte öffnete die lange schmale Tür der Kredenz. Ich stand dicht neben ihr, bereit, mein Heft in Empfang zu nehmen. Die Tür schwang auf und – entsetzt prallte ich zurück.
„Eine Schlinge“, schrie ich hysterisch, „ein Galgen!“
Von dem oberen, einzigen Fach des Kastenabteiles, baumelte ein dickes Seil, zu einer Schlinge geknotet, herab, und ich spürte, wie von dieser Schlinge eine schreckliche Bedrohung ausging.
„Was für eine Schlinge?“, fragte Gerti. „Wo?“
„Da, unter dem Fach! Siehst du sie denn nicht baumeln?“
Gerti schaute mich an, als hätte ich plötzlich den Verstand verloren. Meine Knie zitterten. Ich suchte nach einem Halt. Gerti drückte mich auf einen Stuhl.
Tasso, Gertis schöner Schäfer, der uns bis jetzt schweifwedelnd umkreist hatte, verkroch sich winselnd und mit eingeklemmter Rute unter dem Tisch.
„Was ist los mit dir? Bekommt dir die Hitze nicht? Ich sehe keine Schlinge. Der Kasten ist leer. Und den Hund hast du mir auch verschreckt.“
Gerti griff in das Fach. „Hier ist dein Kochheft – vom Fach mit der Schlinge.“ Sie lachte. Und lachend hielt sie mir das Heft hin. Achtlos fiel es zu Boden. Wie gebannt starrte ich noch immer zum Kasten hin, in dem vor einem Augenblick noch eine Schlinge, geformt wie ein Galgen, gebaumelt hatte. Jetzt war sie weg. Verschwunden. Ich strich mit der Hand über die Augen. Hatte ich geträumt oder hatte ich einen Sonnenstich, wie Gerti annahm?
Wie ich zum Bahnhof und nach Hause kam, wusste ich später nicht mehr. Das Angst einflößende, grausige Bild geisterte noch immer durch meinen Kopf. Abends erzählte ich meinen Eltern davon, ich musste das Erlebte loswerden, und Mutti bemerkte ohnehin, wie verstört ich war. Ich weiß, es klang unglaubhaft. Vater schaute Mutti vielsagend an: „Ich sag’s ja immer, sie schnappt noch über vor lauter Lesen.“
Der Tag will mir nicht aus dem Kopf. Es wird etwas Schreckliches geschehen, ich spüre es. Immer wieder sehe ich die Szene in Gertis Wohnung vor mir, spüre die Angst einer nicht bekannten Gefahr.
Vater ruft! Ich renne die Stufen hinunter in die Kanzlei.
Gerti ist tot!
Vater hat über die Basa-Telefonleitung einen Anruf von der Schuldirektion bekommen. Gerti ist tot. Ich kann, ich will es nicht glauben, aber da ist das Erlebnis…
Noch vor dem Begräbnis hat man den Täter gefasst. Es ist Gertis eigener Vater! Er hatte sich einen heftigen Streit mit seiner Frau geliefert und sie im Zorn erschlagen. Gerti, an geräuschvolle Szenen gewöhnt, hatte sich in ihrem Bett verkrochen. Am Morgen gab er vor, die Mutter sei schon zur Arbeit gegangen, und jetzt sei der Gerichtsvollzieher da. Er habe danach Tisch und Stühle verrückt, Kästen lautstark auf- und zugemacht, um Gerti die Amtshandlung glaubhaft zu machen. Nachts sei er in ihr Zimmer geschlichen und habe sie erwürgt.
Der Apfelbaum vor dem Fenster hat Gerti nicht retten können.
Die beiden Frauen fand man in dem Kastenteil, in dem ich zuvor die Schlinge gesehen hatte – die Mutter mit dem Kopf nach unten, Gerti aufrecht, neben der Mutter. Auch Tasso war tot. Der Mann hatte ihn bewusstlos geschlagen. Später nahm der Hund die Verfolgung auf, wurde vom Mörder aber angeschossen. Schwer verletzt schleppte sich der treue Hund heimwärts, wo er vor der Tür der Nachbarin zusammenbrach und starb.
Ich fuhr mit dem Zug nach Berndorf. Meine Gedanken waren bei Gerti. Warum hatte sie ihrem Vater geglaubt? Warum war sie nicht auf den Apfelbaum geklettert, statt sich einen Tag im Zimmer einsperren zu lassen? Warum musste eine Vierzehnjährige sterben, die gerade die Aufnahmeprüfung in die Handelsakademie mit Auszeichnung bestanden hatte? Warum, warum… Viele Fragen, keine Antworten. Ich werde diesen Juli 1956 nie vergessen.
Vor der Margaretenkirche traf ich schon auf einige Schulkolleginnen. Die lachten und scherzten, als ob sie zu einem Kirtag gehen wollten. Trudi schüttete über ihre Nachbarin gleich ein halbes Fläschchen Parfum aus, und lachte. Einige hatten die Lippen rot angemalt.
Bald holte uns der Autobus ab und brachte uns zum Friedhof. Dort waren viele Menschen versammelt, nur mit Mühe konnten wir uns einen Weg zur Aufbahrungshalle bahnen. Beinahe alle aus unserer Klasse waren gekommen und beinahe alle Lehrkräfte. Automatisch stellten wir uns, wie gewohnt, in Zweierreihen auf, um Gerti und ihrer Mutter das letzte Geleit zu geben.
Langsam formierte sich der Zug; manchmal geriet er ins Stocken. Die Leute von Berndorf drängten heran. Langsam stiegen wir den Hügel zum Grab hinauf. Wir nahmen um die offene Grube herum Aufstellung. Eine jede hatte eine weiße Lilie bekommen, die warfen wir nun ins Grab.
Die Frau Direktor hielt eine Rede, in der sie Gertis Lernfreudigkeit besonders hervorhob. Sie führte aus, dass Gerti vier Jahre hindurch die Klassenbeste gewesen sei. Sie sei von allen Lehrern und Mitschülerinnen geachtet worden, nie habe sie sich etwas zuschulden kommen lassen. Sie sei hilfsbereit, ehrlich, kameradschaftlich gewesen, nie frech oder unwillig oder gar aufsässig, beispielgebend für die ganze Klasse, ja für die ganze Schule.
Der Herr Kaplan sagte etwas von früher Vollendung und einem Wiedersehen im Jenseits.
Auch Gertis Mutter wurde gedacht als einer Frau, die das Letzte für ihre Tochter gegeben habe, ohne dabei an sich selbst zu denken.
Viel mehr habe ich von den Grabreden nicht behalten vor lauter Weinen. Alle weinten wir.
Vor dem Friedhof standen wir noch eine Weile herum; wir wussten nicht recht, was tun, was sagen; das Grauen stand zwischen uns, und die Angst.
„Was machst du jetzt?“, fragte ich Vroni, die neben mir stand.
„Weiß nicht. Vielleicht eine Lehre.“ Ihr Blick ging irgendwohin ins Leere.
Christl wollte so bald wie möglich heiraten, Helga sollte ins Unternehmen ihres Vaters eintreten, Erika würde die Handelsschule besuchen. Sie sagten es beiläufig. Wir schienen Blei an den Füßen zu haben, denn wir standen auf demselben Fleck herum. Auch die Worte gingen uns aus, die Lust zu reden war uns vergangen. Die lange Baumi in ihrem schwarzen Rock und der weißen Bluse sah wie eine vom Sturm geknickte Birke aus. Wir waren nicht mehr dieselben.
Der Bus brachte uns wieder zurück in die Stadt. Wir gingen fort, zerstreuten uns in alle Winde.





























