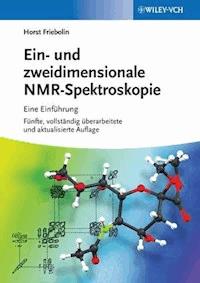
46,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Diese vollstandig uberarbeitete und aktualisierte Neuauflage des klassischen Lehrbuches beinhaltet neben den Grundlagen der NMR-Spektroskopie auch die der Spektreninterpretation. Ohne viel Mathematik bietet der Text eine Einleitung und deckt somit auch den Lehrstoff von Hochschulkursen ab. Der Hauptanteil des Buches ist nach wie vor der NMR-Spektroskopie an Losungen gewidmet, doch wurden auch
verstarkt Untersuchungen an Festkorpern und die Analyse von Biopolymeren berucksichtigt. Zum Schluss werden einige Einsatzmoglichkeiten der Kernspintomographie und der Kombination von Tomographie und Spektroskopie besprochen. Erganzt wurde jedes Kapitel um Aufgaben, deren Losungsvorschlage im Anschluss an Kapitel 14 zu finden sind. Mit seiner ubersichtlichen Darstellung ist dieses Buch ein Muss fur Studenten, Dozenten und Anwender der NMR-Spektroskopie in der Chemie, Biochemie und Pharmazie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 5. deutschen Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Abkürzungen und Akronyme
Symbole
1 Physikalische Grundlagen der NMR-Spektroskopie
1.1 Einführung
1.2 Kerndrehimpuls und magnetisches Moment
1.3 Kerne im statischen Magnetfeld
1.4 Grundlagen des Kernresonanz-Experimentes
1.5 Impuls-Verfahren
1.6 Spektrale Parameter im Überblick
1.7 „Andere“ Kerne [5,6]
1.8 Aufgaben
1.9 Literatur zu Kapitel 1
2 Chemische Verschiebung
2.1 Einführung
2.2 1H-chemische Verschiebungen organischer Verbindungen
2.3 13C-Chemische Verschiebungen organischer Verbindungen
2.4 Spektrum und Molekülstruktur
2.5 Chemische Verschiebung „anderer“ Kerne
2.6 Aufgaben
2.7 Literatur zu Kapitel 2
3 Indirekte Spin-Spin-Kopplung
3.1 Einführung
3.2 H,H-Kopplungskonstanten und chemische Struktur
3.3 C,H-Kopplungskonstanten und chemische Struktur
3.4 C,C-Kopplungskonstanten und chemische Struktur
3.5 Korrelation von C,H- und H,H-Kopplungskonstanten
3.6 Kopplungsmechanismen
3.7 Kopplung „anderer“ Kerne; Heterokopplungen
3.8 Aufgaben
3.9 Literatur zu Kapitel 3
4 Analyse und Berechnung von Spektren
4.1 Einführung [1, 2]
4.2 Nomenklatur
4.3 Zweispinsysteme
4.4 Dreispinsysteme
4.5 Vierspinsysteme
4.6 Spektren-Simulation und Spektren-Iteration [4]
4.7 Analyse von 13C-NMR-Spektren
4.8 Aufgaben
4.9 Literatur zu Kapitel 4
5 Doppelresonanz-Experimente
5.1 Einführung
5.2 Spin-Entkopplung in der 1H-NMR-Spektroskopie
5.3 Spin-Entkopplung in der 13C-NMR-Spektroskopie
5.4 Aufgaben
5.5 Literatur zu Kapitel 5
6 Zuordnung der 1H- und 13C-NMR-Signale
6.1 Einführung
6.2 1H-NMR-Spektroskopie
6.3 13C-NMR-Spektroskopie
6.4 Rechnerunterstützte Spektrenzuordnung in der 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie
6.5 Aufgaben
6.6 Literatur zu Kapitel 6
7 Relaxation
7.1 Einführung
7.2 Spin-Gitter-Relaxation der 13C-Kerne (T1)
7.3 Spin-Spin-Relaxation (T2)
7.4 Aufgaben
7.5 Literatur zu Kapitel 7
8 Eindimensionale NMR-Experimente mit komplexen Impulsfolgen
8.1 Einführung [1]
8.2 Grundlegende Experimente mit Impulsen und gepulsten Feldgradienten
8.3 J-moduliertes Spin-Echo-Experiment
8.4 Spin-Echo-Experiment mit gepulsten Feldgradienten
8.5 Intensitätsgewinn durch Polarisationstransfer
8.6 DEPT-Experiment [12, 13]
8.7 Selektives TOCSY-Experiment [14–16]
8.8 Eindimensionales INADEQUATE-Experiment [17]
8.9 Aufgaben
8.10 Literatur zu Kapitel 8
9 Zweidimensionale NMR-Spektroskopie
9.1 Einführung
9.2 Zweidimensionales NMR-Experiment
9.3 Zweidimensionale J-aufgelöste NMR-Spektroskopie
9.4 Zweidimensionale korrelierte NMR-Spektroskopie
9.5 Zweidimensionales INADEQUATE-Experiment [21–23]
9.6 Zusammenfassung der Kapitel 8 und 9
9.7 Aufgaben
9.8 Literatur zu Kapitel 9
10 Kern-Overhauser-Effekt
10.1 Einführung
10.2 Theoretische Grundlagen
10.3 Experimentelle Aspekte
10.4 Anwendungen
10.5 Aufgaben
10.6 Literatur zu Kapitel 10
11 Dynamische NMR-Spektroskopie (DNMR)
11.1 Einführung [1–3]
11.2 Quantitative Auswertung
11.3 Anwendungen
11.4 Aufgaben
11.5 Literatur zu Kapitel 11
12 Synthetische Polymere
12.1 Einführung
12.2 Taktizität von Polymeren
12.3 Polymerisation von Dienen
12.4 Copolymere
12.5 Festkörper NMR an Polymeren
12.6 Aufgaben
12.7 Literatur zu Kapitel 12
13 NMR-Spektroskopie und Biochemie
13.1 Einführung
13.2 Aufklärung von Reaktionswegen in der Biochemie
13.3 Biomakromoleküle
13.4 Sättigungs-Transfer-Differenz-NMR (STD) (Saturation-Transfer-Difference NMR)
13.5 Aufgaben
13.6 Literatur zu Kapitel 13
14 In vivo-NMR-Spektroskopie in Biochemie und Medizin
14.1 Einführung
14.2 Hochauflösende in vivo-NMR-Spektroskopie
14.3 Magnetische Resonanz-Tomographie
14.4 Magnetische Resonanz-Spektroskopie, 1H-MRS
14.5 Aufgaben
14.6 Literatur zu Kapitel 14
Lösungsvorschläge
Sachregister
Substanzregister
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Günther, Harald
NMR Spectroscopy
Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
3. Auflage
2013
ISBN: 978-3-527-33004-1
Pregosin, Paul S.
NMR in Organometallic Chemistry
2012
ISBN: 978-3-527-33013-3
Berger, Stefan, Braun, Siegmar
200 and More NMR Experiments
A Practical Course
2004
ISBN: 978-3-527-31067-8
Berger, S., Sicker, D.
Classics in Spectroscopy
Isolation and Structure Elucidation of Natural Products
2009
ISBN: 978-3-527-32516-0
Jacobsen, Neil E.
NMR Spectroscopy Explained
Simplified Theory, Applications and Examples for Organic Chemistry and Structural Biology
2007
ISBN: 978-0-471-73096-5
Zerbe, O., Jurt, S.
Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
ISBN: 978-3-527-32774-4
Levitt, M. H.
Spin Dynamics
Basics of Nuclear Magnetic Resonance
2008
ISBN: 978-0-470-51118-3
Breitmaier, E.
Vom NMR-Spektrum zur Strukturformel organischer Verbindungen
2005
ISBN: 978-3-527-31499-7
Autor
Prof. Dr. Horst Friebolin
Organisch-Chemisches Institut
der Universität
Im Neuenheimer Feld 270
D-69120 Heidelberg
unter Mitarbeit von:
Prof. Dr. Christina M. Thiele
T.U. Darmstadt
Petersenstr. 22
D-64287 Darmstadt
5. vollst. überarb. u. erw. Auflage 2013
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Satz Hagedorn Kommunikation GmbH, Viernheim
Druck und Bindung betz-druck GmbH, Darmstadt
Umschlaggestaltung Bluesea Design, McLeese Lake, Canada
Print ISBN: 978-3-527-33492-6
Vorwort zur 5. deutschen Auflage
Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die Grundlagen und Anwendungen der NMR-Spektroskopie. Die neuesten Forschungsergebnisse, die Fortschritte auf dem Gerätesektor sowie der Automation bei der Spektrenaufnahme und der Spektrenauswertung werden nur insofern berücksichtigt, als sie der Intention des Buches entsprechen. Daher sind in vielen Kapiteln nur kleinere Korrekturen vorgenommen worden. Im Einzelnen möchte ich erwähnen: In Tabelle 6-8 in Abschnitt 6.4.2 wurden die mit den Programmen SpecInfo und CSEARCH berechneten Verschiebungswerte den gemessenen und den mit ACD abgeschätzten Werten gegenübergestellt. In Kapitel 8 wurde ein Abschnitt (8.2.3) über die Grundlagen des “Spin Locking“ eingefügt, das bei vielen Verfahren verwendet wird. Kapitel 10, “Kern-Overhauser-Effekt“, ergänzte ich durch den transfer NOE (trNOE), einer Technik, die bei Untersuchungen von biologischen Systemen eine Rolle spielt. Abschnitt 12.5 über die Technik der Festkörper-NMR erweiterte ich um eine Besprechung der Grundzüge des Verfahrens der Cross Polarization (CP). In Abschnitt 13.4 habe ich wegen der grundlegenden Bedeutung von Untersuchungen der Wechselwirkungen zwischen Liganden und Makromolekülen (z.B. Ligand-Enzym-Wechselwirkungen) sowie deren Dynamik das Prinzip der Sättigungs-Transfer-Differenz-Spektroskopie (STD) behandelt.
Die wichtigsten Ergänzungen der fünften gegenüber der vierten Auflage sind jedoch die Aufgaben am Ende eines jeden Kapitels; die Lösungsvorschläge folgen im Anschluss an Kapitel 14.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die zum Gelingen der neuen Auflage beigetragen haben. Erwähnen möchte ich besonders die Herren Dr. Jürgen Graf, Org.-Chem. Institut der Univ. Heidelberg und Dr. Volker Friebolin, Org.-Chem. Institut der Univ. Tübingen, die die Übungsaufgaben und deren Lösungsvorschläge kritisch gelesen haben sowie V. F., der mich beim Abfassen der Abschnitte über den trNOE und die STD-Spektroskopie tatkräftig unterstützte. Mein besonderer Dank gilt auch wieder Herrn Dr. Jack Becconsall, der viele der hier verwendeten ergänzenden Texte im Rahmen der Vorbereitung zur 5. englischen Auflage kritisch kommentierte, so dass ich dadurch für die deutsche Neuauflage profitierte.
Den Mitarbeitern des Verlags Wiley-VCH, Weinheim, danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit.
Heidelberg, im Dezember 2012
Horst Friebolin
Die Nachtigall und die Lerche.
Was soll man zu den Dichtern sagen, die so gern ihren Flug weit über alle Fassung des größten Teiles ihrer Leser nehmen? Was sonst, als was die Nachtigall zu der Lerche sagte: Schwingst du dich, Freundin, nur darum so hoch, um nicht gehört zu werden?
Gotthold Ephraim Lessing
Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist weder eine überarbeitete noch eine erweiterte Auflage des 1974 von mir herausgegebenen Taschenbuches „NMR-Spektroskopie – Eine Einführung mit Übungsbeispielen“; vielmehr zwangen mich die Entwicklungen bei den Impulsverfahren, der 13C-NMR-Spektroskopie und besonders der zweidimensionalen NMR-Spektroskopie, ein neues Buch zu schreiben. Gleich blieb das Ziel, die physikalischen Grundlagen, die Meßverfahren, die Bedeutung der spektralen Parameter sowie die Analyse und Interpretation von NMR-Spektren möglichst einfach darzustellen. Daher sind die theoretischen Ableitungen auf ein Minimum beschränkt, von den exakten quantenmechanischen Berechnungen werden meistens nur die Ergebnisse angegeben und verwendet.
Für den Anfänger sind vor allem die ersten sechs Kapitel geschrieben. In den Kapiteln 8 und 9 werden die Grundlagen sowie Anwendungsmöglichkeiten der augenblicklich wichtigsten ein- und zweidimensionalen Experimente, die sich hinter Kürzeln wie DEPT, COSY, Relayed H,H- und C,H-COSY, INADEQUATE verbergen, vorgestellt, wobei Auswahl und Darstellung auf meinen in Vorlesungen, Seminaren und Übungen gewonnenen Erfahrungen beruhen. Für diesen Teil setze ich die Kenntnis des Inhalts der Kapitel 1 und 7 voraus, insbesondere muß das Prinzip des Impuls- und Spin-Echo-Experimentes verstanden sein.
Diese neuen Verfahren in nur zwei Kapiteln darzustellen, gelingt nicht ohne Weglassen und Vereinfachen, auch nicht ohne radikalen zeitlichen Schnitt. Um die ohnehin schon schwer verdauliche Kost für den Anfänger nicht noch unverdaulicher zu machen, habe ich mich bei den 2D-Verfahren auf die Amplitudenmodulation der Signale und bei der Darstellung auf die Absolutbeträge beschränkt. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Verfahren eine wesentliche Vereinfachung, die gerade die unterschiedlichen Phasenbeziehungen ausnützen. Ich halte dieses Vorgehen jedoch in einer „Einführung“ für vertretbar.
Die nächsten vier Kapitel befassen sich mit speziellen Methoden und Anwendungsmöglichkeiten. Die Auswahl –NOE, DNMR, Verschiebungsreagenzien, synthetische Polymere – ist subjektiv.
Das letzte Kapitel befaßt sich mit Anwendungen in der Biochemie und Medizin, mit der invivo-NMR-Spektroskopie und der Magnetischen Resonanz(MR)-Tomographie. Den Lesern, die sich hauptsächlich für diesen Teil interessieren, beispielsweise Biologen und Mediziner, empfehle ich, zumindest die Grundlagen des Experiments (Kap. 1) und der Relaxation (Kap. 7) durchzuarbeiten.
Viele Probleme werden in dieser Einführung nur angedeutet, doch führen Literaturangaben am Ende der Kapitel die Leser weiter. Insgesamt sind diese Hinweise auf die wichtigsten beschränkt und im allgemeinen auf solche, die Studenten zugänglich sind.
Für viele Substanzen habe ich bewußt ihre Trivialnamen verwendet, beispielsweise Acetylen, Ethylen; die systematischen Namen sind jedoch im Substanzregister angegeben.
Mit wenigen Ausnahmen beschränkt sich das Buch auf die 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie, weil die überwiegende Zahl der Leser nur mit Spektren dieser beiden Kerne in Berührung kommen wird. Zudem sollte das Einarbeiten in die NMR- Spektroskopie anderer Kerne nach der Lektüre der Grundlagen nicht schwerfallen.
Im Gegensatz zum alten Buch habe ich auf getrennte Übungen verzichtet, dafür werden zahlreiche Beispiele ausführlich im Text erläutert.
Dank
Bei meiner Arbeit für dieses Buch war ich auf die tatkräftige Hilfe vieler angewiesen. An erster Stelle will ich drei Namen nennen: meinen ehemaligen Mitarbeiter Dr. Wolfgang Baumann, Dr. Wolfgang Bermel (Bruker) und Doris Lang. Wolfgang Baumann hat u. a. alle abgebildeten 250- und 300 MHz-NMR-Spektren aufgenommen und in abbildungsgerechte Form gebracht; Wolfgang Bermel hat sein ganzes Können bei der Aufnahme der ein- und zweidimensionalen 400 MHz-NMR-Spektren (Kap. 8 und 9) eingebracht. Beiden danke ich außerdem für die kritische Durchsicht von Teilen des Manuskriptes. Doris Lang hat unermüdlich die vielen Abbildungen, Skizzen und Formeln gezeichnet, korrigiert, beschriftet und zusammengestellt – eine Arbeit, die nur ein Eingeweihter richtig schätzen kann.
Ich danke Dieter Ratzel (Bruker) für die Aufnahmen der MR-Tomogramme (Abbildungen 11, 13 und 14 in Kapitel 14) sowie für viele zusätzliche Informationen. Der Firma Bruker, vor allem Tony Keller, habe ich für vielfältige Unterstützung zu danken, die von umfangreichen und zeitaufwendigen Messungen, über Bildmaterial bis hin zur Textverarbeitung reichte.
Ich danke weiterhin: Dr. Wolfgang Bremser (BASF) für die Spektrenabschätzung der Modellverbindung und die kritische Durchsicht des Abschnitts über die rechnerunterstützte Spektrenzuordnung; Dr. Hans-J. Opferkuch (DKFZ HD) für die Aufnahme der 2D-NMR-Spektren von Glutaminsäure (Abbildung 9–19 und 24); Brigitte Faul und Wilfried Haseloff für die Aufnahme von 90 MHz-1H-NMR-Tieftemperaturspektren; Dr. Peter Bischof für die graphische Darstellung der Modellverbindung auf dem Titelblatt; Prof. Reinhard Brossmer für die Überlassung des Neuraminsäurederivats als Testsubstanz; Prof. Klaus Weinges für die Korrektur von Abschnitt 2.4; Prof. Dieter Hellwinkel für die Klärung strittiger Nomenklaturfragen. Meinen Mitarbeitern bin ich für ihre aufbauende Kritik und ihre Anregungen sehr zu Dank verpflichtet. Dr. Gerhard Weißhaar und Doris Lang danke ich zudem für die kritische Durchsicht der Korrekturfahnen. Bei der Reinschrift des ersten Manuskriptes haben Brigitte Rüger und Irmgard Pichler dankenswerter Weise geholfen.
Bei der VCH Verlagsgesellschaft sei vor allem Dr. Eva E. Wille genannt, sie hat mein Manuskript nicht nur für den Druck vorbereitet, sie hat als fachkundige Lektorin den Text kritisch durchgearbeitet. Ihr und Myriam Nothacker, die aus dem Manuskript ein Buch machte, bin ich sehr zu Dank verpflichtet.
Ein spezielles Anliegen ist es mir, Pfarrer Franz Alferi von der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Mannheim zu danken, der mir für meine Arbeit einen Raum in absoluter Abgeschiedenheit zur Verfügung stellte.
Ganz zum Schluß gilt mein Dank meiner Frau und der gesamten Familie, die alle in den vergangenen Jahren wegen dieses Buches vieles „erleiden“ und auf so manches verzichten mußten.
Heidelberg, im April 1988
Horst Friebolin
Abkürzungen und Akronyme
ADP
A
denosin
d
i
p
hosphat
APT
A
ttached
P
roton
T
est
ATP
A
denosin
t
ri
p
hosphat
CLA
C
omplete
l
ine-shape
a
nalysis (vollständige Linienformanalyse)
COSY
Co
rrelated
S
pectroscop
y
CP
Cross Polarization
CSA
C
hiral
s
hift
a
gent (Verschiebungsreagenz) oder
C
hemical
s
hift
A
nisotropie
CW
C
ontinuous
w
ave
2D
zweidimensional
DD
D
ipol
-d
ipol
DEPT
D
istortionless
e
nhancement by
p
olarization
t
ransfer
DMSO
D
i
m
ethyl
s
ulf
o
xide
DNMR
D
ynamische
NMR
DPM
D
i
p
ivaloyl
m
ethan, (2,2,6,6-Tetramethyl-heptandione)
DTPA
D
iethylene
-t
riamine
-p
entaacetic
-a
cid
EXSY
Ex
change
S
pectroscop
y
FID
F
ree
i
nduction
d
ecay
FOD
Hepta
f
luor-7,7-dimethyl-4,6
-o
ctan
d
ion
FT
F
ourier
T
ransformation
gs
G
radient
s
elected
HETCOR
Het
eronuclear
cor
relation
HMBC
H
eteronuclear
m
ultiple
b
ond
c
orrelation
HMQC
H
eteronuclear
m
ultiple
q
uantum
c
oherence
HSQC
H
eteronuclear
s
ingle
q
uantum
c
oherence
INADEQUATE
I
ncredible
n
atural
a
bundance
d
oubl
e qua
ntum
t
ransf
e
r
INEPT
I
nsensitive
n
uclei
e
nhanced by
p
olarization
t
ransfer
Lm
Lösungsmittel
LSR
L
anthanoiden
S
hift
R
eagenz
M
Multiplizität von Signalen
MAS
M
agic
A
ngle
S
pinning
MO
M
olecular
o
rbital
MR
M
agnetische
R
esonanz(-Tomographie)
MRI
M
agnetic
r
esonance
i
maging
NMR
Nuclear Magnetic Resonance
NOE
N
uclear
O
verhauser
E
ffekt (enhancement)
NOESY
N
uclear
O
verhauser
e
nhancement
s
pectroscop
y
NS
N
umber of
S
cans (Zahl der Durchgänge)
PCr
Kreatinphosphat
Pfg
P
ulsed
f
ield
g
radient
P
i
Anorganisches Phosphat
PMMA
P
oly
m
ethyl
m
eth
a
crylat
ppm
P
arts
p
er
m
illion
PRESS
P
oint
R
esolved
S
pectro
s
copy
RDC
Residual Dipolar Couplings
ROESY
R
otating frame
O
verhauser
E
nhancement
S
pectroscop
y
S:N
S
ignal-to
-n
oise ratio (Verhältnis von Signal- zu Rauschamplitude)
SPI
S
elective
p
opulation
i
nversion
STD
Sättigungs-Transfer-Differenz-NMR
TMS
T
etra
m
ethyl
s
ilan
TOCSY
T
otal
c
orrelation
s
pectroscop
y
trNOE
Transfer NOE
TROSY
T
ransverse
R
elaxation
O
ptimized
S
pectroscopy
Symbole
1
Physikalische Grundlagen der NMR-Spektroskopie
1.1 Einführung
1946 gelang den beiden Arbeitsgruppen F. Bloch, W.W. Hansen und M. E. Packard sowie E. M. Purcell, H. C. Torrey und R.V. Pound unabhängig voneinander der erste Nachweis von Kernresonanz-Signalen. Für die Entdeckung wurden Bloch und Purcell 1952 gemeinsam mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Seither entwickelte sich die NMR-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance) zu einem für Chemiker, Biochemiker, Biologen, Physiker und neuerdings auch für Mediziner unentbehrlichen Werkzeug. In den ersten drei Jahrzehnten waren alle Messverfahren eindimensional, das heißt, die Spektren haben eine Frequenzachse, in der zweiten werden Signalintensitäten aufgetragen. In den 70er-Jahren begann dann mit der Entwicklung der zweidimensionalen NMR-Experimente eineneue Epoche in der NMR-Spektroskopie. Spektren, die nach diesen Verfahren aufgenommen werden, haben zwei Frequenzachsen; die Intensitäten sind in der dritten Dimension aufgetragen. Inzwischen sind drei- und mehrdimensionale Experimente möglich, doch gehören diese Techniken im Augenblick noch nicht zu den Routinemethoden. Welche Bedeutung der NMR-Spektroskopie in der Chemie beigemessen wird, zeigt die Tatsache, dass die Nobelpreise für Chemie 1991 an R. R. Ernst und 2002 an K. Wüthrich sowie 2003 für Medizin an P. Lauterbur zusammen mit P. Mansfield für ihre bahnbrechenden Untersuchungen über NMR Methoden in Chemie, Biochemie und Medizin verliehen wurden. Wie gerade die in den letzten Jahren entwickelten neuen Messmethoden beweisen, ist die Entwicklung der NMR-Spektroskopie noch längst nicht abgeschlossen.
Dieses Buch will eine Antwort darauf geben, weshalb die NMR-Spektroskopie speziell für den Chemiker zur (vielleicht) wichtigsten spektroskopischen Methode wurde.
Hauptanwendungsgebiet der NMR-Spektroskopie ist die Strukturaufklärung von Molekülen. Um die entsprechenden Informationen zu gewinnen, misst, analysiert und interpretiert man hochaufgelöste NMR-Spektren, die von niederviskosen Flüssigkeiten aufgenommen wurden, in manchen Fällen auch von Festkörpern, wobei man für Festkörpermessungen andere experimentelle Techniken und (im Allgemeinen) auch andere Geräte verwendet. Wir beschränken uns jedoch im folgenden fast ausschließlich auf die sogenannte hochauflösende NMR-Spektroskopie von Flüssigkeiten.
Unser Hauptinteresse gilt vor allem Protonen (1H) und Kohlenstoff-13-Kernen (13C), da deren Resonanzen für die Strukturaufklärung organischer Moleküle am wichtigsten sind. In den folgenden Kapiteln werden wir jedoch auch Beispielen von NMR-Spektren anderer Kerne begegnen, deren NMR-Signale heute ohne Schwierigkeiten beobachtet werden können.
Zum Verständnis der NMR-Spektroskopie müssen wir zunächst lernen, wie sich Kerne mit einem Kerndrehimpuls P und einem magnetischen Moment µ in einem statischen Magnetfeld verhalten. Im Anschluss daran werden wir das grundlegende NMR-Experiment, das Impuls-Verfahren und die spektralen Parameter diskutieren.
1.2 Kerndrehimpuls und magnetisches Moment
Die meisten Kerne haben einen Kern- oder Eigendrehimpuls P. In der klassischen Vorstellungsweise rotiert der kugelförmig angenommene Atomkern um eine Kernachse. Quantenmechanische Rechnungen zeigen, dass dieser Drehimpuls wie so viele atomare Größen gequantelt ist:
(1-1)
Mit dem Drehimpuls P ist ein magnetisches Moment µ verknüpft. Beides sind vektorielle Größen, die einander proportional sind:
(1-2)
Tabelle 1-1. Eigenschaften von Kernen, die für die NMR-Spektroskopie wichtig sind.
γ, die Proportionalitätskonstante, ist für jedes Isotop der verschiedenen Elemente eine charakteristische Konstante und heißt magnetogyrisches oder gyromagnetisches Verhältnis. Von γ hängt die Nachweisempfindlichkeit eines Kernes im NMR-Experiment ab: Kerne mit großem γ werden als empfindlich, solche mit kleinem γ als unempfindlich bezeichnet.
Mit den Gleichungen (1-1) und (1-2) erhält man für das magnetische Moment µ:
(1-3)
Für die meisten Kerne zeigen Kerndrehimpulsvektor P und magnetisches Moment µ in die gleiche Richtung, sie sind parallel. In einigen Fällen, beispielsweise bei 15N und 29Si (und auch beim Elektron!), stehen sie jedoch antiparallel. Auf die Folgen dieser Tatsache werden wir in Kapitel 10 eingehen.
1.3 Kerne im statischen Magnetfeld
1.3.1 Richtungsquantelung
Wird ein Kern mit dem Drehimpuls P und dem magnetischen Moment m in ein statisches Magnetfeld B0 gebracht, orientiert sich der Drehimpuls im Raum so, dass seine Komponente in Feldrichtung, Pz, ein ganz- oder halbzahliges Vielfaches von ħ ist:
(1-4)
Abbildung 1-1. Richtungsquantelung des Drehimpulses P im Magnetfeld für Kerne mit I =1/2 und 1.
Mit den Gleichungen (1-2) und (1-4) erhält man die Komponenten des magnetischen Momentes in Feldrichtung z:
(1-5)
In der klassischen Betrachtungsweise präzedieren die Kerndipole um die z-Achse, die der Richtung des Magnetfeldes entspricht – sie benehmen sich wie Kreisel (Abb. 1-2). Die Präzessions- oder Larmor-Frequenz vL ist hierbei der magnetischen Flussdichte B0 proportional:
(1-6)
1.3.2 Energie der Kerne im Magnetfeld
Die Energie eines magnetischen Dipols in einem Magnetfeld der magnetischen Flussdichte B0 beträgt
(1-7)
Damit ergeben sich für einen Kern mit (2 I + 1) Orientierungsmöglichkeiten auch (2 I + 1) Energiezustände, die sogenannten Kern-Zeeman-Niveaus. Aus Gleichung (1-5) folgt:
(1-8)
Der Energieunterschied zweier benachbarter Energieniveaus beträgt:
(1-9)
Abbildung 1-4. Energieunterschiede (ΔE) zweier benachbarter Energieniveaus in Abhängigkeit von der magnetischen Flussdichte B0.
1.3.3 Besetzung der Energieniveaus
(1-10)
Da für Protonen – und auch für alle anderen Kerne – der Energieunterschied ΔE sehr klein ist im Vergleich zur mittleren Energie der Wärmebewegung (kBT), sind die meisten Niveaus nahezu gleichbesetzt. Der Überschuss im energieärmeren Niveau liegt nur im Bereich von tausendstel Promille (ppm).
Zahlenbeispiel für Protonen:
1.3.4 Makroskopische Magnetisierung
Abbildung 1-5. Verteilung von N (= Nα + Nβ) Kernen auf dem Doppelpräzessionskegel. Da Nα > Nβ, resultiert eine makroskopische Magnetisierung M0.
1.4 Grundlagen des Kernresonanz-Experimentes
1.4.1 Resonanzbedingung
Im Kernresonanz-Experiment werden Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus induziert, indem die Kerne mit einem Zusatzfeld B1 der richtigen Energie, das heißt, mit einer elektromagnetischen Welle der richtigen Freqenz v1, bestrahlt werden. Dabei tritt die magnetische Komponente der Welle mit den Kerndipolen in Wechselwirkung.
Betrachten wir die Protonen einer Chloroformlösung (CHCl3): Für diesen Fall gilt das linke Energieniveauschema in Abbildung 1-3, Übergänge zwischen den Niveaus sind möglich, wenn die Frequenz v1 so gewählt ist, dass Gleichung (1-11) erfüllt ist
(1-11)
Die Übergänge vom energieärmeren ins energiereichere Niveau entsprechen einer Energieabsorption, solche vom energiereicheren ins energieärmere einer Energieemission (s. Abb. 1-6, Pfeile a bzw. e). Beide sind möglich und auch gleich wahrscheinlich. Jeder Übergang ist mit einer Umkehr der Kernspin-Orientierung verbunden. Wegen des Besetzungsüberschusses im energieärmeren Niveau überwiegt die Energieabsorption aus dem eingestrahlten Zusatzfeld. Dies wird als Signal gemessen, wobei die Intensität dem Besetzungsunterschied Nα-Nβ proportional ist und damit auch proportional der Gesamtzahl der Spins in der Probe, also der Konzentration.
Aus den Gleichungen (1-9) und (1-11) folgt die Resonanzbedingung:
(1-12)
Der Ausdruck Resonanz ist auf die klassische Deutung des Phänomens zurückzuführen, denn Übergänge erfolgen nur dann, wenn die Frequenz der eingestrahlten elektromagnetischen Welle v1 und die Larmor-Frequenz vL übereinstimmen.
(1-13)
1.4.2 Messprinzip
In der Substanzprobe werden dann NMR-Übergänge und damit im Empfänger Signale induziert, wenn die Resonanzbedingung (Gleichung 1-12) erfüllt ist. Um ein Spektrum zu erhalten, kann man entweder die magnetische Flussdichte B0 bei konstanter Senderfrequenz v1 (field sweep method) oder die Senderfrequenz v1 bei konstantem B0 (frequency sweep method) variieren. In beiden Fällen ist der Schreibervorschub direkt mit der Feld- bzw. Frequenzänderung gekoppelt, und der Schreiber zeichnet das Spektrum kontinuierlich auf. Da die Senderleistung im Gegensatz zum Impulsverfahren, das wir im nächsten Abschnitt kennenlernen werden, nicht unterbrochen wird, heißt die Methode im Angelsächsischen continuous wave (CW) method. Auf dieser Grundlage arbeiteten alle bis Ende der 60er-Jahre gebauten NMR-Spektrometer. Heute ist die CW-Technik jedoch vollständig durch die Impulstechnik verdrängt, aus Gründen, die wir später verstehen werden.
Auf seiten der Geräte ist vor allem der Einsatz von Kryomagneten zu nennen, mit denen wesentlich höhere Magnetfeldstärken und damit auch größere Empfindlichkeit erreicht werden als mit Permanent- und Elektromagneten (s. Tabelle 1-2). Der entscheidende Fortschritt wurde jedoch durch die Impuls-Spektroskopie erreicht, deren Entwicklung mit dem stürmischen Fortschritt in der Computertechnik eng gekoppelt ist. Es ist das große Verdienst von R. R. Ernst, zusammen mit W. A. Anderson [2], dieses im Angelsächsischen auch mit Pulse Fourier Transform (PFT) spectroscopy bezeichnete Verfahren in den 60er-Jahren auf die NMR-Spektroskopie angewandt und damit gleichzeitig die Entwicklung einer neuen Generation von Spektrometern und Experimenten (s. Kap. 8 und 9) eingeleitet zu haben. Einen faszinierenden Einblick in diese Entwicklungsphase der NMR-Spektroskopie bietet die Lektüre des Nobel-Vortrages von R. R. Ernst [3]. Das Impuls-Verfahren wird im folgenden Abschnitt ausführlich besprochen, da es die Grundlage der modernen NMR-Spektroskopie ist. Wir werden dabei, wie schon in Abschnitt 1.3, die klassische Beschreibung mit Vektorbildern verwenden. Wie ein Spektrometer im Prinzip aufgebaut ist, werden wir dann in Abschnitt 1.5.6 kennenlernen.
Tabelle 1-2.1H- und 13C-Resonanzfrequenzen bei verschiedenen magnetischen Flussdichten B0.a)
1.5 Impuls-Verfahren
1.5.1 Impuls (Angelsächsisch: pulse)
Beim Impuls-Verfahren werden in der Messprobe durch einen Hochfrequenzimpuls gleichzeitig alle Kerne einer Sorte angeregt, zum Beispiel sämtliche Protonen oder 13C-Kerne. Was versteht man unter einem solchen Impuls, und wie erzeugt man ihn?
Ein Hochfrequenz-Generator arbeitet normalerweise bei einer festen Frequenz v1. Wird er aber nur für eine kurze Zeit τp eingeschaltet, erhält man einen Impuls, der nicht nur die Frequenz v1 enthält, sondern ein kontinuierliches Frequenzband, das symmetrisch zur Frequenz v1 liegt. Für die Anregung der Übergänge ist jedoch nur ein Teil des Frequenzbandes verwertbar, und dieser Teil ist in etwa proportional. Bei NMR- Experimenten liegt die Impulslänge τp in der Größenordnung von einigen µs (Abb. 1-7).
Abbildung 1-7. Schematische Darstellung eines Impulses. Zur Zeit t0 wird der Generator (Frequenz v1) ein-, zur Zeit t1 wieder ausgeschaltet. Die Impulslänge τP beträgt einige µs.
Abbildung 1-8. Frequenzkomponenten eines Impulses; Breite des Bandes , v1 Generatorfrequenz, vA und vB Resonanzfrequenzen der Kerne A und B.
1.5.2 Impulswinkel
Betrachten wir den einfachsten Fall: eine Probe mit nur einer Kernsorte i, zum Beispiel die Protonen einer Chloroformlösung (CHCl3). Wie in Abbildung 1-5 gezeigt, präzedieren die Kernmomente mit der Larmor-Frequenz vL auf der Oberfläche eines Doppelkegels, wobei aufgrund der Besetzungsunterschiede eine makroskopische Magnetisierung M0 in Feldrichtung resultiert. Um NMR-Übergänge anzuregen, lässt man den Impuls in Richtung der x-Achse auf die Substanzprobe einwirken. Hierbei tritt der magnetische Vektor der elektromagnetischen Welle in Wechselwirkung mit den Kerndipolen und folglich mit M0. In einem Versuch, diesen quantenmechanischen Vorgang auch anschaulich darzustellen, wird die zeitliche Veränderung der Amplitude des in x-Richtung linear oszillierenden Magnetfeldes mit Hilfe zweier gleich großer Vektoren B1 beschrieben, die in der x,y-Ebene mit derselben Frequenz vL zirkulieren, der eine linksherum, B1(l), der andere rechtsherum, B1(r). Abbildung 1-9 zeigt, dass eine einfache Addition der beiden Vektoren stets wieder die x-Komponente des oszillierenden Magnetfeldes ergibt, dessen Maximalwert 2B1 beträgt. Von den beiden zirkulierenden Magnetfeldern kann nur das, im folgenden kurz B1 genannt, mit den Kernen (bzw. mit M0) in Wechselwirkung treten, das die gleiche Drehrichtung hat wie die präzedierenden Kerne. Unter seinem Einfluss wird M0 von der z-Achse, der Richtung des statischen Feldes B0, weggedreht, und zwar in der Ebene senkrecht zur Richtung von B1. Da sich diese Richtung aber mit der Larmor-Frequenz vL ändert, lässt sich die Bewegung von M0 nur schwer bildlich darstellen. Verwendet man jedoch anstelle eines ortsfesten ein rotierendes Koordinatensystem x′,y′,z, das mit derselben Frequenz rotiert wie B1, ist die Orientierung und der Betrag von B1 konstant. Da man im Allgemeinen die Richtung von B1 als x′-Achse des rotierenden Koordinatensystems definiert, wird somit der Vektor M0 in der y′, z-Ebene um die x′-Achse gedreht.
Abbildung 1-9. Darstellung eines linear oszillierenden Feldes mit der maximalen Amplitude 2B1 als Summe eines links- und eines rechtszirkulierenden Feldes B1(l) und B1(r).
Gemäß Gleichung (1-14) ist der Winkel Θ um so größer, je höher die Amplitude B1i der für den Kernresonanzübergang verantwortlichen Frequenzkomponente vi des Impulses ist und je länger der Impuls wirkt. Der Winkel Θ heißt Impulswinkel.
(1-14)
Zum Verständnis der meisten Impuls-Verfahren sind zwei Spezialfälle von Bedeutung: Experimente mit den Impulswinkeln 90° und 180°. Fällt, wie in dem gerade besprochenen Fall, die Richtung des B1-Feldes mit der x′-Achse zusammen, werden die Impulse mit und bezeichnet. In Abbildung 1-10 sind die Magnetisierungsvektoren M0 nach - und - Impulsen sowie für einen beliebigen Impulswinkel aufgezeichnet. Die Richtung von B1 ist in den Vektordiagrammen durch eine Wellenlinie symbolisiert. Fällt die Richtung von B1 mit der y′-Achse zusammen, wie in Experimenten, die wir in den Kapiteln 8 und 9 kennenlernen werden, spricht man von - und -Impulsen; die Wellenlinie liegt in den Vektordiagrammen dann auf der y′-Achse des rotierenden Koordinatensystems.
Abbildung 1-10. Richtung des makroskopischen Magnetisierungsvektors M0 im rotierenden Koordinatensystem: a) nach einem beliebigen Impuls; b) nach einem -Impuls; c) nach einem -Impuls. Die Wellenlinie auf der x′-Achse symbolisiert die Richtung des effektiv wirkenden B1-Feldes.
Bei noch längeren Zeiten τP beobachtet man wieder ein Signal, aber mit negativer Amplitude, das heißt, es zeigt im Spektrum nach unten. Dies wird aus dem Vektordiagramm verständlich: Bei einem Impulswinkel größer als 180° entsteht eine Querkomponente –My′ in Richtung der–y′-Achse, und dadurch wird in der Empfängerspule ein negatives Signal induziert.
Abbildung 1-12. Anschauliches Bild der Phasenkohärenz: Nach einem -Impuls präzedieren einige – nicht alle! – Kerne gebündelt, in Phase, um die Feldrichtung z.
1.5.3 Relaxation
Nach Abschalten des Impulses ist der Magnetisierungsvektor M0 um Θ aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt. Er präzediert jetzt wie die Einzelspins mit der Larmor-Frequenz vL um die z-Achse, wobei seine Orientierung im ortsfesten Koordinatensystem immer durch die drei mit der Zeit t variierenden Komponenten Mx, My und Mz festgelegt ist (Abb. 1-13).
Abbildung 1-13. Der makroskopische Magnetisierungsvektor M0 wurde unter der Einwirkung eines Impulses um den Winkel Θ aus seiner Gleichgewichtslage herausgedreht und präzediert anschließend mit der Larmor-Frequenz vL. Im ortsfesten Koordinatensystem hat M0 zur Zeit t die Koordinaten Mx, My und Mz.
Durch Relaxation kehrt das Spinsystem in den Gleichgewichtszustand zurück, Mz wächst wieder auf M0 an, und Mx und My gehen gegen Null. Die recht komplizierte Bewegung des Magnetisierungsvektors während der Einwirkung des hochfrequenten Feldes B1 und der nachfolgenden Relaxation hat Bloch mathematisch analysiert. Er nahm an, dass die Relaxationsprozesse nach 1. Ordnung ablaufen und mit zwei verschiedenen Relaxationszeiten T1 und T2 beschrieben werden können. Dies führt zu einem Satz von Gleichungen (oder einer Vektorgleichung), die angeben, wie sich Mx, My und Mz mit der Zeit ändern.
Die Gleichungen und ihre Lösung werden viel einfacher, wenn man wie Bloch in das mit der Lamor-Frequenz rotierende Koordinatensystem x′,y′,z wechselt, da dann die Präzession um die z-Achse nicht mehr berücksichtigt werden muss. Direkt nach Abschalten des Impulses wird die Rückkehr in den Gleichgewichtszustand, also die Relaxation, durch die nachfolgenden Blochschen Gleichungen beschrieben:
(1-15)
(1-16)
Die reziproken Relaxationszeiten und entsprechen den Geschwindigkeitskonstanten für die beiden Relaxationsprozesse.
Um zu zeigen, wie einfach und anschaulich sich die Relaxation im rotierenden Koordinatensystem darstellen lässt, verwenden wir obige Gleichung und betrachten die Magnetisierung nach einem -Impuls:
Abbildung 1-14. Spin-Spin- oder transversale Relaxation. Ein -Impuls dreht M0 in die y′-Richtung (a). In der Folgezeit fächern die gebündelt präzedierenden Kerndipole infolge Spin-Spin-Relaxation auf (b und c). Diagramm d zeigt den exponentiellen Abfall der transversalen Magnetisierungskomponente My′.
Wir werden in den Kapiteln 8 und 9 bei der Besprechung von ein- und zweidimensionalen Impuls-Techniken auf die Bewegung der Vektoren im feststehenden und rotierenden Koordinatensystem ausführlich zurückkommen. Das Phänomen Relaxation behandeln wir in Kapitel 7.
1.5.4 Zeit- und Frequenzdomäne; Fourier Transformation
Das vom NMR-Spektrometer nach einem Impuls detektierte Signal hängt von My′ ab, es sieht jedoch nicht so aus wie in Abbildung 1-14d gezeigt. Aufgrund des Messverfahrens erhielte man dies nur, wenn zufällig Generatorfrequenz v1 und Resonanzfrequenz der beobachteten Kerne übereinstimmen. Im Empfänger wird vielmehr eine Kurve beobachtet, wie sie in Abbildung 1-15A für CH3I (1) wiedergegeben ist. Dabei stimmt die Umhüllende mit der in Abbildung 1-14 d gezeichneten Kurve überein. In diesem Beispiel mit nur einer Resonanzfrequenz für die drei äquivalenten Protonen der Methylgruppe entspricht der Abstand zweier Maxima dem reziproken Frequenzabstand zwischen v1 und der Resonanzfrequenz vi der Kerne i: 1/Δv. Die im Empfänger registrierte Abnahme der Quermagnetisierung heißt freier Induktionsabfall – im Angelsächsischen Free Induction Decay oder kurz FID genannt.
Enthält eine Probe Kerne mit verschiedenen Resonanzfrequenzen oder besteht das Spektrum aus einem Multiplett infolge von Spin-Spin-Kopplung (siehe Abschnitt 1.6.2), so überlagern sich die Abklingkurven der Quermagnetisierungen, sie interferieren. Abbildung 1-16 A zeigt ein derartiges Interferogramm für das 13C-NMR-Spektrum von 13CH3OH (2). Das Interferogramm, der FID, enthält sowohl die uns interessierenden Resonanzfrequenzen als auch die Intensitäten, das heißt den gesamten Informationsgehalt eines Spektrums. Wir können das Interferogramm jedoch nicht direkt analysieren, da wir gewohnt sind, ein Spektrum in der Frequenzdomäne und nicht in der Zeitdomäne zu interpretieren. Beide Spektren lassen sich aber durch eine mathematische Operation, die
Fourier Transformation (FT), ineinander umrechnen:
(1-17)
f(t) entspricht dem Spektrum in der Zeitdomäne, g(ω) dem in der Frequenzdomäne. g(ω) ist eine komplexe Funktion, die aus einem Real- und einem Imaginärteil (Re bzw. Im) besteht. Im Prinzip ist es gleichgültig, ob man für die Darstellung den Real- oder den Imaginärteil verwendet, denn sie geben beide das Frequenzspektrum wieder. Allerdings unterscheiden sich die Signalphasen um 90°. In der eindimensionalen NMR-Spektroskopie ist es üblich, für die Wiedergabe der Spektren den Realteil zu verwenden und Absorptionssignale abzubilden (Abb. 1-17).
Bedingt durch die Aufnahmetechnik erhält man nach der FT meistens Signale mit Absorptions- und Dispersionsanteilen. Durch Phasenkorrektur lässt sich der Dispersionsanteil entfernen, sodass alle Signale die in der NMR-Spektroskopie gewohnte Form von Absorptionslinien haben.
Abbildung 1-15. 90 MHz 1H-NMR-Spektrum von Methyliodid CH3I (1); 1 Impuls, Spektrenbreite 1200 Hz, 8 K Datenpunkte. Die Aufnahmezeit (Acquisition time) betrug 0,8 s. A: Spektrum in der Zeitdomäne (FID), wobei die Generatorfrequenz ungefähr gleich der Resonanzfrequenz ist; B: Spektrum in der Frequenzdomäne, erhalten aus A durch Fourier Transformation.
Abbildung 1-16. 22,63 MHz 13C-NMR-Spektrum von Methanol 13CH3OH (2); in D2O, 17 Impulse, Spektrenbreite 1000 Hz, 8 K Datenpunkte. A: Spektrum in der Zeitdomäne (FID); B: Spektrum in der Frequenzdomäne, erhalten aus A durch Fourier-Transformation. Es besteht aus einem Quartett, da der 13C-Kern mit den drei Protonen der Methylgruppe koppelt.
Die Abbildungen 1-15B und 1-16B zeigen die aus den Interferogrammen 1-15A und 1-16A durch FT erhaltenen, phasenkorrigierten Frequenzspektren: Das 1H-NMR-Spektrum für Methyliodid besteht aus einem Singulett, das 13C-NMR-Spektrum von 13CH3OH aus einem Quartett.
In der zweidimensionalen NMR-Spektroskopie berechnet man häufig die Absolutwerte der Signale, das Magnitudenspektrum, . Durch diese Rechenoperation entsteht ebenfalls ein Frequenzspektrum mit Absorptionssignalen, wobei die Signale aber einen breiteren Fuß haben als die, die man aus dem Realteil erhält (Abb. 1-17). Diese Art der Darstellung hat den großen Vorteil, dass keine Probleme durch eventuell vorhandene Phasenunterschiede der Signale entstehen. Wir kommen in Abschnitt 9.4.2 darauf zurück.
Abbildung 1-17. A: Absorptionssignal B: Dispersionssignal C: Absolutwert des Signals
Die Theorie der FT, die Programmierung des für die Berechnung der FT notwendigen Computers und andere technische Einzelheiten sind in der Literatur nachzulesen (s. Abschn. 1.9 unter „Ergänzende und weiterführende Literatur“).
1.5.5 Spektrenakkumulation
Meist ist die Intensität eines einzelnen FID so schwach, dass die Signale nach der FT im Verhältnis zum Rauschen sehr klein sind. Dies gilt vor allem für Kerne mit geringer Empfindlichkeit und geringer natürlicher Häufigkeit (13C,15N) oder für schwach konzentrierte Proben. Deswegen werden im Computer die FIDs vieler Impulse aufsummiert, akkumuliert, und erst danach transformiert. Beim Akkumulieren mittelt sich das statistisch auftretende elektronische Rauschen zum Teil heraus, während der Beitrag der Signale stets positiv ist und sich deshalb addiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis S: N (Signal:Noise) wächst proportional mit der Wurzel aus der Zahl der Einzelmessungen NS (Number of Scans):
(1-18)
Das Akkumulieren vieler FIDs, manchmal vieler hunderttausend über einen Zeitraum von mehreren Tagen, aber auch das Messen zweidimensionaler Spektren, setzt eine absolut genaue Feld-Frequenz-Stabilisierung voraus sowie ein exaktes Abspeichern der Daten eines jeden FID in digitaler Form in den gleichen Speicherplätzen des Computers. Jede Instabilität während der Messung, auch eine solche der Temperatur, verbreitert die Linien und führt zum Verlust von Empfindlichkeit (S : N). Die Geräteeinheit, die die Aufgabe der Feld-Frequenz-Stabilisierung übernimmt, heißt im Angelsächsischen lock unit. Diese benutzt einen getrennten Radiofrequenzkanal, um die Kernresonanz eines anderen Kernes als der des aktuellen NMR-Experimentes zu messen; im Allgemeinen benutzt man die 2H-Resonanz des deuterierten Lösungsmittels. Dazu braucht man einen Sender, der die Deuteriumresonanzen anregt (mittels eines Impulses), einen Empfänger und Verstärker und einen Detektor (signal processor). Ändert sich die Magnetfeldstärke oder die Frequenz, ist die Resonanzbedingung nicht mehr exakt erfüllt, und die Signalintensität nimmt ab. Die „lock unit“ reagiert automatisch darauf, indem sie das Magnetfeld korrigiert, bis die Resonanzbedingung wieder erfüllt ist. Wenn die Feld-Frequenz-Stabilität für das Lösungsmittel wieder erreicht ist, darf man davon ausgehen, dass dies auch für die Kerne der gelösten Moleküle gilt.
Das „Lock“-Signal kann auf dem Bildschirm beobachtet werden; in der Praxis benutzt man es, um entweder von Hand oder automatisch die Magnetfeldhomogenität zu optimieren. Die entsprechende Einheit heißt shim unit (s. auch Abschn. 1.5.6), und die notwendigen Einstellungen werden im Laborjargon „shimmen“ genannt.
Weil die Magnetisierung durch Relaxation mit der Zeit abnimmt, enthält das Interferogramm am Ende des Abspeicherns einen höheren Anteil an Rauschen als zu Beginn. Die Geschwindigkeit, mit der der FID abklingt, wird durch die Relaxationszeit T2 und Feldinhomogenitäten (ΔB0) bestimmt. Diese Tatsache ist besonders für die im Experiment verwendeten Impuls-Intervalle wichtig, denn bei genauen Intensitätsmessungen muss das System vor jedem neuen Impuls vollständig relaxiert, das heißt wieder im Gleichgewichtszustand sein. In der Praxis jedoch folgt nach dem Abspeichern der Daten des FID der nächste Messimpuls schon bevor das Gleichgewicht erreicht ist. Das heißt zum einen, dass Mz noch nicht den Wert M0 erreicht hat, zum andern, dass auch noch Quermagnetisierungen Mx′ und My′ in der x′,y′-Ebene vorhanden sein können. Während man diesen Nachteil im Allgemeinen in Kauf nimmt, verursachen noch vorhandene Quermagnetisierungen vor allem bei zweidimensionalen Experimenten Artefakte.
Eine elegante Lösung zum Entfernen solch störender Quermagnetisierungen bietet das Verfahren der „gepulsten Feldgradienten“. Zwar wurden Feldgradienten schon lange in der magnetischen Resonanz-Tomographie verwendet (s. Kap. 14), doch in die hochaufgelöste NMR-Spektroskopie fanden sie erst Eingang, nachdem die Spektrometer mit der entsprechenden „hardware“, einschließlich spezieller Gradientenspulen im Probenkopf, ausgerüstet wurden.
Wegen der inzwischen erlangten großen Bedeutung solcher Experimente wollen wir in Abschnitt 8.4 ausführlich auf die Methode der „Pulsed Field Gradients“ (PFG) als Werkzeug (tool) in der modernen NMR-Spektroskopie eingehen.
1.5.6 Impulsspektrometer
NMR-Spektrometer sind aufwendige Messinstrumente, denn sowohl an Homogenität und Stabiliät des Magneten als auch an die Elektronik werden hohe Anforderungen gestellt. Den Aufbau und die Funktionsweise eines Impulsspektrometers im Rahmen dieses Buches genau zu beschreiben, ist weder möglich noch sinnvoll. Im folgenden werden nur einige grundsätzliche Fragen angeschnitten, die das Spektrometer, die Aufnahmetechnik und die Datenverarbeitung betreffen.
Abbildung 1-18 zeigt schematisch den Aufbau eines Impulsspektrometers. Es besteht aus dem Kryomagneten, dem Probenkopf, der Konsole mit Elektronik und einem Computer.
Magnet: Ein wesentliches Bauelement eines jeden Spektrometers ist der Magnet (1), in Abbildung 1-18 als Längsschnitt gezeigt. Von seiner Qualität hängt die Qualität des Experimentes und damit des endgültigen Spektrums ab. Waren es bis Anfang der 60er-Jahre Permanent- oder Elektromagnete mit einer magnetischen Flussdichte bis 1,41 T (entsprechend einer Messfrequenz von 60 MHz für Protonen), erreicht man heute mit Kryomagneten schon 23,49 T, d. h. 1000 MHz Messfrequenz für Protonen. In Tabelle 1-2 sind einige typische magnetische Flussdichten B0 und die entsprechenden 1H- und 13C-Resonanzfrequenzen von Spektrometern angegeben, die in der Vergangenheit verwendet wurden und in modernen Geräten verwendet werden. Es gibt nur noch wenige Spektrometer, die unter 4,70 T (200 MHz für 1H) arbeiten, und alle modernen Geräte sind mit Kryomagneten ausgestattet. Die Richtung des Magnetfeldes B0 liegt in der Längsachse der Messprobe.
Probenkopf: Das Herzstück eines Spektrometers ist der Probenkopf (2). Er nimmt die Substanzprobe auf, er enthält die Sender-, Empfänger-, Entkoppler-, Lock- und Gradientenspulen sowie den Vorverstärker. Der Probenkopf wird von unten in die Magnetbohrung eingeführt. Im allgemeinen hat die Bohrung 5 cm Durchmesser.
Zur Verbesserung der Auflösung und der Empfindlichkeit kann in speziellen Probenköpfen die Elektronik gekühlt werden (Kryoköpfe).
Die Substanzprobe (3) ist normalerweise in einem ca. 20 cm langen Glasröhrchen mit 5 mm äußerem Durchmesser enthalten und wird mit Hilfe eines Probenwechslers (4) von oben in den Probenkopf eingeführt. Diesen Vorgang kann man auch mit Hilfe eines automatischen Probenwechslers, der bis zu 50 Proben aufnimmt, ablaufen lassen. Man erreicht dadurch eine optimale Auslastung des Spektrometers, z. B. über Nacht oder über das Wochenende.
Abbildung 1-18. Schematischer Aufbau eines NMR-Spektrometers mit Kryomagnet; 1 Magnet: a Magnetspulen; b, c Einfüllstutzen für flüssiges Helium bzw. flüssigen Stickstoff; d innere und äußere Vakuumkammern; 2 Probenkopf; 3 Substanzprobe; 4 Probenwechsler; 5 Shim-Einheit.
Im erweiterten Sinne kann man die Vorrichtung für die Probenrotation und die Shim-Einheit (zum Einstellen der Magnetfeldhomogenität) zum Probenkopf hinzunehmen (5). Diese befinden sich in einem Rohr konzentrisch um den Probenkopf, sie bleiben jedoch im Magneten, wenn der Probenkopf gewechselt wird. Normalerweise rotiert das Probenröhrchen zur Verbesserung der effektiven Feldhomogenität um seine Längsachse. Die entsprechende Vorrichtung, eine Turbine, befindet sich am oberen Ende des Shim-Rohres. Bei der neuesten Gerätegeneration ist die Feldhomogenität so gut, dass auf die Rotation verzichtet werden kann. Erst dadurch wurden die Experimente mit Feldgradienten möglich.
Sendereinheit (Transmitter): Die Sendereinheit besteht aus einem Radiofrequenzgenerator und einem „frequency synthesizer“. Sie liefert die für die Experimente benötigten Frequenzen (die Beobachtungsfrequenz v1, die Entkoppler- und Lockfrequenzen), wobei alle Frequenzen von einer festen, quarzstabilisierten Frequenz abgeleitet werden. Außerdem erzeugt der Transmitter die Impulse mit der richtigen Länge und Leistung. Die Steuerung aller Funktionen übernimmt der Computer.
Empfänger (Receiver): Wie schon in Abschnitt 1.5.2 erwähnt, wird in der Empfängerspule eine zur Quermagnetisierung My′ proportionale, hochfrequente elektrische Spannung induziert. Die Frequenz entspricht der des NMR-Übergangs [s. Gl. (1-11)], typischerweise einige hundert MHz. Im allgemeinen enthält die induzierte Spannung jedoch nicht nur eine einzige Frequenz, sondern aufgrund der chemischen Verschiebung (s. nächsten Abschnitt) eine ganze Reihe von Frequenzen, die innerhalb eines engen Bereichs von wenigen kHz über und unter der Senderfrequenz v1 liegen. Das vom Empfänger und Vorverstärker kommende Signal muss noch weiter verstärkt werden. Aus technischen Gründen ist es von Vorteil und einfacher, Frequenzen zu bearbeiten, die beträchtlich niedriger sind als v1. Daher verwendet man bei der Detektion in der Radiotechnik einen nützlichen Trick: Man nimmt die Frequenz v1 als Referenzbasis; ein getrennter Generator („local oscillator“) erzeugt dann eine neue Frequenz v1 + vi.f., wobei vi.f. einer Zwischenfrequenz (intermediate frequency, i.f.) von nur einigen wenigen MHz entspricht, und mischt diese Frequenz des „local oscillators“ mit dem NMR-Signal, um ein neues Signal zu bilden, dessen Frequenz die Differenz beider ist. Die weitere Verstärkung erfolgt dann in einem Verstärker, der auf diese Zwischenfrequenz abgestimmt ist. Ein phasenempfindlicher Detektor vergleicht dann das verstärkte Zwischenfrequenzsignal mit einer Zwischenfrequenzspannung, die vom „local oscillators“ abgeleitet ist; daraus resultiert ein Signal mit relativ niedrigen Frequenzen, die den Differenzen zwischen v1 und den in der Empfängerspule empfangenen Frequenzen entsprechen. Nach weiterer Verstärkung durch den Niederfrequenz-Breitbandverstärker erhält man ein Spektrum in der Zeitdomäne, das Interferogramm oder FID (von Free Induction Decay; Beispiele sind in den Abbildungen 1-15A und 1-16A gezeigt). Dieser FID wird dann im Computer weiterverarbeitet.
Bei dieser Art der Detektion eines FID und dem daraus abgeleiteten Frequenzspektrum werden nur die Absolutwerte der Differenzen zwischen Signal- und Referenzfrequenz bestimmt; folglich kann das System nicht zwischen einem Signal mit höherer Frequenz als v1 und einem solchen mit um den gleichen Betrag niedrigerer Frequenz unterscheiden. Wenn also zwei Signale zufällig denselben Abstand von v1 haben, das eine bei höherer, das andere bei niedrigerer Frequenz, erhält man im Spektrum nur ein Signal. Man muss daher beim Experiment darauf achten, dass die Referenzfrequenz v1 am Rand und nicht mitten im Spektrum liegt. Das hat jedoch zwei Nachteile: Zum einen bleibt die Hälfte des über die Impulslänge τp definierten Frequenzbandes ungenutzt (s. Abschn. 1.5.1), zum anderen wird das elektronische Rauschen dieses ungenutzten Bereichs ins Spektrum zurückgefaltet. Beides führt zu einem erheblichen Empfindlichkeitsverslust.
Um diese Nachteile zu vermeiden, benutzen die heutigen Impulsspektrometer meistens die „quadrature-detection“. Dieses Verfahren verwendet zwei phasenempfindliche Detektoren, der eine registriert My′, die y′ -Komponente des Magnetisierungsvektors, der andere gleichzeitig Mx′, die um 90 ° phasenverschobene x′-Komponente. Werden beide Komponenten für die Fourier Transformation verwendet, lassen sich aufgrund ihrer verschiedenen Phase Frequenzen unterscheiden, die größer oder kleiner sind als die Referenzfrequenz. Somit ist es möglich, v1 in die Mitte des zu beobachtenden Spektrenbereichs zu legen. Man gewinnt dadurch den Faktor an Nachweisempfindlichkeit.
Computer: Das Interferogramm, das schließlich vom Verstärker kommend den Computer erreicht, enthält die gesamte Information über das NMR-Spektrum in analoger Form. Damit man schließlich das gewohnte Spektrum in der Frequenzdomäne erhält, müssen die Daten zunächst digitalisiert werden. Dazu müssen in gleichen Zeitabständen die Amplituden des Interferogramms (elektrische Spannungswerte) gemessen, dann digitalisiert und schließlich im Computer abgespeichert werden. Die Fourier Transformation (FT) ist dann in Sekundenschnelle durchgeführt. Damit die Signale nach der Fourier Transformation auch bei den korrekten Frequenzen im NMR-Spektrum erscheinen, müssen die Zeitabstände bei der Datenerfassung so kurz sein, dass mindestens zwei Datenpunkte pro Sinuswelle (Periode) der höchsten Frequenzkomponente im Interferogramm erfasst werden. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, behandelt der Computer diese Komponente so, als sei sie eine mit niedrigerer Frequenz, sodass das Signal ins Spektrum zurückgefaltet (back-folded) wird; das Spektrum enthält also ein Signal in einem Bereich, in dem keines sein dürfte. Die höchste vom System gerade noch richtig berechnete Frequenz heißt Nyquist-Frequenz.
Bis vor nicht allzu langer Zeit waren das Abspeichern und die Fourier Transformation die Hauptaufgaben des Computers. In modernen Spektrometern steuert der Computer dagegen nahezu alle Spektrometerfunktionen. Dazu gehören u. a. das Laden der Programme einschließlich Eingabe der notwendigen Parameter für das spezielle Experiment, das man ausführen will, das automatische Shimmen, die Analyse, Simulation, Vorhersage und Interpretation von Spektren und vieles andere mehr. Heute ist es außerdem bei entsprechender Vernetzung möglich, die FIDs und andere Daten vom Kunden direkt vom Computer des Spektrometers zum eigenen Arbeitsplatzrechner abzurufen und dort zu bearbeiten [4].
1.6 Spektrale Parameter im Überblick
1.6.1 Chemische Verschiebung
1.6.1.1 Abschirmung
Nach den bisherigen Betrachtungen ist für jede Kernsorte nur ein Kernresonanz-Signal zu erwarten. Wäre dies tatsächlich so, dann wäre die Methode für den Chemiker uninteressant. Glücklicherweise werden die Resonanzen in charakteristischer Weise von der Umgebung des beobachteten Kernes beeinflusst. Nur um das Problem zu vereinfachen, gingen wir bisher von isolierten Kernen aus. Der Chemiker betrachtet jedoch Moleküle, in denen die Kerne immer von Elektronen und anderen Atomen umgeben sind. Die Folge ist, dass in diamagnetischen Molekülen das am Kernort wirkende Magnetfeld Beff stets kleiner ist als das angelegte Feld B0: Die Kerne sind abgeschirmt. Der Effekt ist zwar klein, aber messbar. Diesen Befund gibt Gleichung (1-19) wieder.
(1-19)
σ ist die Abschirmungskonstante, eine dimensionslose Größe, die für Protonen in der Größenordnung von 10–5 liegt, für schwere Atome aber höhere Werte erreicht, weil die Abschirmung mit zunehmender Elektronenzahl größer wird. Zu beachten ist, dass σ-Werte Molekül-Konstanten sind, die nicht vom Magnetfeld abhängen. Sie werden nur durch die elektronische und magnetische Umgebung der beobachteten Kerne bestimmt.
Die Resonanzbedingung, Gleichung (1-12), geht somit über in:
(1-20)
Die Resonanzfrequenz v1 ist zur magnetischen Flussdichte B0 des stationären Magnetfeldes und – was für uns wichtiger ist – zum Abschirmungsterm (1 – σ) proportional. Aus dieser Aussage können wir folgenden wichtigen Schluss ziehen: Chemisch nicht-äquivalente Kerne sind unterschiedlich abgeschirmt und liefern im Spektrum getrennte Resonanzsignale.
Abbildung 1-19. 90 MHz 1H-NMR-Spektrum eines Gemisches von CHBr3 (3), CH2Br2 (4), CH3Br (5) und TMS (6).
Entsprechend einer allgemeinen Regelung werden in der NMR-Spektroskopie die Resonanzsignale aller Kerne so aufgetragen, dass von links nach rechts die Abschirmungskonstante σ zunimmt.
(In einem Spektrum, das nach der Feld-Sweep-Methode aufgenommen wird – konstante Frequenz v1 und variable Flussdichte B0 –, müßte bei gleicher Reihenfolge der Signale auf der Abszisse die magnetische Flussdichte nach rechts ansteigen. Es ist historisch bedingt, dass aufgrund dieser Tatsache Ausdrucksweisen benutzt werden wie: „ein Signal erscheint bei hoher Feldstärke“ oder „ein Signal liegt bei tiefster Feldstärke“.)
1.6.1.2 Referenzsubstanz und δ-Skala
Die Referenzsubstanz gibt man vor jeder Messung zu der zu untersuchenden Substanzprobe, weshalb man von einem inneren Standard spricht. In der Praxis benützt man ein Lösungsmittel, dem man vorher eine bestimmte Menge der Referenzverbindung beigegeben hat. Als solche Referenz verwendet man in der 1H- und 13C-NMR Spektroskopie meist Tetramethylsilan (TMS), da TMS vom spektroskopischen wie vom chemischen Standpunkt besonders günstig ist: Es enthält 12 äquivalente, stark abgeschirmte Protonen, man muss zum einen nur wenig beimischen, zum anderen beobachtet man nur ein scharfes, von den meisten anderen Resonanzsignalen deutlich getrenntes Signal am rechten Spektrenrand (Abb. 1-19). Außerdem ist TMS chemisch inert, magnetisch isotrop und assoziiert nicht. Zudem lässt sich TMS wegen seines niedrigen Siedepunktes (26,5 °C) leicht entfernen, wenn die untersuchte Substanz wieder zurückgewonnen werden soll.
Referenzsubstanzen für „andere“ Kerne siehe Lit. [1].
Wertet man das Spektrum in Abbildung 1-19 aus, erhält man für die Frequenzdifferenzen Δv von Bromoform, Methylenbromid und Methylbromid zu TMS als innerem Standard 614, 441 und 237 Hz. Mit den heutigen Geräten werden alle Linienlagen durch FT berechnet und die Frequenzen direkt ausgedruckt.
Aber auch Δv ist von B0 abhängig! Daher definiert man eine dimensionslose Größe δ, die chemische Verschiebung, wie folgt:
(1.21)
Da der Zähler in diesem Ausdruck normalerweise von der Größenordnung von einigen hundert Hz ist, der Nenner dagegen einige hundert MHz beträgt, ist der so definierte δ-Wert im Allgemeinen eine sehr kleine Zahl. Daher werden δ-Werte in parts per million (ppm) angegeben. Aus Gleichung (1-21) wird somit Gleichung (1-22), wobei die Dimension von Δv Hz und von vReferenz MHz ist:
(1-22)





























