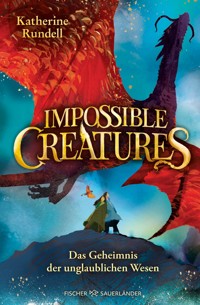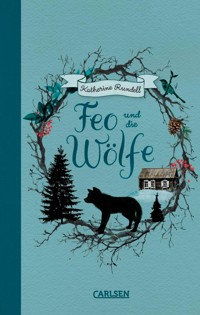7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der neue Abenteuerroman von Katherine Rundell! Spannend und mitreißend - für alle, die "Wells & Wong" lieben! Kaum ist Vita mit ihrer Mutter in New York gelandet, fordert sie auch schon den stadtbekannten Betrüger Victor Sorrotore heraus. Schließlich hat der ihren Großvater um das Familienanwesen gebracht. Vita schwört Rache und schmiedet zusammen mit einer Taschendiebin und zwei Jungen vom Zirkus einen ausgeklügelten Plan, um das Haus oder doch zumindest den Smaragd ihres Großvaters zurückzuholen. Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer beginnt. Ein Buch voll unerwarteter Wendungen, waschechter Zirkustiere und halsbrecherischer Akrobatik, dazu vier wunderbare Freunde, die gemeinsam einen echten Bösewicht bekämpfen. Das perfekteLesevergnügen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Katherine Rundell
Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer
Kaum ist Vita mit ihrer Mutter in New York gelandet, fordert sie auch schon den stadtbekannten Betrüger Victor Sorrotore heraus. Schließlich hat der ihren Großvater um das Familienanwesen gebracht. Vita schwört Rache und schmiedet zusammen mit einer Taschendiebin und zwei Jungen vom Zirkus einen ausgeklügelten Plan, um das Haus oder doch zumindest den Smaragd ihres Großvaters zurückzuholen. Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer beginnt.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für Ellen Holgate, meine Lektorin,und Claire Wilson, meine Agentin.Mit zwei solcher Frauen zu arbeiten, ist ein wahres Glück.
1
Vita reckte entschlossen das Kinn und nickte der Stadt zu, wie ein Boxer vor dem Kampf seinem Gegner zunickt.
Sie stand allein auf dem Deck des Schiffes. Das tosende Meer schleuderte die Gischt meterhoch in die Luft. Alle anderen Passagiere des Ozeandampfers, auch Vitas Mutter, waren so vernünftig gewesen, in ihren Kabinen Zuflucht zu suchen.
Aber vernünftig zu sein ist manchmal unvernünftig.
Vita hatte sich davongeschlichen und stand draußen, beide Hände fest um die Reling geschlossen, während das Schiff auf einer Welle von den Ausmaßen eines Opernhauses ritt. So kam es, dass sie als einziger Passagier den ersten Blick auf die Stadt erhaschte.
»Da ist sie!«, rief ein Decksarbeiter. »In der Ferne, an Backbord!«
Die Häuser New Yorks schälten sich aus dem Nebel, hoch und blaugrau und schön; so wunderschön, dass es Vita zum Bug zog, um die Stadt von dort weiter zu betrachten. Sie beugte sich so weit wie möglich über die Reling, als plötzlich etwas auf sie zusauste.
Sie zog erschrocken den Kopf ein. Am Himmel machte eine Möwe Jagd auf eine junge Krähe, hackte kreischend nach ihrem Rücken. Vita runzelte die Stirn. Das war kein fairer Kampf, fand sie. Sie kramte zornig in der Tasche und ihre Finger schlossen sich um eine smaragdgrüne Murmel. Sie zielte, schätzte kurz entschlossen Entfernung und Winkel ab, holte aus und warf.
Die Murmel erwischte die Möwe am Hinterkopf. Sie kreischte wie eine empörte Herzogin, und die Krähe riss sich im Flug herum und sauste zu den Wolkenkratzern von New York zurück.
Im Hafen nahmen sie ein Taxi. Vitas Mutter zählte ein paar Münzen ab und nannte dem Fahrer die Adresse. »Bitte fahren Sie uns so weit, wie es das Geld gestattet«, sagte sie, und er warf einen Blick auf ihre sorgfältig geflickten Säume und nickte.
Manhattan sauste vor den Scheiben vorbei, sturmumtoste Gebäude, zwischen denen bunte Farben aufleuchteten. Sie kamen an einem Kino vorbei, das mit Bildern Greta Garbos geschmückt war, und an einem Mann, der aus einem Karren gekochte Hummerscheren verkaufte. Eine Straßenbahn raste über eine Kreuzung und verfehlte knapp einen Lastwagen, der für Gewürzgurken der Marke Colonial warb. Vita saugte die Stadt in sich auf. Sie versuchte, sich den Verlauf der Straßen einzuprägen, im Kopf einen Stadtplan anzulegen; sie flüsterte die Namen: »Washington Street, Greenwich Avenue.«
Sobald die Summe aufgebraucht war, gingen sie zu Fuß weiter. Sie schritten auf der Seventh Avenue so schnell aus, wie es Vita im stürmischen Wind und mit Koffern in den Händen möglich war, wichen Männern im Nadelstreifenanzug und Frauen mit hochhackigen Schuhen aus.
»Da!«, sagte Vitas Mutter. »Dort wohnt Grandpa.«
Das Apartmentgebäude aus braunem Stein, das an der Ecke Seventh und West 57th stand, erhob sich hoch und stattlich über dem geschäftigen Bürgersteig. Ein Zeitungsjunge stand davor und brüllte Schlagzeilen in den Wind.
Auf der anderen Straßenseite stand ein Gebäude aus hellrotem Backstein mit reich verzierter Fassade und Bogenfenstern. Man hatte Flaggenhalter über dem Eingang angebracht, in denen zwei wild flatternde Fahnen steckten. Darüber standen die Worte Carnegie Hall, hervorgehoben durch buntes Glas.
»Sieht alles sehr … edel aus«, sagte Vita. Das Apartmentgebäude schien verächtlich auf die Welt hinabzusehen. »Bist du dir sicher, dass er hier wohnt?«
»Ganz sicher«, sagte ihre Mutter. »Er wohnt ganz oben, direkt unter dem Dach. Früher war es die Dienstmädchen-Wohnung. Es wird eng, aber wir bleiben ja nicht lange.« Sie hatten Tickets für eine Rückreise in drei Wochen gebucht. Vitas Mutter meinte, dass sei genug Zeit, um Grandpas Unterlagen zu sichten, einige Sachen zu packen und ihn zu überreden, zusammen mit ihnen heimzukehren.
»Komm!« Ihre Mutter klang unnatürlich heiter. »Wir klopfen an seine Tür.«
Der Fahrstuhl war kaputt, also rannte Vita die Treppen hinauf, so schnell ihre Beine sie trugen. Ihr Koffer knallte gegen die Wände, als sie schmale Treppen hinaufhetzte, ohne ihren linken Fuß zu beachten, der immer stärker schmerzte. Sie war außer Puste, als sie die Wohnungstür erreichte. Sie klopfte, aber ihr Grandpa reagierte nicht.
Vitas Mutter schnaufte die letzte Treppe hinauf. Sie bückte sich und zog den Türschlüssel unter der Fußmatte hervor. Dann zögerte sie, den Blick auf ihre Tochter gesenkt. »Es ist bestimmt nicht so schlimm, wie wir glauben«, sagte sie, »aber …«
»Mama! Er wartet!«
Ihre Mutter schloss die Tür auf, und Vita stürmte durch den Flur; in der Wohnzimmertür blieb sie wie angewurzelt stehen.
Grandpa war stets dünn gewesen; gut aussehend und schlank, mit langen, schmalen Fingern und spitzbübischen, blaugrauen Augen. Nun war er hager und seine Augen hatten sich tief in den Schädel zurückgezogen. Er ballte die Hände zu Fäusten, als wollte er sich mit jeder Faser seines Körpers aus der Welt zurückziehen. Neben seinem Stuhl lehnte ein Gehstock an der Wand – er hatte noch nie einen Stock gebraucht.
Er nahm sie nicht gleich wahr und sein Gesicht wirkte kurz wie ein Ebenbild tiefster Trauer.
»Grandpa!«, sagte Vita.
Da wandte er sich um und sein Gesicht leuchtete auf und sie bekam wieder Luft.
»Satansbraten!« Er stand auf und Vita warf sich in seine Arme und er lachte, obwohl ihm die Luft wegblieb.
»Julia«, sagte er, als Vitas Mutter eintrat. »Dein Telegramm kam erst vor drei Tagen, andernfalls hätte ich dir die Überfahrt ausgeredet …«
Vitas Mutter schüttelte den Kopf. »Versuch mal, uns zu stoppen, Dad.«
Grandpa drehte sich wieder zu Vita um. »Schenkst du mir noch ein Lächeln, Satansbraten?«
Also lächelte sie, anfangs ganz natürlich, und dann, als er seinen Blick nicht abwandte, immer breiter, bis sie das Gefühl hatte, jeden einzelnen Zahn zu zeigen.
»Danke, Satansbraten«, sagte er. »Du lächelst immer noch wie deine Großmutter.« Vitas Magen verkrampfte sich, als sie sah, dass ihrem Großvater Tränen in die Augen traten.
»Grandpa?«
Er hustete und lächelte und räusperte sich. »Mein Gott, wie gut, euch zu sehen. Aber das wäre nicht nötig gewesen.«
Julia schob Vita zur Tür. »Schau dir mal dein Zimmer an, Süße«, sagte sie.
»Aber …«
»Bitte«, sagte ihre Mutter. Sie sah bleich und erschöpft aus. »Sofort.«
»Es ist am Ende des Flurs«, sagte Grandpa. »Eher ein Schrank als ein Zimmer, fürchte ich«, ergänzte er, »aber mit einem herrlichen Ausblick.«
Vita ging langsam durch den Flur, den Koffer in der Hand. Sie bemerkte, dass die Dielen knarrten und die Wandfarbe abblätterte. Sie wollte die Tür aufdrücken, aber sie klemmte. Vita stützte sich an der Wand ab und trat mit ihrem gesunden Fuß gegen die Tür. Sie flog auf und es regnete Putzbröckchen.
Das Zimmer war so winzig, dass Vita dort, wo sie stand, alle vier Wände hätte berühren können, aber es gab einen Schrank und ein Fenster mit Blick auf die Straße. Vita setzte sich aufs Bett, zog den linken Schuh aus und nahm ihren Fuß in beide Hände. Sie knetete die Sohle, dehnte und bewegte die Zehen und versuchte nachzudenken.
Sie waren am Ziel. Sie hätte hellauf begeistert sein müssen. Sie hatten den Ozean überquert, waren um die halbe Welt gereist und draußen vor dem Fenster wartete New York auf sie, die Skyline strebte zum Himmel wie ein Schriftzug, hingeworfen von einem temperamentvollen Gott.
Aber nichts davon zählte, weil es Grandpa nicht so schlecht ging wie erwartet. Sondern noch viel schlechter.
Vitas Rocktaschen waren voller Kiesel aus ihrem Garten; sie suchte die größten heraus und warf sie gegen die Schranktür. Das half ihr beim Nachdenken.
Einem Zuschauer wäre vielleicht aufgefallen, dass jeder Stein den Griff des Schrankes genau in der Mitte traf – aber niemand sah zu und Vita selbst achtete nicht groß darauf. Sie vergeudete keinen Gedanken an die Kiesel.
Sie musste etwas tun, um das Unrecht wiedergutzumachen. Sie wusste noch nicht was oder wie, aber es liegt wohl in der Natur der Liebe, dass sie den Menschen keine Wahl lässt.
2
Das Unheil war aus heiterem Himmel über Grandpa hereingebrochen, aber ein Unheil kündigt sich natürlich selten an. Sein Telegramm an Vitas Mutter war kurz gewesen: DEINEMUTTERISTLETZTENACHTVERSTORBEN.
Vita hatte wie gelähmt auf der Fußmatte gehockt. Ihre kreidebleiche Mutter trug sie ins Bett, und dort tranken sie Johannisbeersaft und erzählten einander von Grandma, die mit Grandpa rund um die Welt gereist war und so tief in der Kehle gelacht hatte wie ein Seebär. Diese Geschichten trösteten beide ein bisschen, denn es kann heilsam sein, wenn man erzählt.
Damit war es aber noch nicht vorbei. Weitere Briefe folgten. Die ersten waren kurz und düster. Hudson Castle, schrieb Grandpa, wimmele von Gespenstern.
Verglichen mit anderen Burgen war Hudson Castle eher klein. Vitas Urururgroßvater hatte es von einem Hügel in Frankreich gepflückt und Stein um Stein über den Ozean nach Amerika verschiffen lassen. Damals hatte die Burg als prachtvoll, aber auch als etwas verrückt gegolten. Nun war sie baufällig und begann zu bröckeln, war aber wunderschön, und Grandpa wohnte dort mutterseelenallein.
Dann tauchte ein Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Ein Mann, schrieb Grandpa, wolle Hudson Castle mieten. Er habe vor, die Burg in eine Schule umzuwandeln. Grandpa würde als Direktor weiter dort wohnen; er hätte wieder eine Aufgabe, etwas zu tun. Noch waren keine Verträge unterzeichnet, aber der Mann wolle unbedingt mit der Renovierung beginnen. Er heiße Sorrotore und sei ein New Yorker Millionär.
Grandpa tat einen Artikel in den Umschlag. Das Zeitungsfoto zeigte einen Mann, der in New York vor einem mächtigen Gebäude stand und wie ein Hollywood-Star in die Kameras lächelte. »Victor Sorrotore vor seinem Zuhause im Dakota Building«, lautete die Bildunterschrift.
»Victor Sorrotore«, flüsterte Vita und prägte sich für alle Fälle sein Gesicht ein.
Es dauerte keine Woche, da schlug Sorrotore zu. Grandpa stellte bei der Rückkehr von einem Nachmittagsspaziergang fest, dass der Weg in sein Zuhause versperrt war. Ein fremder Mann kam mit zwei Wachhunden aus dem Hausmeister-Cottage und richtete ein Gewehr auf ihn. »Hudson Castle gehört Mr Sorrotore«, sagte der Wächter. »Verschwinde!«
Grandpa war während seines gesamten Lebens als Erwachsener nie befohlen worden, zu verschwinden. Er wollte sich am Wächter vorbeidrängeln, aber einer der Hunde biss ihn ins Bein; er schnappte nicht nur danach, sondern schlug eine blutende Wunde. Das Gewehr wurde auf die Brust von Vitas Großvater gerichtet. Er stieg daraufhin verstört in einen Zug nach New York, mietete die winzige Wohnung in der Seventh Avenue und suchte Sorrotores Anwalt auf.
Der Anwalt zeigte sein Erstaunen, wie das nur Anwälte können: Er zog die Augenbrauen so hoch, dass sie fast auf den Hinterkopf rutschten. Grandpa wisse doch, sagte der Anwalt, dass er die Burg an Sorrotore verkauft habe. Er habe das Geld schon auf dem Konto. Eine bescheidene Summe – zweihundert Dollar –, aber es sei doch wohl klar, dass Hudson Castle inzwischen eine Belastung darstelle, und deshalb sei Grandpa sicher froh, es losgeworden zu sein. Grandpa überprüfte sein Konto; man hatte das Geld tatsächlich überwiesen.
Daraufhin versuchte Grandpa, einen Anwalt zu engagieren, um Sorrotore zu zwingen, die Eigentumsurkunde vorzulegen, aber die Kosten der Anwälte überstiegen seine Möglichkeiten. »Gerechtigkeit«, schrieb er in seinem letzten Brief, »können sich offenbar nur Reiche leisten.« Er wolle nun versuchen, das Haus zu vergessen, in dem er das Licht der Welt erblickt habe. Er wolle versuchen, schrieb er, das Leben zu vergessen, das er dort mit Lizzy geführt habe: das sei wohl das Beste.
Als Vita diesen Brief las, schnürte es ihr die Kehle zu. Hudson Castle war Grandpas Zuhause. In der Burg hätte er mit all seinen Erinnerungen an Grandma Lizzy leben können. »Nein«, hauchte sie.
Dann schaute sie ihre Mutter an, deren Miene für frische Hoffnung sorgte. Ihre Mutter war zart gebaut und hatte eine feine Stimme, aber auch einen eisernen Willen. Vita hatte die braunen Augen und das trotzige Kinn von ihr geerbt.
Am nächsten Tag kehrte ihre Mutter mit zwei Tickets aus der Stadt zurück. »Wir holen ihn nach England, ob es ihm passt oder nicht. Das Schiff legt in Liverpool ab«, sagte sie. »Wir brechen gleich heute Abend auf.«
Vita bemerkte, dass Verlobungsring und Ehering von der linken Hand ihrer Mutter verschwunden waren. Sie fragte nicht weiter, sondern ging packen. Auf dem Weg zum Schlafzimmer rumsten ihre Schuhe wie die Stiefel eines Soldaten auf dem Weg in die Schlacht.
Grandpa hatte Vita das Werfen beigebracht.
Vitas Großvater hieß Jack Welles. Genau genommen – denn er stammte aus einer jener Familien, die lange Namen, lange Autos und lange Abendessen schätzen – lautete sein Name William Jonathan Theodore Maximilian Welles. Das Familienvermögen war längst den Bach hinuntergegangen, aber der Hang zu extravaganten Namen hatte sich erhalten. Sein Vater war Amerikaner, seine Mutter und seine Bildung waren britisch. Jack war von Haus aus Juwelier. Er war groß genug, um eine Bedrohung für Türrahmen darzustellen, und schmal genug, um seine Beine durch einen Briefkastenschlitz schieben zu können.
Als Vita fünf war, geschah zweierlei: Ihr Vater starb als Soldat im Weltkrieg und sie infizierte sich mit Kinderlähmung. Ihre Mutter kämpfte mit ungestümer, nimmermüder Leidenschaft gegen die Krankheit an. Vita lag lange, dunkle Monate in einem Krankenhausbett, das sie nur verließ, um in oxidiertem Wasser mit Mandelmehl zu baden. Man flößte ihr sogar Goldchlorid und Pepsinwein ein. Nach einer Weile sah sie viel älter aus, als sie war.
Eines Tages reisten ihre Großeltern aus Amerika an. Grandpa saß neben ihrem Bett, gab ihr einen Tischtennisball und meinte, sie solle ihn rufen, sobald es ihr gelänge, den Chefchirurgen zu treffen. Dann malte er mit der sicheren Hand eines Juweliers einen klitzekleinen Kreis auf die weit entfernte Wand.
Sie warf daneben und wieder daneben, bis sie schließlich nicht mehr danebenwarf.
Grandpa trainierte sie wie eine Athletin. Auch er konnte meisterhaft werfen und Vita warf stundenlang. Sie warf mit Kieselsteinen, Murmeln, Dartpfeilen, Papierfliegern. Als sie das Krankenhaus verließ, war sie sieben Jahren alt und konnte ein Steakmesser so werfen, dass es in eleganten Schwüngen durch die Luft flog und am anderen Ende des Zimmers mit der Klinge voran punktgenau in einem Butterfässchen landete.
Vita wuchs und ihre Knochen wurden kräftiger und schließlich wurde die Beinschiene abgenommen. Ihre linke Wade war dünner als die rechte, ihr linker Fuß bog sich nach innen und ein Schuster fertigte ihre Schuhe gratis aus dem weichsten Leder, das er auftreiben konnte. Ihre Mutter verzierte den Spann mit Nähten aus roter Seide und stickte Vögel darauf. Vita konnte rennen, obwohl sich ihre Muskeln verkrampften und wehtaten, und obgleich sie gern jammerte, wenn sie sich schnitt, verlor sie kein Wort über diese Schmerzen.
Sie blieb relativ klein und war still und wachsam. Sie hatte sechs Lächeln und fünf davon waren aufrichtig. Alle waren es wert, gesehen zu werden. Ihre Haare waren rotbraun wie ein frisch gewaschener Fuchs.
Julia, ihre Mutter, sprach ihre ständigen Zielübungen nur ein einziges Mal an.
»Sie wird es nicht einfach haben«, meinte Grandpa. »Und sie wirkt so zerbrechlich. Da ist es nicht verkehrt, wenn sie weiß, wie man mit Steinen wirft.«
Als Vita acht war, konnte sie einen Apfel hoch oben im Baum aus fünfzig Schritten Entfernung treffen. Sie konnte einen Stein dreiundzwanzig Mal hintereinander über das Wasser springen lassen. »Zu Hause in New York ist dein Grandpa der beste Werfer«, sagte Grandma Lizzy. Sie war eine große Frau mit Adlernase und gütigen Augen. »Aber ich glaube, du bist noch besser.«
Grandpa sah zu, wie Vita einen Stein schwungvoll aufs Meer warf. »Nun musst du lernen, was es mit der Geschwindigkeit auf sich hat – wie der Luftwiderstand den Kurs eines Wurfgeschosses ändert. Das musst du nachlesen! Und dir einprägen! Du musst möglichst viel lernen, denn Lernen heißt leben! Herrlich!« Grandpa war der einzige Mensch, fand Vita, der beim Reden Funken sprühte wie ein Feuerstein, den man gegen Stahl schlug.
Schließlich fuhren Grandpa und Grandma wieder nach Amerika, zurück zum Hudson Castle. Bald darauf wurde alles anders und führte Vita in dieses klitzekleine Dachbodenzimmer, durch das sie nun beobachtete, wie über New York die Sonne unterging.
3
In jener ersten Nacht standen weder Mond noch Sterne am Himmel, aber in New York ist es niemals dunkel. Als Vita nach Mitternacht aufstand, war die Stadt noch wach. Sie ging zum Fenster; das Apartmentgebäude war hoch, höher als die umliegenden Häuser, und sie konnte die Straßen sehen, die zum tiefdunklen Central Park führten. Straßenlaternen, Lichter in den Häusern, die zwielichtigen Kellerfenster verbotener Flüsterkneipen, Autoschweinwerfer, Zigarrenglut; Manhattan bebte und glühte.
Vita hatte das Gefühl, dass sich Schlafen verbot. Im Gebäude nebenan war ein Restaurant, aus dem der Klang zweier Geigen und schiefer, männlicher Gesang drangen.
Der rote Backstein der gegenüberliegenden Carnegie Hall schimmerte bronzefarben im Schein der Straßenlaternen, die Fassade strahlte eine stille Würde aus. Dann blinzelte Vita und sah genauer hin.
Die Fassade war weder still noch würdevoll, denn ein Junge schickte sich an, im dritten Stock aus einem Fenster zu springen.
Er kletterte auf die Fensterbank. Er war schmal gebaut, hatte dunkle Haut und abstehende Ohren und er sah nicht nach unten, sondern hatte den Blick auf die Stadt gerichtet.
Ein zweiter, kleinerer Junge flitzte um die Ecke des Gebäudes. Er lachte und zog mit beiden Händen eine Matratze über den Bürgersteig. Er ließ die Matratze fallen und rief: »Listo! Alles bereit! Hops!«
Der Junge auf der Fensterbank hob die Arme über den Kopf, und bevor Vita ihm zurufen konnte, er solle das lassen, stieß er sich ab und sprang. Vita stockte der Atem. Er presste die Knie fest gegen seine Brust, drehte sich im Fallen zwei Mal um sich selbst, machte sich kurz vor dem Aufprall kerzengerade und landete mit den Füßen auf der Matratze. Er tat einen Schritt, kippte auf die Knie und sprang wieder auf. Der kleinere Junge schrie triumphierend und der größere lächelte verhalten.
Dann hob er den Blick und sah Vita, die sich gefährlich weit aus dem Fenster lehnte, dessen Kante in ihren Bauch schnitt. Alle starrten einander mit großen Augen an. Dann lächelte der größere Junge wieder rätselhaft und der kleinere Junge lachte und winkte. Als Vita den beiden etwas zurufen wollte, bogen sie schon um die Ecke, der Kleinere mit der Matratze im Schlepptau.
Vita schaute auf den Bürgersteig, entdeckte aber niemanden, der hätte bezeugen können, dass soeben ein Junge durch die Luft geflogen war.
»Vergiss sie nicht«, flüsterte sie. »Nur für den Fall. Nur für den Fall.« Als hätte sie das je vergessen können.
Am ersten Morgen in New York erwachte Vita zu Musik, die draußen vor ihrem Fenster erklang. Sie spuckte auf einen Finger, um sich den Schlaf aus den Augen zu wischen, und schaute nach draußen. Auf dem Bürgersteig stand ein Mann, der den Hut tief in die Stirn gezogen hatte, und drehte die Kurbel seines Leierkastens.
Der Tag war sonnig und strahlend blau, aber so kalt, dass sie beim Waschen ihre Atemwolken sah. Sie zog eine warme Strickjacke und einen knallroten Rock mit viel Beinfreiheit an. Sie schloss sorgsam ihre roten Seidenstiefel und kämmte sich mit den Fingern.
Grandpa saß im Wohnzimmer in einem Sessel und betrachtete den Himmel. Als sie hereinkam, drehte er sich nach ihr um, und sie merkte, wie viel Mühe es ihn kostete, wie gewohnt zu lächeln.
»Satansbraten! Guten Morgen. Deine Mutter ist schon los, um mit meinem Bankberater zu sprechen und auszuloten, was man tun kann. Sie hat ganz besonders kämpferisch dreingeschaut.«
Vita nickte. Wenn ihre Mutter ein Ziel hatte, steuerte sie es mit der Beharrlichkeit eines Kriegsschiffes an, das keinen Millimeter vom Kurs abwich.
»Sie sagt, sie sei viel unterwegs, denn sie müsse meinen Pass erneuern und alles, was ich auf dem Konto habe, nach Großbritannien überweisen – also bin ich für dich und das, was du treibst, verantwortlich. Ich musste ihr schwören, dass wir vernünftig sind.« Er zog eine Augenbraue hoch. »Weißt du schon, was du heute machen willst?«
Vita sagte: »Ich mache jetzt Würstchen mit Ketchup.« Sie hatte Ketchup auf dem Schiff entdeckt und seither täglich gegessen, es war eine Offenbarung. »Willst du auch was?«
Er schüttelte den Kopf. »Sehr nett, aber ich verzichte.«
»Vielleicht Kaffee?« Vita wusste, dass man in Amerika Kaffee trank. Sie fand, dass er wie wütender Matsch schmeckte, aber sie wusste, dass andere ihn gern tranken. »Ich weiß zwar nicht, wie man ihn zubereitet, aber ich kann es probieren.«
»Nein, besten Dank.«
»Kann ich nichts für dich tun?«
»Du bist bei mir und das genügt.«
Sie wusste aber, dass es nicht genügte, denn als sie in die Küche gehen wollte, bemerkte sie, dass er wieder mit leerem Blick im Sessel zurücksank.
Sie fand Würstchen und tat sie in den Ofen und wollte gerade ein Messer in die Ketchup-Flasche tauchen, als Grandpa rief.
»Satansbraten? Bist du noch da?«
Vita sauste zu ihm, so schnell sie ihre Beine trugen. »Ja!«
»Setz dich zu mir, während die Würstchen brutzeln. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.« Grandpa schaute an ihr vorbei, er schaute an den Dächern vorbei, sein Blick schien über die Stadt hinauszugehen und sein Blick war wütend.
»Was denn?« Als er nicht reagierte, setzte sie sich auf den Fußboden und legte ihm eine Hand auf den Fußknöchel. Sie hatte herausgefunden, dass es tröstlich war, wenn einem jemand die Hand auf den Fußknöchel legte, vorausgesetzt, es war der richtige Jemand.
»Du musst jetzt gut zuhören«, sagte er. »Du warst immer eine extrem gute Zuhörerin, Satansbraten. Zu deiner eigenen Sicherheit muss ich dich über Sorrotore aufklären. Und du musst wissen, was er mir geraubt hat.«
»Deine Grandma hat die alte Burg zum Leben erweckt«, sagte Grandpa. »Sie ließ Pflanzen an Stellen wachsen, wo eigentlich nichts gedieh. In den Mäulern der Wasserspeier wuchsen Erdbeeren und auf den Fenstergittern rankten Rosen, die bis in die Fenster reichten. Die Kloschüssel war so von Efeu überwuchert, dass man sie kaum noch benutzen konnte.« Er kniff die Augen zusammen, als könnte er alles sehen, und der Anblick schien ihn zu schmerzen.
»Mein Urgroßvater würde sich für mich schämen«, sagte Grandpa. »Er glaubte bei seinem Tod, er würde uns im Luxus zurücklassen – Kutschen, Pferde, Juwelen. Lauter Diamanten, Rubine, Saphire. Fast alle gingen verloren. Mein Großvater verspielte das meiste. Aber was ich getan habe, ist noch viel schlimmer. Ich habe unser Zuhause verloren. Mein Gott – was würde Lizzy sagen, wenn sie das wüsste?«
»Sie würde sagen, dass es nicht deine Schuld ist«, erwiderte Vita entschieden. »Das weiß ich.«
»Die Welt stand uns offen, als wir jung waren. Das letzte Schmuckstück war eine Kette – mit einem Smaragd-Anhänger, groß wie ein Löwenauge. Wir ließen ihn schätzen, als wir Geld brauchten, um das Dach zu erneuern. Er war Tausende wert. Oh, Satansbraten – hättest du uns nur gesehen! Sie legte die Kette mit dem Smaragd an und dann gingen wir tanzen.«
Vita versuchte, keine Miene zu verziehen, nicht aufgeregt dreinzuschauen. »Tausende Dollar?«
»Sie war so schön. Ich habe ein Foto gemacht, als sie die Kette trug – meine Liz! Sie liebte den Smaragd …« Er verstummte und hustete erstickt. »Nach ihrem Tod wusste ich nicht, was tun – also habe ich ihn versteckt. Ich habe den Anblick nicht mehr ertragen. Und er liegt immer noch im Versteck. Oh, Vita.« Er holte tief und rüttelnd Luft und versuchte, gelassener zu schauen.
Eine Kette mit Smaragd. Dieser Gedanke durchzuckte Vita wie ein Stromstoß. Sie konnte die Burg nicht zurückerobern; aber ein Smaragd war etwas anderes. Ein Smaragd, so groß wie das Auge eines Löwen und Tausende Dollar wert – der konnte alles ändern.
Ich kann ihn finden. Ich kann ihn zurückholen.
Und ich könnte ihn verkaufen. Ich könnte mit dem Erlös einen Anwalt bezahlen und diesen Sorrotore zwingen, Grandpa sein Zuhause zurückzugeben.
»Nein, unmöglich«, sagte sie zu sich selbst. Aber, flüsterte ein leises Stimmchen in ihrem Inneren, unmöglich heißt ja nicht, dass es keinen Versuch wert wäre.
Vita legte einen Apfel auf ihre Kommode. Sie setzte sich auf das Bett, das Taschenmesser in der Hand, und konzentrierte sich auf die Spitze des Apfelstiels.
Farben flackerten hinter ihren Augen und sie schob die Alltagsgedanken beiseite, den üblichen Kleinkram, und suchte nach dem stillen Ort in ihrem Geist. Grandpa hatte immer gesagt: »Wenn du dein Denken dorthin lenkst, wo eine Idee dich finden kann, dann wirst du zu guter Letzt auch eine Idee haben.«
Er hatte noch hinzugefügt: »Die Idee muss natürlich nicht unbedingt praktikabel oder erlaubt sein.«
Der Plan, der in ihren Gedanken Gestalt annahm, war tatsächlich weder praktikabel noch erlaubt.
Sie saß lange da, starrte geradeaus und atmete kaum. So still hatte sie noch nie dagesessen. Sie spürte den pochenden Schmerz im Fuß nicht mehr. Ihre Gedanken umrundeten Ecken und entwischten aus Sackgassen.
Der Plan nahm in ihrem Kopf in Großbuchstaben und kursiver Schrift Gestalt an. Er verfestigte sich.
Vita blinzelte und schüttelte sich. Sie klappte die Klinge ihres Taschenmessers aus und warf es durch das Zimmer; der Griff hatte eine Unwucht und drehte sich, aber die Klinge bohrte sich trotzdem mit einem dumpfen Geräusch direkt in das Herz des Apfels. Er flog auf den Fußboden.
Vita lächelte eines ihrer sechs Lächeln. Dann schüttelte sie ein rotes Notizbuch aus ihrem Gepäck und schrieb zwei Wörter hinein:
DERPLAN.
Dann drehte sie das Notizbuch um, weil sie hinten auf einer freien Seite beginnen wollte, und fing an zu schreiben:
Am Tag, als Grandpa und Grandma wieder nach Amerika aufbrachen, bekam ich mein Taschenmesser.
Ich wollte nicht sehen, wie sie abfuhren, also ging ich allein in den Wald. Ich versuchte, die Wucherung an einem Baumstamm mit Steinen zu treffen, warf aber jedes Mal daneben; mein Blick war getrübt.
Eine Stimme hinter mir sagte: »Konzentrieren.«
Und ich sagte: »Das tue ich doch!«
Er sagte: »Du bist traurig, Satansbraten, und wütend. Ich weiß. Aber wenn es dir gelänge, Trauer und Wut in etwas anderes zu verwandeln – in Arbeit, in Güte –, dann wärst du ein ganz besonderer Mensch. Lass Wut und Trauer in dein Handgelenk fließen und wirf.«
»Wie denn?«, fragte ich. »Wie soll das gehen?«
Er sagte: »Man braucht sehr lange, um das zu lernen. Versuch es noch mal. Stell dir vor, die Trauer aus deiner Brust ins Handgelenk umzuleiten. Wirf.«
Ich versuchte es. Ich verlagerte mein Herz in die Hand und warf den Stein und traf die Wucherung des Stamms. Ich drehte mich um und da saß er lächelnd auf einem Baumstumpf. Und er sagte: »Schließ deine Augen.«
Und er drückte mir ein Taschenmesser in die Hand.
Er sagte: »Das hatte ich, als ich in deinem Alter war. Es ist ein Messer der Schweizer Armee. Es soll dich daran erinnern, dass du selbst eine Armee bist.«
Ich klappte die Klinge aus. Sie war lang und gut geölt. Außerdem gab es eine Schere und am oberen Ende eine Pinzette, die man herausziehen konnte.
»Verwende es als Werkzeug, nicht als Waffe«, sagte er. »Die Waffe, die du in deinem Leben führst, wird kein Messer sein – sondern etwas viel Mächtigeres und Originelleres. Die Pinzette dagegen ist praktisch. Eine gute Pinzette ist nicht zu verachten.«
Er küsste mich oben auf den Kopf und ging wortlos davon.
So war mein Grandpa vor Grandmas Tod. Vor Sorrotore.
Vita zog einen Strich unter das, was sie geschrieben hatte, und schob das Buch unter ihr Kopfkissen.
Die Würstchen fielen ihr erst viel später ein, und obwohl sie fast zu Holzkohle verbrannt waren, futterte sie alle mit viel Ketchup und aß danach einen Apfel. Pläne haben die Eigenart, den Appetit anzuregen, und so war es auch hier.
4
Später am Tag schlich Vita aus der Wohnung, in der Grandpa schlief, und wollte ein Taxi nehmen. Sie tat das zum ersten Mal allein. Ihr Herz hämmerte und sie vergrub die geballten Fäuste in den Manteltaschen.
Ihr erster Versuch schlug fehl; sie stand vor der Carnegie Hall an der Bordsteinkante und reckte den Daumen, aber als der Taxifahrer das Tempo drosselte und sah, dass sie nicht in Begleitung eines Erwachsenen war, schwenkte er ab und fuhr weiter. Bei ihrem zweiten Versuch riss sie die Tür auf und warf sich auf den Rücksitz, bevor der Fahrer ohne sie abzischen konnte.
Sie presste ihr Gesicht gegen die Scheibe. Früher Abend, und die Straßen waren voll. Das Auto sauste durch die 59th Street und dann durch die Central Park West, wo über einem Kinoeingang ein Filmtitel erstrahlte: Wild Bill Hickock.
Vita spürte, wie die Energie und die Lebendigkeit New Yorks auf sie übersprangen. Sie griff in ihre Tasche. Darin befand sich ein Stadtplan, den sie von ihrem Großvater geliehen hatte, und darunter lag ihr Taschenmesser.
Das Taxi hielt unvermittelt am Bürgersteig. »Da sind wir, Kleine«, sagte der Fahrer. »Das Dakota Building!«
Er nannte den Preis für die Fahrt, der schwindelerregend hoch klang. Vita wusste, dass die Amerikaner immer Trinkgeld gaben, nur wusste sie nicht, in welcher Höhe, also gab sie dem Mann ihr ganzes Geld und rannte danach auf dem Bürgersteig davon, denn das hielt sie für das Klügste.
Sie stand da und sah zu dem Gebäude auf. Es war riesig; eine regelrechte Festung mit Türmchen und Zinnen an jeder Ecke und hell erleuchteten Fenstern.
Während sie dort stand, rauschten ein grauhaariger Mann und eine große Frau an ihr vorbei. Der Wind wurde plötzlich böig und die Frau lachte und griff mit einer Hand in ihr Haar, das sie mit einer diamantenbesetzten Schwanenfeder hochgesteckt hatte.
»Sei bitte kein Langweiler, Liebling, und rede nicht endlos über Politik«, sagte die Frau mit einem starken New Yorker Akzent. »Victors Partys sind immer so fabelhaft angesagt.«
Vitas Herz pochte vor Freude schneller. Sie erlaubte sich kein Zaudern und folgte dem Paar so dicht, wie sie wagte. Die beiden durchschritten eine Tür, nickten einem Portier zu (Vita nickte auch und versuchte, portiersgerecht zu lächeln) und traten in einen Fahrstuhl. Vita folgte ihnen hinein, wobei sie versuchte, so unbekümmert und arrogant zu wirken, als wäre ein Fahrstuhl mit Eichenvertäfelung ihr zweites Zuhause. Die Frau senkte den Blick, sah ihren linken Fuß und wandte sich sofort wieder ab.
Der Fahrstuhl öffnete sich auf einen Flur. Am einen Ende war eine Doppeltür aus Eiche, zu der sechs Marmorstufen hinaufführten. Das Paar klopfte, es ertönten schrille Schreie des Entzückens, Musik schallte in den Flur, dann traten sie ein. Hinter der Tür erklangen die Fetzen Dutzender Gespräche. Sorrotore feierte tatsächlich eine große Party.
Nichts wie weg, befahl jeder Instinkt Vitas. Ich kann bei anderer Gelegenheit wiederkommen, dachte sie. Ihr Magen plädierte begeistert für diese Idee.
Aber ihre Füße sträubten sich. In diesem Moment waren die Füße mutiger als alles andere an Vita. Sie trugen sie die fünf verbleibenden Stufen hinauf und ihre noch mutigere Faust pochte drei Mal laut gegen die Tür.
Diese wurde sofort geöffnet und auf der Schwelle stand ein professionell lächelnder Lakai mit weißen Handschuhen und wulstiger Stirn. Seine schwarzen Stiefel waren so blank poliert, dass sich seine Nasenlöcher darin spiegelten.
Bei Vitas Anblick kam sein professionelles Lächeln ins Wanken. Sie nahm ihn mit einem verstörend zornigen Blick ins Visier. Sie konnte spüren, dass ihre Wangen rot vor Kälte waren, und ihr Unterkiefer bebte, weil sie die Zähne so fest zusammenbiss.
»Ja? Womit kann ich dienen?«
Vita drückte ihren Rücken durch, um größer zu wirken. »Ich möchte Mr Sorrotore sprechen.« Sie versuchte, den Namen so auszusprechen wie ihr Großvater: »Sorro-tori-ä.«
»Er gibt heute eine Soirée – wie du siehst.« Links hinter ihm öffnete sich eine Doppeltür zu einem riesigen Raum, aus dem eine Kakofonie von Stimmen und Gelächter in den Flur drang. »Komm morgen wieder.«
»Könnten Sie ihn trotzdem fragen, ob ich ihn sprechen darf?«
»Er könnte sich ärgern, und das Risiko gehe ich nicht ein.«
Vita fragte sich, ob sie etwas von dem Geld hätte behalten sollen. Ob der Lakai ein Bestechungsgeld erwartete?
»Er könnte genauso ärgerlich sein, wenn er erfährt, dass sie mich davongejagt haben. Richten Sie ihm aus … dass Jack Welles mein Großvater ist.«
Der Lakai sah sie eindringlich an. Er zog einen Handschuh aus und kratzte sich am Auge, die Spitze seines kleinen Fingers streifte den Augapfel. Dann seufzte er. »Wenn er ärgerlich ist, wirst du das ausbaden.« Er ging in den hell erleuchteten Raum. Als er den Handschuh wieder anzog, sah Vita, dass er die Tätowierung einer fauchenden Katze zwischen Daumen und Zeigefinger hatte.
Vita wartete. Dann stieß sie die Tür zum Salon auf und folgte den Düften von Parfüm, Schweiß und Zigarettenrauch.
Es glich einem Blick in ein Kaleidoskop. Paare mit Kleidern in leuchtenden Farben tanzten in der Mitte des Raums oder hatten sich am Rand zusammengeschart. Die Frauen trugen Diamanten, groß genug, um einen Mann damit zu erschlagen, tranken viel und lachten laut. Sie hatten ihre Wangen mit Rouge gepudert und alle waren Schönheiten.
Es war so heiß, dass die Fensterscheiben beschlagen waren. Vita schlang die Arme trotz der Hitze um ihren Körper und zitterte, denn das Gelächter war so schrill, als wollte man etwas verbergen, zum Beispiel Angst oder Panik. Die Atmosphäre war fiebrig, angespannt. Die Frauen schienen nicht aus Fleisch und Blut zu bestehen, sondern nur Zierde zu sein. Vita wusste, dass die Prohibitionsgesetze keinen Alkohol erlaubten, und trotzdem saß eine Frau da und starrte die Wand an, zu betrunken, um noch aufstehen zu können.
Einige Gäste bemerkten Vita und sie nahm wahr, dass die Blicke stets auf ihren Fuß fielen. Danach schaute man mitleidig drein. Vita kannte das. Sie bemühte sich, möglichst nicht zu blinzeln, spürte aber, dass Hals und Ohren knallrot anliefen.
Sie wollte gerade in den Flur zurückweichen, als eine der Bedienungen – ein großes Mädchen, nicht viel älter als sie, mit einem schmuddeligen, weißblonden Zopf und einem spitzen, mürrischen Gesicht – »Entschuldigung, bitte« sagte und sich mit einem Champagnertablett an ihr vorbeizwängte. Vita wich aus und drückte sich gegen die Wand.
Da sah sie, wie ein massiger, weißhaariger Mann nach dem letzten Champagnerglas griff. Er kam ihr irgendwie bekannt vor. Die Bedienung knickste und wollte mit dem leeren Tablett in der Menge untertauchen, stolperte aber über ihre eigenen Füße und streifte den Mann. Ihre Finger flatterten einen Augenblick vor seinem linken Handgelenk und anstelle seiner Armbanduhr gab es nur noch blanke Haut.