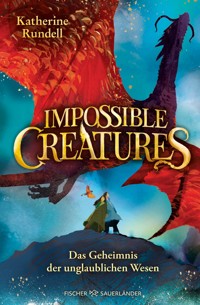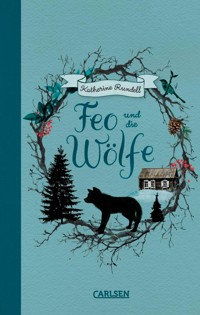12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Unsere Welt ist einzigartig und verblüffend. Es gibt Haie, die schon zu Shakespeares Zeiten gelebt haben, Giraffen, die durch Paris flanierten, verliebte Spinnen und Einsiedlerkrebse, die ihre Häuser renovieren. Mit einem bemerkenswerten Gespür für fesselnde Geschichten und kuriose Anekdoten eröffnet uns die preisgekrönte Autorin Katherine Rundell in diesen 22 eindrücklich recherchierten Porträts bedrohter Tierarten einen neuen Blick auf die hinreißend seltsame Schönheit unserer Erde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katherine Rundell
Warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt
und andere Kuriositäten aus dem Tierreich
Aus dem Englischen von Tobias Rothenbücher
Mit farbigen Illustrationen von Talya Baldwin
Diogenes
Für meinen Onkel Chris, der mir eine Menge über die Welt der Lebewesen beigebracht hat.
Der Welt wird es nie an Erstaunlichem mangeln, sondern nur am Staunen.
G.K. Chesterton
Einleitung
Ein Mauersegler fliegt im Laufe seines Lebens etwa zwei Millionen Kilometer; das entspricht der Strecke zum Mond, zweimal hin und zurück, und dann noch einmal zum Mond. Mindestens zehn Monate des Jahres fliegt er ohne Pause. Von Wolken umspült und im Flug schlafend muss er überhaupt nicht landen.
Der nordamerikanische Waldfrosch übersteht den Winter, indem er sich vollständig gefrieren lässt. Sein Herz schlägt langsamer, dann steht es still: Das Wasser, das seine Organe umgibt, wird zu Eis. Mit Beginn des Frühlings taut er wieder auf, und das Herz setzt sich von selbst wieder in Gang. Wir verstehen noch immer nicht, woher es weiß, dass es erneut schlagen soll.
Im Meer pfeifen Delfine für ihre Jungen im Mutterleib; schon Monate vor der Geburt und zwei Wochen danach singt das Weibchen immer wieder dasselbe Erkennungszeichen. In dieser Zeit sind die anderen Delfine leiser als gewöhnlich, um das ungeborene Kalb nicht zu verwirren, damit es den Ruf der Mutter erkennen lernt.
Solche Dinge – ewiger Flug, sich selbst reanimierende Herzen, ungeborene Babys, die einen Namen lernen – klingen wie Märchen, die wir Kindern erzählen. Tatsächlich aber ist die Realität so verblüffend, dass unsere Fähigkeit zu staunen, so groß sie auch sein mag, gerade eben den Rand der Wahrheit streift.
In diesem Buch geht es um Momente, in denen Lebewesen unseren Weg kreuzten, Momente der Freude, aber auch der Erschütterung, Augenblicke des Glücks, der Erhabenheit und der Dummheit. Es sind Begegnungen, die uns den Spiegel vorhalten und in denen wir uns verzückt und aus der Fassung gebracht sehen – von unserer seltsamsten Seite. So zahlreich sind die Berichte solcher Zusammentreffen, dass sie viele Tausend Bücher füllen könnten: etwa die Geschichte vom heiligen Cuthbert, einem auf der Insel Lindisfarne lebenden Mönch aus dem 7. Jahrhundert, von dem es heißt, er habe Seeotter zur Hilfe gerufen, die seine Füße mit ihrem Atem wärmten und ihn mit ihrem Fell trockneten, als er nass aus dem Meer kam. Von der schönen jungen Frau, die zu Alexandre Dumas sagte, sie teile gern mit ihm das Bett, aber nur, wenn er ihr zuerst eine Manguste und einen Ameisenbären schenke. Von dem blinden Bauern aus Suriname, der ein junges Wasserschwein rettete und es zu seinem sehenden Helfer machte. Es stand im Guinnessbuch der Rekorde: Geführt von einer Art Riesenmeerschwein trat ein Mann mutig hinaus ins Dunkel der Welt und wurde nach Hause gebracht.
Es ist nicht überliefert, ob Dumas seinen Teil der Abmachung erfüllen konnte – aber es ist unwahrscheinlich. Die Manguste hätte man im Paris des 19. Jahrhunderts noch recht einfach auftreiben können, beim Ameisenbären jedoch standen die Chancen sehr viel schlechter. Gar nicht schwer zu begreifen ist allerdings, warum die junge Frau die elegante Ratten-Katze und das wurmzüngige Säugetier überhaupt haben wollte: Seit jeher verspüren wir ein großes Verlangen nach den anderen Lebewesen, mit denen wir die Welt teilen.
Dieses Buch ist außerdem eine lange Liste all der Mutmaßungen und Missverständnisse – der schillernden Irrtümer, auf denen unser akribisch gesammeltes Wissen fußt. Ein Beispiel: Weil wir Biber einst in der Annahme gejagt haben, ihre Hoden seien ein Aphrodisiakum, ein köstliches noch dazu, glaubten wir jahrhundertelang, das Tier beiße sich auf der Flucht die eigenen Genitalien ab, um seinen Verfolgern zuvorzukommen. »[Er] wirft sie ihnen so hin«, behauptet ein um das Jahr 200 n. Chr. entstandener Text aus dem alten Rom, »wie ein kluger Mann, der unter Räuber gefallen ist, das, was er bei sich führt, zu seiner Rettung niederlegt und dies als ein Lösegeld hingibt.« Daher fanden sich überall in den mittelalterlichen Bestiarien Bilder von grimmigen Bibern, die sich mit ihren Schneidezähnen selbst kastrierten. Auf ähnliche Weise führte die mittelalterliche Überzeugung, Strauße könnten Eisen verdauen, dazu, dass in arabischen und europäischen Handschriften immer wieder Zeichnungen dieses Vogels auftauchten, in denen er ein Hufeisen oder ein Schwert in seinem hungrigen Schnabel hält. Die Theorie wurde von dem großen Naturforscher al-Dschāhiz überprüft, der im 9. Jahrhundert im heutigen Irak lebte. Er berichtet, der Strauß verspeise bereitwillig glühende Metallstücke, habe sich beim Verschlingen einer Schere aber von innen aufgeschlitzt. Auch glaubten wir einst, Strauße wären in der Lage, ihre Eier allein dadurch auszubrüten, dass sie sie unbeirrbar und intensiv anstarren.
Diese alten Irrtümer sind so fantastisch wie fantasievoll und verraten viel über die Hoffnungen und Sorgen der Menschen: über unsere Ängste, unsere Sehnsucht nach einer gesünderen Verdauung und sexueller Leistungsfähigkeit, unsere Suche nach Zaubermitteln gegen unsere allzu menschlichen Probleme. Und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass wir heute nicht genauso viel falsch verstehen wie jede Generation bisher. Diese Erkenntnis sollten wir verinnerlichen, von ganzem Herzen. Unser Wissen, so immens es auch sein mag, erfasst nur einen unendlich kleinen Bruchteil des Lebens auf der Erde. Noch immer gibt es so viel zu erfahren über den Boden unter unseren Füßen und über das, was daraus entsteht. Doch unser Verlangen, den wilden Wesen der Welt nahezukommen, hat ihnen häufig wenig Gutes gebracht. Jedes Tier in diesem Buch gilt als gefährdet, oder es hat Verwandte, die gefährdet sind – weil es heute fast kein Geschöpf mehr gibt, für das dies nicht gilt. Vor allem der globale Westen hat zur Zerstörung der weltweiten Ökosysteme beigetragen; doch die Auswirkungen werden für die ganze Erde spürbar sein. Die Zeit wird knapp.
Dieses Buch übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors mit Zylinder, Peitsche und angemaltem Schnurrbart. Er selbst ist nicht sonderlich bemerkenswert, aber seine Aufgabe besteht darin, uns das Bemerkenswerte zu zeigen und zu sagen: Liebe Freunde, schaut, was es hier zu sehen gibt – schaut hin! Findet ihr nicht auch, es verdient Staunen und Liebe? Denn Liebe, mit Aufmerksamkeit verbunden, wird in den kommenden Jahren dringend gebraucht.
Der Wombat
»Der Wombat«, schrieb Dante Gabriel Rossetti 1869, »ist ein Glück, ein Triumph, eine Freude, eine Verrücktheit!« Zu seinem Haus am Cheyne Walk Nummer 16 in Chelsea gehörte ein großer Garten, in dem der Maler, kurz nachdem er Witwer geworden war, wilde Tiere zu halten begann. Unter anderem erwarb er Wallabys, Kängurus, einen Waschbären und ein Zebu. Er spielte mit dem Gedanken, sich einen Afrikanischen Elefanten anzuschaffen, kam aber zu dem Schluss, der Preis von 400 Pfund sei unverhältnismäßig hoch. Er kaufte einen Tukan, dem er, wie man munkelte, beibrachte, auf einem Lama zu reiten. Doch was er über alles liebte, waren Wombats.
Er besaß zwei, einen namens Top, benannt nach William Morris, der aufgrund seines dichten Lockenkopfs den Spitznamen »Topsy« trug. Im September 1869 schrieb Rossetti in einem Brief, der Wombat habe es geschafft, John Ruskin bei einem scheinbar ununterbrechbaren Monolog zu unterbrechen, indem er seine Nase zwischen Weste und Jackett des Kunstkritikers geschoben habe. Rossetti zeichnete die Wombats mehrfach: Eine Skizze zeigt seine Geliebte – William Morris’ Ehefrau Jane –, wie sie einen an der Leine führt. Sowohl Jane als auch der Wombat wirken ungehalten. Beide tragen einen Heiligenschein.
Rossettis Zuneigung ist nicht schwer zu verstehen. Wombats haben eine trügerische Erscheinung; sie sind schneller, als sie aussehen, mutiger, als sie aussehen, und zäher, als sie aussehen. Sie haben ein niedliches Gesicht und eine rundliche Form. Die erste überlieferte Beschreibung eines Wombats stammt von dem Siedler John Price, der 1798 New South Wales besuchte. Price schrieb, es handele sich um »ein Tier von etwa zwanzig Zoll Höhe mit kurzen Beinen und einem dicken Körper mit einem breiten Kopf, runden Ohren und sehr kleinen Augen; es ist sehr feist und ähnelt in seiner Gestalt einem Dachs.« Seine Worte legen nahe, dass Price mit Dachsen wohl nur mäßig vertraut war. Tatsächlich sehen Wombats aus wie ein Zwischending aus einem Wasserschwein, einem Koala und einem Bärenjungen. Und wenngleich das Fell der meisten unauffällig braun ist, tragen manche Südlichen Haarnasenwombats eine genetische Mutation in sich, die ihnen eine goldene Farbe verleiht; das satte Blond von Marilyn Monroe.
Obwohl sie nicht gerade stromlinienförmig wirken, können rennende Wombats bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen und dieses Tempo 90 Sekunden lang halten. Die schnellste dokumentierte Geschwindigkeit eines menschlichen Läufers erreichte Usain Bolt, als er beim Hundertmetersprint im Jahr 2009 auf 44,7 km/h kam, das aber nur für die Dauer von 1,61 Sekunden, was nahelegt, dass Wombats ihm locker davonlaufen könnten. Außerdem sind sie in der Lage, einen erwachsenen Mann zu Fall zu bringen und können mit ihrem Hinterteil angreifen; so zerquetschen sie Raubtiere mit dem knochenharten Knorpelgewebe ihres Rumpfs an der Wand ihrer Wohnhöhlen. Man hat in den Bauen der Tiere schon die zertrümmerten Schädel von Füchsen gefunden.
Wombatweibchen kümmern sich umsichtig und fürsorglich um ihre Jungen, die jedes Jahr im Frühling geboren werden. Wie bei allen Beuteltieren kommen die winzigen Embryonen nach nur dreißig Tagen im Mutterleib zur Welt und suchen dann für weitere acht Monate Zuflucht im Beutel der Mutter, wo sie sich weiterentwickeln. Wombats tragen ihren Beutel umgekehrt, sodass das Kleine zwischen den Hinterbeinen der Mutter hinausschaut, damit sie graben kann, ohne Schlamm hineinzuschaufeln. Das ist nicht nur eine außerordentliche evolutionäre Anpassung, es wirkt auch, als befände sich die Wombatmutter in einem achtmonatigen Dauerzustand der Niederkunft, was wiederum erklärt, warum sich der Autor von Pu der Bär doch für ein Känguru entschieden hat.
Für die frühen australischen Siedler waren Wombats eine Plage. Zwar ergänzte Wombatschinken, neben Kängurusteaks, ihre karge Ernährung, doch die Tiere galten in erster Linie als Gefahr für die Ernte und wurden massenweise abgeschlachtet. (Sie sind leicht aufzuspüren, denn ihr Kot hat eine nahezu perfekte Würfelform.) Ab 1906 galten Wombats im australischen Bundesstaat Victoria als Schädlinge, und 1925 wurde ein Kopfgeld ausgesetzt: Der Skalp eines Wombats brachte zehn Schilling. Diese Prämie war ein Ansporn für Jäger, und es kam vor, dass ein einzelner Grundbesitzer innerhalb eines Jahres eintausend Skalps eintauschte. Daher ist der Nacktnasenwombat heute nicht mehr sehr weit verbreitet. Durch Überweidung und die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums hat sich die Zahl der Tiere so stark verringert, dass inzwischen alle Wombatarten unter Schutz stehen. Besonders der Nördliche Haarnasenwombat ist vom Aussterben bedroht. Er hat ein geschmeidigeres, weicheres Fell als der Nacktnasenwombat und sieht schlecht, weshalb er sich in der Nacht von seiner seidig zarten Nase zu seiner Nahrung führen lässt. Da sein Lebensraum immer weiter beschnitten wird, ist er heute eines der seltensten Landtiere der Welt. Laut einer Zählung lebten 1982 noch dreißig Exemplare, und nach jüngsten Ergebnissen konnten 251 Tiere der fahrlässigen Naturzerstörung des Menschen entkommen.
Andere Wombats wiederum sind unmittelbar durch menschliche Hand gestorben. Im Jahr 1803 kehrte der berühmte Entdecker Nicolas Baudin von einer Reise nach Neuholland (das heutige Australien) mit einer wahren Arche voller Tiere für Napoleons Frau Joséphine zurück. Es war eine harte Fahrt mit zahlreichen Todesfällen bei Mannschaft und Fracht: Mehr als die Hälfte der Besatzung musste aufgrund von Krankheiten von Bord gehen, zehn Kängurus starben an Unterkühlung, und die Kabine des Botanikers wurde kurzerhand umfunktioniert, um unter Deck Platz für die übrig gebliebenen Tiere zu schaffen. Die kranken Emus bekamen Zucker und Wein und wurden kränker, Baudin selbst spuckte Blut. Zwei Wombats starben, aber ein weiterer konnte Kaiserin Joséphine überreicht werden.
Oft haben Wombats uns Menschen Trost gespendet, wo sonst nur wenig Trost zu finden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg besuchte der Philosoph Theodor Adorno regelmäßig den Zoologischen Garten in Frankfurt. 1965 schrieb er dem Direktor: »Wäre es nicht schön, wenn der Frankfurter Zoo ein Wombat-Pärchen erwerben könnte? Ich kann mich an diese freundlichen und rundlichen Tiere mit viel Identifikation aus meiner Kindheit erinnern und wäre sehr froh, wenn ich sie wiedersehen dürfte.«
Doch geliebt zu werden reicht oft nicht aus. Auch Rossettis Wombats ging es in Gefangenschaft nicht gut. Seine letzte Wombat-Zeichnung zeigt ihn selbst: Ein Taschentuch vor dem Gesicht, beweint er einen toten Wombat. Darunter setzte er diesen traurigen Vierzeiler:
Nie zog ich einen Wombat groß
Mit winz’gem Aug, hübsch anzuseh’n
Doch kaum war er schön fett, famos
Und schwanzlos, musst’ er von uns geh’n!
Der Grönlandhai
Im Jahr 1606 wurde London von einer verheerenden Pestwelle heimgesucht. Die Sterbenden und ihre Familien wurden in ihre mit Brettern verschlagenen Häuser gesperrt und die Theater, Bärenarenen und Bordelle per Erlass geschlossen. Genau in dieser Zeit schrieb Shakespeare eine der wenigen Stellen seines Werks, die sich auf die Pest beziehen, ein Verweis auf unser prekäres Dasein:
Beim Grabgeläut
Fragt kaum noch einer, wer? – und manches Leben
Manch braves Leben welkt vor’m Strauß am Hut,
Krepiert, bevor’s erkrankt.
Als er diese Worte schrieb, schwamm ein Grönlandhai unbeeindruckt durch die Meere des Nordens, ein Hai, der heute noch lebt. Er war damals vielleicht hundert Jahre alt und hatte somit noch nicht einmal die Geschlechtsreife erreicht: Seine Eltern waren wohl alt genug, dass sie bereits zu Boccaccios Zeiten auf der Welt waren und seine Ururgroßeltern wiederum zu Zeiten Julius Cäsars. Seit Tausenden von Jahren schwimmen Grönlandhaie in den stillen Tiefen dahin, während oben an Land die Welt in Flammen steht, neu errichtet wird, erneut brennt.
Der Grönlandhai ist das langlebigste Wirbeltier der Welt, doch erst seit Kurzem können Wissenschaftler sein ungefähres Alter bestimmen. Der dänische Arzt Jan Heinemeier hat eine Methode entwickelt, mit der sich der Kohlenstoff-14-Gehalt bestimmter kristalliner Proteine in der Augenlinse feststellen lässt. Die Konzentration des natürlichen radioaktiven Isotops Kohlenstoff-14 (C-14) ändert sich von Jahr zu Jahr. Die weitesten Ausschläge nach oben zeigt die Kurve in den 1960er-Jahren, als die Menschheit sich ganz besonders für Nuklearwaffen begeisterte, aber letztlich hat jede Epoche ihre eigene C-14-Signatur. Indem man die Proteinkristalle in den Augen der Haie untersuchte, ließ sich – recht grob – ihre bisherige Lebenszeit bestimmen: Das größte der achtundzwanzig getesteten Tiere, ein fünf Meter langes Weibchen, wurde auf ein Alter zwischen 272 und 512 Jahre geschätzt. Die Größe der Tiere gilt als ein relativ guter Indikator für ihr Alter, und da manche Grönlandhaie nachweislich sieben Meter Länge erreichen, existieren heute sehr wahrscheinlich Exemplare, die bereits ihr sechstes Jahrhundert bestreiten.
Der Grönlandhai ist keine offenkundige Schönheit. Er hat ein plumpes Gesicht, verkümmerte Flossen, und auf seinen Augen sitzen lange, wurmartige Krebstiere namens Ommatokoita elongata. Sie heften sich an die Hornhaut und flattern wie Luftschlangen in der Strömung, was den Hai nicht nur fast erblinden, sondern auch so abstoßend wirken lässt, dass es an Ungerechtigkeit grenzt. Und er stinkt. Die Harnstoffkonzentration seines Körpers ist so hoch, dass sein Salzgehalt dem des Meeres entspricht, was verhindert, dass durch Osmose Wasser abgegeben oder aufgenommen wird. Diese Notwendigkeit bewirkt aber auch, dass er nach Urin stinkt – und das so intensiv, dass eine Legende der Inuit besagt, er sei dem Nachttopf der Meeresgöttin Sedna entsprungen. Der Harnstoff bedeutet außerdem, dass der Verzehr von frischem Haifleisch für Menschen schädlich ist. Roh und unbehandelt enthält es Giftstoffe, die einen, wie man in Norwegen sagt, »Hai-trunken« machen: Es erzeugt Schwindel, man taumelt, lallt, übergibt sich. Genießbar wird es erst, wenn man das Fleisch mehrere Monate fermentieren lässt, zum Beispiel indem man es eingräbt, und dann weitere Monate zum Trocknen aufhängt. Bekannt unter dem Namen Hákarl wird es in kleinen Würfeln serviert, die einige – wenige – als Delikatesse empfinden, andere jedoch als Scheußlichkeit. Es schmeckt anscheinend wie sehr reifer Käse, der im Hochsommer eine Woche lang im Auto eines Teenagers liegengeblieben ist.
Der Grönlandhai ist langsam, wie es einem so ehrwürdigen Veteranen geziemt. Mit großer Anstrengung erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 2,75 bis 3,5 km/h. Er ist zwar eines der größten fleischfressenden Meerestiere, hat aber einen erstaunlich langsamen Stoffwechsel. Zum Überleben reicht einem 200 Kilo schweren Hai das Kalorienäquivalent von anderthalb Schokokeksen am Tag. Im Mutterleib ist er hungriger als im späteren Leben: Dem kräftigsten Fötus wachsen scharfe Zähne, dann frisst er seine Geschwister und gleitet schließlich allein hinaus ins Wasser. Nach der Geburt sind die Haie Jäger und Aasfresser. Lange vermutete man, dass sie Seehunde jagen, zum Beispiel indem sie sich die schlafenden, an der Wasseroberfläche treibenden Tiere schnappen, doch sie fressen wohl alles, was vom Eis ins Wasser fällt: Rentiere, Eisbären. Im Magen eines Hais wurde das Bein eines Menschen gefunden, jedoch nicht der Rest von ihm. Sogar das Sterben ist bei diesem Hai ein langsamer Prozess. Der Schiffsarzt Henry Dewhurst beschrieb 1834 den Fang und die Tötung eines Hais:
Wird er auf Deck gehoben, schlägt er so ungestüm mit dem Schwanz, dass es gefährlich ist, sich in seiner Nähe aufzuhalten, und die Seeleute töten ihn meist sofort. Noch einige Zeit nachdem das Leben aus dem Tier gewichen ist, zeigen die abgetrennten Stücke Kontraktionen der Muskelfasern. Er kann daher nur unter großen Schwierigkeiten getötet werden, und die Hand in sein Maul zu legen ist selbst dann noch gefährlich, wenn der Kopf bereits abgetrennt wurde. […] Solche Bewegungen sind noch nach drei Tagen zu beobachten, wenn jemand gegen den Körper tritt oder schlägt.
Ihr Leben spielt sich in großer Tiefe und im Verborgenen ab. Sie wurden durchaus bereits an der Wasseroberfläche gesehen, lieber aber bleiben sie am Meeresgrund, wo es dunkel und kalt ist: Sogar 2200 Meter unter den Wellen hat man sie schon gesichtet – sechs Eiffeltürme tief. Niemand hat je ein Weibchen gebären sehen, und nie haben wir bezeugen können, wie sie sich paaren. Weil sie für uns so unsichtbar bleiben, wissen wir nicht, wie stark gefährdet sie sind: Derzeit gelten sie als »potenziell gefährdet«, aber sie könnten genauso gut die am weitesten verbreiteten Haie der Welt sein oder hochgradig bedroht. Sicher ist, dass ihre Bestände eine Zeit lang stark überfischt wurden, um Öl zu gewinnen – im 20. Jahrhundert mit 30000 Exemplaren pro Jahr. Angeblich standen auf manchen norwegischen Inseln Häuser, die fünfzig Jahre zuvor mit Farbe aus dem Leberöl der Haie gestrichen worden waren und immer noch glänzten: ein Lack wie kein anderer. Wir wissen auch, dass ein Weibchen erst 150 Jahre alt werden muss, um sich fortpflanzen zu können, weshalb sich die Bestände nur langsam erholen. Einst glaubte man auch, sie wären hervorragende Eltern. Der griechische Dichter Oppian aus dem 2. Jahrhundert behauptete, die Haimutter würde bei Gefahr ihr riesiges Maul öffnen, um ihren Nachwuchs darin zu verstecken. Da dies anscheinend – leider – nicht stimmt, müssen stattdessen wir auf sie aufpassen.
Weil sie weit entfernt von unseren Schiffen und Tauchern leben, wissen wir nicht, wo sie schwimmen. Nur dort, wo es kalt genug für sie ist, kommen sie an die Oberfläche, in der Arktis, rings um Grönland und Island. Doch in großen Tiefen wurden sie auch schon nahe Frankreich, Portugal oder Schottland gefunden. Wissenschaftlern zufolge sind sie womöglich überall, wo der Ozean ausreichend weit hinabreicht und kalt genug ist: Vielleicht sind sie uns viel näher, als wir glauben.
Ich bin froh, dass ich kein Grönlandhai bin. Meine Gedanken könnten keine fünfhundert Jahre füllen. Aber dass sie unter uns sind, gibt mir Hoffnung. Sie werden hier sein, egal welches schwindelerregendes Chaos wir gerade durchmachen, welcher große Knall darauf folgt, und was danach kommen mag, von dem wir uns heute noch kein Bild machen können: Veränderungen, neue Erkenntnisse, womöglich neugewonnene Freiheiten. Darin liegt ihre atemberaubende Schönheit: Sie bleiben. Von allem, was dieser Planet zu bieten hat, kommen diese trägen, halbblinden Wesen mit ihrem strengen Geruch der Ewigkeit vielleicht am nächsten.
Die Giraffe
Der römische Dichter Horaz hatte entschieden etwas gegen Giraffen. Sie seien ihrer Idee nach nicht stimmig, »ein Zwitter aus Kamel und Leopard«. Dieser »Camelopard« zöge zwar die Blicke auf sich, sei aber ein einziges Durcheinander. In Ars Poetica, seinem Werk über die Dichtkunst, schrieb er: »… ein menschlich Haupt auf dem Hals eines Rosses! / Also verlangt es die Laune des Malers. [Oder] oben ein reizendes Mädchen, wird’s unten ein schwimmendes Scheusal. / Könntet ihr, Freunde, bei solchem Anblick das Lachen verbeißen?« Als Julius Cäsar im Jahr 46 v. Chr. eine Giraffe aus Alexandria mit nach Rom brachte (ein Geschenk von Kleopatra, wie manche sagten), sahen die Menschen am Straßenrand, wie schon Horaz, ein aus zwei Teilen zusammengesetztes Geschöpf. Cassius Dio berichtet davon in seiner Historia Romana: »In all seinen sonstigen Teilen gleicht dieses Tier einem Kamel, nur sind seine Beine nicht alle von der gleichen Länge, vielmehr die Hinterbeine kürzer. […] Und indem es sich gewaltig emporreckt […] hebt [es] den Nacken wiederum zu ungewöhnlicher Höhe. Was sein Fell betrifft, ist es wie ein Leopard gesprenkelt […].« Aber die Menge erfreute sich an dem abenteuerlich zusammengesetzten Wesen.