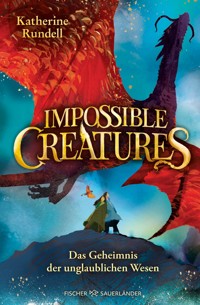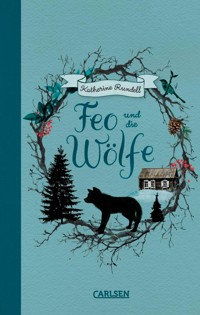
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Feo und ihre Mutter leben in einer kleinen Hütte im Wald. Sie wildern Wölfe aus, die einst als Glücksbringer an die St. Petersburger Oberschicht verkauft worden waren, aber jetzt zu groß und wild geworden sind. Nun auf einmal sollen die Wölfe nicht bloß ausgewildert, sondern getötet werden. Doch Feos Mutter weigert sich und wird von General Rakow gefangen genommen. Feo kann in letzter Sekunde entkommen. Gemeinsam mit drei Wölfen, einem Wolfsjungen und einer bunt zusammengewürfelten Kindertruppe macht sie sich auf den Weg, um ihre Mutter zu retten und dem General die Stirn zu bieten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
CARLSEN-Newsletter: Tolle Lesetipps kostenlos per E-Mail!Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de.
Alle Rechte vorbehalten.Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle deutschen Rechte Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2017Originalcopyright © 2015 by Katherine RundellOriginalverlag: Bloomsbury Publishing, LondonOriginaltitel: The Wolf WilderAus dem Englischen von Henning AhrensUmschlagillustrationen: shutterstock.com: ©green fairy ©Anelina ©Jan Faukner ©hell ©Sonya illustration ©YIK2007 ©Le Panda ©Valentyna Chukhlyebova /©Natalia Hubbert Umschlagtypografie: formlabor Lektorat: Katja MaatschSatz und E-Book-Erstellung: Pinkuin Satz & Datentechnik, Berlin
ISBN: 978-3-646-92981-2
Für meine Großmutter, Pauline Blanchard-Sims, mit ihrem unübertrefflichen Mut und Flair
EIN WORT ZU DEN WILDWOLFERN
Wildwolfer sind schwer zu erkennen.
Ein Wildwolfer gleicht weder einem Löwenbändiger noch einem Zirkusdirektor: Manche Wildwolfer bekommen ein Leben lang kein einziges Zirkuskostüm zu Gesicht. Auf den ersten Blick wirken sie wie ganz normale Menschen, aber es gibt Hinweise: Mehr als der Hälfte fehlen ein Fingerglied, ein Ohrläppchen, ein oder zwei Zehen. Sie wechseln ihre Verbände wie andere Leute die Socken. Sie riechen leicht nach rohem Fleisch.
In den urtümlichen Regionen im Westen Russlands gibt es ganze Trupps von Wolfshändlern, die frischgeborene Welpen jagen. Sie fangen die noch blinden und nassen Tiere, pferchen sie in Kisten und verkaufen sie in Sankt Petersburg an Männer und Frauen, die ein elegantes Leben in Häusern mit dicken Plüschteppichen führen. Ein Wolfswelpe kann bis zu tausend Rubel einbringen, ein schneeweißes Tier sogar das Doppelte. Ein Wolf im Haus bringt angeblich Glück: Ruhm und Reichtum, Söhne mit makelloser Nase und Töchter ohne Pickel. Peter der Große besaß sieben Wölfe, alle weiß wie der Mond.
Die gefangenen Wölfe tragen Goldketten um den Hals und sind so erzogen, dass sie brav dasitzen, während die Leute um sie herum lachen, trinken und ihnen Zigarrenrauch in die Augen pusten. Man füttert sie mit Kaviar, den sie ekelhaft finden, was wohl nur vernünftig ist. Manche werden so fett, dass ihr Bauch voller Staub und Asche ist, weil sie den Boden fegen, wenn sie die Treppen hinauf- und hinuntertrotten.
Trotzdem sind Wölfe nicht so leicht zu zähmen wie Hunde und man kann sie nicht im Haus halten. Sie sind ebenso wenig für ein ruhiges Leben geboren wie Kinder. Sperrt man Wölfe ein, dann drehen sie irgendwann durch, dann fressen sie ein Häppchen von jemandem, der nie erwartet hätte gefressen zu werden. Und danach stellt sich die Frage: Was passiert mit dem Wolf?
Russische Adelige glauben, das Töten eines Wolfes ziehe ein besonders schweres Unglück nach sich. Kein so schreckliches Unglück wie das Entgleisen eines Zuges oder der Verlust eines Vermögens, sondern etwas Finsteres und Heimtückisches. Wenn man einen Wolf tötet, sagen sie, beginnt das Leben zu schwinden. Dein Sohn wird an dem Tag volljährig, an dem ein Krieg ausbricht. Deine Zehennägel wachsen nach innen, deine Zähne nach außen, und dein Zahnfleisch blutet nachts und färbt das Kissen rot. Deshalb darf man einen Wolf weder erschießen noch verhungern lassen; stattdessen lässt man ihn von ängstlichen Dienern verpacken wie ein Paket und schickt ihn zu einem Wildwolfer.
Dieser flößt dem Wolf wieder Mut ein, bringt ihm das Jagen, das Kämpfen und das Misstrauen gegenüber Menschen bei. Er lehrt den Wolf, wie man heult, denn ein Wolf, der nicht heulen kann, ist wie ein Mensch, der nicht lachen kann. Und am Ende wird der Wolf dort ausgesetzt, wo er geboren wurde, in einem Land, das ebenso wild und lebendig ist wie die Tiere selbst.
EINS
Vor langer, langer Zeit, es ist bald hundert Jahre her, da gab es ein dunkelhaariges, ungestümes Mädchen.
Das Mädchen war Russin, und obwohl sie von Natur aus dunkle Haare und dunkle Augen und außerdem dreckige Fingernägel hatte, ließ sie ihrem stürmischen Wesen nur dann freien Lauf, wenn es gar nicht anders ging. Was allerdings ziemlich oft der Fall war.
Das Mädchen hieß Feodora.
Sie lebte in einer Blockhütte, deren Holz in den umliegenden Wäldern gefällt worden war. Zum Schutz vor dem russischen Winter waren die Wände mit Schafwolle verkleidet und in den Zimmern brannten Sturmlaternen. Feo hatte diese Laternen in allen Farben bemalt, die ihr Malkasten zu bieten hatte, und so warf das Haus rotes, grünes und gelbes Licht in den Wald. Ihre Mutter hatte das Holz der zwanzig Zentimeter dicken Tür eigenhändig gesägt und abgeschmirgelt. Feo hatte die Tür in Schneeblau gestrichen. Im Laufe der Jahre hatten die Wölfe ihre Klauenspuren darauf hinterlassen, was dabei half, ungebetene Besucher abzuschrecken.
Und alles – aber auch alles – begann mit einem Klopfen an dieser schneeblauen Tür.
»Klopfen« war allerdings nicht das passende Wort für das Geräusch, fand Feo. Eher klang es, als wollte jemand mit den Knöcheln ein Loch ins Holz hämmern.
Ein Klopfen an der Tür war die Ausnahme. Eigentlich klopfte niemand; es gab nur Feo selbst, ihre Mutter und die Wölfe. Wölfe klopfen nicht. Wenn sie reinkommen wollen, nehmen sie das Fenster, ob offen oder nicht.
Feo legte den Ski weg, den sie eingeölt hatte, und horchte. Es war noch früh am Morgen und sie war im Nachthemd. Weil sie nichts anderes fand, zog sie den von ihrer Mutter gestrickten Pullover an, der bis zur Narbe auf ihrem Knie reichte, und lief zur Haustür.
Ihre Mutter, die einen Hausmantel aus Bärenfell trug, wandte den Blick von dem Feuer ab, das sie gerade im Wohnzimmer entfacht hatte.
»Ich gehe!« Feo rannte an ihr vorbei, um die Tür zu öffnen. Sie klemmte, denn die Angeln waren vereist.
Ihre Mutter wollte sie festhalten: »Feo! Warte!«
Aber Feo hatte die Tür schon aufgerissen. Diese schwang nach innen und traf sie am Kopf, bevor sie ausweichen konnte. »Autsch!« Feo stolperte über ihre eigenen Füße. Sie stieß ein Wort aus, bei dem der Fremde, der sich an ihr vorbeidrängte, Augenbrauen und Mund verzog.
Das Gesicht des Mannes schien nur aus rechten Winkeln zu bestehen. Er hatte eine sehr lange Nase, und seine Falten, die auf ein jähzorniges Wesen hindeuteten, waren so tief, dass sie im Dunkeln Schatten warfen.
»Wo ist Marina Petrowna?« Er stürmte im Flur an Feo vorbei und zog dabei eine Spur aus Schnee hinter sich her.
Feo wollte aufstehen – und sprang sofort zurück, weil zwei weitere Männer in grauen Mänteln ihre Finger beim Hereinkommen nur um Haaresbreite mit den schwarzen Stiefeln verfehlten. »Weg da, Mädchen!« Sie schleppten einen jungen, an den Beinen aufgehängten Elch. Er war tot, sein Blut tropfte auf den Boden. Beide Männer trugen die hohe Pelzmütze der Kaiserlich Russischen Armee und hatten eine übertrieben amtliche Miene aufgesetzt.
Feo lief ihnen nach. Sie winkelte Knie und Ellbogen an, um notfalls kampfbereit zu sein.
Die zwei Soldaten ließen den Elch auf den Teppich sacken. Das Wohnzimmer war klein, und die zwei jungen Burschen waren breitschultrig und hatten Gesichter, die von einem buschigen Schnurrbart beherrscht wurden.
Aus der Nähe wirkten sie kaum älter als sechzehn; der Mann, der gegen die Tür gehämmert hatte, war jedoch alt, und seine Augen waren das Älteste an ihm. Feos Magen zog sich zusammen.
Der Mann richtete seine Worte über Feos Kopf hinweg an ihre Mutter. »Marina Petrowitsch? Ich bin General Rakow.«
»Was wollen Sie?« Marina stand mit dem Rücken gegen die Wand.
»Ich bin als General der Kaiserlich Russischen Armee für die tausendfünfhundert Werst südlich von Sankt Petersburg zuständig. Und ich bin hier, weil deine Wölfe diesen Schaden angerichtet haben«, sagte er und trat gegen den Elch. Blut spritzte auf seinen blank polierten Stiefel.
»Meine Wölfe?« Feos Mutter wirkte äußerlich gefasst, doch ihr Blick war weder entspannt noch glücklich. »Ich besitze keine Wölfe.«
»Du lässt sie dir schicken«, erwiderte Rakow, in dessen Blick eine fast unmenschliche Kälte lag. »Also bist du für sie verantwortlich.« Seine Zunge hatte durch das Rauchen einen gelben Belag.
»Nein. Nein, das stimmt nicht«, sagte Feos Mutter. »Die Wölfe werden mir von Leuten geschickt, die sie nicht mehr haben wollen – von Adeligen und Reichen. Wir wildern sie aus, mehr nicht. Wölfe gehören niemandem.«
»Lügen helfen dir auch nicht weiter, gute Frau.«
»Aber ich …«
»Ich sehe deine Tochter manchmal mit drei Wölfen. Und da behauptest du, diese Raubtiere gehören dir nicht?«
»Nein, natürlich nicht!«, ging Feo dazwischen. »Sie sind …« Doch ihre Mutter schüttelte heftig den Kopf und befahl Feo mit einem Wink, still zu sein. Also biss Feo auf ihre Haare und klemmte sich die Fäuste unter die Achseln.
Ihre Mutter antwortete: »Die Wölfe sind nicht unser Eigentum. Sie gehören uns nur in dem Sinn, wie ich zu meiner Tochter gehöre und umgekehrt. Sie sind Feos Gefährten, nicht ihre Haustiere. Und dieser Biss stammt weder von Schwarzpelz noch von Weißpelz oder Graupelz.«
»Ja. Die Bissspuren«, sagte Feo mit einem Blick auf den Elch, »stammen von einem viel kleineren Wolf.«
»Wenn ihr glaubt, dass ich Ausflüchte hören will«, sagte Rakow, »liegt ihr falsch.« Seine Stimme klang immer weniger amtlich: lauter, schneidender.
Feo versuchte ihren Atem zu beruhigen. Sie sah, dass die beiden jungen Burschen ihre Mutter anstarrten; einem von beiden stand der Mund offen. Marina hatte breite Schultern, ausladende Hüften und einen kräftigen Rücken; ihre Muskeln waren eigentlich typisch für Männer oder, wie Feo dachte, für Wölfe. Doch ihr Gesicht ähnelte, wie ein Gast einmal bemerkt hatte, dem einer Schneeleopardin oder einer Heiligen. »Ihre Züge«, hatte der Gast gesagt, »haben etwas von einer Göttin.« Feo hatte ihren Stolz auf diese Worte damals verborgen.
Rakow schien gegen die Schönheit ihrer Mutter immun zu sein. »Mir wurde befohlen Schadensersatz für den Zar einzutreiben. Du schuldest deinem Zaren hundert Rubel. Und versuch erst gar keine Spielchen!«
»Ich besitze keine hundert Rubel.«
Rakow schlug mit der Faust gegen die Wand. Das Holz erbebte. Für einen so alten, verschrumpelten Mann war er verblüffend stark. »Ich will keine Einwände oder Ausflüchte hören, Weib! Man hat mich geschickt, um an diesem gottverlassenen Ort für Gehorsam zu sorgen, und sei es mit Gewalt.« Er senkte den Blick auf seinen blutbespritzten Stiefel. »Der Zar belohnt den Erfolg.« Er trat so plötzlich und heftig gegen den Elch, dass dessen Beine hin und her flogen. Feo entwich ein entsetztes Zischen.
»Du!« Rakow ging quer durch das Zimmer und beugte sich so tief über Feo, dass sein zerfurchtes und nikotingelbes Gesicht nur Zentimeter von ihrer Nase entfernt war. »Hätte ich ein Kind mit einer so frechen Visage, dann würde ich es grün und blau schlagen. Bleib hier sitzen. Ich will dich nicht mehr sehen.« Als er Feo zurückstieß, verfing sich das um seinen Hals hängende Kreuz in ihren Haaren. Er riss es wütend an sich und ging durch die Tür in den Flur. Die Soldaten folgten ihm. Marina wies Feo an, sich nicht vom Fleck zu rühren – mit derselben Geste, die sie für die Wölfe benutzten –, und rannte den Männern nach.
Feo stand in der Tür und wartete darauf, dass das Summen in ihren Ohren abflaute; dann hörte sie einen Schrei und ein Krachen, als würde etwas zerbrechen. Sie rannte los, schlitterte auf ihren Socken durch den Flur.
Die Soldaten drängten sich in Feos Schlafzimmer, erfüllten es mit ihrem Gestank. Ihre Mutter war nicht da. Feo zuckte zurück – es stank nach Rauch und Schweiß und Bärten, die seit einem Jahr nicht mehr gewaschen worden waren. Einer der Soldaten hatte einen so starken Unterbiss, dass er nach seiner eigenen Nase hätte schnappen können.
»Nur Plunder«, sagte einer der beiden. Sein Blick glitt über die Tagesdecke aus Rentierfell, die Sturmlaterne und blieb dann an den Skiern hängen, die neben dem Kamin standen. Feo flitzte los und stellte sich schützend davor.
»Die gehören mir!«, sagte sie. »Der Zar hat kein Recht darauf. Ich habe sie selbst gebaut.« Sie hatte für jeden Ski einen Monat gebraucht, hatte sie jeden Abend abgeschmirgelt und mit Fett eingerieben, um sie zu glätten. Feo packte einen der Skier wie einen Speer mit beiden Händen. Sie hoffte, dass man ihr nicht ansah, wie nahe sie den Tränen war. »Kommt ja nicht näher.«
Rakow lächelte, aber nicht gütig. Er nahm Feos Laterne und hielt sie ins Morgenlicht. Feo wollte danach greifen.
»Halt!«, sagte Marina. Sie stand in der Tür und hatte einen frischen Bluterguss auf der Wange. »Merkt ihr denn nicht, dass ihr im Zimmer meiner Tochter seid?«
Die jungen Männer lachten. Rakow stimmte nicht ein, sondern starrte die beiden nur an, bis sie erröteten und verstummten. Er ging zu Feos Mutter, betrachtete den Bluterguss auf ihrer Wange. Er beugte sich vor, bis seine gelbe Nasenspitze ihre Haut berührte, und schnupperte. Marina stand stocksteif da und kniff die Lippen zusammen. Dann brummte Rakow und schleuderte die Laterne gegen die Decke.
»Verdammt!«, schrie Feo und duckte sich, weil Scherben auf sie hinabregneten. Sie stürmte auf den General zu und schwang dabei blindlings ihren Ski. »Raus!«, rief Feo. »Raus hier!«
Der General entriss ihr lachend den Ski. »Setz dich und sei brav, Kindchen, sonst werde ich noch wütend.«
»Raus hier«, wiederholte Feo.
»Hinsetzen! Oder wir binden deine Beine zusammen und hängen dich auf wie den Elch.«
Marina schien schlagartig lebendig zu werden. »Was? Sind Sie verrückt geworden? Sie wagen es, mein Kind zu bedrohen?«
»Ihr widert mich beide an.« Rakow schüttelte den Kopf. »Mit diesen Tieren zu leben ist abscheulich. Wölfe sind Ungeziefer mit Zähnen.«
»Das ist …« Die Miene von Feos Mutter verriet, dass ihr hundert verschiedene Schimpfwörter durch den Kopf gingen, bis sie schließlich ergänzte: »falsch.«
»Und wenn sich deine Tochter mit diesen Biestern herumtreibt, ist sie auch Ungeziefer. Ich habe so einiges über euch gehört – du bist eine lausige Mutter.«
Marina entwich ein Laut, der Feo wehtat, eine Mischung aus Zischen und Keuchen.
Der General fuhr fort: »Es gibt Schulen – in Wladiwostok –, auf denen man sie die Werte einer besseren Mutter lehren würde – die Werte von Mütterchen Russland. Vielleicht lasse ich sie dorthin schicken.«
»Feo«, sagte Marina, »geh in die Küche und warte dort. Sofort.« Feo rannte aus dem Zimmer, duckte sich aber hinter die Tür und schielte durch den Spalt. Ihre Mutter drehte sich wieder zu Rakow um und ihr Gesicht glühte vor Zorn und anderen, viel komplizierteren Gefühlen.
»Nein – Feo ist mein Kind. Begreifen Sie denn nicht, was das heißt, in Gottes Namen?« Marina schüttelte ungläubig den Kopf. »Mein Kind ist mehr wert als ein ganzes Heer von Kerlen wie Ihnen. Und meine Liebe für sie sollten Sie nicht unterschätzen, es sei denn, Sie möchten unbedingt sterben. Diese Liebe – sie brennt wie ein Feuer.«
Rakow strich über sein Kinn. »Worauf willst du hinaus? Das ist doch unlogisches, dummes Gewäsch.« Er wischte seinen Stiefel am Bett ab. »Du ermüdest mich.«
»Ich will darauf hinaus, dass Sie besser die Hände von meiner Tochter lassen, wenn Sie Wert darauf legen, Ihre Hände zu behalten.«
Rakow schnaubte. »Klingt ziemlich unweiblich.«
»Oh, nein. Ich finde das sehr weiblich.«
Rakow starrte Marinas Finger an, denen zwei Kuppen fehlten, und danach ihr Gesicht. Seine Miene war furchterregend; er sah aus, als würde er gleich explodieren. Marina hielt seinem Blick stand. Rakow blinzelte zuerst.
Er brummte und schritt durch die Tür. Feo wich ihm rückwärts aus und folgte ihm dann in die Küche.
»Du erleichterst dir die Sache nicht gerade«, sagte er. Er stieß den Esstisch mit gleichgültiger Miene um. Feos Lieblingsbecher knallte auf den Fußboden.
»Mama!«, sagte Feo, und als Marina in die Küche stürmte, klammerte sich ihre Tochter an einen Zipfel des Hausmantels ihrer Mutter.
Rakow würdigte sie keines Blickes. »Nehmt die Gemälde mit«, sagte er. Es gab drei und auf allen bildeten bunte Kuben die Gestalten von Männern und Frauen. Marina liebte diese Bilder. Und Feo mochte sie, weil sie ihrer Mutter gefielen.
»Halt! Die nicht!«, sagte Feo. »Das sind Mamas Malewitschs. Die waren ein Geschenk! Halt! Hier. Nehmt die!« Feo zog sich ihre Kette über den Kopf und hielt sie einem der jungen Soldaten hin. »Sie ist aus Gold. Sie hat meiner Großmutter gehört, ist also alt. Gold wird mit den Jahren immer kostbarer.« Der Soldat biss auf die Kette, roch daran, nickte und reichte sie Rakow.
Feo lief los, um die Haustür zu öffnen. Als sie auf der Schwelle stand, sammelte sich Schnee auf ihren Socken. Sie zitterte am ganzen Körper. »Und jetzt müssen Sie gehen.«
Marina schloss kurz die Augen, öffnete sie wieder und lächelte Feo an. Die zwei Soldaten spuckten gelangweilt auf den Boden und traten in den Schnee vor der Haustür.
»Ihr seid gewarnt und die Warnung wird nicht wiederholt«, sagte Rakow und scherte sich nicht um die offene Tür, durch die der Wind den Schnee hereinblies. »Unser Zar duldet es nicht, dass Wölfe, denen ihr das Jagen beigebracht habt, sein Wild reißen. Ab jetzt erschießt ihr die Wölfe, die euch aus der Stadt geschickt werden. So will es unser Zar.«
»Nein!«, sagte Feo. »Auf keinen Fall! Außerdem haben wir kein Gewehr! Sag es ihm, Mama!«
Rakow ignorierte sie. »Ihr sagt den abergläubischen Idioten, die euch diese dämlichen Haustiere schicken, dass ihr die Wölfe ausgewildert habt, und dann erschießt ihr die Tiere.«
»Bestimmt nicht«, erwiderte Marina, die so kreidebleich war, dass sich Feo innerlich wand. Sie hätte gern eine Waffe gehabt, um sie auf den General zu richten.
Rakow zuckte mit den Schultern, wobei sich sein Mantel bauschte. »Wisst ihr, was passiert, wenn man sich den Befehlen unseres Zaren widersetzt? Erinnert ihr euch daran, was mit den Aufständischen in Sankt Petersburg passiert ist? Dies ist die erste und letzte Warnung.« Er ging zur Haustür, und als er hindurchschritt, zeigte er mit einem Finger auf Feos Herz. »Auch für dich, Kleine.« Er gab ihr einen heftigen Stoß gegen die Brust. Feo taumelte zurück.
»Wenn wir das Mädchen noch einmal mit einem Wolf sehen, erschießen wir den Wolf und nehmen die Kleine mit.«
Er knallte die Tür hinter sich zu.
Später am Tag saßen Feo und ihre Mutter vor dem Feuer. Sie hatten die Glas- und Porzellanscherben aufgefegt, den Elch in Eis verpackt und im Holzschuppen verstaut. Feo hätte ihn gern begraben, ganz feierlich und mit einem Kreuz, aber ihre Mutter hatte davon nichts wissen wollen. Gut möglich, dass sie ihn essen mussten, wenn die Kälte noch klirrender wurde. Feo hatte ihren Kopf auf die Schulter ihrer Mutter gelegt.
»Und was jetzt, Mama?«, fragte sie. »Sollen wir die Wölfe wirklich töten? Das tun wir nicht, oder? Das würde ich nicht zulassen. Wir dürfen das nicht.«
»Nein, Lapotschka!« Marina hielt Feo in einem ihrer kräftigen, vernarbten Arme. »Natürlich nicht. Aber wir müssen noch vorsichtiger und wachsamer sein.« Sie ließ die Kastanien klappern, die auf dem Rost im Feuer lagen, und schnippte Feo eine in die Hände. »So verhalten sich die Wölfe. Und das können wir auch, stimmt’s?«
Natürlich konnten sie das, dachte Feo, als sie abends die Skier anlegte. Menschen waren Feo mehr oder weniger egal; es gab nur eine Person, die sie wirklich liebte, mit jenem wilden Stolz liebte, durch den man Ärger bekommen, im Gefängnis landen, aber auch in die Geschichtsbücher eingehen kann. Ihre Mutter, dachte sie, war in jeder Hinsicht unschlagbar.
Feo brauchte auf Skiern zehn Minuten bis zur Ruine der aus Stein erbauten Kapelle. In der Eingangshalle standen drei verwitterte Heiligenstatuen. Die Köpfe fehlten, und zwei hatten eine Schuppenhaut aus grünen Flechten, aber Feo fand, dass die Heiligen selbst ohne Kopf so aussahen, als würden sie sich von Drohungen nicht einschüchtern lassen. Zwei Mauern standen noch ganz, eine dritte halb, und der Schutt des vor Ewigkeiten eingestürzten Daches türmte sich auf dem Mosaikfußboden. Es gab ein paar wurmzernagte Bänke und eine Marmorstatue der Jungfrau Maria, die Feo mit dem zerkauten Ende eines Zweigs geputzt hatte. Wenn das Licht günstig war, konnte man erkennen, dass die Wände der Kapelle mit goldenen Figuren bemalt gewesen waren. Für Feo war dies der schönste Ort auf Erden.
In dieser Kapelle lebten drei Wölfe.
Ein Wolf war weiß, einer schwarz, und einer war grau, hatte aber schwarze Ohren und schaute listig drein. Diese Tiere waren weder zahm – sie gehorchten nicht, wenn man sie rief – noch ganz wild. Die Nachbarn hielten auch Feo für halbwild und starrten ihren roten und nach Wolf stinkenden Mantel jedes Mal entsetzt an. Es leuchtete also ein, dass Feo und die Wölfe gute Freunde waren – sie kamen sich auf halbem Weg entgegen.
Als sie auf ihren Skiern durch die Tür glitt, rissen die Wölfe gerade an den Kadavern zweier Raben und bespritzten die Marienstatue mit Blut. Feo hielt Abstand – am besten, man störte Wölfe nicht beim Fressen, selbst wenn sie gute Freunde waren –, legte ihre Füße auf eine Bank und wartete, bis die Tiere aufgefressen hatten. Sie leckten in aller Ruhe ihre Lefzen und Vorderpfoten und stürmten dann zu Feo, warfen sie von der Bank und benetzten ihr Kinn und ihre Hände mit Speichel. Schwarzpelz spielte zwischen den Bankreihen gern Fangen mit Feo, und um ihr Gleichgewicht wiederzufinden, schwang sie sich um die kopflosen Heiligen. Der Stein, der ihr im Magen lag, schien etwas leichter zu werden.
Feo bildete sich ein, ihre geliebten Wölfe von Anfang an um sich gehabt zu haben. Man musste diese Tiere einfach lieben, denn sie waren so schlank und so schön und so unbeugsam. Sie war damit aufgewachsen, Kiefernnadeln aus ihrem Pelz und Fleischreste aus ihren Zähnen zu picken. Ihre Mutter meinte, sie habe jaulen können, bevor sie das Sprechen gelernt habe. Sie hatte die Wölfe von Anfang an verstanden; Wölfe, dachte Feo, gehörten zu dem wenigen, für das es sich zu sterben lohnte. Sie hielt es allerdings für unwahrscheinlich, dass man dies von ihr verlangte – zumal es meist die Wölfe waren, die man zum Sterben verdammte.
ZWEI
Die Wölfin, die zwei Wochen nach der Drohung des Generals eintraf, war noch jung und hatte eine wunderschöne Rute, war aber fetter, als gut für sie war.
Wenn die Kutschwagen vor dem Haus im Wald hielten, sahen sich die Fahrer stets blinzelnd nach einem Hünen um, der aus dem Haus trat und den Wolf losband. Stattdessen erblickten sie Feo und ihre Mutter, die nach Küche rochen. Marina war dreiunddreißig und so groß, wie die Tür hoch war. Sie hatte Feo gezeigt, wie man im Türrahmen Klimmzüge machte. Ihr linkes Auge war von Narben umgeben, Spuren von vier Krallen. Wenn ihr ein Mann begegnete, konnte es diesem sekundenlang den Atem verschlagen.
An diesem Morgen war Feo zuerst beim Wagen. Sie schlug das Hilfsangebot des Kutschers aus, hob die strampelnde Wölfin vom Wagen, legte sie in den Schnee und streichelte ihren Kopf. Daraufhin beruhigte sich das Tier.
Feo hatte noch nie so schwarzes Fell gesehen. Diese Wölfin wäre nachts unsichtbar – ja, dachte Feo, sie wäre sogar dunkler als die Nacht, denn russische Nächte waren nie ganz finster, vor allem dann nicht, wenn Schnee das Licht reflektierte.
»Schön dich kennenzulernen«, sagte Feo zu der Wölfin. Sie ließ den Kutscher links liegen, senkte das Gesicht und berührte die Schnauze der Wölfin mit ihrer Nase. Die Wölfin leckte ihr Kinn. Ihr Atem roch beruhigend nach Speichel und Silbermünzen, aber die Zunge war geschwollen und blutete leicht.
»Sie hat sich gebissen«, sagte Feo. »Du hättest vorsichtiger fahren müssen.« Dann sah sie den Kutscher prüfend an. Er war ein kräftiger Mann mit einer langen, nahtlos in den Vollbart übergehenden Nase. »Sind dir unterwegs Soldaten begegnet?«
»Wieso? Warum …«
»Ach, egal.« Feo schüttelte heftig den Kopf. »Vergiss meine Frage.« Sie löste vorsichtig die Stricke, achtete darauf, die Hände immer so zu halten, dass die Wölfin sie sah. Ihre Klauen waren schon so lang, dass sie sich zu den Ballen der Pfoten bogen. Feo zog ihr Messer, legte sich eine Wolfstatze aufs Knie und begann die Klauen zu stutzen.
»Hast du Futter dabei?«, fragte Feo den Kutscher, der seine Augenbrauen hochzog. »Sie ist hungrig.«
»Nein. Ich finde, sie ist fett genug.«
Feo legte sich die Schnauze der Wölfin vor den Bauch, zwängte ihr Maul auf und strich über die Zähne, betastete das Zahnfleisch.
»Lass das, Kleine! Bei der heiligen Mutter Gottes!«, rief der Mann. Feo nahm interessiert zur Kenntnis, dass er feuchte Hände bekam. »Was tust du da?«
»Ich will nur schauen, ob das Zahnfleisch gesund ist.« Das war es. Sie ließ die Wölfin los und kraulte sie unter den Vorderläufen. Die Wölfin fiel auf die Flanke und winselte genussvoll.
Der Mann zog weiter ein entsetztes, fast wütendes Gesicht. »Müsste man dem Vieh nicht das Maul zubinden?« Er starrte Feo an, betrachtete ihre Augen und Ohrläppchen; eines war versehentlich von einer Wolfskralle eingerissen worden, als sie sechs gewesen war. Feo schüttelte sich die Haare ins Gesicht und warf dem Kutscher einen vernichtenden Blick zu. Das versuchte sie jedenfalls. Sie hatte nur in Büchern davon gelesen und wusste nicht recht, wie es funktionierte. Sie stellte sich vor, dass die Nasenflügel dabei sehr aktiv sein mussten.
»Wölfe brauchen keine Stricke. Sie sind nicht wie Hunde.« Wölfe waren viel feuriger, dachte sie, und auch viel launischer. Das war schwer zu erklären. Sie biss auf ihre Unterlippe, suchte nach einer Formulierung und schüttelte dann den Kopf. Andere Menschen waren immer so kompliziert. »Wenn du willst, kannst du fahren. Ich an deiner Stelle würde es tun.«
Als Marina mit halb geflochtenen Zöpfen aus dem Haus kam, verschwand der Kutschwagen schon in der Ferne.
»Wollte er denn gar nichts trinken?«, fragte sie.
»Nein«, sagte Feo und grinste ihre Mutter an. »Ich glaube, er war nicht besonders scharf darauf, länger zu bleiben.«
»Umso besser. Komm – wir bringen sie rasch in den Wald, damit man sie nicht sieht.«
»Meinst du, sie beobachten uns?« Feo ließ einen Blick über die verschneite Landschaft gleiten. »Schon jetzt?«
»Wäre möglich, Lapotschka. Ich glaube nicht, dass es eine leere Drohung war. Wäre mir neu, dass so viel zu Bruch geht, wenn leere Drohungen ausgesprochen werden.«
Die Wölfin trottete quälend langsam zum Wald und winselte dabei, als wäre sie die Kälte nicht gewohnt.
Marina wischte unterwegs Schnee von Feos Haaren. »Wir sollten unbedingt besprechen, was wir im Notfall tun müssen.«
»Hm-hm.« Die Wölfin hustete. Feo knetete ihre Kehle sanft mit zwei Fingern. »Was mag sie angestellt haben? Warum wollte man sie loswerden?«
»Angeblich ist sie in den Kleiderschrank der Gräfin gekrochen und hat die Kleider zerbissen. Hörst du mir eigentlich zu?«
»Mehr nicht? Sie hat niemanden zerfleischt? Ja, entschuldige. Ich höre dir zu!« Feo dachte an ihr kleines Rudel. Graupelz hatte einem Steuereintreiber den Daumen abgebissen. Weißpelz hatte einer Herzogin eine tiefe Wunde in den Oberschenkel geschlagen, als sie vor Besuchern hatte tanzen sollen. Und Schwarzpelz hatte drei Zehen gefressen, die streng genommen einem englischen Lord gehört hatten. Ihre Wölfe, dachte Feo, waren eine herrliche Verbrecherbande.
»Wenn Rakows Männer uns tatsächlich beobachten, darfst du dich mit den Wölfen nicht blicken lassen.«
»Weiß ich. Hast du schon gesagt, Mama! Übrigens habe ich den Kutscher gefragt, ob ihm Soldaten begegnet seien, aber das hat er verneint.«
»Wie bitte?« Marina klang erschrocken. »Du darfst die Soldaten niemandem gegenüber erwähnen. Anderen zu verraten, dass man etwas zu befürchten hat, ist nicht klug.«
»Oh.« In Feo krampfte sich alles zusammen. »Das tut mir leid. Das wusste ich nicht.«
»Ist mein Fehler. Ich hätte es dir sagen müssen.« Marina fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare. »Ich habe einen Fluchtplan ausgetüftelt. Nur für den Notfall.«
Die Wölfin drückte ihre Schnauze seitlich gegen Feos Knie und hustete wieder. »Hat sie die Kleider vielleicht verschluckt, Mama? Wenn sie noch Stoff zwischen den Zähnen hat, könnte das wehtun.«
»Feo, lass das …«
»Ich muss nachschauen, Mama.« Feo zwängte das Maul der Wölfin auf. Speichel troff auf ihre Hand, während sie es sorgsam abtastete. Zwischen den hintersten Zähnen hing ein Stofffetzen. Feo riss daran. Es war roter Samt, auf den noch eine winzige Staubperle genäht war.
»Na also! Und die Schnur, mit der sie gefesselt wurde, war zu dünn«, sagte Feo und hielt ihrer Mutter eine Pfote hin. »Da ist Blut, siehst du? Ihre Pfoten sind sehr empfindlich.« Sie gab der Wölfin einen Kuss aufs Ohr. »Wir nennen dich Zartpfote.«