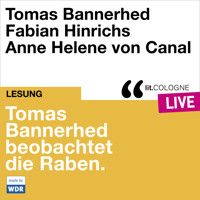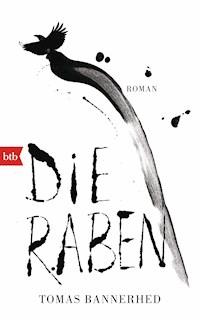8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Noch ein bisschen sehnsüchtiger als anderorts warten die Schweden auf das Ende eines langen Winters. Und umso freudiger begrüßen sie die zurückkehrenden Zugvögel wie Feldlerchen oder Graureiher. Gemeinsam mit vielen seiner Landsleute zieht Tomas Bannerhed los, um im unvergleichlichen Dekor der schwedischen Sommerlandschaft Vögel zu beobachten. Eine Gans belegt den Horst eines Fischadlers, Möwen attackieren Falkenjunge – Bannerheds tagebuchartige Reflexionen stecken voller Überraschungen, Humor und Skurrilem und vermitteln seine Bewunderung für die reiche Vogelwelt Schwedens.
Kongenial ergänzt wird der Text durch Brutus Östlings Fotos. Sie fangen die Weite der schwedischen Landschaft ebenso ein wie kleinste Details im Gefieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tomas Bannerhed
Mit Fotos von
Brutus Östling
Ein Vogeljahr in Schweden
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
27. Februar
Mitten in der Nacht und viele Kilometer tief im Wald, wo die Eulen wohnen. Vollmond, zwanzig Grad unter null und nirgends ein Lebenszeichen, so weit das Auge reicht, aber im Auto singt Joni Mitchell, damit wir vergessen, wie allein wir sind.
Ladies of the Canyon: die Gitarre und das Klavier, ihre unvergleichliche Stimme und ihre Harmonien.
It was a rainy nightWe took a taxi to your mother’s homeShe went to Florida and left youWith your father’s gun alone
Jetzt stehen wir hier vor dem Auto und halten einander an der Hand, nesteln ein wenig unbeholfen an den Handschuhen herum und lauschen dem Ticken des Motors. Die Fichten haben ihren Winterpelz bekommen und glitzern wie in den Märchen.
Die stille Fährte des Hasen im Schnee. Die Kontur eines Ameisenhügels im Mondschein. Die Kälte, die in den Wangen zwickt.
So war es auch schon vor tausend Jahren in einem schwarzweißen Wald mitten im Winter.
Welche Botschaften ließen sich damals aus der gewaltigen Punktschrift des Nachthimmels herauslesen? Welche Bedeutung hatte die Scheibe des Vollmonds für die Seefahrer? Die Girlanden des Nordlichts für Fischer und Bauern?
„Pst!“
Der da gebellt hat, das war der Habichtskauz. Der Schärfste von allen, der einem die Augen aufschlitzt, wenn man zu aufdringlich wird. Sitzt sicher auf seinem Schornsteinbaumstumpf am Rand des Kahlschlags und will sich in dieser Saukälte paaren. Ein Revierruf durch die große Stille des Nadelwalds.
Wou-wou-wou-wou-wou-wou-wou – – –
Dumpf und rätselhaft wie aus einer anderen Zeit.
Habichtskauz
Als wir das Auto verlassen und dem geräumten Hauptweg ein Stück tiefer hinein folgen, geht es auf ein Uhr zu. Hohe Schneewälle und knirsch knarz unter den Stiefeln, kalter Atemrauch aus den Mündern und die bläulichen Schatten der Säulenstämme, die das Erdreich säumen. Der Mond ist blendend scharf konturiert, als wäre seine Oberfläche mit Eis überzogen oder glasiert worden.
Ich hebe Aufmerksamkeit gebietend einen Finger, und wir bleiben mit gespitzten Ohren stehen und schauen uns an.
Das Leuchten des Wiedererkennens in den Augen und eine unmittelbare Verpflanzung in jene Eulennacht im Haus deiner Mutter, vor nicht allzu langer Zeit, als der Regen fiel und alles noch von Sommer durchdrungen war.
Es ist das sanfte, trillernde Lachen des Waldkauzmännchens, das wir aus der Richtung des Großen Wagen kommend hören, und das Weibchen, das ihm sogleich antwortet: Komm mit, komm mit!
Was zumindest in Småland, sechshundert Kilometer entfernt von hier, bedeutet, dass ein Kind zur Welt kommen wird.
5. März
Tropfende Dächer und nass glänzende Bürgersteige unterhalb der Kungsholmen-Kirche, und gestern, an den Straßenrändern auf der Mälarinsel Färingsö, knospende Winterlinge und Huflattiche.
Nun hat der Wind gedreht, und der Schnee schmilzt mit aller Macht bei Südwind und Sonnenschein. Der Schwarzspecht trommelt Frühjahrsankündigungen, und die Feldlerchen verbreiten sich zu tausenden das Land hinauf, eifrig den Rückzug des Winters signalisierend, jede einzelne unterwegs zu ihrem kleinen Abschnitt Feld oder Weide mit Licht und Musik für die Bauern, die es noch gibt.
Und schon bald hängt die Lerche über jenem Fleckchen Erde, auf dem sie zur Welt kam und tiriliert am Himmel, hängt da oben auf hektisch flatternden Flügeln und kann vom eigenen Gesang anscheinend nie genug bekommen, sirrend und wirbelnd und perlend wie nichts sonst an diesen ersten Frühlingstagen.
8. März
Die Reiher sind gekommen! Wie alte, ergraute Fischer verharren sie im wortlosen Gespräch unterhalb ihrer Nistbäume auf der Insel Djurgården in Stockholm und lassen es sich in der Sonne gutgehen: hochgezogene Schultern, vorgeschobener Kopf, ein bisschen stur, so scheint es, aber dennoch zusammen. Und oben, in den riesigen Kronen der gealterten Erlen, stehen die Vögel stets zu zweit in den Astgabeln und Nestern, necken sich ein bisschen und klappern mit den Schnäbeln oder suchen Zweige und Stöckchen und richten ihr Heim her, während andere vom Fressen ganz dösig geworden sind und zu einem Mittagsschläfchen auf das Eis flattern, in gebührender Entfernung vom Land, damit nicht einmal der Fuchs sie überlisten kann, ehe irgendwer rechtzeitig Alarm schlägt.
Die große Reiherkolonie am See Isbladskärret ist wieder einmal voll von geflügeltem Leben. Die perlgrauen Urzeitvögel lassen sonntäglich müßige Stockholmer Flaneure innehalten und die Hand zum Schutz vor der Sonne an die Stirn heben, wenn sie am Kanal entlanggehend näher kommen.
„Siehst du? Wie groß sie sind! Das sind doch Reiher, nicht?“
„Dann können jeden Tag die Leberblümchen blühen.“
Von fern sieht es fast aus, als wären die Erlen von Hexenbesen oder Mistelknäueln erobert worden, aber wer näher herangeht, erkennt schnell, dass es da und dort von langen Vogelhälsen und dolchförmigen Schnäbeln wimmelt. Es ist wohl eine der größten Reiherkolonien des Mälartals – wenn nicht des ganzen Landes. Aus den wenigen Siedlern, die Ende der achtziger Jahre aus dem benachbarten Zoo Skansen auswanderten, sind in dem kleinen Wäldchen sechzig, siebzig nistende Paare geworden.
Die Schnäbel flammend feuergelb von Gegenlicht und Hormonen, die Stirntolle aufgerichtet und die Halsmähne flatternd im Wind, bei den älteren Vögeln üppige Brustkrausen.
Der Graureiher: dieser lauernde Vielfischer, der so träge wirkt, aber zuschlägt wie eine Kobra, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt.
Graureiher
Für einen wie den Reiher gibt es hier mit Sicherheit genug zum Leben, mit Aussicht auf die inneren Schäreninseln und in unmittelbarer Nähe zu Fischgründen im Mälarsee und im Meer. Und natürlich in dem sumpfigen See, an dem sie wohnen, sobald das Eis geschmolzen ist.
Falls es wirklich zutreffen sollte, dass Vögel in der Lage sind, sich über die Menschen und ihr Verhalten zu wundern (ein Gefühl, das einen mit Macht beschleicht, wenn man Mikael Kristerssons meisterliche Filmdokumentation Das Auge des Falken gesehen hat), dürfte es den Reihern am Isbladskärret nicht an Gelegenheit dazu fehlen. Hier spazieren Hundebesitzer mit gespannten Leinen und einsatzbereiten Kotbeuteln vorbei, hier ziehen Jogger keuchend in ihrem Versuch vorüber, ihre Todesangst zu bezähmen und zumindest ansatzweise unser widernatürliches Großstadtleben zu kompensieren, hier passieren feuerrote Finnlandfähren mit grölenden jungen Leuten auf dem Sonnendeck, und vom weiter entfernt liegenden Vergnügungspark Gröna Lund hört man den ganzen Sommer über die Schreie von Leuten, die beschlossen haben, alles fahren zu lassen und sich im freien Fall zur Erde herabzustürzen.
Aber Isbladskärret ist auch Bestandteil des Nationalstadtparks, der grünen Lunge für Stockholm mit siebenundzwanzig Quadratkilometern geschützter Natur, der Erste seiner Art weltweit und eingeweiht im Mai 1995 vom König höchstpersönlich. Hier haben Kronprinzessin Victoria und ihr Prinz ihren eigenen Liebespfad, hier sind Eichen, Eulen und Fahrradfahrer gleichermaßen zufrieden mit ihrem Leben, und hierher kommen Jahr um Jahr die Reiher – so heimatverbunden wie nur wenige andere.
Kräähk!, schallt es plötzlich über den See. Kräähk! – Kräähk! – – –
Das ist nicht unbedingt etwas für musikalische Feinschmecker, erinnert aber an neues Leben und lässt urbane Flaneure in Straßenschuhen genauso lächeln wie ein Kind des Waldes, das es in die Stadt verschlagen hat.
Die Sonne steht schon tief an diesem weit fortgeschrittenen Nachmittag, aber sie wärmt mehr, als man erwarten darf, denn bis Ostern sind es noch ein paar Wochen. Und während das Blässhuhn an seinem Schilfrand heranschleicht und die Kiebitze klagend auf den frisch aufgetauten Schlamminselchen umherwatscheln, machen die Reiher von Zeit zu Zeit kleine Ausflüge zum Kunstmuseum Thielska Galleriet oder weiter hinaus zu der kleinen Inselgruppe Fjäderholmarna oder steigen wie Drachen in den Himmel auf, um anschließend zu den halbtoten Erlen herabzuschweben, gleichsam leblos an ihren eigenen Flügeln hängend, aber mit ausgefahrenem Fahrwerk.
Etwa eine Stunde später nähern sich vom Mälarsee kommend mehrere Riesenvögel in einer Reihe, im Landeanflug, ganz ähnlich den Passagierflugzeugen, die sich im Abendlicht dem Flughafen Bromma nähern, eins nach dem anderen dem gleichen Kurs folgend.
Dieser ruhige, mächtige Flug mit gewölbten Flügeln, die Flugsilhouette wie eine liegende Drei vor einem rot verfärbten Himmel im Westen.
So wollen sie es haben, die Reiher: zum Fischen losziehen, wenn der Hunger an ihnen nagt, und danach zum Clan heimkehren. Nach ihrem Nest schauen, auf Eiern liegen, es sich in der Sonne gutgehen lassen und sich zur Nachtruhe begeben. Immer zusammen.
Und ausgerechnet sie sollen mit der Rohrdommel verwandt sein, sagen die Artenforscher. Sie ist der muhende Eremit des Schilfdschungels. Der Sonderling par excellence unter allen Sonderlingen in der nordischen Natur, der einsam in irgendeinem entlegenen Flachlandsee hockt und nächtelang pumpt und ächzt und den man so gut wie nie zu Gesicht bekommt.
Botaurus stellaris: der sternfleckige, muhende Stier.
Das ganze Frühjahr und bis weit in den Sommer hinein bleibt er unermüdlich, versteckt sich im tiefsten Schilf, stößt in seine Posaune und hofft auf ein Weibchen. Nicht die kleinste Anstrengung unternimmt er, um es anzulocken, mit Ausnahme dieses eigentümlich dumpfen Brummens, das einen am ehesten an etwas Jenseitiges denken lässt, wie ein hundert Jahre alter Gruß aus dem Reich der Ertrunkenen.
Linné: „Man hört ihn nachts. Er klingt wie eine Trompete, und Menschen, die ihn hören, meinen, es sind Geister. Einige sagen, er setzt den Schnabel in ein Rohr und muht wie ein Ochse, daher der Name Rohrdommel. In Holland wird seine Daumenkralle genutzt, um sie in Silber einzufassen und sich die Zähne mit ihr zu reinigen. Er hat schönes Fleisch.“
Und sollte sich der muhende Sumpfochse schließlich paaren dürfen, gibt er sich damit nicht zufrieden, sondern setzt sein Ächzen noch wochen- und monatelang fort – während sich die Reiher in ihrem Kollektiv am Isbladkärret an der Sonne laben und jedem, der es sehen möchte, ihre Fähigkeiten auf dem Feld der Flugkunst und der Fischerei demonstrieren.
So unterschiedlich kann das Ergebnis in der großen Lotterie ausfallen: Der Einsiedler in der Wildnis und der Geselligkeit liebende Großstadteinwohner sind in Wahrheit fast die gleiche Art.
Singschwan (auch auf den folgenden Seiten)
15. März
In diese Woche fällt die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche: Wieder einmal ist die Erde eine halbe Runde um ihren lodernden Stern gezogen, 470 Millionen Kilometer in ihrer ewigen Ellipse, und der Norden ist von Neuem auf der Sonnenseite. Der Frost weicht aus dem Boden und der Baumsaft steigt. Im Süden blühen Haselsträucher und Huflattich, und das Land hinaufziehend lösen die Formationen der Zugvögel einander ab.
Lerche und Kiebitz, Star und Buchfink, Taube und Gans.
Am See Tysslingen in der Ebene von Närke stehen tausende Singschwäne und trompeten, weil es Frühling geworden ist. Die Uferwiesen sind von gelbschnäbeligen Wildnisvögeln übersät, die posaunen und sich ewig aufspielen. Sich zanken und necken, eine Runde fliegen und zurückkehren, den Schnabel jubelnd gen Himmel strecken oder sich zu noch einem Saatkorn herabbeugen, ein wenig gemessen mit den Flügeln schlagen, wie um sie zu trocknen, oder liegen bleiben und sich putzen und die Federn einfetten. Drüben am Fluss Blackstaån gleiten einige durch das Wasser und gründeln nach Seefutter, andere stehen einbeinig auf dem Eis, die Schnäbel unter die Flügel gesteckt.
Wenn die Sonne herauskommt, glitzert die gesamte Schwanenbucht blendend weiß. Ihre Fanfarenstöße sind ohrenbetäubend und ertönen ununterbrochen.
Das Parkrestaurant wurde hier schon vor einem Monat eröffnet. Da war eine Vorhut von etwa zwanzig Schwänen auf dem Weg nach Norden eingetroffen, woraufhin im schneidenden Wind die erste Fütterung hinausgekarrt wurde.
„Dreißig Tonnen sind es pro Saison. Vor allem Korn. Für die Schwäne ist das hier der reinste McDonald’s“, berichtet Ronnie Nederfeldt, der den größten Teil seines Lebens Vögel beobachtet hat und seit fünfzehn Jahren am Tysslingen Führungen leitet.
„Eine ganze Reihe von Bauern schenkt uns etwas Getreide, damit ihnen die Vögel daheim in der Herbstaussaat erspart bleiben.“
Der Tysslingen ist seit langem als „Schwanensee“ bekannt, aber die Singschwäne sind dort wahrlich nicht allein. Gänse leisten ihnen zu vielen Hunderten Gesellschaft, vor allem Kanadagänse, aber auch Graugänse und Saatgänse. Auch die eine oder andere Blässgans und Kurzschnabelgans hat den Weg hierher gefunden. Ein paar Krickenten mit Kriegsbemalung im Gesicht und zwei ausgestoßene Höckerschwäne. Über dem Espenwäldchen im Osten hängt plötzlich ein rüttelnder Raufußbussard, die Wühlmäuse im Blick.
Kein Zweifel, der Vogelfrühling ist gekommen! Die Kiebitze flattern paarungslüstern über den Grassoden der Viehweiden, nölend und jammernd wie Kindertrompeten. Und die Feldlerche schraubt sich unablässig zwitschernd in den Himmel, ruckweise, als hinge sie an einer Schnur, die gerade jemand einholt. Selbst die Dohlen scheint die Wiederkehr des Lichts zu beleben, krächzend und in starenschwarmähnlichen Formationen fliegen sie über den Feldern hin und her.
In dem Wäldchen an der Rånnestastugan ist die Luft erfüllt vom Silbersirren der Blaumeise und der feurigen Warmwetterphrase der Kohlmeise: di-do di-do di-do di-do. Die Grünfinken sprudeln und trillern und quaken aus ihren Fichtenwipfeln, und irgendwo sitzt die Goldammer und zählt bis sieben. Hinter der vertrauten Frühlingssymphonie der Standvögel lässt sich fortwährend das dumpfe Puhuhen der Ringeltaube vernehmen: Nun komm doch – endlich!
So geht es immer weiter.
Und rund um die Birkentrauben draußen auf der Ebene steht ein bleiches, silberviolettes Schimmern und flüstert von Blumen und Bienen.
„Die Enten fliegen im Schwarm auf!“, ruft plötzlich einer der Schwanenspäher. „Und die Stare am anderen Ufer des Sees!“
„Bestimmt ein Habicht“, kommentiert jemand. „Manchmal streicht er haarscharf über den Boden.“
„Oder ein Wanderfalke!“
Während wir den Himmel vergebens nach dem schnellsten Vogel der Welt absuchen, entdecken wir stattdessen über Kilsbergens blauender Nadelwaldborte einen scharfäugigen Steinadler: die Flügel ausgestreckt zu einem flachen V und der Kopf eifrig spähend. Aber auch die Gänse am See haben Augen im Kopf und heben ab, sobald er ihnen zu nahe kommt.
Die Schwäne bekümmert das nicht weiter. Sie sind zu groß, um sich zu fürchten, und im Übrigen mit anderem beschäftigt. Den ganzen Tag über hallen ihre singenden, klingenden Hornstöße über der ganzen Gegend wider.
Guoong-ong, guoong-ong, guoong-ong – – –
Tysslingen: der See mit seinen flachen Ufern am Fuß der Kilsbergen, langgezogen wie Schweden, seicht wie eine überschwemmte Wiese. Mittlerweile Europas bedeutendster Rastplatz für Singschwäne. Hier wird den Vögeln Futter und Ruhe, Gesellschaft und Schutz geboten. Insgesamt ziehen hier etwa achttausend auf ihrem Weg von den Winterquartieren an der Nordsee vorbei und folgen dabei ihrer uralten Route nach Finnland und Russland, wo in irgendeinem Waldsee oder Sumpftümpel die Vorjahresnester liegen und warten und von ihnen nur noch ausgebessert werden müssen. Vier Fünftel der Reise stehen ihnen noch bevor, und die Schwäne wirken nahezu ekstatisch aufgekratzt bei dem bloßen Gedanken, die Reise zu den Sumpfgebieten im Norden fortsetzen zu dürfen, um sich dort der Brutpflege und erneuertem Familienleben zu widmen.
Für die Einwohner der Provinz Närke ist die Ankunft der Singschwäne zu einem beliebten Frühlingsboten geworden. Mit Fernglas und Thermoskanne und einem Lächeln auf den Lippen versammelt man sich am Tysslingen. Mit Eiersandwiches im Rucksack und einer warmen Sitzunterlage.
Dieses Jahr sind die Schwäne früh gekommen. Schon Anfang März waren mehr als tausend da, und am Wochenende wurde mit über viertausend der Höchststand erreicht. Daraufhin wurde auch das Schwanenfestival eröffnet, das immer noch andauert. Spektivführungen und Kunstausstellung, Nistkastenverkauf und Schwanengottesdienst mit Kaffeeausschank. An einem schönen Märztag kommen an diesem See bis zu zweitausend Besucher zusammen.
„Aber die Menschen zählen wir hier nicht“, erklärt Ronnie Nederfeldt. „Wir zählen nur die Vögel.“
Zum Nachmittag hin werden die Wolken dichter, und der Nordwind erhält den Berghang herabkommend zusätzlichen Schwung, aber an der Ruine steht man windgeschützt, wenn es nicht mehr hilft, sich die Arme um den Körper zu schlagen. Hier sammeln sich die Vogelbeobachter zu einem wärmenden Gespräch über die Aha-Erlebnisse des Tages und alles andere, was sich ereignet hat. Zum Beispiel, dass das Seeadlerpaar ausgerechnet am Schalttag zueinandergefunden hat („wann ist das wohl zuletzt passiert?“), dass bei der Fütterung am Haus einige Türkentauben aufgetaucht sind und der Steinadler den ganzen Vormittag am anderen Seeufer geschlemmt hat („vermutlich ein Reh, jetzt sind die Krähen an der Reihe“).